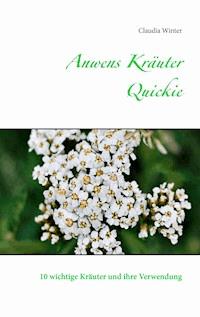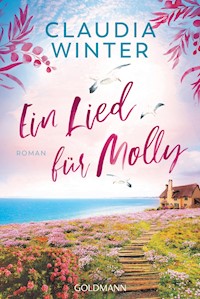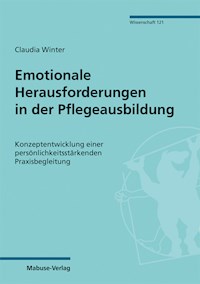2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für die gehörlose Maelys Durant wird ein Traum wahr, als sie ein Kunststudium in Paris beginnt. Doch dann erkrankt ihre Tante Valérie, und Maelys muss auf dem Montmartre Touristen porträtieren, um Geld zu verdienen. Dort macht ihr eines Tages ein geheimnisvoller Fremder ein erstaunliches Angebot: für eine stattliche Summe soll sie seinen Großvater in Lissabon malen. Maelys‘ Neugier ist geweckt, und sie begibt sich auf die Reise in die weiße Stadt am Tejo. Dort stößt sie auf die Spuren einer herzergreifenden Liebesgeschichte, die bis ins Paris der 1960er Jahre zurückreicht – und ahnt nicht, welch besondere Rolle sie selbst darin spielt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Für die gehörlose Maelys Durant wird ein Traum wahr, als sie ein Kunststudium in Paris beginnt. Doch dann erkrankt ihre Tante Valérie, und Maelys muss auf dem Montmartre Touristen porträtieren, um Geld zu verdienen. Dort macht ihr eines Tages ein geheimnisvoller Fremder ein erstaunliches Angebot: Für eine stattliche Summe soll sie seinen Großvater in Lissabon malen. Maelys’ Neugier ist geweckt, und sie begibt sich auf die Reise in die weiße Stadt am Tejo. Dort stößt sie auf die Spuren einer herzergreifenden Liebesgeschichte, die bis ins Paris der 1960er Jahre zurückreicht – und ahnt nicht, welch besondere Rolle sie selbst darin spielt …
Weitere Informationen zu Claudia Winter und zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Claudia Winter
Wie sagt man ich liebe dich
Roman
OriginalausgabeDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Das Zitat sowie das Motto stammen von Fernando Pessoa, »Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares«, herausgegeben von Richard Zenith, aus dem Portugiesischen von Inés Koebel, Nachwort von Egon Ammann.Abdruck mit freundlicher Genehmigung des S. Fischer Verlags.
Taschenbuchausgabe Juni 2020
Copyright © der Originalausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München.
www.erzaehlperspektive.de
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
CN · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-23355-6V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Mama und Papa.
Wenn der liebe Gott sich im Himmel langweilt, dann öffnet er das Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris.
Heinrich Heine
Und kein Blumenstrauß hat für mich je die farbige Vielfalt Lissabons im Sonnenlicht.
Fernando Pessoa
Prolog
PARIS, IMDEZEMBER 2018.
Das Alter braucht den Winter nicht, um einen Menschen Demut zu lehren. In diesem Spruch lag eine Wahrheit, die er heute in jedem Knochen spürte. Mit einem verkrampften Lächeln sank Eduardo auf den Eisenstuhl und ließ die Papiertaschen und Plastiktüten achtlos zu Boden gleiten. Es gab keinen Anlass, sich Gedanken um Taschendiebe zu machen. Die Tische auf dem Gehweg vor der Brasserie Au Clairon des Chasseurs an der Place du Tertre waren verwaist, trotz der Heizstrahler, die müde Touristen herbeilocken sollten.
Warum keiner hier sitzen wollte, konnte er nicht wirklich nachvollziehen. Er fand die Bistrotische recht einladend, so wie sie sich in ihren karierten Mänteln aneinanderschmiegten, als müssten sie sich an diesem winterlichen Spätnachmittag gegenseitig wärmen. Ihm dagegen war schon seit einer halben Stunde nicht mehr kalt. Er schwitzte unter dem Hut, seine Hüfte zwickte. Das war dann wohl die gerechte Strafe für die Schnapsidee, ausgerechnet den höchsten Hügel von Paris zu Fuß erklimmen zu wollen, statt die Montmartre-Seilbahn zu besteigen oder gleich ein Taxi zu nehmen.
Eduardo de Alvarenga seufzte. Dass er bereits vierundsiebzig Jahre alt war, konnte er mitunter selbst kaum glauben, aber so stand es in seinem Pass, der mit der Geldbörse in seinem Bauchgürtel steckte. Er betastete ihn automatisch, während er sich nach einer Bedienung umsah. Der Kellner stand rauchend im Türrahmen des Restaurants und weckte bei Eduardo einen Anflug von Sympathie. Die Situation der jungen Leute war heutzutage überall gleich schwierig, ob in Paris oder Lissabon, seiner Heimatstadt. Er vermutete, dass der Bursche die Schiebermütze und das alberne rote Halstuch nur aus einer Notwendigkeit heraus trug, die ihm ein Zimmer in irgendeiner schäbigen Studentenbude sicherte. Was dem Burschen an Stolz geblieben war, fand Ausdruck in den gemächlichen Rauchfahnen, die sich in der Dezemberluft mit dem Geruch von Schnee und verkohlten Maronen mischten. Er war ihm vertraut, dieser Duft. Auch in seiner Stadt wurden in den Wintermonaten Esskastanien verkauft.
Eduardo wartete geduldig, nicht nur, weil er dem Jungen die Zigarettenlänge Rebellion gönnte. Er kam aus einem Land, wo man Leute, die es eilig hatten, mit einem verständnislosen Kopfschütteln bedachte. Eigentlich war er dem Kellner sogar dankbar für seine Ignoranz. Sie verschaffte ihm Gelegenheit, sich über die Preise auf der Getränkekarte zu wundern und die mit Lichterketten geschmückten Bäume und Holzbuden zu betrachten, an denen Crêpes und weihnachtliche Souvenirs feilgeboten wurden.
Es überraschte ihn nicht, dass ihm dieser Ort fremd vorkam. Fünfzig Jahre waren eine lange Zeit, und die Bilder in seinem Kopf waren fünfundzwanzig Grad wärmer und trugen die Farben des Sommers. Doch je länger Eduardo die vermummten Gestalten vor den Staffeleien musterte, desto stärker wurde die undefinierbare Sehnsucht, die ihn seit Monaten umtrieb und letztendlich zu dieser Reise gedrängt hatte. Zu Hause ahnte niemand, dass er die Weihnachtseinkäufe bloß vorgeschoben hatte, auch sein braver Butler Albio nicht, der ihn bescheiden um ein paar antiquarische Postkarten für seine Sammlung gebeten hatte. Eduardos liebe Familie hingegen war ganz wild auf luxuriöse Seifen, Seidentücher und Süßigkeiten. Eduardo fand, er habe seine Pflicht mehr als ausreichend erfüllt – gemessen am Gewicht der Taschen, die er, der alte Narr, durch halb Paris schleppte, statt einen Zwischenstopp im Hotel einzulegen.
Es war eine spontane Idee von ihm gewesen, herzukommen. Eine Idee, die auf einer alten, verblichenen Erinnerung gründete, die auch noch nach fünfzig Jahren ein Ziehen in seiner Brust verursachte. É insano – verrückt war das. Oder, wie sein Gärtner beim Anblick einer unerwartet aufgeblühten Pflanze auszurufen pflegte: »Caramba!«
Caramba. Jetzt saß er also tatsächlich an der Place du Tertre, vor der Brasserie, die sogar noch dieselbe von damals war, und fragte sich, was zum Teufel er hier suchte, rund zweitausend Kilometer von zu Hause entfernt.
Der Kellner schnippte den Filter aufs Trottoir und wischte im Gehen auf seinem Mobiltelefon herum. »Putain!«, sagte er verächtlich und wandte sich endlich Eduardo zu. Was er von dem weißhaarigen Herrn hielt, dem Nadelstreifenanzug und der rosafarbenen Krawatte, die zwischen dem Revers des Kaschmirmantels hervorlugte, blieb, wo es hingehörte: in seinem Kopf.
Eduardo bestellte un café, der mit vier Euro sechzig zu Buche schlug, und bekam dafür einen tiefschwarzen herrlich duftenden Espresso serviert. Zumindest das hatten die Franzosen mit den Portugiesen gemein, sie wussten, wie man vorzüglichen Kaffee machte. Zufrieden grunzte Eduardo in seinen Bart und rührte drei Löffel Zucker in das Tässchen. Warum er mitten in der Bewegung innehielt, konnte er zunächst nicht mit Bestimmtheit sagen. Er nahm die Lesebrille ab und blinzelte zu den Staffeleiplätzen hinüber, bis sein Blick an einem gelben Fleck hängen blieb, der sich Sekundenbruchteile später als junge Frau entpuppte.
Eine junge Frau in einem senfgelben Mantel.
Er spürte, wie sein Herz aus dem Takt geriet. Das Tässchen klirrte auf dem Unterteller, als er versehentlich gegen das Tischbein stieß, eine der Einkaufstaschen kippte auf den Bürgersteig. Er lockerte die Krawatte und wusste, dass seine Reaktion überzogen war. In den letzten Jahrzehnten hatte er unzählige Frauen in einem solchen Kleidungsstück gesehen. Ihm war bewusst, dass es in der Mode nichts gab, das nicht schon hundertmal neu erfunden worden wäre. Dass ihm jedoch ausgerechnet hier ein solcher Mantel unterkam, war … Caramba, das war gruselig.
Eduardo verengte die Augen. Obwohl er eine Lesebrille brauchte, funktionierte seine Fernsicht einwandfrei. Leider dämmerte es bereits, und sie war zu weit entfernt, als dass er ihr Gesicht erkennen oder gar ihr Alter hätte schätzen können. Aber die Art, wie sie sich bewegte … Wie sie einer Frau nach der Verabschiedung reglos hinterherschaute und danach die rote Wollmütze tiefer in die Stirn zog … Wie sie die Malutensilien verräumte, als beanspruchte jeder Pinsel einen festen Platz in dem Holzkasten … Er vermutete, dass sie kaum älter als dreißig war. So alt wie seine Enkelin Angela.
Eduardos Gaumen zog sich zusammen, als die bittersüße Flüssigkeit seine Geschmacksknospen traf. Mit geschlossenen Lidern schimpfte er sich einen senilen Dummkopf und erwartete, dass sich in wenigen Sekunden bestätigte, dass das Mädchen eine Halluzination war. Zur Sicherheit bekreuzigte er sich und zählte stumm bis zehn, bevor er die Augen öffnete.
Sie ist fort. Natürlich ist sie das.
Er atmete aus, halb erleichtert, halb enttäuscht. Doch dann erstarrte er, als er die Frau auf dem Gehsteig entdeckte. Sie ging schnell und hielt den Oberkörper wegen des Gewichts der Staffelei leicht zur Seite geneigt. Zu seinem Schrecken steuerte sie geradewegs auf ihn zu.
Instinktiv griff Eduardo nach der Karte und musterte sie angestrengt, als wären café double, noisette und chocolat chaud verschlüsselte Codewörter, die der französische Geheimdienst unter das gemeine Volk geschmuggelt hatte. Das Blut rauschte ihm in den Ohren und mischte sich mit dem herannahenden Klackern der Stiefelabsätze und der Leierkastenmelodie zu einer unerträglichen Kakofonie. Mon beau sapin – »O Tannenbaum«, ein Weihnachtslied, das zu Hause Ó pinheirinho hieß, ertönte krumm und schief.
Er hielt es nicht länger aus. Langsam senkte er die Karte – und sah in ein zartes Gesicht mit braunen Locken, die in dem Mantelkragen lagen wie in einer senfgelben Schale. Auch wenn sie müde aussahen, waren ihre Augen betörend, porzellanblau wie polierte Azulejo-Kacheln. Eduardo fühlte sich, als werfe er einen Blick in die Vergangenheit.
Sie sieht aus wie sie. Aber sie ist es nicht, dachte er und stöhnte innerlich auf, als ihr Blick den seinen berührte und ohne ein Erkennen aufs Trottoir fiel. Sie blieb stehen und zögerte unmerklich, bevor sie sich samt ihrer Last bückte, Eduardos entwischte Einkaufstüte aufhob und zu den anderen neben seinen Stuhl stellte.
Verwirrt versuchte er sich an einem »Merci mille fois, Mademoiselle. – Tausend Dank, Fräulein«, aber die Wörter gingen irgendwo in seinem Mund verloren. Zu sehr strengte er sich an, ihre abgespannten Züge mit dem fröhlichen Gesicht aus seiner Erinnerung abzugleichen, das ihm beim Sortieren des Bibliothekschranks als Polaroidfoto in die Hände gefallen war. Seitdem hockte das Bild in seinem Kopf. Und es flüsterte unentwegt.
Die junge Frau schien kein Dankeschön zu erwarten. Stattdessen neigte sie den Kopf und brachte ein Lächeln hervor, das ausreichend lang für eine Höflichkeitsbekundung, aber kurz genug für einen Fremden war. Damit wandte sie sich ab und setzte ihren Weg fort.
Fassungslos starrte Eduardo dem gelben Mantelrücken mit dem Rucksack hinterher. Nicht wegen der so typischen Kinnbewegung, die ihn an ein Kind erinnerte, das Königin spielt und dabei nur mühsam ernst bleiben kann. Nein. Weitaus mehr schockierte ihn die Brosche, die er am Revers des Mantels entdeckt hatte. Eine Sardine. Kupfern. Kaum größer als sein Daumen.
Fico maluca. Ich werd verrückt. Das kann kein Zufall sein! Seine Gedanken überschlugen sich. Diesmal benötigte er nur einen Augenblick für die einzige Reaktion, die jetzt noch für ihn infrage kam.
»Mademoiselle! Warten Sie!« Mit zittrigen Fingern öffnete Eduardo den Bauchgürtel und schob den letzten Schein aus dem Portemonnaie unter die Espressotasse. Hektisch raffte er seine Weihnachtsgeschenke zusammen und nahm die Verfolgung auf, ein erfreutes »Putain!« im Rücken.
Die steilen Treppen und engen Gassen forderten seine ganze Aufmerksamkeit. Den Blick fest auf den gelben Mantel gerichtet, der bereits die nächste Querstraße erreicht hatte, eilte er die Rue des Abbesses hinunter. Das Pflaster glänzte feucht von geschmolzenen Schneeflocken, er musste höllisch aufpassen, dass er nicht ausrutschte.
Meu Deus,er war wirklich keine zwanzig mehr. Schon nach fünfzig Metern bekam er Seitenstechen, nach hundert Metern hätte er am liebsten einem entgegenkommenden Radfahrer den Drahtesel entrissen. Tapfer rannte er weiter, durch das Schneegestöber, an Cafés und fremden Gesichtern vorbei. Er entschuldigte sich in einem fort, umschiffte Kreidetafeln, parkende Motorroller und einen Bistrostuhl, der wie ein vergessenes Umzugsstück auf dem Gehweg stand. Je mehr er sich dem Boulevard de Clichy näherte, umso mühsamer kam er zwischen den Fußgängern voran.
Kurz entschlossen bog Eduardo in die nächstbeste Seitenstraße ein, was er auf gut Glück und ohne konkreten Anhaltspunkt tat, denn er hatte den gelben Mantel längst aus den Augen verloren. Schwer atmend verringerte er das Tempo, bis er sich kaum noch von den flanierenden Touristen unterschied, die alle paar Meter vor einer Boutique oder einem Souvenirladen verweilten. Herzrasen, Knieschmerzen. Eduardo sah ein, dass der Mauervorsprung unter dem Schaufenster einer antiquarischen Buchhandlung das ideale Plätzchen für eine kurze Verschnaufpause bot.
Ächzend sank er auf den handtuchbreiten Absatz, stellte die Taschen auf den Boden und legte die Hände auf die Knie. Über ihm, im ersten oder zweiten Stock, wurde helles Frauengelächter hinter einer herunterratternden Jalousie eingesperrt. Irgendwo schlug eine Kirchturmuhr, bellte ein Hund. Eduardo lehnte den Hinterkopf gegen das Schaufenstergitter und schloss die Augen, während Paris den Atem anhielt und unter einer dünnen weißen Decke verschwand.
Es war vorbei.
Das Mädchen mit dem senfgelben Mantel war fort.
1. Kapitel
SINTRA/LISSABON, IMMAI 2019.
António.
Wie schnell die Dinge doch aus dem Gleichgewicht geraten, dachte António, als er in halsbrecherischem Tempo die Auffahrt zum Landhaus seines Großvaters hinauffuhr und dabei einen Blick auf das Armaturenbrett warf. Zwanzig Uhr dreißig. Früh für portugiesische Verhältnisse, aber vielleicht zu spät für das, was ihn hinter den altehrwürdigen Mauern der Quinta de Alvarenga erwartete.
Que merda. Eine unbestimmte Furcht zog ihm den Brustkorb zusammen. Er hatte VovôsNachricht viel zu spät gesehen, weil er das Mobiltelefon im Personalraum des Hotels vergessen hatte. Zwar war er sofort ins Auto gesprungen, als seine Rückrufe erfolglos blieben, doch ausgerechnet heute hatte die Polizei die Avenida da Liberdade wegen einer Demonstration gesperrt. Auf sämtlichen Ausweichrouten in Richtung Nordwesten ging deshalb so gut wie nichts mehr. Er würde etliche Ave-Maria wegen der Kraftausdrücke beten müssen, die er in dem hupenden Autokorso gelassen hatte. Warum, verdammt, hatte er nicht den Roller genommen? Er riss das Steuer herum und brachte den Mercedes neben der schwarzen Limousine seines Großvaters zum Stehen.
Komm zur Quinta. Ein Notfall.
Nie hätte er gedacht, dass zwei Sätze genügen könnten, um seine Welt zum Einsturz zu bringen.
Erst als er beim Aussteigen die feuchtkühle Waldluft der Serra de Sintra auf dem Gesicht spürte, fiel ihm auf, dass er vergessen hatte, sich anzuschnallen. Und wenn schon. Trotzig knallte António die Autotür zu, hastete aufs Eingangsportal zu und nahm zwei Stufen auf einmal. Den bronzenen Türklopfer ignorierte er heute, was Albio ihm sicherlich verzeihen würde. Nur die Kokosmatte im Eingangsbereich benutzte er, ein Mechanismus, den er mithilfe einiger Kopfnüsse schmerzhaft hatte erlernen müssen. Zeig Respekt vor dem Personal, lautete das Credo dieses Hauses, damals und auch heute noch, lange nachdem Dona Sofia gestorben war.
António musterte das Gesicht seiner Großmutter, das im Foyer von einem schlichten Rahmen aus auf ihn herablächelte. Die Vorstellung, dass Dona Sofia vielleicht schon bald nicht mehr alleine dort hängen würde, verursachte ihm Gänsehaut. Ob er seine Schwester anrufen sollte? Ehrlich gesagt, hatte er keine Ahnung, wo sie gerade steckte. Kapstadt? New York? Angelas Dienstplan änderte sich ständig, seit die Fluggesellschaft sie auf Interkontinentalstrecken gesetzt hatte. Vermutlich war sie in irgendeinem Land, in dem es entweder zu früh oder zu spät für ein Telefonat war, und er würde sie sowieso nicht … António straffte die Schultern, als er die Küchentürflügel und kurz darauf Albios Schritte hörte, die immer klangen, als schleife er einen Sandsack hinter sich her.
»Boa tarde,Senhor António.«
»Dir auch einen guten Abend, Albio.« Er zwang sich, den gebeugten grauhaarigen Butler nicht anzustarren, der bei jedem seiner Besuche wirkte, als sei er in seinem dunkelblauen Anzug noch mehr geschrumpft. Albio hingegen begutachtete ihn ungeniert, bis António sich daran erinnerte, dass er einen Soßenfleck auf dem Hemd hatte.
»Der Türklopfer, Senhor.« Der Alte bemühte seine Mundwinkel erst gar nicht.
»Was ist damit?«
»Offenbar haben Sie es versäumt, Ihre Ankunft anzukündigen.«
»Das habe ich, Albio. Entschuldigung. Ich dachte, es eilt.«
»Oh, das tut es. Zweifellos.« Albio nickte. »Ihr Großvater erwartet Sie schon ungeduldig.«
António schloss für einen Moment die Augen.
»Ist er im Schlafzimmer?«, fragte er rau und erntete dafür einen irritierten Blick, den er sich nicht recht erklären konnte.
»Es ist gleich Zeit fürs Abendessen. Senhor de Alvarenga befindet sich in der Bibliothek. Zum Apéro.«
»Zum Apéro?« António hob die Brauen. Nur langsam dämmerte ihm, dass die Dinge völlig anders lagen, als er angenommen hatte. Beruhigend anders. Und auch wieder nicht. Er hätte es wissen müssen, schließlich war er in diesem Haus aufgewachsen. »Meinem Großvater geht es also gut, ja? Es gibt gar keinen«, er holte zitternd Luft, »Notfall?«
Der alte Butler musterte ihn stumm und fast ein wenig mitleidig. Sie kennen ihn doch, sagte sein Blick, dann wandte er sich der Treppe zu, die er kummervoll betrachtete, bevor er den Fuß auf die erste Steinstufe stellte.
»Ich sage ihm, dass Sie angekommen sind.«
»Nicht nötig. Das erledige ich heute selbst.« Entschlossen drückte António sich an Albios Anzugrücken vorbei, der kaum breiter als der eines Kindes war.
Im ersten Stock angekommen stürmte er in Richtung Bibliothek, am Speisezimmer vorbei, wo Rosária, die junge Köchin, den Tisch deckte und seinen Gruß dank ihrer Handystöpsel im Ohr überhörte. Das Anklopfen unterließ er diesmal ganz bewusst.
»Bist du von allen guten Geistern verlassen, Vovô?«
Ehrlich, er hatte nicht schreien wollen. Doch die Erleichterung, den Großvater quicklebendig und Zigarre paffend in seinem Lehnsessel vorzufinden, war einfach zu groß. Falls er jedoch gehofft hatte, dass Eduardo de Alvarenga in irgendeiner Form Notiz von seinem Gemütszustand nehmen würde, wurde er enttäuscht. Der alte Mann sah von seiner Sportzeitung auf, dann verschwand sein bärtiges Gesicht in einer Wolke aus Zigarrenrauch.
»António. Da bist du ja«, sagte die Wolke in einem Ton, den Eduardo normalerweise für eine Verspätung zu einer Essenseinladung bemühte. Halb tadelnd, halb verständnisvoll. »Wir haben uns schon Sorgen gemacht.«
Fast hätte er aufgelacht. Es war doch immer dasselbe. Sein Großvater schreckte vor keinem Mittel zurück, um seine Lieben dorthin zu bringen, wo er sie haben wollte. Wahrscheinlich musste er sogar froh sein, dass Eduardo nicht auf die Idee gekommen war, Inspektor Coelho um einen Gefallen unter alten Schulfreunden zu bitten. Das hatte Vovô früher schon einmal getan, als Angela die vereinbarte Heimkehrzeit von einem Rendezvous nicht eingehalten hatte: Mit Blaulicht und Sirenen hatte er seine kleine Schwester nach Hause schaffen lassen. Páh, was hatte die getobt!
Die Zigarrenrauchwolke verzog sich und mit ihr sein Zorn. Auch das war nicht neu. Immer wenn er die Marionettenfäden kappen wollte, an denen er ein gefühltes Leben lang hing, musste er einsehen, dass er es nicht konnte. Er konnte und wollte seinem Großvater nicht böse sein, weil er ihn über alles liebte.
Seufzend sank er auf den Polsterstuhl vor dem Mahagonischreibtisch und musterte das Bücherregal, in dem sich die Werke portugiesischer Literaten wie zerlesene Schulbücher aneinanderdrückten. Die Buchrücken erinnerten ihn daran, dass Fernando Pessoa und der frühe José Saramago in diesem Haus nicht nur gelesen, sondern auch oft diskutiert wurden. Es stimmt ja, überlegte er. Er hatte seinen Großvater schon viel zu lange nicht mehr besucht, auch wenn das nur zum Teil seine Schuld war.
»Wie war’s in Brasilien? Sind alle wohlauf?«, fragte er, obwohl ihn Letzteres nicht sonderlich interessierte. Seit dem Tod der Großmutter verbrachte Vovô regelmäßig die Wintermonate bei irgendwelchen gesichtslosen Großcousins, -onkeln und -tanten, deren Namen António ständig durcheinanderbrachte. Mittlerweile war seine Familie so weit verzweigt, dass er längst den Überblick verloren hatte.
»Es war warm«, lautete die Antwort, die vom trockenen Knistern der Zeitungsseiten begleitet wurde. »Außerdem hatte ich Zeit zum Nachdenken. Viel Zeit.«
»Ist das jetzt die Stelle, an der du mir den angeblichen Notfall erklärst?« António konnte es sich nicht verkneifen, zwei ironische Gänsefüßchen in die Luft zu malen.
Statt ihm zu antworten, legte Eduardo die A Bola beiseite und erhob sich aus dem Sessel. António überraschte es immer wieder, wie beweglich sein Großvater war. Im Gegensatz zu Albio, der von Mal zu Mal gebrechlicher wurde, wirkte Vovômit zunehmendem Alter agiler als je zuvor. Unruhiger war er auch, was er demonstrierte, indem er mit den Händen auf dem Rücken vor der Terrassentür hin und her ging, die sich nach Süden zu dem prächtigen Botanischen Garten in Hanglage öffnete.
»Du hast also nachgedacht«, hakte er vorsichtig nach. Bei Eduardo de Alvarenga wusste man nie genau, was einem blühte, wenn er nachgedacht hatte. Beim letzten Mal hatte er ihn mal eben kurz zum Hoteldirektor befördert.
Sein Nacken kribbelte, ein Zeichen dafür, dass er ungeduldig wurde. Er mochte keine Halbsätze und Andeutungen, aber dieses Gespräch richtete sich wie üblich nicht nach seinen Bedürfnissen. Sein Großvater war vor dem Barschrank stehen geblieben, einer aufklappbaren Weltkugel, die allerlei Hochprozentiges barg. Er fischte eine dunkelgrüne Flasche heraus und studierte das Etikett.
»Es gibt zwar nicht den einen Moment für ein Glas Portwein, aber sicher gibt es einen passenden Port für jeden Moment«, sagte er und zwinkerte ihm zu.
»Ich muss noch fahren, Vovô.«
»Du fährst nirgendwohin. Zumindest nicht heute.«
»Heißt im Klartext?« Misstrauisch verfolgte er, wie Eduardo den Vintage Port entkorkte. Er schenkte zu großzügig ein für seinen Geschmack, zumal es sich um einen Spitzenjahrgangswein handelte, den Vovô nur zu besonderen Anlässen herausholte. Dennoch nahm er das Glas entgegen, weil er wusste, dass sein Großvater ein Nein sowieso nicht akzeptieren würde.
»Du fliegst morgen mit der ersten Maschine nach Paris.«
António fing an zu lachen. »Ich fliege ganz bestimmt nirgendwohin. Ich habe ein Hotel zu führen.«
»Das hab ich alles schon geregelt.« Sein Großvater schnupperte an der dunkelroten Flüssigkeit in seinem Glas und prostete ihm zu. »Senhora Nascimento kümmert sich während deiner Abwesenheit um das Gloriosa.«
»Manuela?« António setzte sich auf. »Aber sie ist erst seit einem knappen Jahr meine Assistentin. Sie kennt die Abläufe noch nicht gut genug.«
»Dann lernt sie die eben kennen.«
»Vovô …«
»Senhora Nascimento wirkte recht furchtlos auf mich, außerdem bin ich auch noch da. Ich habe das Gloriosa vierzig Jahre lang geleitet und werde wohl nicht alles vergessen haben.«
Sprachlos starrte er seinen Großvater an, besann sich auf das Glas in seiner Hand und nahm einen kräftigen Schluck.
»Du meinst es ernst, oder? Du willst mich wirklich nach Paris schicken.« Hilflos hob er die Hände, der Wein schwappte gegen die Glaswand und hinterließ lang gezogene Schlieren, lagrimas,Tränen. »Wozu? Was um Gottes willen soll ich da?«
»Ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Eine Frau.« Eduardo ging zum Schreibtisch. Das Polaroid, das er António kurz darauf überreichte, war vergilbt und an den Rändern geknickt. Es zeigte eine dunkelhaarige Frau mit großen hellbraunen Augen und spitzbübischem Lächeln, die aussah, als wäre sie gerade in einen Platzregen hineingeraten. Sie war hübsch, wenn auch erst auf den zweiten Blick. Stirnrunzelnd musterte António das Datum auf der Bildrückseite. 1966.
»Wer ist das?«
»Das tut nichts zur Sache. Es dient nur zur Orientierung. Wegen der Ähnlichkeit.«
»Zur Orientierung. Wegen der Ähnlichkeit«, echote António, der nicht wusste, ob er belustigt oder besorgt sein sollte.
Jetzt ist der alte Kauz vollkommen verrückt geworden.
»Die Frau, die ich suche, ist Künstlerin und etwa dreißig Jahre alt«, fuhr Eduardo unbeirrt fort. »Einen Namen habe ich nicht, aber du dürftest sie auf der Place du Tertre im Künstlerviertel finden. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Dunkles Haar, ihre Augen sind blau. Blau wie Azulejo-Kacheln. Vielleicht trägt sie einen gelben Mantel.«
»Combinado. In Ordnung.« António atmete aus. »Mal angenommen, ich würde tatsächlich nach Paris fliegen, um dir diesen seltsamen Gefallen zu tun … Was genau soll ich mit dieser Frau machen, wenn ich sie gefunden habe?«
»Ich will, dass du sie nach Lissabon holst.«
»Wie bitte?«
»Du hast mich schon verstanden. Du schaffst sie hierher. Sie soll ein Gemälde malen. Ein Porträt. Von mir.«
»Ein Porträt. Von dir.«
»Bist du ein Papagei, Junge?« Eduardo schnalzte ungeduldig. »Das Mädchen ist gut, ich hab ihre Werke gesehen, als ich im Dezember in Paris war.«
»Ach. Wieso hast du dich dann nicht gleich dort von ihr porträtieren lassen?«
»Es gab keine passende Gelegenheit.«
»Und jetzt willst du sie einfliegen lassen. Eine dir völlig Unbekannte. Damit sie dich malt.« António seufzte. »Lissabon wimmelt von Künstlern. Warum suchst du dir nicht im Bairro Alto einen armen Schlucker, der sich über ein paar Scheine freut?«
»Ich will nicht irgendeinen Maler. Ich will sie.« Eduardo leerte sein Glas und knallte es auf die Schreibtischplatte.
»Bist du sicher, dass deine Künstlerin nichts mit der Frau auf dem Polaroid zu tun hat? Ein Name wäre vielleicht ganz hilfreich, falls sie nicht an der Place du …«
»Das Mädchen wird dort sein.«
»Das weißt du doch gar nicht. Weihnachten ist fünf Monate her. Davon abgesehen wird sie sich kaum von einem Wildfremden überreden lassen, mal eben kurz nach Portugal zu fliegen. Porträt hin oder her.«
»Dann lass dir was einfallen. Mach ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann«, erwiderte Eduardo angesäuert, ehe seine Stimme sanft und einschmeichelnd wurde. »Tu deinem alten Vovôden Gefallen, Junge. Wer weiß, wie oft du noch Gelegenheit dazu haben wirst. Außerdem erinnere ich mich, dass du dich während deines Studiums sehr wohl in Paris gefühlt hast. Es wäre eine gute Gelegenheit, alte Freunde zu treffen, meinst du nicht?« Beiläufig legte er sich die Hand auf die Brustmitte, wo sie liegen blieb wie ein Mahnmal.
»Aber ich habe überhaupt keine Freunde in Paris«, wandte António halbherzig ein und fluchte innerlich, weil er spürte, wie er weich wurde. Seit Vovô vor zwei Jahren einen Herzanfall erlitten hatte, wusste er ganz genau, aus welchem Rohr er feuern musste, um sie alle in eine salutierende Garnisonsreihe zu stellen. Und António war immer derjenige, der ganz vorne stand. Wer weiß, wie oft du noch Gelegenheit dazu haben wirst. Als ob es morgen mit ihm zu Ende ginge.
Irritiert verfolgte er, wie sein Großvater mit leidender Miene und einem gekünstelten Ächzen in den Lehnsessel sank. Er war ein mieser Schauspieler. Trotzdem fand António, dass er erschöpft aussah, als ob ihm das Gespräch mehr zusetzte, als er zeigen wollte. Anscheinend war es ihm wirklich wichtig, dass diese Künstlerin aus Paris ein Bild von ihm malte. Was wäre er für ein Enkel, wenn er Vovô diesen Wunsch abschlug? Seine Schuldgefühle stellten sich so zuverlässig ein wie Albio, der mit dem Stundenschlag der Standuhr die Bibliothek betrat, um die Apéro-Schälchen mit Oliven, Käse und gesalzenen Lupinenkernen abzuräumen.
»Die Caldo verde ist angerichtet, Senhor.«
»Danke, Albio. Sag Rosária, wir kommen gleich«, antwortete Eduardo, ohne sich zu rühren. Er wartete auf eine Antwort, dabei war er normalerweise ganz verrückt nach Rosárias Grünkohlsuppe.
Antónios Hirn arbeitete auf Hochtouren. Grundsätzlich sprach nichts gegen ein paar Tage in Paris, solange die Geschäfte im Gloriosa weiterliefen – zumal er tatsächlich eine Auszeit nötig hatte. Er war überarbeitet, schlief schlecht und fand im stressigen Hotelalltag kaum ein paar Minuten für sich. Außerdem sagte ihm sein Bauchgefühl, das Vovô etwas vor ihm verbarg. Und genau dieses Etwas machte ihn neugierig.
»Wann genau geht mein Flug?«
Seine Frage schwebte einen Moment lang im Raum, ehe sich ein selbstzufriedenes Lächeln auf Vovôs Gesicht ausbreitete.
»Früh genug für ein Frühstückscroissant auf der Place du Tertre, mein Junge.«
***
PARIS, DREITAGESPÄTER.
Maelys.
Das Mädchen, das mit seinen Eltern im Garküchenbereich des marokkanischen Marktstands saß, war etwa fünf Jahre alt, hatte Sommersprossen im Gesicht und einen Kranz aus Gänseblümchen im Haar, den es fortwährend betastete. Lächelnd drückte Maelys den Schwamm im Spülbecken aus. Gerade erst heute Morgen, als sie mit dem Fahrrad zum Marché des Enfants Rouges aufgebrochen war, hatte sie überlegt, was den Frühling in Paris eigentlich so besonders machte. Da waren zum Beispiel die Petunientöpfe in Madame Vidals Küchenfenster. Oder die ausgeblichenen Sonnenschirme, die endlich wieder vor der italienischen Eisdiele in der Rue Martel standen. Im Square du Temple säumten zinkweiße, kobaltblaue und kadmiumrote Beete die Kieswege, die Luft roch nach Teichwasser und gemähtem Gras, und die Spaziergänger, an denen sie vorbeigesaust war, trugen kurze Ärmel und führten Hunde und Kinderwagen aus. Dass jedoch ausgerechnet in Hadirs Garküche die schönste Antwort auf sie wartete, schenkte ihr einen unerwarteten Glücksmoment.
Eine Gänseblümchenkrone, mitten in der Großstadt. Genau das bedeutet Frühling in Paris für mich.
Mit einem Seufzen, das irgendwo zwischen erschöpfter Zufriedenheit und einer unbestimmten Sehnsucht siedelte, zog Maelys den Stöpsel aus dem Spülbecken.
»Asil!«, rief sie und zeigte Hadirs Sohn am Verkaufstresen an, dass er ihr frisches Wasser und die nächste Ladung Geschirr bringen konnte. Dann kehrte sie gedanklich zu der Familie am Ecktisch zurück, die sich eine späte Mittagspause gönnte – neben dem Kind die Mutter in einer cremefarbenen Leinenbluse, die Beine elegant übereinandergeschlagen. Vom Vater sah sie nur die lichte Stelle auf dem Hinterkopf und den Wolljackenrücken.
Es überraschte sie nicht, dass ihr Ruf die Aufmerksamkeit des kleinen Mädchens auf sich gezogen hatte. Neugierige Augen ruhten jetzt auf ihr, glänzend wie Flusskiesel. Maelys fand sie viel zu erwachsen für das Gesicht. Würde ich diese Augen malen wollen, nähme ich Schwarzbraun und Byzantinischblau, dazu ein paar Tupfen Zinkweiß. Für das Licht.
Maelys hob eine Braue, die Kleine starrte weiter, während seine Eltern keine Reaktion zeigten. So war es oft. Die Leute schauten, weil sie die Kontrolle über ihre Stimmbänder verlor, sobald sie lauter wurde oder lachte. Doch während die Erwachsenen beiseite oder auf den Boden blickten, als suchten sie nach einer verlorenen Münze, vermuteten die Kinder in ihrer natürlichen Neugierde keinen Fauxpas. Das mochte Maelys an ihnen.
Sie winkte der Kleinen, und als diese nicht reagierte, schnitt sie ihr eine Grimasse. Das Mädchen grinste und streckte ihr die Zunge heraus, woraufhin Maelys gespielt entrüstet den Finger hob. Von einem sanften Händedruck auf ihrer Schulter wurde dieser heimliche Moment unterbrochen.
»Hast du wieder une petite amie gefunden?«, fragte Hadir, wobei er das Wort petite, klein, mit Daumen und Zeigefinger und amie, Freundin, mit einer auf der Brustmitte kreisenden Hand gebärdete. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen. Ihr Chef bemühte sich stets, deutlich zu sprechen. Es war leicht, von seinen Lippen zu lesen.
»Bist du eifersüchtig?«, konterte Maelys in Lautsprache.
»Sacrebleu. Jetzt hast du mich erwischt.«
»Und ich dachte, du hättest genug von albernen Spielen bei acht Kindern und so vielen Enkeln, dass du sie durchnummerieren musst.«
»Für ein gehörloses Mädchen bist du verflixt schlagfertig.« Hadir schmunzelte. »Ich wundere mich immer, wie deutlich du sprichst. Meinen kleinen Großneffen versteht man kaum, wenn er redet.«
»Man muss bei allem Pech auch etwas Glück haben.« Maelys pikste ihm den Finger in den Bauch. Sie wurde nicht gern daran erinnert, dass sie bis zu ihrem dritten Lebensjahr ein normal hörendes Mädchen gewesen war. Blöde Hirnhautentzündung.
Der Standbesitzer musterte sie wohlwollend. Sie mochte ihn. Ihn und seine Lachfalten. Den warmen Sienaton seiner Haut, die nach Kreuzkümmel und Minztee roch.
»Was machst du noch hier, Mademoiselle Durant?«
»Ich spüle Couscousteller und Salatschüsseln. Für diesen Job bezahlst du mich.«
»Das meine ich nicht, und das weißt du. Wann gehst du zurück in deine Schule?«
Immer dieselbe Frage, jeden zweiten Tag.
»Willst du mich loswerden, Hadir?«
»Wärst du meine Enkeltochter«, antwortete der Marokkaner nach einer Pause, in der seine Stirn noch ein paar Falten mehr bekam, »würde ich dir verbieten, deine Zeit an einem Imbissstand zu vergeuden.«
»Aber ich arbeite gern bei euch.« Ihr Herz stolperte. Gelogen hatte sie nicht, nur die halbe Wahrheit gesagt. Aber es half ja nichts. Sie tat, was getan werden musste. »Das Studium läuft mir schon nicht davon.«
Hadir sah sie lange an. Zu lange.
»Gut«, sagte der Kreis, den er mit Daumen und Zeigefinger bildete. »Aber du machst jetzt Schluss. Deine Schicht ist längst vorbei.«
Seine Züge hatten sich entspannt, dennoch war sie froh, dass sie nicht hörte, was er vor sich hin brummelte. Gehorsam band Maelys die Schürze ab, was eine Weile dauerte, da sie sich das Band zweimal um den Körper geschlungen hatte.
»Du bist zu dünn, ma fille, sogar für eine Französin. Ich sage Asil, dass er dir zwei Portionen Hühnchen-Tajine einpacken soll. Eine für dich, eine für deine Tante.«
Sie wollte höflich ablehnen, doch Hadir hatte sich bereits abgewandt und demonstrierte damit auf seine Art, dass er in seinem Zehnquadratmeter-Königreich das letzte Wort hatte.
Der kleine Ecktisch war leer, als Maelys mit ihrem Lohn und einer viel zu großen Plastiktüte dabei war, den Marktstand zu verlassen. Obwohl ihre Arbeitszeit vorbei war, räumte sie pflichtbewusst noch die Couscousteller ab und hielt inne, als sie die Handtasche an der Stuhllehne sah. Suchend schaute sie sich um und entdeckte den hochgewachsenen Wolljackenrücken in der Menschenmenge, die zum Ausgang der Markthalle drängte.
»Warten Sie!« Rasch pflückte sie die Tasche von der Lehne und lief los, begleitet vom erschrockenen Blick einer blondierten Frau, die bei ihrem Ausruf zusammengefahren war. »Verzeihung, Madame«, warf Maelys über die Schulter zurück, dann war die vergrämte Miene der Fremden nur noch eine Erinnerung, die sich zu all den anderen Gesichtsausdrücken aus ihrer Vergangenheit gesellte.
Etwa fünfzig Meter später hatte sie die Familie auf Höhe des Postkartenladens in der Rue de Bretagne eingeholt. Vater und Mutter, verbunden durch die Hände der Gänseblümchenprinzessin.
»Monsieur!« Atemlos berührte sie den Mann am Ärmel und bemerkte zu spät, dass er Professor Ledoux’ Parfum trug. Sie zog die Hand zurück und starrte verblüfft in das eisengraue Augenpaar, von dem sie sich seit zwei Jahren wünschte, dass es sie einmal, nur ein einziges Mal wahrnahm. So wie jetzt.
Die erhobenen Brauen des Professors waren so hell, dass sie sich kaum von seiner Blässe abhoben. Doch sosehr Maelys sich auch erhoffte, in dem hageren Gesicht ein Erkennen zu finden … Da war nichts. Sébastien Ledoux, der allseits gefürchtete Professor für Freie Malerei an der École nationale supérieure des beaux-arts, der ENSBA, hatte keine Ahnung, wer sie war.
Nur seine Frau reagierte, während das Mädchen sich, auf einmal schüchtern geworden, hinter den Beinen seiner Mutter versteckte. Mit einem erfreuten Ausruf nahm Madame Ledoux die Handtasche entgegen und sagte etwas, das ganz sicher nett gemeint war. Gleich darauf wandte sie sich hilfesuchend an ihren Gatten, weil sie begriff, dass Maelys nicht verstanden hatte. Wie auch? Der erdbeerrote Mund der Frau hatte sich beim Sprechen kaum bewegt. Normalerweise half Maelys den Menschen, die sich mit ihr verständigen wollten, klärte auf, bat freundlich um einen zweiten Versuch. Doch sie war wie erstarrt. Nicht nur taub, sondern auch stumm vor Schreck. Er weiß nicht mal, wer ich bin.
Ledoux sah sich um, als wäre ihm die Situation unangenehm, und der folgende Wortwechsel zwischen dem Ehepaar besaß keine Buchstaben, die Maelys lesen konnte. Schließlich beugte er sich zu seiner Tochter hinunter, nahm sie huckepack, was ihre Flusskieselaugen zum Leuchten brachte. Freundlich nickte er Maelys zu, dann legte er die Hand auf die Schulter seiner Frau und forderte sie zum Weitergehen auf.
Maelys stand noch lange mit hängenden Schultern vor dem Postkartenladen in der Rue de Bretagne. So lange, bis sie sich daran erinnerte, dass sie atmen musste.
Das zehnte Arrondissement gehörte wegen des dichten Verkehrs und seiner Nähe zum Gare du Nord nicht gerade zu den bevorzugten Wohngegenden von Paris. Maelys hatte die Rue Martel, in der sie mit Tante Valérie wohnte, anfangs überhaupt nicht gemocht. Die meisten Häuser waren schmutzig grau und graffitibeschmiert, und die Teerflickenwege luden förmlich dazu ein, Dinge, die man nicht mehr brauchte, einfach fallen zu lassen, statt sie in den nächsten Abfallbehälter zu werfen. Es hatte Zeit und viele beiläufige Hinweise von Tante Valérie gekostet, bis Maelys erkannt hatte, dass das Liebenswerte dieser Straße nicht an ihrem Aussehen, sondern an ihren Bewohnern festzumachen war – allesamt einfache Leute, die ihren Reichtum nicht am Körper, sondern im Herzen trugen.
Besonders heute war Maelys erleichtert, als sie das Fahrrad über den holprigen Asphalt lenkte, an Monsieur Pouparts Boulangerie und am Friseurladen vorbei. Sie bedachte Silvio mit einem Lächeln, der aus der Eisdiele kam, um ihr zuzuwinken. Vor der Hausnummer 1 stieg sie ab, schloss die Tür auf und bugsierte das Rad in den Flur, der nach Suppe und Madame Vidals Kernseifenlauge roch. Nachdem sie den Postkasten geleert hatte, zog sie den Rucksack und ihren Skizzenblock aus dem Hohlraum unter der ersten Treppenstufe hervor und stieg ins Dachgeschoss. Unterwegs blätterte Maelys eilig die Post durch. Keines der Kuverts war an sie adressiert, aber das hatte sie auch nicht erwartet. Maman war mit ihrem Freund im Umzugsstress, ihre Schwester Gwenaelle, die in Berlin als Redakteurin bei einer Zeitschrift arbeitete, textete lieber via Mobiltelefon. Von Pierre bekam sie schon seit einem halben Jahr keine Briefe mehr.
Wie schnell die Zeit doch vergeht.Maelys spürte einen leisen Anflug von Heimweh. Ihr fehlten das Meer und der immer zu kühle bretonische Wind, der nach Salz schmeckte und den Strandhafer unbarmherzig in die Dünen drückte. Doch Moguériec war weit weg. Sie war jetzt in Paris zu Hause und würde schon irgendwie zurechtkommen, selbst wenn nicht alles nach Plan lief. Mit zusammengepressten Lippen sortierte Maelys den Umschlag von Valéries Vermieter aus. Kaum hatte sie ihn im Rucksack verstaut, als die Wohnungstür jäh von innen aufgerissen wurde.
»Wieso kommst du nicht rein?« Tante Valérie beugte sich nach vorn und spähte an ihr vorbei in den Flur. »Steigt da draußen eine Party, zu der ich nicht eingeladen bin?«
Maelys war zu verdutzt, um auf die Frage einzugehen.
»Warst du beim Friseur?« Sie deutete auf Valéries Kopf, auf dem sich heute Morgen noch ein grau gesträhnter Dutt befunden hatte. Die Veränderung war bemerkenswert.
Valérie fasste sich in den kinnlangen Bob und drehte sich leicht zur Seite. »Gefällt’s dir?«, buchstabierten die Finger ihrer rechten Hand, flink und fehlerlos, als hätten sie schon ihr ganzes Leben lang gebärdet.
»Es ist rot.« Maelys zog die Nase kraus. Zinnoberrot. Vielleicht ein wenig gewagt für eine Vierundsiebzigjährige. Aber genau passend zum Lippenstift.
»Rot? Nein!« Valérie riss die Augen auf.
»Doch, ist es. Wolltest du es gar nicht so?«, fragte Maelys besorgt und verzichtete darauf, wissen zu wollen, woher Valérie das Geld für einen Friseurbesuch nahm. Ganz zu schweigen davon, dass sie mit einem Gipsarm durch die Gegend spazierte, statt sich nach ärztlicher Anweisung zu schonen. Erst als ihre Tante kichernd abwinkte, begriff sie, dass Valérie mal wieder etwas gesagt hatte, das gar nicht so gemeint gewesen war. Hörende machten das oft, und sie hatte bisher nicht herausgefunden, woran genau sie festmachen sollte, wann jemand ironisch war und wann nicht.
»Meine Kleine, das Leben ist zu kurz für nur eine Haarfarbe. Außerdem war der Schnitt umsonst. Nathalie hat für ihre Meisterprüfung geübt.« Valérie strich ihr zärtlich die Locke hinters Ohr, die sich immer wieder den Platz auf Maelys’ Stirnmitte zurückeroberte. »Komm rein, fleißiges Studentenmädchen, wie war’s in der Schule? Ich habe uns ein raffiniertes Mittagessen gekocht, denn das Leben ist auch viel zu kurz für schlechtes Essen.«
Mit einem unguten Gefühl im Bauch betrat Maelys hinter ihrer Tante die Dachgeschosswohnung, die so winzig war, dass sie immer unaufgeräumt wirkte. Schon im Flur empfing sie das übliche Durcheinander aus Schuhen, an den Regalwänden stapelten sich Kisten mit Büchern und Klamotten für den nächsten Flohmarkt in Saint-Ouen.
Jeden Tag räumte Maelys unverdrossen von Neuem auf, stellte Valéries Pumps in Reih und Glied, hängte herabgefallene Jacken und Hüte an die Garderobe, die genauso unerschütterlich einen Teil ihrer Last wieder abwarf. Überall lagen bunte Zettel, Flugblätter von Protestaktionen und Kundgebungen, an denen Valérie Aubert so leidenschaftlich teilnahm wie andere Damen ihres Alters beim allwöchentlichen Bingoabend. Sie protestierte eben gern, laut und unbekümmert, und es war ihr meist ziemlich egal, wogegen, solange es einem hehren Zweck diente.
Ergeben folgte Maelys den Zetteln, die sich wie eine Brotkrumenspur über den Flur zogen. In der Küche bestätigte sich ihre Vorahnung: Auf dem Tisch, an dem nur zwei Holzstühle Platz fanden, stand Valéries casserole.Darin, in einer rötlich braunen Soße, badete ein echter Hummer.
»Ein bescheidener Gruß aus unserer Heimat. Hummer nach Art der Bretagne. Trinkst du ein Gläschen Chardonnay dazu?« Valérie strahlte wie zur Bescherung am Weihnachtstag. Sie hatte sogar das gute Porzellan aus dem Schrank geholt, das weiße mit dem Goldrand, in der hellblauen Vase stand ein Strauß Rosen.
»Aber Valérie … Wer soll das bezahlen?« Sie sank auf ihren Stuhl, wie betäubt von dem Estragon, der sich mit den süßlichen Aromen der Blumen mischte.
»Ach, bezahlen.« Sorgfältig strich Valérie ihren schwarzen Rock glatt und setzte sich ihr gegenüber. »Monsieur Thibaut hat mich anschreiben lassen. Der Mann ist so reizend, auch wenn er riecht wie ein skandinavischer Dosenfisch.« Sie schwenkte die Hummergabel wie einen Weihwasserstab. »Außerdem ist es vulgär, über Geld zu sprechen.«
Noch eine unbezahlte Rechnung also, die sich zu den Mietrückständen, überfälligen Strom- und Gasrechnungen und Arztrechnungen hinzugesellte. Da Valérie sich weigerte, im Discounter einzukaufen – »Essen ist einfach Teil unserer Kultur, ma petite. Kein Pariser verzichtet auf erstklassige Qualität, weil ihm ein bisschen Klimpergeld fehlt!« –, ließ sie ihr Fleisch beim Metzger anschreiben, den Fisch beim Fischhändler, den Kuchen in der Pâtisserie und das Obst und Gemüse im Gemüseladen. Vermutlich gab es im zehnten Arrondissement kein einziges Geschäft mehr, in dem sie keine Schulden hatten.
Maelys strich über ein zartes gelbes Rosenblütenblatt und warf ihrer Tante einen verstohlenen Blick zu. Valéries Gesicht sah trotz Schminke und Fröhlichkeit schmerzgeplagt aus. Die komplizierte Unterarmfraktur, die sie sich zugezogen hatte, als sie vor sechs Wochen beim Putzen in der Galerie von der Leiter gestürzt war, wollte nicht recht heilen. Und obwohl ihnen durch Valéries Verdienstausfall hinten und vorne das Geld für das ohnehin schon bescheidene Leben fehlte, das sie führten, musste die alte Dame sich beschäftigen. Das tat sie, indem sie vorgab, es gäbe kein Problem. Schon gar kein finanzielles.
Über einen gewissen Zeitraum funktionierte Valéries Täuschungsmanöver reibungslos – bis Maelys in der Altpapierkiste ein Schreiben von Valéries Vermieter gefunden hatte. Darin stand in deutlichen Worten, was ihnen blühte, wenn sie die rückständigen Mieten nicht zahlten. Räumungsklage. Ein hässliches Wort, das sich wie Sonnenbrand auf der Haut anfühlte, ihre Tante jedoch völlig kaltließ.
»Ach, François. Der spielt sich doch nur auf«, hatte sie mit einem Lächeln gesagt, das man allenfalls einem Vierjährigen spendiert, der sich brüllend im Supermarkt auf den Boden wirft, weil ihm die Mutter eine Tüte Bonbons verweigert. »Ich wohne seit vierzig Jahren in dieser überteuerten Schuhschachtel, und bisher hat dieser Halsabschneider seine Miete noch immer bekommen – früher oder später.« Damit war das Thema für sie erledigt gewesen, und Maelys war nichts anderes übrig geblieben, als sich selbst um das Problem zu kümmern.
»Hör auf zu grübeln, ma chère.« Valérie pflückte ein zinnoberrotes Haar von ihrem Blusenärmel und musterte es argwöhnisch. »Konzentrier dich auf dein Kunststudium und überlass mir das Drumherum. Iss lieber, damit dir heute Nachmittag nicht vor Entkräftung der Pinsel aus der Hand fällt. Oder du den Touristen hässliche Nasen malst.«
»Ja, Tante.« Gehorsam griff Maelys nach dem Besteck und dachte bedauernd an Hadirs Plastiktüte, die sie einem Obdachlosen im Park in die schmutzigen Hände gedrückt hatte. Ein kostenloses Essen auf Vorrat hätten sie selbst gut brauchen können, aber sie wollte nicht riskieren, dass ihre Tante von ihrem Job auf dem Markt erfuhr. Es war schon schwierig genug gewesen, Valérie zu überreden, das Geld zu nehmen, das sie mit den Touristenporträts verdiente. Ein Tropfen, der auf ihrem glühenden Schuldenstein verdampfte.
»Ich nehme nur Geld von dir, solange dein Studium nicht darunter leidet!«,hatte ihre Tante mit kantigen Gebärden gesagt, und ihr Mund war klein und spitz dabei geworden. Sie war so stolz auf ihre Nichte, die jetzt Studentin der Hochschule der Bildenden Künste war, und Maelys hätte nur zu gern ebenfalls daran geglaubt, dass ihr Stipendium ein Beweis ihrer Begabung sei. Alle hielten sie für begabt: Tante Valérie, Maman und auch ihre Schwester, die immer behauptete, sie könne selbst dann keine gerade Linie zeichnen, wenn man ihr eine Pistole an den Kopf hielte. Leider schien es, als hätten sie alle sich geirrt, denn offensichtlich wusste nicht mal ihr Professor, wer sie war.
Gedankenverloren tunkte sie den Löffel in die sämige Cognacsoße, während Valérie das Fleisch aus einer Hummerschere pulte. Ihre Miene ähnelte der von Ledoux’ Gänseblümchentochter: verzückt und ein wenig ungläubig. Ein Hummer nach einer Woche Käse und altbackenem Baguette, und für ihre Tante war die Welt in Ordnung.
Maelys lächelte, obwohl ihr eigentlich nicht danach zumute war. Zweifelsohne hatte Valéries Unbeschwertheit ihr zwei aufregende Jahre in Paris geschenkt. Aber nun brauchten sie dringend ein kleines Wunder. Vielleicht sogar ein großes.
2. Kapitel
PARIS, IMMAI 2019.
António.
An seinem dritten Tag in Paris – den er mehr oder weniger auf demselben Stuhl vor derselben Brasserie verbrachte wie die Tage zuvor – kam er zu der ernüchternden, wenn auch nicht ganz überraschenden Erkenntnis: Er taugte nicht zum Privatdetektiv.
Frustriert legte er die Le Monde auf den Bistrotisch und öffnete den ersten Hosenknopf. Er war unvorsichtig gewesen und hatte sich nach dem Mittagessen noch ein Stück Schokoladenkuchengegönnt, der ihm jetzt wie ein Pflasterstein im Magen lag. Ein guter Anlass, um diese bescheuerte Mission mit hartem Geschütz auf Eis zu legen. Anisschnaps lautete das Allheilmittel der Franzosen, das vermischt mit Wasser jene milchige Konsistenz bekam, die gegen alles half: Erkältung, Magenschmerzen, Liebeskummer. Und gegen das Gefühl, versagt zu haben.
»Pastis, Mathéo. Einen doppelten.«
Der Kellner, der ihn heute wie einen Stammgast im Au Clairon des Chasseurs begrüßt hatte, schaute ihn mitleidig an. »Wieder nichts?«
»Wieder nichts.« António zog das Gesicht, das der junge Mann von ihm erwartete, nachdem er ihn gestern Abend in einem spontanen Anfall portugiesischer Mitteilsamkeit ins Vertrauen gezogen hatte.
»Putain!« Mathéo schnalzte. »Es ist doch immer dasselbe mit den Frauen.«
Gut, vielleicht hatte er Mathéo nicht die ganze Wahrheit erzählt. Er wollte ja nicht, dass sein neuer Freund ihn für verrückt hielt. Ihn oder seinen Großvater, obwohl er allmählich befürchtete, dass er einem Hirngespinst nachjagte. Vovôs Hirngespinst, aber welchen Unterschied machte das schon? Er saß längst mit im Boot, umspült von Hunderten Gesichtern, von denen keins zu dem Polaroid in seiner Brieftasche passte.
Missmutig schirmte António die Augen vor der Sonne ab. In Paris war das Licht kühler als in Lissabon, Farbe befand sich hier hauptsächlich auf der grellbunten Kleidung der Touristen. Paris selbst hielt es lieber gedeckt, das betraf das Straßenbild als auch seine Bewohner, bei denen zurückhaltendes Schwarz, Grau oder Marineblau angesagt war. Diese Überlegung half ihm dabei, nach Französinnen Ausschau zu halten, die jedoch auf der Place du Tertre dünn gesät waren. Unter den Künstlern hatte er nicht eine Frau entdeckt, die der Beschreibung seines Großvaters entsprach. Die meisten waren weit über dreißig und weder zierlich noch elegant.
Nun denn, er würde eine letzte Runde drehen, bevor er sich in sein Hotel zurückzog und sein Scheitern zusammen mit seinen Habseligkeiten in den Koffer packte. Vielleicht würde er sich auf der Dachterrasse noch einen Pastis genehmigen, um sich stilvoll von der Seine und dem Eiffelturm zu verabschieden.
Tut mir leid, Vovô. Ich hab’s ehrlich versucht.
Das hatte er tatsächlich, und es erstaunte ihn, dass es ihm schwerfiel, seinem Großvater eine entsprechende Nachricht zu schicken. Er starrte auf das leere Display und steckte das Mobiltelefon zurück in die Jackentasche. Den Pastis, den Mathéo ihm servierte, leerte er mit zwei langen Zügen.
»Der geht heute aufs Haus, mon ami.« Mathéo wehrte ab, als er die Brieftasche zückte, und deutete mit dem Kinn zum Künstlerplatz. »Ein letzter Versuch?«
Er nickte und bemerkte, dass der junge Mann sich versteifte, als er ihn zum Abschied umarmte. Ständig vergaß er, dass die spröden Franzosen mit der portugiesischen Herzlichkeit nichts anzufangen wussten. In seiner Heimat war es normal, dass Männer sich umarmten oder küssten, ohne gleich für schwul gehalten zu werden. Um den Fauxpas wettzumachen, boxte er Mathéo in die Seite.
»Melde dich, falls du mal in Lissabon bist. Wir haben sehr hübsche Mädchen, die dir sicher gefallen werden.« Damit verließ er die Brasserie und ließ sich von den Menschen mitziehen, die um den Gemeindeplatz mit den alten Bäumen kreisten, vorbei an Marktschirmen, unter denen alles Platz fand, was es mit Sicherheit niemals in eine Galerie schaffte. Später würde er sich an kein einziges Bild mehr erinnern, so angestrengt musterte er die Künstler.
Dieselbe Prozedur seit drei Tagen, der stets die ernüchternde Erkenntnis folgte, dass er das Gesuchte nicht finden würde. António löste sich aus dem Strom, um zwischen den Staffeleiplätzen umherzuschlendern. Abgelenkt von einigen streitenden Elstern im Baumgeäst legte er den Kopf in den Nacken und stolperte über die spindeldürren Beine eines Mannes mit spitzen Schuhen, der sich auf seinem Kinderschemel sichtlich unwohl fühlte.
»Entschuldigung«, murmelte er, während ihn der Maler unter der Schirmmütze finster ansah. Als António zurückwich, bohrte sich ein harter Gegenstand in seinen Rücken.
»He! Sie müssen aufpassen, wohin Sie gehen, Monsieur.«
Irritiert drehte António sich um.
Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Dunkles Haar, ihre Augen sind blau. Blau wie Azulejo-Kacheln. Vovôs Worte waren das Letzte, was ihm in den Sinn kam, bevor sich seine Denkfähigkeit in Luft auflöste.
Das Mädchen, das gar kein Mädchen mehr war, hob die Brauen. Sie waren dicht, ungezupft und eine Nuance dunkler als die Locke, die sie sich mit einem kohlegeschwärzten Handgelenk aus der Stirn strich. In der anderen Hand hielt sie einen Grafitstift, der ihr anscheinend als verlängerter Zeigefinger gedient hatte.
»Hat es Ihnen die Sprache verschlagen?«
»Desculpe,Senhora …« Que merda. Er stotterte, und das nicht nur, weil ihm ihre schleppende Art zu sprechen seltsam vorkam. Aber diese Augen versöhnten ihn sogar mit dem ausgeleierten Baumwollkleid, das ihrem Körper jegliche Rundungen stahl. »Excusez-moi, Mademoiselle, aber ich wollte nicht …«
»Stopp.« Der Stift wackelte hin und her. Nicht barsch oder belehrend, sondern wie der Taktstock eines Dirigenten, der ein Instrument behutsam in die richtige Tonspur brachte. »Sie müssen langsamer sprechen. Und deutlich. Ich bin taub.«
Vielleicht war es das Wort taub, das den Kiesel löste, der zwischen die Zahnräder seines Gehirns geraten war. Er kam augenblicklich zur Besinnung.
»Dann passen wir ja gut zusammen. Sie sind taub, und ich habe offenbar das Sprechen verlernt.«
»Aber Sie sprechen doch«, erwiderte sie, das Azulejo-Blau zu einem schmalen Streifen verengt. »Oder war das ironisch gemeint?«
António geriet aus dem Konzept. »Das war es«, sagte er und fühlte sich wie ein Idiot. »Tut mir leid, ich war unhöflich.«
Sie nickte, womit das Thema für sie offenbar erledigt war.
»Jedenfalls müssen Sie hier aufpassen. Sie hätten beinahe meine Staffelei umgeworfen.«
Erst jetzt bemerkte er den Holzständer mit den bunten Kreiden und Künstlerstiften auf der Ablage. Doch während die anderen mit folierten Arbeitsproben um Kunden warben, war ihr Platz leer – vom Skizzenblock abgesehen, der blütenweiß und unschuldig auf der Staffelei wartete. Nebenan schüttelte der Mann mit den dünnen Beinen dem Maler mit der Schiebermütze überschwänglich die Hand. Schwer zu sagen, ob er sich über das mäßig gelungene Porträt freute oder einfach nur froh war, nicht länger auf dem harten Schemel sitzen zu müssen.
»Sind Sie Künstlerin?« Eine rhetorische Frage, aber die unverfänglichste, die António einfiel.
»Schon möglich.« Sie lachte auf, wobei ihm die unerwartete Ähnlichkeit mit der kokett lächelnden Frau auf Vovôs Polaroid den letzten Zweifel nahm.
Ich habe sie gefunden, Vovô. Und sie ist keine fixe Idee von dir, sondern eine Frau aus Fleisch und Blut.
»Wollen Sie ein Porträt, Monsieur? Eine Kohlezeichnung vielleicht? Ich mache einen fairen Preis.«
Unschlüssig sah António sich um. Eigentlich legte er keinen Wert darauf, sein Gesicht auf Papier zu sehen. Andererseits hatte er kaum drei Nachmittage auf einem unbequemen Eisenstuhl verbracht, um unverrichteter Dinge abzuziehen. Zwar hatte er Vovôs Fata Morgana gefunden, aber seine eigentliche Mission lag noch vor ihm.
»Okay.« Er setzte sich mit einem unbehaglichen Lächeln auf den Klapphocker, den das Mädchen flugs vor der Staffelei aufgestellt hatte.
Eine Weile geschah gar nichts. Sie musterte ihn mit verschränkten Armen, starrte abwechselnd auf den jungfräulichen Skizzenblock und zu ihm. Ausgeliefert. So also hatte sich der Mann mit den dünnen Beinen gefühlt.
»Sie müssen stillhalten.«
»Aber Sie haben doch noch gar nicht angefangen.«
Sie legte den Finger auf den Mund. »Nicht reden, nicht die Stirn knittern. Sonst sehen Sie nachher auf dem Bild aus, als ob Sie Magenschmerzen hätten.«
Verflucht, er hatte Magenschmerzen. Wegen des Schokoladenkuchens von vorhin und ganz grundsätzlich, weil er Kaffee konsumierte wie ein Kettenraucher Zigaretten. Die Frau nahm ein Kohlestück aus der Stiftablage und wog es in der Handfläche.
»Denken Sie an etwas Schönes«, sagte sie ernst und ließ die flache Hand über der Brustmitte kreisen. »An etwas, das Sie lieben.«
Er rutschte unangenehm berührt auf dem Hocker herum.
War es für ihn als Mann normal, dass keine Frau vor seinen Augen auftauchte, sondern eine verlebte Schönheit mit heruntergekommenen Häusern in den Farben von Bonbons und Pfirsichen? Wenn ihm das Wellenmuster der Calçada Portugesa auf dem Rossio in den Sinn kam und die engen Gassen der Alfama, die ein einziges Labyrinth aus Treppen und wäschebehangenen Fenstern waren? Dass er hinter dem Triumphbogen am Praça do Comércio den Tejo sah, tagsüber ozeanblau und abends ein Meer aus Stroh unter rosafarbenem Dunst, über das der Cristo Rei vom anderen Ufer aus mit ausgebreiteten Armen wachte?
Sein Herz weitete sich, weil ihm klar wurde, dass es keinen Ort gab, dem er sich mehr verbunden fühlte als seiner Heimatstadt. Was konnte dem Gefühl von Liebe näher sein?
»So ist es viel besser.« Die junge Frau setzte einige schwungvolle Linien auf das Blatt. »Ist sie hübsch?«
Er lachte auf. Nicht nur, dass dieses gehörlose Mädchen sprach wie eine Hörende – man musste wirklich sehr genau hinhören, um die feinen Unsauberkeiten in ihrer Satzmelodie zu bemerken –, sie war vor allem ziemlich direkt. Das brachte ihn in Verlegenheit, was einer Frau normalerweise nur selten gelang.
»So hübsch, wie eine Stadt nur sein kann, die man als sein Zuhause bezeichnet.«
»Erzählen Sie mir von dieser Stadt.«
»Ich dachte, ich soll nicht reden.« António gab sich belustigt, obwohl sein Puls in die Höhe schnellte. Lieferte ihm die Frau tatsächlich eine Steilvorlage für das, was er vorhatte? »Sie heißt Lissabon. Lisboa. Man spricht es weich aus, mit einem langen Sch in der Mitte«, fuhr er vorsichtig fort. »Es ist die Hauptstadt von Portugal.«
»Lisboa.« Sie berührte ihre Kehle und wiederholte den Namen. »Das fühlt sich wirklich nach einer wunderschönen Stadt an.«
»Oh, das ist sie. Sie ist bunt und fröhlich, voller Musik. Außerdem leben dort sehr freundliche Menschen.« Er überlegte, ob die Erwähnung von Musik taktlos gewesen war, doch sie nickte, als ob sie genau wüsste, was er meinte.
»Lebt Ihre Familie auch in Lisboa?«
»Mein Großvater und Angela, meine Schwester. Das heißt, eigentlich lebt sie derzeit überall und nirgends. Sie ist Stewardess«, erklärte er schmunzelnd. »Darüber hinaus gibt es noch eine Menge anderer Verwandte. Zu viele, um sie aufzuzählen.«
Sie rieb mit dem Daumen über das Blatt und wählte einen anderen Stift aus. »Ich komme aus der Bretagne, und meine Familie zähle ich an einer Hand ab.« Ohne aufzusehen, hielt sie drei geschwärzte Finger in die Höhe, Daumen und Zeigefinger balancierten den Kohlestift. »Maman und meine Schwester Gwenaelle. Außerdem meine Tante Valérie, bei der ich hier in Paris wohne.« Über ihr fein geschnittenes Renaissancegesicht flog ein sehnsüchtiger Ausdruck. »Ich vermisse das Meer sehr. Auch wenn ich Paris mag, aber ich fühle mich oft unfrei in dieser Stadt.«
»Lissabon liegt am Atlantik! Also fast.« António wunderte sich, wie offen sie einem Fremden ihr Innerstes preisgab, ohne dabei allzu vertrauensselig zu wirken. Sie sprach so selbstverständlich über ihre Gefühle wie andere Leute über ein Bund Suppengemüse, das sie im Supermarkt in den Einkaufswagen legten. »Wir haben einen Fluss, den Tejo. Man sagt, er sei der einzige Fluss in Europa, der wie das Meer aussieht.«
»Wirklich?«
»Sie sollten Lissabon kennenlernen. Die Reise lohnt sich.« Das läuft fast zu gut, um wahr zu sein.
»Ich bin noch nie über Frankreich hinausgekommen.«
»Dann wird es Zeit.«
Ihr Lachen war sehr laut und ein bisschen sperrig, nicht wirklich schön. Trotzdem riss es ihn mit, weil es nichts Kokettes hatte und so ungeniert aus ihrem Mund kam. Einem schönen, weiblichen Mund.
»Das geht nicht. Ich kann nicht einfach verreisen«, sagte sie, nachdem sie sich gefangen hatte. Es lag Bedauern in ihren Worten – und auch wieder nicht.
»Warum nicht?«
Sie schraffierte, verwischte, schraffierte erneut. Rieb sich die Nase und hinterließ einen Kohlestreifen auf der porzellanblassen Haut.
»Weil Tante Valérie sich den Arm gebrochen hat. Ich muss mich darum kümmern, dass wir die Miete bezahlen können und nicht noch mehr Schulden machen. Außerdem studiere ich Kunst. Das heißt …« Sie stockte und fuhr achselzuckend fort: »Momentan gehe ich nicht zu Vorlesungen. Bis wir wieder Geld haben.«
António atmete aus. Das hier war in der Tat ein erstaunliches Gespräch. Es vermittelte ihm den Eindruck, diese Frau zu kennen, obwohl er nicht mal ihren Namen wusste. War es das, was das Fehlen des Gehörs aus den Menschen machte? Dass Hirn und Herz eins wurden und sie deshalb ohne Scheu über Dinge sprachen, die Hörende allenfalls engen Freunden anvertrauten? Und er? Konnte er hingehen und dieses Wissen einfach so für seine Zwecke ausnutzen?
Lass dir was einfallen. Mach ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann, hörte er Vovôs spöttische Stimme und überlegte, ob es nicht besser wäre, wenn er sich höflich verabschiedete.
Doch seine Neugier war stärker. Entgegen ihrem händewedelnden Protest erhob er sich und trat hinter die Staffelei. Bestürzt musterte er die halb fertige Zeichnung, die schonungslos seine ewige Bettfrisur abbildete. Darunter erkannte er die Narbe in den Brauen, die er dem Deckenbalken über seiner Wohnungstür verdankte, die römische Nase und ein eckig angedeutetes Kinn. In den Augen – die eindeutig seine waren – spiegelten sich das silbrige, kühle Licht des Pariser Himmels und jene Melancholie, für die es nur im Portugiesischen das passende Wort gab. Saudade. Er bekam eine Gänsehaut.
»Es ist noch nicht fertig, Monsieur.«
António straffte den Rücken und wandte sich ihr zu, damit sie von seinen Lippen ablesen konnte.
»Mein Name ist António.« Er bemühte sich sehr, jeden einzelnen Buchstaben zu betonen.
»Maelys.« Belustigt imitierte sie seinen Buchstabierversuch. »Ich heiße M-ä-h-l-i-s-s.«
Er sammelte sich, dann tippte er den ersten Dominostein an, der die Ereignisse in Gang setzte – Ereignisse, von denen er nicht ahnte, wohin sie führen würden.
»Also Maelys. Jetzt, da wir uns kennen … Wie viel müsste ich Ihnen bezahlen, damit Sie nach Lissabon kommen und ein Porträt von meinem Großvater anfertigen?«
Maelys.
Als sie nach Hause kam, roch die Wohnung noch immer durchdringend nach Hummer. Maelys schloss die Haustür hinter sich und betastete automatisch die Rocktasche ihres Hängerkleids, ehe sie sich bückte und die Sneakers in die Lücke zwischen Valéries Pumps stellte. Dann holte sie die Visitenkarte hervor, auf deren Vorderseite die klassizistische Fassade eines schicken Hotels abgebildet war. Auf die Rückseite hatte António seine private Handynummer geschrieben, der sie mit den Fingerspitzen nachfühlte, weil sie nicht glauben konnte, dass sie wirklich da war.
Sie atmete tief durch und ging durch den Flur zum Wohnzimmer. Valérie hockte barfuß auf dem Teppich, den die damals siebenjährige Maelys bei ihrem ersten Parisbesuch mit einem tellergroßen blauen Farbfleck verziert hatte, der bis heute zu sehen war. Ihre Tante hatte sie noch nicht bemerkt oder wollte sie nicht bemerken, was man bei Valérie nie genau wissen konnte. Maelys reckte den Hals, um die schwarzen Blockbuchstaben auf dem Plakat zu lesen. Je suis contre! Ich bin dagegen!,stand da, und Valérie malte soeben das reichlich überdimensionierte Ausrufezeichen aus, dem sie die Form eines Bajonetts verpasst hatte.
»Was machst du da?«
»Wonach sieht es denn aus?« Ihre ungeduldige Gebärde schloss Valérie ab, indem sie sich die zinnoberroten Haare raufte. Maelys’ Nase zuckte, als sie den abgeschraubten Besenstiel und das Klebeband auf dem Boden bemerkte.
»Du bastelst ein Demoplakat? Gegen was protestierst du diesmal?«
»Gibt es nicht immer irgendwas, wogegen man sich auflehnen sollte?«
»Schon.« Maelys verschränkte die Arme vor der Brust. »Solange ich dich nicht schon wieder auf der Polizeistation abholen muss. Der Commissaire hat gesagt, er lässt dich beim nächsten Mal nicht so glimpflich davonkommen.«
Valérie hob eine gezupfte Braue. »Sich für eine Sache einzusetzen heißt, ein paar unangenehme Konsequenzen auszuhalten, ma chère. Vergiss nicht, dass gerade deine Generation ihre Freiheiten einigen mutigen Frauen verdankt, die keine Angst vor einer Gefängnispritsche hatten.« Ihr Filzstift malte ein Ausrufezeichen in die Luft. »Es lebe die Revolution!«
»Um was geht es also?«
»Tiefkühlkost.« Sie machte ein Gesicht, als schmecke das Wort nach saurer Milch.
»Wie bitte?«
»Ist es nicht unsäglich?« Valérie blies die Backen auf. »Die Gemeinde will an der École élémentaire in unserer Straße Tiefkühlkost einführen. Billige Convenience-Küche statt Frischkost, und das bei Grundschulkindern! Das ist der Niedergang der französischen Genusskultur, sag ich dir. Ich musste eine ganze Stunde lang auf dem Friedhof spazieren gehen, bis ich mich beruhigt hatte.«
Maelys konnte das Kichern nicht länger unterdrücken. Sie kannte wirklich keinen Menschen, der sich Gräber ansah, wenn er sich aufregte.
»Wieso schreibst du nicht einfach ›Ich bin gegen Tiefkühlkost‹ auf das Plakat?«