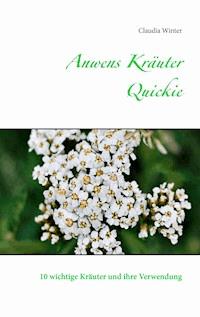8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charmant und gewitzt hat sich Claire Durant auf der Karriereleiter eines Berliner Gourmet-Magazins ganz nach oben geschummelt. Denn niemand ahnt, dass die Französin weder eine waschechte Pariserin ist noch Kunst studiert hat – bis sie einen Hilferuf aus der Bretagne erhält, wo sie in Wahrheit aufgewachsen ist: Ihre Mutter muss ins Krankenhaus und kann Claires gehörlose Schwester nicht allein lassen. Claire reist in das kleine Dorf am Meer und ahnt noch nicht, dass ihre Gefühlswelt gehörig in Schieflage geraten wird. Denn ihr Freund Nicolas aus gemeinsamen Kindertagen ist längst nicht mehr der schüchterne Junge, der er einmal war, und dann taucht aus heiterem Himmel auch noch ihr Chef auf. Claire muss improvisieren, um ihr Lügengespinst aufrechtzuerhalten – und stiftet ein heilloses Durcheinander in dem sonst so beschaulichen Örtchen Moguériec …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Charmant und gewitzt hat sich Claire Durant auf der Karriereleiter eines Berliner Gourmet-Magazins ganz nach oben geschummelt. Denn niemand ahnt, dass die Französin weder eine waschechte Pariserin ist noch Kunst studiert hat – bis sie einen Hilferuf aus der Bretagne erhält, wo sie in Wahrheit aufgewachsen ist: Ihre Mutter muss ins Krankenhaus und kann Claires gehörlose Schwester nicht alleinlassen. Claire reist in das kleine Dorf am Meer und ahnt noch nicht, dass ihre Gefühlswelt gehörig in Schieflage geraten wird. Denn ihr Freund Nicolas aus gemeinsamen Kindertagen ist längst nicht mehr der schüchterne Junge, der er einmal war, und dann taucht aus heiterem Himmel auch noch ihr Chef auf. Claire muss improvisieren, um ihr Lügengespinst aufrechtzuerhalten – und stiftet ein heilloses Durcheinander in dem sonst so beschaulichen Örtchen Moguériec …
Weitere Informationen zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Claudia Winter
Die Wolkenfischerin
Roman
Der Regen fällt nur auf die Dummenund das in dicken Tropfen.
Bretonisches Sprichwort
Prolog
FRANKREICH IM JULI 1998
Ihr erstes Leben hatte fünfzehn Jahre und achtundzwanzig Tage gedauert. Natürlich erinnerte sie sich nicht daran, wie und wo es begonnen hatte, aber Maman erzählte den Leuten immer gern, wie froh die Schwester im Krankenhaus gewesen sei, sie endlich loszuwerden, weil sie so hässlich war und pausenlos geschrien hatte. Gestorben war sie wesentlich leiser, auch wenn sie nicht mehr genau sagen konnte, wie. Sie wusste nur, dass es an einem regnerischen Februarnachmittag passiert war, auf einem Felsen, der sich unter ihren Fingern anfühlte wie die bucklige Schale einer Auster.
Gwenaelle löste den Blick von den vorbeiziehenden Wolkenschäfchen und der Landschaft, die immer mehr Bäume und Häuser hatte, je näher sie Paris kamen. Die Salzwiesen, das Heidekraut, der Ginster – alles, was sich wegducken konnte vor dem ewigen Wind, war dort geblieben, wo es hingehörte: ans Ende der Welt, das die Bretonen Finistère nennen.
Eingeklemmt zwischen Koffern und nach Schweiß riechenden Körpern, musterte Gwenaelle ihre Mitreisenden. Drei Frauen, ein Mann und ein Kind in einem viel zu engen Zugabteil. Auf eine seltsame Art waren ihr alle fremd, obwohl sie zwei von ihnen aus ihrem ersten Leben kannte – als sie noch nicht gewusst hatte, wie es war, wenn man von außen zornig und von innen leer war.
Das Mädchen auf dem Sitz gegenüber war sieben Jahre alt, auch wenn es jünger aussah mit seinem Mausgesicht, das sich neuerdings ständig hinter den drahtigen Locken versteckte. Die vernarbten Knie passten nicht recht zu den feinen Spitzensöckchen und den Lackschuhen, die einmal Gwenaelle gehört hatten, bevor diese beschloss, dass ihr offene Schnürsenkel besser gefielen als Riemchen.
Maelys hingegen war schon immer unkompliziert gewesen, leichter zu handhaben, wie Maman gerne betonte. Ganz im Gegensatz zu Gwenaelle, die sämtliche Protestwörter dazubekommen hatte, die eigentlich Maelys gehört hätten.
Trotzig baumelte Gwenaelle mit den Füßen. Die Schuhbänder peitschten den Boden des Abteils, aber ihre Mutter bemerkte es nicht einmal. Kerzengerade klebte sie an dem samtblauen Sitz, die Nägel in ihre Handtasche gekrallt, die Augen geschlossen. Ein Muster aus Tageslicht und Tunnelschatten huschte über ihr Gesicht, das sogar müde aussah, wenn sie wach war.
Gwenaelle begann vor sich hinzusummen und fing sich vom Gangplatz den Blick einer alten Frau ein, die mit einer Leselupe ein Buch las. Sie sah nicht aus, als würde sie Kinder mögen, was sich bestätigte, als Maelys nieste und der Ärmel ihrer Schuluniformjacke für den Rotzfaden am Kinn herhalten musste. Die Leselupenfrau schnalzte missbilligend, und Gwenaelle wackelte pflichtbewusst mit dem erhobenen Zeigefinger, was ihre Schwester zum Lachen brachte. Ein helles, trillerndes Geräusch, das ein wenig wie der Lockruf eines Sandpfeifers klang.
Maelys war so leicht zum Lachen zu bringen. Eine Grimasse, eine herausgestreckte Zunge. Ein alberner Smiley, mit dem Finger auf die schmutzige Scheibe eines Abteilfensters gemalt. Es war unmöglich, sich nicht von ihrem Gelächter anstecken zu lassen, das so arglos aus ihr herauskam wie das, was jetzt auf dem viel zu langen Uniformärmel trocknete.
Gwenaelle entschlüpfte ein Kichern, und nun traf er sie doch, der tadelnde Blick aus Mamans braunen Augen. Der Busen unter der schief geknöpften Bluse hob sich für die unvermeidliche Rüge, aber die Blechstimme aus dem Lautsprecher war schneller als der verkniffene Mund.
»Mesdames et messieurs, dans quelques minutes nous arriverons à la Gare Montparnasse, Paris.«
Maman erhob sich und richtete ein »Merci« an den freundlichen Mann, der rasch die Zeitung beiseitegelegt hatte, um ihre Tasche von der Gepäckablage zu hieven. Mit einer Geste gab sie Maelys zu verstehen, dass ihre Reise hier endete.
Sie standen hintereinander in dem schmalen Gang, als der TGV aus Morlaix in den Bahnhof von Montparnasse einfuhr. Gwenaelle sprang als Erste auf den Bahnsteig und zog ihren Rollkoffer hinter sich her wie eine bockende Ziege. Sie erstarrte, überwältigt von der Hitze und dem Lärm in der riesigen Bahnhofshalle, von den vielen Menschen, die hin und her liefen. Ein abenteuerliches Duftgemisch aus Abgasen und verbrannter Schokolade stieg ihr in die Nase, während die Tür in ihrem Rücken die anderen Passagiere ausspie.
Wie selbstverständlich eilten sie in dieselbe Richtung davon, als ob sie alle zur selben Party eingeladen waren, bei einem Gastgeber, den man besser nicht warten ließ. Für einen kurzen Augenblick jedoch stockte der Strom auf dem Bahnsteig, als brächen Wellen an einem Riff. Es dauerte nicht länger als einen Wimpernschlag, dann teilte sich die Menschenmenge und umspülte den dunklen Fels in der Brandung.
Gwenaelle kniff die Augen zusammen. Das Riff entpuppte sich als schwarz gekleidete Frauengestalt, überraschend klein und zart für die Kraft, mit der sie sich nun einen Weg in ihre Richtung bahnte. Sie spürte, wie sich Maelys schwitzige Hand in ihre schob, und erinnerte sich daran, dass sie atmen musste.
»Yvonne!«, rief der Fels und winkte. Die laute, befehlsgewohnte Stimme eines Kapitäns auf hoher See.
Gwenaelles Herz klopfte schneller.
»Valérie.« Maman hob verhalten die Hand. Sie hatte es noch nie gemocht, wenn sie in der Öffentlichkeit auffiel.
Die Frau blieb stehen, ihr bunt gemusterter Hermès-Schal flatterte im Wind. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, sie beugte sich nach vorne und breitete die Arme aus. Gwenaelle spürte, wie Maelys’ Hand ihr entglitt, und wollte nachfassen, griff jedoch ins Leere.
Maelys rannte los, die Lackschühchen klapperten über den Bahnsteig. Und noch während ihre Schwester in die Arme der Tante flog, die sie eigentlich nur aus Erzählungen kannte, traf er Gwenaelle – der Blick aus meerwasserblauen Augen, die sie von der ersten Sekunde an durchschauten, als wäre ihre Haut aus Glas.
Eins
CLAIRE
Das Schönste am Sommer waren die Wolken, wenn sie aussahen wie Zuckerwatte, von klebrigen Kinderfingern an den Himmel gepappt. Kam außerdem ein milder Spätnachmittagswind hinzu, der nach Sonnencreme roch und Lounge-Musik von der Strandbar herübertrug, stand dem perfekten Einstieg ins Wochenende nichts, rein gar nichts im Weg.
Claire lächelte und setzte ihre Sonnenbrille auf. Seufzend lehnte sie sich in der Klappliege zurück, nahm das Kunstmagazin aus der Tasche und vergrub die Zehen im Sand. Satte vierunddreißig Grad hatten sie vorhin im Radio gemeldet. Es war zweifellos eine brillante Idee gewesen, nach Redaktionsschluss zum Weißensee zu fahren, obwohl halb Berlin offensichtlich denselben Einfall hatte. Aber mit geschlossenen Augen, ein bisschen Fantasie und wenn sie das Gekläffe und Kindergeschrei ausblendete, konnte sie sich an diesem Ort problemlos in den Urlaub träu…
»Claire! Wo bleibst du denn? Komm ins Wasser, es ist herrlich!«
Gut, sie brauchte mehr als nur ein bisschen Fantasie. Claire hielt die Zeitschrift ein wenig höher, auch wenn sie wusste, dass Sasha derartige Signale grundsätzlich ignorierte.
»Du kannst dich nicht verstecken, Mademoiselle Durant. Ich sehe deinen käsigen Alabasterkörper noch immer!«
Sie vermied einen allzu genauen Blick auf das schaukelnde Holzfloß und das viele Wasser drum herum und konzentrierte sich auf die Gestalt, die auf der Badeinsel auf und ab hüpfte. Dünn und biegsam, wie Sasha war, la fillesans balcon et derrière – das Mädchen ohne Busen und Hintern, wie Claire sie insgeheim nannte, wirkte sie wie eine ausgelassene Sechzehnjährige. Claire schmunzelte und wedelte mit dem Magazin, als verscheuche sie ein hübsches, aber lästiges Insekt.
Sie liebte diesen See mit der lilienförmigen Fontäne in der Mitte und den Booten, die träge darum herum dümpelten. Allerdings war es eine Liebe, wie sie ein Kunstkenner verspürt, wenn er ein Gemälde betrachtet: aus respektvollem Abstand und ohne das Bedürfnis, es berühren zu müssen, um es zu verstehen. Davon abgesehen wurde ihr bereits beim Anblick des schwankenden Floßes übel.
Sasha schien aufgegeben zu haben. Von ihr war mit einem Mal weit und breit nichts mehr zu entdecken, und da Claire davon ausging, dass die kleine Wasserratte sicher nicht ertrunken war, kehrte sie zu dem Artikel zurück, der bereits in der Redaktion ihre Aufmerksamkeit erregt hatte.
Vom Dachbodenfund bis zur Semesterabschlussarbeit – Galeristen stellen neue Weichen in der Pariser Kunstszene und präsentieren die Werke unentdeckter Talente.
Sie seufzte. Wenn Genusto doch nur ein wenig breiter aufgestellt wäre. Davon abgesehen, dass sie schon ewig nicht mehr in Paris war – wie gern würde sie sich diese Ausstellung ansehen und darüber berichten. In jüngerer Vergangenheit gab es in London und in New York ähnliche Veranstaltungen, bei denen sich Künstler wie Jefferson Newthorne oder Angela Winston einen Namen in der internationalen Kunstszene gemacht hatten. Wenn die Kunstmetropole Paris gleichzog, konnte dies der Beginn von etwas Großem sein, das über kurz oder lang auch Berlin erreichen würde.
Ihr Puls erhöhte sich, wenn sie nur darüber nachdachte. Die Entdeckung neuer französischer Talente – bei einem solchen Ereignis dufte sie keinesfalls fehlen. Doch da Genusto sich hauptsächlich mit Themen rund ums Essen befasste und die Rubrik Kultur und Lebensart nur lächerliche drei Doppelseiten in dem Food-Magazin einnahm, durfte sie kaum darauf hoffen, dass Hellwig ihr eine Dienstreise im Namen der Kunst finanzierte.
Natürlich konnte sie Urlaub einreichen und das Ganze zu ihrem Privatvergnügen machen, aber Presseausweis hin oder her: Ohne persönliche Einladung würde sie nicht mal in die Nähe des Grand Palais gelangen, wo die große Eröffnungsgala stattfand. Vielleicht sollte sie ihren Chef doch …
»Ich wusste gar nicht, dass du wasserscheu bist«, ertönte eine fröhliche Stimme über ihr, die ein paar eiskalte Wassertröpfchen mitbrachte, welche sich auf Claires Schenkeln und der Zeitschrift verteilten.
Claire verbiss sich ein spontanes Quieken. Eine grande dame kreischte nicht. In keiner Lebenslage. Schon gar nicht, wenn zwei leidlich gut aussehende junge Männer nebenan lagen und frech herübergrinsten. Also lupfte Claire bewusst gemächlich die Sonnenbrille.
»Ich bin nicht wasserscheu«, sagte sie gedehnt und bohrte den Blick in Sashas Bauch, der mehr wie der eines Kindes als der einer Frau aussah. »Aber du hast da was kleben. Etwas ziemlich … Ekliges, wenn du mich fragst.«
»Was? Wo?«
»Ouuu! Es krabbelt.«
»Claire! Das ist nicht witzig.«
»Doch, chérie, ist es.«
Kichernd packte Claire die Zeitschrift ein. Es war Zeit für den angenehmen Teil des Tages. Sie würde am Montag mit dem Chef über die Ausstellung in Paris sprechen und über einige andere Dinge, die ihr im Kopf herumspukten.
»Nun hör schon auf, dich zu drehen wie ein verrückter Kreisel. War bloß Spaß«, sagte sie milde, woraufhin Sasha schnaubend neben ihr in den Sand plumpste.
»Das war kein Spaß. Ich hab Angst vor Krabbelviechern.«
Die Versuchung, Sasha ein blondes, tropfendes Löckchen aus der Stirn zu streichen, war groß. Aber sosehr sie die Kleine mochte und sosehr es ihr gefiel, mit ihr ein paar unbeschwerte Stunden fernab der Redaktion zu verbringen, in erster Linie war Sasha ihre Praktikantin, auch wenn sie den Anstellungsvertrag bei Genusto so gut wie in der Tasche hatte.
»In was für eine Klemmmühle bin ich denn da schon wieder geraten? Nun schmoll nicht, ma petite.« Claire zwinkerte und senkte die Stimme. »Erklären wir lieber den garçons da drüben, wie die Franzosen hübschen Frauen Komplimente machen. Ich wette, ich bringe die Jungs dazu, uns zu einem Cocktail einzuladen.«
»Die Wette gilt. Du hast zehn Minuten.« Sasha hob eine Braue, ihr schmaler Mund zuckte. »Und es heißt Zwickmühle, Mademoiselle, nicht Klemmmühle.«
Am frühen Abend schob Claire ihr Fahrrad durch den efeubewachsenen Torbogen zum Hinterhaus der Ratiborstraße 15. Sie war schon ein paar hundert Meter vorher abgestiegen, denn der Gehweg war brüchig und mit Schlaglöchern übersät. Unter normalen Umständen stellte das Kreuzberger Pflaster keine große Herausforderung für ihre Fahrkünste dar, doch nach zwei Caipirinhas fühlte sie sich nicht mehr so sicher auf Iah. So hatte sie ihren Drahtesel einst getauft, weil er trotz Kettenschmiere und gutem Zureden nicht aufhören wollte zu quietschen. Aber wie das eben so ist mit Dingen, denen man einen Namen gibt: Claire liebte Iah heiß und innig, und das alte Klapprad dankte ihr die geflüsterten Koseworte, indem es sie seit Jahren unverdrossen durch die Hauptstadt trug.
Sie bugsierte Iah in den Fahrradschuppen zu seinen namenlosen Kollegen, tätschelte den Sattel und nahm die Einkaufstüten aus dem Korb.
Es war immer dasselbe Gefühl, das sie überfiel, wenn sie nach Hause kam: eine Mischung aus Nostalgie, angesichts der balkonlosen Fassade, die im Gegensatz zum schmucken Vorderhaus dringend einen Anstrich benötigte, und Staunen über die Topfpflanzenidylle des Hinterhofs mit den Sitzgelegenheiten aus umgedrehten Obstkisten. Kinder hatten mit Kreide ein Hüpfkästchenspiel auf das Pflaster gemalt, und als Claire in das Halbdunkel des Hausflurs schlüpfte, war sie außer Atem und lächelte vergnügt, obwohl beim letzten Sprung der Henkel ihrer Obsttüte gerissen war.
Im dritten Stock drückte sie zweimal kurz und einmal lang auf den blank geriebenen Messingknopf neben dem Klingelschild und wartete, bis sich die vertrauten Pantoffelschritte näherten. Jemand hustete.
»Wer ist da?«
»Frau Kaiser, ich bin’s. Claire Durant von oben. Ich bringe Ihnen etwas Obst.« Sie fischte einen Apfel aus der Tüte und hielt ihn vor den Türspion. »Sieht der nicht lecker aus? Na ja, eine kleine Druckstelle hat er wohl abbekommen, weil mir vorhin beim la marelle ein klitzekleines Malheur …«
Die Kette rasselte, die Tür öffnete sich.
»Sie brauchen nicht so zu schreien, Fräulein Durant. Ich bin alt, aber nicht taub.«
»Natürlich Madame. Entschuldigen Sie bitte.«
Frau Kaiser war so klein, dass sogar Claire auf sie hinabschauen konnte. Rein körperlich, versteht sich, denn die pensionierte Oberschullehrerin gehörte nicht zu den Menschen, auf die man herabsah. Dazu war sie viel zu furchteinflößend.
»Das ist jetzt schon das dritte Mal in zwei Wochen, dass Sie mir was vorbeibringen«, sagte sie vorwurfsvoll und beäugte die zerrissene Tüte über den Rand ihrer Hornbrille hinweg.
»Nun ja, Sie sind erkältet. Deshalb dachte ich mir, es schadet nicht, wenn Sie ein paar Vitamine bekommen.«
»Dachten Sie das.«
»Bien sûr, Madame.« Claire lächelte gewinnend. »Aber wenn Sie die Äpfel nicht wollen, nehme ich sie gerne wieder …«
»Nu stellen Sie sich mal nicht so an, junge Dame«, schnarrte Frau Kaiser und öffnete die Tür so weit, dass Claire einen Blick auf den verschlissenen Perserteppich im Flur erhaschte. Sogar bis hierhin stapelten sich Bücher auf dem Boden. »Kommen Sie schon rein, für eine Tasse Tee werden Sie ja wohl Zeit haben.«
Claire wusste nie, ob sie die Luft anhalten oder gierig einatmen sollte, wenn sie diese Wohnung betrat, die mehr mit einem Antiquariat gemein hatte als manch alteingesessene Buchhandlung. Die Raumaufteilung entsprach der ihrer eigenen Wohnung im Stockwerk darüber, neben Küche und Bad gab es zwei winzige Zimmer am Ende des schlauchförmigen Flurs. Die meisten Berliner Hinterhäuser waren früher so konzipiert worden, damit die Arbeiterfamilien Wand an Wand mit den Bürgerlichen im Vorderhaus leben konnten.
Fasziniert strich Claire über die Buchrücken in dem deckenhohen Regal, wie kleine Füße marschierten ihre Fingerkuppen über raues Leder und goldgeprägte Titel. Anders als ihre roch diese Wohnung nach Staub und vergilbtem Papier – und ein bisschen nach saurer Kohlsuppe. Frau Kaiser nahm ihr die Obsttüte ab und ging voraus in die Küche, wo sie jeden Apfel einzeln begutachtete, ehe sie sie mit den roten Backen nach vorne in eine Blechschale legte. Auf dem Herd pfiff ein Flötenkessel, daneben standen zwei Tassen bereit, als hätte Frau Kaiser mit einem Gast gerechnet.
»Wie trinkt ihr Franzosen euren Tee?«, fragte sie über die Schulter und hob den Kessel von der Platte.
»In Pariser Teesalons trinkt man ihn üblicherweise mit etwas Zitrone, aber machen Sie sich bitte keine Umstände. Ein Löffelchen Zucker genügt vollkommen.«
»Paris, hm?« Frau Kaiser schob mit dem Ellenbogen ein paar Bücher beiseite, stellte die Tontassen ab und setzte sich Claire gegenüber an den Tisch. »Wo genau kommen Sie her?«
Die schilfgrünen Augen hinter den dicken Brillengläsern schauten Claire so intensiv an, dass sie mit einem Mal auf der Hut war.
»Sie kennen Paris?«, entgegnete sie und spielte mit dem Teebeutelschild. Wie erwartet eine gute, teure Marke, obwohl die alte Frau nur von einer kleinen Witwenrente lebte.
»Ob ich Paris kenne, fragt sie.« Frau Kaiser lachte. Ein heiseres, keuchendes Lachen, das ein wenig wie das Bellen eines winzigen Hundes klang. »Ich war schon so oft dort, dass ich manchmal denke, ich kenne die Stadt besser als Kreuzberg. Das will was heißen, immerhin lebe ich hier, seit meine arme Mutter im Schlafzimmer nach der Geburtszange geschrien hat.« Sie erhob sich umständlich und watschelte in ihren Pantoffeln aus der Küche, um kurz darauf mit einigen Büchern zurückzukommen. »Ich hatte die besten Stadtführer, die man auf dem Trödel kaufen kann. Hemingway, Süskind, Camus, Simone de Beauvoir … Suchen Sie sich eins aus, die meisten Geschichten spielen in Paris.«
Claire blätterte in einem Buch mit dem schweren, griffigen Einband und war sonderbar gerührt. »Mein Vater hat Hemingway immer gern gelesen, aber diesen Roman kenne ich nicht.«
»Behalten Sie ihn. Gibt eh niemanden, dem ich das Buch vermachen kann.«
»Das kann ich nicht annehmen, Frau Kaiser.«
»Beleidigen Sie mich nicht, sonst muss ich Sie bitten, ihre hübschen Schneewittchenäpfel wieder mitzunehmen.«
Claire nickte langsam. »In Ordnung. Vielen Dank dafür.«
Sie tranken den Tee, und es war durchaus kein unangenehmes Schweigen, das unter der Hängelampe schwebte, bis Frau Kaiser erneut das Wort ergriff.
»Wissen Sie, Sie sehen gar nicht aus wie eine typische Pariserin.«
Beinahe hätte Claire sich verschluckt. Mit Sicherheit wäre sie auch rot geworden, hätte sie nicht gewusst, dass die Bemerkung vollkommen ins Blaue zielte. Zum Glück schien die alte Dame keine Antwort von ihr zu erwarten. Sie spazierte gerade mit einem abwesenden Lächeln durch ihr eigenes literarisches Montmartre, weshalb Claire die Gelegenheit nutzte und rasch ihren Tee austrank.
»Ich muss leider gehen, Madame. Mein Kater wartet auf mich, und wenn ich ihn nicht gleich füttere, wird mich das teuer zu stehen kommen. Beim nächsten Mal bringe ich Ihnen Erdbeeren mit, wenn Sie möchten.«
Frau Kaiser nickte verträumt, drehte den Kopf und sah zum Fenster hinaus, als hätte jemand die Basilika Sacré-Cœur in den Hinterhof versetzt – oder gleich den Eiffelturm.
Claire war schon fast an der Haustür angelangt, als die heisere Stimme aus der Küche ihr verdeutlichte, dass ihre Nachbarin durchaus noch mit den Gedanken in dieser buchseitenstaubigen Wohnung weilte.
»Auch wenn ich finde, dass Sie für Hüpfkästchenspiele schon ein bisschen zu alt sind, Sie sind ein gutes Kind, Fräulein Durant. Ihre Eltern müssen sehr stolz auf Sie sein.«
Für einen winzigen Moment schloss Claire die Augen. »Vielen Dank für das Buch, Frau Kaiser«, antwortete sie und hoffte inbrünstig, dass es fröhlich geklungen hatte.
Claire rannte die Stufen nach oben, genau fünfundzwanzig waren es, und tastete wenig später nach dem Lichtschalter neben dem Garderobenhaken. Etwas Weiches strich ihr um die Beine, kurz darauf brannte ein scharfer Schmerz in ihrer Wade, den sie eigentlich hätte kommen sehen müssen. Sie fluchte leise, weil ihr das Buch entglitten und auf die Dielen gepoltert war. Wie ein pfeilschneller Schatten flüchtete der Angreifer durch den Flur und verschwand durch die angelehnte Küchentür.
»Du brauchst dich gar nicht zu verstecken, Sarkozy! Ich weiß, dass du das warst«, rief sie ihm hinterher, teils verärgert, teils belustigt.
Dieser Kater war eine Primadonna, das wusste vor allem die bedauernswerte Nachbarschaft, die er regelmäßig zusammenschrie, wenn seine Mitbewohnerin mal wieder später von der Arbeit kam. Dass er sich neuerdings für einen schwarzen Panther hielt, machte das Zusammenleben mit ihm nicht leichter. Kopfschüttelnd hängte Claire die Badetasche an die Garderobe, schlüpfte aus den Slingpumps und bückte sich nach dem Buch. Mit Bedauern erkannte sie, dass der Buchrücken beim Sturz gebrochen war. Um Sarkozy eins auszuwischen, ließ sie die Einkaufstüte liegen und schlenderte an der Küche vorbei ins Schlafzimmer.
Eine Weile stand sie unschlüssig vor dem ungemachten Bett, dann gab sie sich einen Ruck und öffnete den Spiegelschrank, der sie mit dem Geruch von Secondhand-Klamotten und, etwas unterschwelliger, dem ihres eigenen Parfums empfing. Die Kleiderstange trug schwer an ihrer Last und bog sich wie der Rücken einer alten Stute.
Automatisch strich sie über den Kragen der dunkelblauen Fleecejacke, die sie ganz rechts einsortiert hatte, bei den Kleidungsstücken, die sie selten oder nie trug. Immer wieder misslang es ihr, der Versuchung zu widerstehen, und jedes Mal, wenn ihre Fingerspitzen Jans Trainingsjacke berührten, fragte sie sich, wieso sie das verwaschene Teil nicht längst in den Altkleidercontainer geworfen hatte. Er würde es sowieso nicht abholen.
Claire musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um das Hutablagefach zu erreichen. Während in der Küche ein lang gezogenes Maunzen davon kündete, dass Sarkozy mit seiner Katzengeduld am Ende war, schob sie das Buch unter die Schuhe, die in bunten Schachteln auf besondere Gelegenheiten warteten, die nie kamen.
Etwas klirrte, wahrscheinlich die gelb gepunktete Café-au-lait-Schale vom Morgen, die zweite, die in diesem Monat zu Bruch ging. Claire schloss den Schrank und spürte den leisen Anflug eines schlechten Gewissens, das in ihrer Brust kratzte und flatterte wie ein eingesperrter Vogel. Wie hätte sie ihrer alten Nachbarin denn nur erklären sollen, dass dieses Buch – oder vielmehr das, was sie damit verband – zu einem Leben gehörte, an das sie sich nicht erinnern wollte?
Noch nicht.
Vielleicht nie.
GWENAELLE
Valérie Aubert lebte allein, hatte keine Kinder, und ihre Lieblingsfarbe war Schwarz. Zu dieser Erkenntnis kam Gwenaelle an ihrem vierten Tag in Paris, das sie zu diesem Zeitpunkt nur durch das Fenster einer fremden Wohnung gesehen hatte.
Dabei war Schwarz eigentlich gar keine Farbe, wie ihr Kunstlehrer einmal behauptet hatte. Gwenaelle wusste es jetzt besser. Es hatte Nuancen, ein physikalisches Gewicht und sogar eine eigene Sprache. Es konnte blau glänzen wie die Rabenfeder an Valéries Hut oder seidig braun wie der Goldschnallengürtel, der aussah, als würde er jeden Moment an den Hüften ihrer Tante herunterrutschen. Schwarz konnte laut sein wie Absatzschuhe auf Küchenfliesen oder leise wie das Geräusch, das entstand, wenn Valérie ihren Rock glatt strich. Es vermochte Gefühle hervorzurufen, sogar bei Maman, die stirnrunzelnd Valéries Strumpfnaht betrachtete, die sich an die schlanken Waden ihrer Schwester schmiegte. Vor allem aber brachte es alle anderen Farben zum Strahlen. Einen roten Mund, ein nachlässig um die Schultern geworfenes türkisgrünes Tuch, eine bunte Glasbrosche, die im Sonnenlicht funkelte. All das war das Geheimnis von Valéries Schwarz – und es machte sie unwiderstehlich.
Ob es ihrer Tante auffiel, dass Gwenaelle sie praktisch observierte, ließ sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht ignorierte Valérie verstohlene Blicke aus Gewohnheit oder war zu höflich für eine ungeduldige Bemerkung. Sie schien ein Mensch zu sein, der sehr vieles ignorierte. Etwa das selbstvergessene Grunzen von Maelys, wenn sie wie ein Äffchen auf dem Teppich hockte und einen Malblock nach dem anderen mit den Wasserfarben vollkleckste, die Valérie ihr geschenkt hatte. Ebenso Gwenaelles mürrisches Kopfschütteln, wenn sie die Himbeertörtchen aus der Patisserie um die Ecke probieren sollte, für die sie in ihrem ersten Leben vermutlich gemordet hätte. Das unentwegte Plärren des Fernsehers, wenn Maman sich eine Kochsendung nach der anderen ansah, den Blick auf die gelb gestrichene Wand dahinter gerichtet.
Es war Gwenaelle unheimlich, mit anzusehen, was mit Maman geschah. Schon vor Paris war sie nur noch ein Schatten jener Frau gewesen, die einmal ihre Mutter war: fröhlich, geduldig und stets um ein liebevolles Wort reicher als alle anderen. Zuerst war ihr Gesicht grau geworden und danach die Haare, die sie seit jenem furchtbaren Tag nie wieder offen getragen hatte. Irgendwie hatte Maman trotzdem funktioniert, obwohl ihre Haltung etwas von Patapoufdem Stoffhasenhatte, der zu Hause auf Maelys’ Bett saß und auf ihre Rückkehr wartete. Erst als sie sich mit krummem Rücken in die Umarmung ihrer Schwester sinken ließ, hatte Maman zum ersten Mal geweint. Seitdem schien es ihr unmöglich, aufrecht zu stehen.
Und Valérie? Valérie wartete. Geduldig und beharrlich, seit nunmehr sechsundneunzig Stunden. Nur zum Einkaufen verließ sie die Wohnung oder um die Le Monde vom Zeitungskiosk zu holen. Zum Mittagessen machte sie Salat, und am Abend kochte sie dreigängige Menüs, in denen ihre Gäste lustlos herumstocherten. Ihr rot geschminkter Mund stand fast nie still, sie plauderte über das herrliche Sommerwetter oder eine Ausstellung in irgendeiner Galerie, deren Namen Gwenaelle sofort wieder vergaß. Sie putzte, bügelte und räumte die Schulbücher auf, die Gwenaelle wütend in die Ecke geworfen hatte, trällerte Chansons im Radio mit und machte Unsinn mit Maelys, der sie als Einzige mit ihren kindischen Grimassen ein Lächeln entlockte.
Dann saß sie wieder stundenlang in dem Ohrensessel neben dem kalten Ofen, barfuß, ein Buch auf den angewinkelten Knien. Oft starrte sie nur aus dem Fenster, das Kinn in die Hände gestützt, wie eine Patientin, die im Wartezimmer eines Arztes ausharrt, bis sie an der Reihe ist.
Insgeheim bewunderte Gwenaelle sie für ihre Ausdauer, zumal sie ihren eigenen trotzigen Willen in ihrer Tante wiedererkannte, aber eines konnte selbst eine Valérie Aubert trotz der heimlich im Badezimmer gerauchten Zigaretten nicht mehr lange ignorieren: Die Dachgeschosswohnung in der Rue Martel 1 war viel zu eng für vier Personen. Vor allem, wenn drei davon nicht dazu zu bewegen waren, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Allein deshalb kamen Gwenaelle die zäh dahinfließenden Pariser Hochsommertage endlos lang vor, doch sie waren nichts gegen die Nächte, in denen sie nach Hause zurückkehrte.
Sie fuhr stets abrupt und mit weit aufgerissenen Augen aus ihren Träumen auf, auf der Brust einen Stein, der sich keinen Millimeter bewegen ließ. Dann faltete sie sich wie ein Klappmesser zusammen und atmete durch den Mund, weil ihr Herz wehtat und ihr von dem stechenden Lavendelgeruch der Bettwäsche übel war.
Wenn Maelys spürte, dass sie wach war, krabbelte sie zu ihr auf das viel zu schmale Sofa und kuschelte sich in ihre Armbeuge. Mit ihren Puppenhänden umschloss sie Gwenaelles Gesicht und pustete ihr gegen die Stirn, als hätte sie dort einen Kratzer, der schnell heilen sollte. Ein Trost, der nach Orangenshampoo und süßlichem Kinderschweiß roch und so lange hielt, bis Maelys in ihren Armen eingeschlummert war und Gwenaelle mit der Nacht allein ließ. Den Atemzügen von ihrer Schwester und Maman lauschend, die sich im Schlaf hin und her wälzte, versuchte sie sich an den guten, den glücklichen Erinnerungen von zu Hause, um dann doch nur mit schlechtem Gewissen an Luik oder Nicolas zu denken. Ihren lieben, sanften Freund Nicolas.
Sie hatte ihm versprochen, den Sommer über in der Fischhalle zu helfen, beim Entladen der Kutter, beim Kistenschleppen. Dass die Jungs sie überhaupt gefragt hatten, war etwas Besonderes, weil sie am Hafen eigentlich keine Mädchen gebrauchen konnten. Das war, bevor Maman ihr eröffnet hatte, dass sie die Ferien bei Tante Valérie in Paris verbringen würden.
Gwenaelle hatte nicht erwartet, dass allein die nächtlichen Geräusche der Stadt einen so viel stärkeren Sog auf sie ausüben würden als die verwaschenen Erinnerungen aus Sand, Schlick und Felsen. Zu Hause fühlte sich auf einmal weit weg an, und es war so still dort, während hier sogar die Nacht einen Herzschlag hatte. Auf der Straße knatterten Motorroller vorbei, Musik und Stimmengewirr flatterten bis weit nach Mitternacht durch das geöffnete Fenster herein. Sie stellte sich vor, wie die Leute unten vor dem Bistro saßen, sommerelegant gekleidete Pariser mit entspannten Gesichtern und weinschweren Zungen – die letzten Gäste, die sich kaum daran störten, dass der patron bereits die unbesetzten Tische und Stühle auf dem Bürgersteig zusammenklappte.
Die Standuhr im Wohnzimmer tickte überlaut, das Silberpendel schimmerte im Mondlicht. Valérie kehrte stets pünktlich zehn Minuten nach zwei von ihren nächtlichen Ausflügen zurück, über die keiner je ein Wort verlor. Vielleicht war Gwenaelle die Einzige, die davon wusste. Normalerweise drehte sie sich zur Wand um, sobald sie das Türschloss klicken hörte, das Klappern, wenn Valérie den Schlüssel in die Glasschale legte, und das Tapsen ihrer nackten Sohlen, ehe sich die Schlafzimmertür hinter ihr schloss.
Heute blieb Gwenaelle, wo sie war, das Gesicht dem erleuchteten Flur zugewandt. Valérie hielt inne, die Absatzschuhe in der Hand – ein krummer Scherenschnitt im Türrahmen. Obwohl ihr Flüstern verloren ging wie eine Handvoll Glitter, den man in die Luft wirft, konnte Gwenaelle die Worte ihrer Tante fühlen. Sie waren freundlich und kratzten ein bisschen, als ob eine raue Spülhand ihr Gesicht streichelte.
Neugierig beobachtete sie, wie Valérie einen Gegenstand aus dem Regal im Flur zog und auf die Türschwelle legte, ehe sie lautlos verschwand, geschmeidig wie eine schwarze Katze. Gwenaelle zählte. Bei achtundachtzig erlosch der Lichtstreifen unter der Schlafzimmertür. Erst bei hundertzwanzig schlüpfte sie unter der Bettdecke hervor, schnappte sich das Buch und huschte zurück aufs Sofa. Um im Mondlicht den Titel lesen zu können, musste sie den schweren Band hoch über den Kopf halten.
Spaziergang durch Paris. Ein Reiseführer.
Sie ließ das Buch auf die Brust sinken und starrte zur Zimmerdecke empor, ihre Armmuskeln kribbelten, und ihr Herz klopfte lauter als normal. Von unten drangen das Klackern von Frauenabsätzen und Gelächter herauf, Glas zersprang auf dem Asphalt. Irgendwo heulte ein Motor auf, ein Hund bellte.
Das war also Paris. Die Stadt der Blau- und Lilatöne, der Kunst und der Mode. Und der Liebe.
Gwenaelle schauderte, als ein Gefühl der Zuversicht in ihr aufstieg, obwohl es eigentlich keinen Anlass dafür gab. Doch aus irgendeinem Grund wusste sie plötzlich, dass es bald schon keine Nächte mehr geben würde, in denen sie im Traum ertrank.
Alles würde gut werden.
Zwei
CLAIRE
Die Drehtür, die aus der Sommerhitze in das kühle Innere des Verlagshauses Hebbel + Foch führte, war seit Wochen defekt, weshalb Claire den Seiteneingang nahm. Weil sie ewig mit dem verrosteten Fahrradschloss von Iah gekämpft hatte, musste sie rennen, um die akademische Viertelstunde einzuhalten, innerhalb der Hellwig eine Verspätung seiner Mitarbeiter tolerierte. Eigentlich hätte sie sofort die Treppe ansteuern müssen, trotzdem ging sie zielstrebig zum Empfangspult, hinter dem sie die blonde Dauerwelle von Frau Rose erspähte.
»Bon jour, Barbara«, rief sie fröhlich. »Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende.«
Die Empfangssekretärin hatte ein teigiges Gesicht mit schlechter Haut und missmutige Augen, die selten wohlwollend auf ihre Mitmenschen gerichtet waren. Claire lächelte breiter und beugte sich über das Pult. Barbara trug ein zuckriges Parfum mit einer seifigen Note, die typisch für ein preisgünstiges Drogeriemarktprodukt war.
»Du hast heute eine sehr hübsche Bluse an, ma chère.«
»Und du hast wohl mal wieder verschlafen, meine Liebe«, sagte Frau Rose mit unbewegter Miene. Nur der faltige Mund zuckte verräterisch.
Claire mochte solche Menschen, die sie verres d’eau– Wassergläser nannte. Außen hart, innen flüssig und durchschaubar, was es leicht machte, sie für sich zu gewinnen.
»Du hast recht«. Claire schielte auf die Katzenbrosche, die an Frau Roses Blusenausschnitt steckte. »Sarkozy hat mich die halbe Nacht wach gehalten, und ich habe es mal wieder nicht übers Herz gebracht, ihn aus dem Bett zu werfen.«
Barbaras Gesichtszüge wurden sofort weich. »Das kenne ich«, seufzte sie und setzte den Kopfhörer ab. »Aber so lieb dein Kater ist, du darfst ihm nicht alles durchgehen lassen.«
Claire dachte an ihre zerbrochenen Lieblingsschalen und den daumenlangen Kratzer an ihrer Wade, weshalb sie im Hochsommer eine Hose trug. Lieb war nicht unbedingt die Vokabel, die ihr zu Sarkozy einfiel.
»Vielleicht kannst du mir ja mal einen Rat geben, was das angeht. So von Fachfrau zu ahnungsloser Anfängerin.«
»Natürlich, meine Gute.« Barbara lächelte geschmeichelt.
Hab ich dich, dachte Claire und wandte sich nach einem geflüsterten »Merci, hab einen schönen Tag, ma chère« endlich der Wendeltreppe in die oberen Etagen zu.
Sie hatte den ersten Stock kaum erreicht, als hinter ihr eine affektierte Stimme erklang.
»So von Fachfrau zu Anfängerin …«, deklamierte Sasha, rollte mit den Augen und hüpfte an ihr vorbei, obwohl sie eine Druckerpapierkiste trug, die ziemlich schwer aussah.
Dieses verrückte Mädchen hüpfte ständig, selbst in Situationen, in denen andere Menschen gar nicht auf die Idee kämen – geschweige denn, dass sie es könnten.
»Du hast gelauscht. Das ist kein gutes Benehmen.«
»Und du hast dich eingeschleimt. Das ist viel schlimmer.«
»Ich habe mich nicht einge…« Claire verzog das Gesicht. »Was soll das überhaupt sein, dieses fürchterliche Wort?«
»Du bist der ollen Schreckschraube in den Hintern gekrochen. Hast dich lieb Kind gemacht, angebiedert, eingeschmeichelt … Suchs dir aus, es gibt viele Ausdrücke dafür.«
»Sasha, du hast keine Ahnung. Ich war bloß nett zu ihr, und dafür ist sie nett zu mir.«
»Ah.« Sasha spitzte ihren rosafarbenen Mund. »Vermutlich wieder so ein Franzosen-Dings.«
»Nein, das nennt sich Charme«, antwortete Claire trocken. »Ein bisschen mehr davon täte deinem Deutschen-Dings ganz gut.«
»Touché, mademoiselle.« Sasha stellte die Kiste ab und hielt ihr mit einem frechen Grinsen die Glastür auf, auf der in geschwungenen Lettern Genusto – Ressort Essen & Lebensart prangte.
Wie immer bemühte sich Claire, nicht auf die leere Stelle zu schauen, wo noch im letzten Jahr der Name ihrer Lieblingskollegin geklebt hatte. Obwohl sie nur kurz befreundet gewesen waren, vermisste sie Hanna noch immer, die mittlerweile glücklich verheiratet in Italien lebte. Zwar spielte Claire ständig mit dem Gedanken, ihre Freundin zu besuchen, aber bisher war jeder Versuch gescheitert, weil sie entweder keinen Urlaub bekam oder sich niemand fand, der sich um ihren durchgeknallten Stubentiger kümmerte.
»Was ist, Mademoiselle Durant? Hoppelahopp, wie du immer so schön sagst, rein mit deinem unvergleichlichen Pariser Charme. Den können wir heute gut gebrauchen, der Chef hat hohen Besuch. Ich sag dir, diese Vorstandsmitglieder sehen irgendwie alle gleich aus. Reich, selbstzufrieden und wichtig. Zwei Keksschachteln haben sie schon verputzt und Kaffee trinken sie wie ausgedörrte Kamele auf ’ner Wüstenwander…«
»Der Vorstand ist hier?« Claire spürte, wie sich jede Faser ihres Körpers anspannte, während sie nebeneinander durch den Flur gingen, Claire mit klappernden Absätzen, Sasha mit quietschenden Turnschuhen. »Weißt du, warum?«
»Ich würde sagen, zum Kaffeetrinken.« Sasha schnalzte abschätzig und bog zum Lagerraum ab.
Claire hatte eigentlich nicht vor der Glasfront des Besprechungsraums stehen bleiben wollen, aber die Jalousie war heruntergelassen – ein untrügliches Zeichen dafür, dass dort etwas Wichtiges vor sich ging. Stimmengemurmel drang heraus, hier und da untermalt von Frauengelächter. Sogar Zigarettenqualm roch sie, dabei hatte der Chef das Rauchen im gesamten Gebäude strikt untersagt. Zögernd trat sie näher an die Scheibe heran. Wenn sie sich bückte, konnte sie zwischen den Lamellen der Jalousie hindurchspähen.
Sebastian Hellwig schlenderte am Kopfende des Konferenztisches hin und her, die Hände in den Taschen der Leinenhose vergraben, den Blick auf seine Zuhörer gerichtet. Drei Männer, eine Frau. Sie war nicht mehr jung, aber attraktiv, obwohl sie zu stark geschminkt war. Im Gegensatz zu den Herren, deren Anzugärmel förmlich auf der Tischplatte klebten, wippte sie mit übereinandergeschlagenen Beinen auf dem Schwingstuhl und strich sich fortwährend den rot gefärbten Bob aus der Stirn, während sie Hellwig unter schweren Wimpern hervor musterte. Sie sah aus wie eine Hyäne, die ihr Mittagessen begutachtete, und so sehr Claire gegen das spontane Gefühl ankämpfte – sie mochte diese Frau nicht.
Hellwig kam zum Ende. Ein Lächeln huschte über sein kantiges Gesicht, als die Frau ihm applaudierte und die Männer pflichtbewusst einstimmten. Er setzte die Brille ab und nahm Platz, nicht am Kopfende, wo er sonst immer saß, sondern an der Längsseite des Konferenztisches.
»Gehört Herumspionieren auch zum berühmten französischen Charme, oder hab ich da was verwechselt?«, wisperte jemand Claire ins Ohr.
»Mon Dieu, Sasha! Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht immer anschleichen wie ein Fredchen auf Mäusejagd?«, schimpfte Claire und versuchte, nicht rot zu werden.
»Frettchen.« Sasha kniff die Augen zusammen.
»Pardon?«
»Das Tier heißt Frettchen«, wiederholte Sasha, blickte zum Konferenzraum hinüber und hob eine Braue. »Mir scheint allerdings, hier ist wer anders auf der Pirsch.«
»Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal deine Arbeit erledigst?« Claire pikste in den Katalogpacken in Sashas Armen, die aussahen, als würden sie unter dem Gewicht jeden Moment auseinanderknicken wie trockene Äste. »Geh die Post verteilen und spaziere nicht auf meinen Nerven herum.«
»Zu Befehl, Madame général.« Sasha feixte und legte der verblüfften Claire die Kataloge in den Arm.
»Was soll das denn jetzt?«
»Das ist deine Post.« Ihre Praktikantin drehte sich um und flüchtete in die Belegschaftsküche, nicht ohne ein schadenfrohes »Damit wären wir quitt« auf dem Flur zurückzulassen.
Zunächst war Claire versucht, ihr die passende Antwort hinterherzurufen, doch sie überlegte es sich anders und steuerte ihr Büro an. Davon abgesehen, dass sie grundsätzlich und niemals die Contenance verlor – das war etwas für stille Abende mit Sarkozy und einer Flasche Crémant –, stand ihr nicht der Sinn danach, Sasha gegenüber die Vorgesetzte zu mimen. Wo das Mädchen recht hatte, da hatte es recht. Sie hatte spioniert, obwohl sie es nur ungern zugab.
GWENAELLE
Valérie Auberts Geduldsfaden riss an einem Montagmorgen, zehn Tage, nachdem sie in Paris angekommen waren. Gwenaelle hatte den Knall kommen sehen, schon als ihre Tante die Brauen zusammenzog und ausholte. Die Tasse donnerte auf die Küchenanrichte, wo Valérie im Stehen frühstückte, meist ein Stück Baguette vom Vortag, das sie in ihren café crème stippte. Trotzdem fuhr Gwenaelle zusammen, als hätte ihre Tante einen Colt gezückt und damit ein Loch in die Decke geschossen. Ein sehr großes Loch.
»Bon sang, Yvonne«, sagte Valérie schmallippig und ihre Augen funkelten angriffslustig.
Sie ist sogar schön, wenn sie wütend ist, dachte Gwenaelle und sah zu Maman hinüber, die wie eine Wachsfigur auf dem Stuhl saß, lieblos hingegossen von wem auch immer und dann vergessen. Maman hob den Kopf und blinzelte. Valérie hatte die Hände in die Hüften gestemmt, ihr linker Schuh und die Hutfeder wippten im Takt. Sie wirkte wie eine ulkige Zeichentrickfigur und Gwenaelle hätte wahrscheinlich gelacht, wenn ihre Tante nicht so bitterernst geschaut hätte.
»Armel ist tot. Das ist furchtbar, wirklich furchtbar. Aber er wird nicht wieder lebendig, wenn du mit ihm stirbst. Also reiß dich gefälligst zusammen und kümmere dich um deine Töchter.« Valéries Worte durchschnitten die Luft wie ein Peitschenhieb.
Gwenaelles Brust zog sich zusammen. Tot. Es war das erste Mal, dass jemand dieses Wort in den Mund nahm, seit …
Maelys, die nichts von Valéries Ausbruch bemerkt hatte, riss ein Blatt aus dem Malblock und murmelte vor sich hin. Obwohl es Gwenaelle nicht sonderlich interessierte, was ihre kleine Schwester da malte, eines war nicht zu übersehen: Sie geizte nicht mit Farbe, die mittlerweile auch Valéries cremefarbenen Teppich zierte.
Tot.
Noch während Maelys auf allen vieren zu der Mappe krabbelte, in der sie gleich sorgsam ihr neues Werk verstauen würde, empfand Gwenaelle plötzlich das heftige Verlangen, taub zu sein. Wie ihre Schwester.
Valérie stand so dicht vor Maman, dass sich ihre Knie fast berührten, und streckte die Hand aus. »Versuch es doch wenigstens.«
Sie hatte schlanke, gepflegte Finger mit weißen Halbmonden an den Nagelspitzen. Unwillkürlich verbarg Gwenaelle ihre eigenen abgeknabberten Nägel hinter dem Rücken, während Mamans Blick im Raum umherirrte. Er verhedderte sich in Maelys’ dunkelbraunen Locken, die ihren Kindernacken noch zarter aussehen ließen, als er ohnehin schon war. Sie saß noch immer auf dem Boden, nestelte an der Bildermappe herum, wobei sie grunzte und schmatzte, wie eins der Ferkel von Monsieur Gourriérec, wenn es nach Futter suchte. Drei Versuche brauchte sie, bis es ihr gelang, das rote Band, das die Mappe zusammenhielt, zu einer Schleife zu binden. Das war typisch für Maelys. Alles musste stets aufgeräumt und an seinem Platz sein.
Mamans Brust wölbte sich, auf Valéries Arm gestützt torkelte sie auf die Füße und suchte mit den Augen nach Gwenaelle, die instinktiv die Arme verschränkte. Gleich würde sie kommen, die Ermahnung, sie solle die Nase besser in die Schulbücher stecken, die unangetastet in der Wohnung verteilt lagen. Monatelang dieselbe Leier, weinerlich und anklagend, weil ihre Leistungen nicht mehr dem entsprachen, was ihre Lehrer von der Klassenbesten erwarteten.
Das konnte Maman getrost vergessen. Gwenaelle wollte nicht lernen. Nicht mehr. Sie wusste längst genug über das Leben und über das Sterben – besonders über das Sterben. Außerdem gab es niemanden mehr, dessen Gesicht vor Stolz leuchtete, wenn sie gute Noten mit nach Hause brachte. Wozu also die Mühe?
Wider Erwarten sagte Maman nichts, sondern wandte sich an Valérie. »Ich glaube, etwas frische Luft wäre eine gute Idee.«
Gwenaelle sah überrascht auf, weil Maman so normal geklungen hatte. Ihre Mutter nickte Valérie zu und ging ins Bad, steif und schwerfällig, wie jemand, der tagelang im Bett gelegen hatte.
Valérie lehnte jetzt an der Spüle, die Beine elegant gekreuzt. Die marokkanische Holzperlenkette baumelte vor ihrem Bauch, während sie an dem erkalteten café crème nippte und Maelys bei dem gut gemeinten Versuch beobachtete, mit dem Spüllappen einen handtellergroßen blauen Farbklecks aus dem Teppich zu schrubben.
»Manchmal kann uns eine gut platzierte Ohrfeige tatsächlich ins Leben zurückholen«, sagte sie an Gwenaelle gewandt und musterte anschließend mit einer gewissen Abscheu den Inhalt ihrer Tasse. »Notfalls tut es aber auch ein Schluck kalter Kaffee mit Bodensatz.«
Mit der Metro fuhren sie in das berühmte Quartier Latin, das völlig anders war als in Valéries Reiseführer beschrieben. Natürlich hatte Gwenaelle ihn gelesen. Zweimal, im Mondlicht oder in der Morgendämmerung, die gegen vier Uhr ein lilafarbenes Seidentuch über die Dächer des 10. Arrondissements breitete.
Zunächst war sie misstrauisch gewesen. Welcher junge Mensch las schon freiwillig einen Reiseführer, noch dazu über eine Stadt, die er sich nicht ausgesucht hatte? Letztendlich war es der Autor selbst, der Verständnis für Gwenaelles Vorbehalte zeigte und sie mit lustigen Geschichten und Bleistiftzeichnungen durch ein Paris führte, das sie neugierig machte. Umso enttäuschter war sie, als ihre Tante sie bei ihrem ersten Ausflug ausgerechnet in die Moschee an der Place du Puits-de-l’Ermite führte.
Hier spürte sie nichts von dem authentischen Pariser Straßenflair, von dem der Autor in dem Buch schwärmte. Weder gab es ausgefallene Klamottenläden noch waren sie auf dem kurzen Weg von der Metrostation hierher an irgendeinem Wein- oder Käseladen vorbeigekommen. Keine Männer mit Schirmmützen und Baguettes unter dem Arm, keine berühmte Schauspielerin, die ihr Hündchen Gassi führte. Kein buntes Markttreiben unter roten Markisen ließ ihr Herz höher schlagen, keine Geigen- oder Akkordeonmusik wehte durch die Gassen, und nirgendwo hielt ein verliebtes Pärchen an einem Bistrotisch Händchen.
Gwenaelle beschlich das Gefühl, dass Valérie sie absichtlich durch all die unscheinbaren Häuserlücken hierher geschleust hatte, aus Rücksicht auf Maman oder Maelys, die manchmal Angst bekam, wenn sich zu viele Menschen an einem Ort zusammendrängten – oder warum auch immer. Jedenfalls fühlte sie sich betrogen. Erst schenkte Valérie ihr dieses Buch, und nun hockten sie in einem langweiligen, schattigen Innenhof mit lauter leeren Mosaiktischen und spielten Tausendundeine Nacht.
Valérie legte den Kopf in den Nacken und ließ eine schnurgerade Rauchfahne in das Blätterdach der Bäume aufsteigen. Feigenbäume, hatte sie Gwenaelle erklärt, die es gar nicht wissen wollte.
»Was ist mit deiner Schwester?«, fragte Valérie einen besonders ausladenden Baum, der es ihr offenbar nicht übel nahm, dass sie ihn mit ihren Gitanes einräucherte.
»Was soll mit ihr sein?«, brummte Gwenaelle. »Sie ist taub.«
»Aber stumm ist sie nicht, oder? Ich erinnere mich an eine nervtötende Vierjährige, die unentwegt geschnattert und wild gestikuliert hat.« Valérie wies mit dem Kinn zum Brunnen hinüber, wo Maelys einige Blütenblätter schwimmen ließ, die sie aus den Rosenstöcken am Gittertor gerupft hatte. »Das da ist ein stummer Fisch, kein gehörloses Kind.«
Gwenaelle ließ sich nicht anmerken, dass sie überrascht war, weil Valérie Maelys noch so gut in Erinnerung hatte. Sogar sie selbst, die wesentlich älter war, erinnerte sich nur dunkel an die wenigen, meist kurzen Besuche ihrer Tante. Maman hatte einmal erzählt, Valérie sei sehr jung gewesen, als sie die Bretagne verließ, um einen reichen Pariser Playboy zu heiraten, der sie wie befürchtet sitzengelassen hatte.
Gwenaelle bezweifelte mittlerweile, dass diese Geschichte stimmte. Valérie sah nicht aus wie sitzengelassen, auch wenn sie keinerlei Vorstellung davon besaß, wie eine solche Frau auszusehen hatte. Statt zu antworten, rührte Gwenaelle zwischen den Minzeblättern herum, die wie Algen in ihrem Tee schwammen. Die Flüssigkeit war ganz trüb, weil sie versehentlich zu viel Honig hineingetan hatte, dabei war ihr Mund schon klebrig genug von den süßen pâtisseries, die angebissen auf ihrem Teller lagen.
Von Maman war keine Hilfe zu erhoffen. Sie war schon vor einer Viertelstunde mit ihrem Schminktäschchen auf die Toilette verschwunden und bisher nicht zurückgekommen.
Leider schien Valérie immer noch auf eine Reaktion zu warten. Sie war hartnäckig, vor allem wenn es um Dinge ging, über die normale Erwachsene nicht mit Kindern redeten. Aber Gwenaelle wusste ja, dass Valérie alles andere als eine normale Erwachsene war. Schon wie sie dasaß in ihrem Hosenanzug, die riesige Sonnenbrille auf der Nase und die Handgelenke voller klimpernder Armreife. Sie benahm sich wie ein Filmstar, der in einem Palais wohnte, nicht in einer Dachgeschosswohnung über einem billigen Bistro in einem ebenso billigen Viertel. Trotzdem ertappte Gwenaelle sich bei dem Gedanken, dass sie gern ein bisschen wie Valérie wäre.
»Sie hat eben irgendwann aufgehört zu reden«, antwortete Gwenaelle unwillig und zuckte mit den Schultern.
Maelys hatte inzwischen die Lackschuhe und Söckchen ausgezogen, war auf den Brunnenrand geklettert und planschte vergnügt mit den Füßen im Wasser. Das war bestimmt verboten, aber wen kümmerte das schon. Gwenaelle war es leid, ständig den Babysitter zu spielen.
»Hat sie damit aufgehört, bevor oder nachdem euer Vater gestorben ist?«
Sie starrte ihre Tante an und wusste nicht, ob sie entsetzt, wütend oder einfach nur erstaunt sein sollte. Valérie sprach über das Sterben, als plauderte sie über das Wetter. Dabei wirkte sie nicht im Geringsten beschämt oder verkrampft, nur interessiert.
Vor dem Sturm oder nach dem Regen?
»Ist doch egal«, murmelte Gwenaelle und schob den Teller beiseite.
»Du solltest das aufessen, es ist gut für die Seele.«
»Woher willst du wissen, was gut für meine Seele ist? Du kennst mich ja kaum.«
»Savoir-vivre, petite Gwen.« Valérie beugte sich vor. »Ich lade dich ein, du isst, so lautet die Pariser Regel, dafür muss ich dich nicht kennen. Ein bisschen Zucker hat noch niemandem geschadet, außer du stopfst dir das Zeug täglich rein. Dann geht es auf die Hüften.« Sie tippte sich seitlich an den Bauch, wo außer der Wölbung ihres Hüftknochens nicht viel zu sehen war.
»Ich heiße Gwen-a-elle, nicht Gwen«, murrte Gwenaelle und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie tat das ziemlich oft in letzter Zeit, das wusste sie. »Außerdem weiß ich gar nicht, was wir hier sollen. Ich dachte, du zeigst uns Paris. Das hier ist …« Gwenaelle machte eine abschätzige Geste, die nicht nur den Innenhof des Moschee-Cafés, sondern gleich die ganze Stadt einschloss.
Valérie lächelte geheimnisvoll und legte einen Finger auf die roten Lippen, denn Maman kehrte gerade zurück.
»Oh, das hier ist Paris«, flüsterte sie. »Das und noch viel mehr, ma belle. Je mehr du davon siehst, desto mehr wird es mit dir machen.«
CLAIRE
In ihrem Büro angekommen, legte Claire den Postpacken auf den Schreibtisch, auf dem noch allerhand unerledigte Arbeit von gestern lag. So war es eigentlich immer. Seit Hanna nicht mehr da war, kam sie kaum hinterher, obwohl Sasha mittlerweile ganz passable Artikel schrieb.
Während der Rechner hochfuhr, begann sie die Post vorzusortieren. Die Tageszeitungen nach links, die Verlagsprogramme, Reisekataloge und Einrichtungsmagazine nach rechts. In die Mitte die Portfolios der PR-Agenturen und die diversen Einladungen zu Presseterminen. Eine Tabakmanufaktur veranstaltete einen Tag der offenen Tür, die Eisfabrik lud zu einer Street-Art-Tour ein, und der Winzer aus dem Rheingau, den sie letzte Woche telefonisch interviewt hatte, schickte endlich seinen Hausprospekt.
Claire öffnete das E-Mail-Postfach und stöhnte. Fast einhundertfünfzig neue Nachrichten. Der arme Sarkozy – das sah nach einem langen Arbeitstag aus. Bedauernd dachte sie an das Kunstmagazin in ihrer Handtasche und nahm das erste Kuvert vom Stapel mit den Broschüren. Es half nichts, irgendwo musste sie schließlich anfangen. Sie würde sich einfach von rechts nach links vorarbeiten.
Simone vom Reisebüro am Wittenbergplatz schickte ihr einen Sonderkatalog mit kulinarischen Reiseangeboten, denen Claire stets besondere Aufmerksamkeit widmete. Das Team von Simone war klein und bestand laut Sasha aus einem Haufen Spinner, aber das war in Claires Augen das Kapital dieses Veranstalters. Ein bisschen unkonventionell, ein bisschen experimentierfreudig und dazu … Sie hielt inne, als ihr Blick auf das Cover fiel.
Ein Weidenkorb mit Austern stand auf einem Felsen, in der Ferne erhob sich eine zerklüftete Steilküste. Darüber durchtrennte ein Flugzeug mit weißem Schweif den makellosen Himmel.
Sie las den Titel und atmete aus. Ihre Finger schienen auf einmal an dem Katalog zu kleben, ihr Körper versteifte sich. Trotz aller Konzentration brachte sie es nicht fertig, darin zu blättern. Nur am Rande nahm sie wahr, wie jemand die Tür öffnete.
»Falls du dich mit einem Kaffee lieb Kind machen willst, vergiss es. Ich bin nicht bestechlich«, murmelte Claire, ohne aufzusehen.
Die Felsen wirkten fast schwarz auf dem Bild, nass von den Wellen, die der Atlantik gegen die Klippen warf. Es war eine gelungene Aufnahme, die nach Salzwasser roch und nach Muscheln schmeckte. Fast glaubte sie, ein paar Gischttröpfchen auf dem Handrücken zu spüren, wenn sie nur lange genug hinsah. Claire zögerte, dann beugte sie sich nach rechts und warf die Broschüre in den Papierkorb. Der Bastbehälter fiel um, aber das unangenehme Prickeln in ihren Fingerspitzen hörte sofort auf.
»Natürlich sind Sie nicht bestechlich, Mademoiselle Durant. Alles andere würde mich schwer enttäuschen«, sagte eine belustigte Stimme, die nicht wie Sashas klang. Dazu war sie zu tief. Und zu männlich.
Claire richtete sich mit klopfendem Herzen auf. Sebastian Hellwig stand mit zwei Tassen in der Hand vor ihrem Schreibtisch.
»Nehmen Sie den Kaffee trotzdem, wenn ich Ihnen sage, dass ich sozusagen mein Leben riskiert habe, um ihn zu ergattern? Frau Senge ist beängstigend selbstbewusst für eine Praktikantin.«
Er hatte ein sehr nettes Lächeln, auch wenn sie ihrem Chef insgesamt eher gemischte Gefühle entgegenbrachte, weil er zu jenen Menschen gehörte, die alles andere waren als ein verre d’eau. Um ehrlich zu sein, gab es niemanden in der Redaktion, den sie weniger einschätzen konnte als ihn.
»In diesem Fall werde ich kaum meinen Job riskieren und ablehnen, n’est-ce pas?«, antwortete sie forsch und legte den Kopf schief. Immerhin wusste sie, dass er ihren französischen Akzent mochte.
»Ich war mir nicht sicher, wie Sie ihn trinken.« Er stellte die Tassen ab, nestelte in den Jackettaschen und legte ein paar Zuckerpäckchen auf den Tisch. »Deshalb habe ich die ménage gleich mitgebracht. So nennt man das doch in Frankreich, oder?«
Seine Bewegungen wirkten immer etwas steif und unbeholfen, weshalb sie rasch ein aufmunterndes Lächeln aufsetzte. »Das ist sehr aufmerksam von Ihnen.«
Hellwig sah schweigend zu, wie Claire drei der quadratischen Päckchen aufriss und den Zucker in den Kaffee rieseln ließ. Sie rührte um und nippte vorsichtig, da sie wusste, dass Sashas Kaffee nur für Menschen mit robustem Magen geeignet war. Es kostete sie unglaubliche Überwindung, sich nicht zu schütteln. Sasha hatte sich heute mit der Kaffeepulverdosis selbst übertroffen, woran der hohe Besuch im Konferenzraum sicher nicht unschuldig war.
»Er schmeckt wunderbar.«
»Wirklich?« Hellwig runzelte die Stirn. »Ich finde ihn grauenhaft, aber ich bin kein großer Kaffeeexperte.«
Claire überlegte und nickte schließlich ergeben.
»Sie haben recht Er ist grauenhaft.«
»Nun denn, solange Frau Senge besser schreibt, als sie Kaffee kocht, soll es mir egal sein. Schließlich bilden wir hier keine Baristas aus.« Hellwig trat an ihre Seite und musterte neugierig den überquellenden Schreibtisch. »Das wirkt ziemlich ambitioniert. Wollen Sie das alles etwa noch in diesem Jahr abarbeiten?«
Claire machte eine wegwerfende Handbewegung. »Es wirkt schlimmer, als es ist, Chef. Das meiste davon ist Info-Material. Wir wollen schließlich eine besonders schöne Novemberausgabe machen.«
»Und das hier haben Sie als unbrauchbar eingestuft, nehme ich an?« Zu ihrem maßlosen Entsetzen bückte er sich, um den Papierkorb aufzustellen, und fischte dabei den Katalog heraus, den sie vorhin weggeworfen hatte.
»Das ist bloß …« Claire suchte nach Worten, während Hellwig gedankenverloren über das Cover strich.
Umstandslos setzte er sich auf den Besucherstuhl und blätterte in dem Katalog. »Savoir-vivre in der Bretagne«, las er vor, und es war nicht zu überhören, dass ihm gefiel, was er sah. »Das müsste genau Ihr Thema sein, Mademoiselle Durant. Sie sind doch Französin.«
Claire lachte, ein wenig zu laut und zu schrill, und fand ihre Reaktion selbst maßlos überzogen. Mon Dieu, es war schließlich nur eine Reisebroschüre mit ein paar Bildern!
»Ouuu, ich bin Pariserin, Monsieur Hellwig, und man sagt über uns, dass wir nicht zum Rest Frankreichs gehören«, versuchte sie zu scherzen. »Davon abgesehen gehört die Bretagne sicher nicht zu den bevorzugten Urlaubszielen unserer Leser.«
»Warum denn nicht?«
»Sie ist eben nicht die Haute Provence oder die Côte d’Azur.« Claire zuckte mit den Schultern. »Das Wetter beispielsweise ist … terrible. Es ist wechselhaft, kalt und windig. Der bretonische Regen … Ach, fragen Sie lieber nicht. Man traut sich sogar im Sommer kaum ohne Jacke vor die Tür.«
»Das schreckt mich jetzt nicht sonderlich«, sagte Hellwig, und seine Augen leuchteten auf. »Im Gegenteil, ich mag das raue Klima am Atlantik. Sehr sogar.«
»Sie vielleicht nicht. Aber unsere Klientel ist vorwiegend weiblich und möchte sich im Urlaub bekochen, bedienen und umsorgen lassen. Schöne Hotels und gute Restaurants gibt es in der Gegend kaum, und wenn, sind sie maßlos überteuert.«
»Und weiter?« Hellwig ließ die Broschüre sinken und musterte Claire interessiert.
Allmählich wurde sie nervös. Sein Blick war ebenso unergründlich wie die Farbe seiner rauchgrauen Augen, und jedes Mal befürchtete sie, er könnte sie von innen lesen. Was natürlich Blödsinn war. Ihr Chef wusste genau das von ihr, was er wissen sollte, dafür hatte sie von Anfang an gesorgt.
»Die Gezeiten«, erwiderte sie hastig. »Die Ebbe in der Bretagne ist sozusagen eine Fundamentalebbe, die sich über Kilometer hinzieht. Nichts von wegen entspanntem Sonnenbaden am Strand und einer gelegentlichen Abkühlung in den Wellen, o non!« Claire schürzte die Lippen. »Das Meer versteckt sich irgendwo am Horizont, während im Sand nichts als stinkende Algen zurückbleiben und einem ständig Krebse über die Füße krabbeln.«
Hellwig schmunzelte. »Verstehe.«
»Abgesehen davon sind die Bretonen … die Franzosen nennen sie nicht umsonst die Schotten Frankreichs.« Claire wedelte mit der Hand, als hätte sie sich verbrannt. »Wortkarge, griesgrämige Menschen und alles andere als höflich, schon gar nicht touristenfreundlich. Manche weigern sich sogar, Französisch zu sprechen, von Englisch ganz zu schweigen.«
»Ich dachte, Letzteres behauptet man gemeinhin von allen Franzosen?« Nun war es nicht mehr zu übersehen, ihr Chef amüsierte sich königlich über sie.
»Was für ein Unsinn.« Claire schob das Kinn nach vorne und holte Luft. »Außerdem gibt es da bloß Fisch. Fisch, Fisch und noch mal Fisch. Fleisch können die Bretonen nicht, außer Sie bevorzugen Schuhsohlen auf dem Teller. Wer gibt sich schon mit einer derart grätigen Auswahl an kulinarischen Möglichkeiten zufrie…?«
Hellwig lachte auf und hob die Hand. »Ich hab’s kapiert, Mademoiselle Durant. Also keine Genusto-Sonderausgabe über die Bretagne.«
»Genau.« Erleichtert lehnte sie sich zurück und schlug die Beine übereinander. »Aber wir könnten über eine Paris-Ausgabe sprechen«, wagte sie einen kühnen Vorstoß.
Leider blätterte Hellwig immer noch in diesem verflixten Katalog herum.
»Roscoff, St. Malo, Moguériec«, las er vor. »Da scheint man aber doch jede Menge Ruhe zu bekommen, wie es auf den Bildern aussieht. Allein der Name klingt hübsch. Moguériec.« Er klang fast ein wenig sehnsüchtig.
»Moguériec!« Claire spie das Wort förmlich aus, und es fiel ihr schwer, das Zittern zu verbergen, das unkontrolliert durch ihren Körper lief. Ebenso die Sehnsucht, die noch viel mehr in ihr in Aufruhr brachte. »Wenn Sie mit Ruhe Langeweile meinen, dann bestimmt. Kulturell gesehen ist die Bretagne irgendwo im vorletzten Jahrhundert stehen geblieben … Was man von Paris nicht behaupten kann.« Mit fahrigen Fingern angelte sie das Kunstmagazin aus der Tasche und legte es auf den Tisch, die Bildseite Hellwig zugewandt. »Demnächst gibt es im Grand Palais eine wundervolle, sehr ungewöhnliche Ausstellung, über die ich liebend gerne im Kulturteil berichten würde, und …«
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich den hier mitnehme?«, unterbrach er sie und wedelte mit dem Prospekt. Das Kunstmagazin dagegen würdigte er keines Blickes.
Claire atmete aus, in dem Gefühl, ihre Chance verpasst zu haben. »Natürlich können Sie ihn haben«, sagte sie leichthin und hoffte, er hörte ihr die Enttäuschung nicht an. Au revoir, Grand Palais. Es wäre zu schön gewesen.
Hellwig schaute auf seine Armbanduhr und erhob sich. »Eigentlich bin ich aus einem bestimmten Grund hier.«
Wieder dieser Blick, der ihr Magenflattern verursachte.
»Ach, Sie wollten gar keinen Kaffee mit mir trinken? Wie schade.« Immerhin gelang es ihr, jenen koketten Ton anzuschlagen, mit dem sie ihr Gegenüber meist mühelos für sich einnahm. Sofern es männlich war. Und nicht Sebastian Hellwig hieß.
Wie erwartet verzog ihr Chef keine Miene. »Der Kaffee war bloß ein Vorwand. Ich wollte Sie für morgen Abend zum Essen einladen. Vorausgesetzt, Sie haben nicht schon andere Pläne.«
Claire riss die Augen auf. »Pardon?«
Schlug Hellwig ihr soeben allen Ernstes vor, mit ihm auszugehen? Nicht, dass sie ihn unattraktiv fand, obwohl unterkühlte, nordische Männer eigentlich nicht ihr Fall waren, aber zut alors – verflixt noch mal … Er war ihr Chef!
»Ich möchte bloß zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.«
»Sie wollen Fliegen schlagen?« Claire blinzelte verwirrt.
Hellwig schmunzelte. »Das sagt man so, wenn man mehrere Dinge gleichzeitig erledigen möchte. In meinem Fall bedeutet das, ich würde gerne mit Ihnen etwas Geschäftliches besprechen und dabei die Gelegenheit ergreifen, mit einer Expertin ein französisches Lokal in Zehlendorf zu testen … für eine sehr anspruchsvolle Lady, die ich demnächst dorthin ausführen möchte.«
Das erleichterte »Ah d’accord – Ach so« entschlüpfte ihr, ehe sie ihre Zunge zügeln konnte.
Hellwig hob eine Braue, wodurch seine rechte Gesichtshälfte in Schieflage geriet, als hätte man bei einem Puzzle versehentlich ein paar Teile verschoben. Nein, er war ganz sicher nicht ihr Typ. Selbst wenn, ist er immer noch mein Chef, dachte Claire, verwirrt, weil sie tatsächlich ein Selbst wenn in Betracht gezogen hatte.
»Heißt das, Sie sind einverstanden? Sie täten mir einen großen Gefallen.«
»Natürlich gehe ich sehr gerne mit Ihnen essen.« Hoffentlich merkte er ihr die Verlegenheit nicht an. Ein Rendezvous mit Hellwig. Auf welch dumme Ideen sie doch manchmal kam. »Ich bin zwar schon verabredet, aber das kann ich verschieben«, log sie nonchalant und hob das Kinn. »Geschäftliches geht natürlich vor.«
Ein Ausdruck glitt über sein Gesicht, den Claire nur schwer zu deuten wusste. »Ganz Ihrer Meinung, Mademoiselle Durant. Da ich vorher noch einen Termin in Charlottenburg habe, ist es hoffentlich in Ordnung für Sie, wenn wir uns morgen direkt im Rive Gauche in der Königstraße treffen? Ich habe für zwanzig Uhr einen Tisch reserviert.«
»Ich werde da sein.«
Mit klopfendem Herzen und leerem Blick sah Claire auf die Glastür, die sich längst hinter ihrem Chef geschlossen hatte, nachdem er ihr zum Abschied ein knappes »Bis morgen« und seine unangetastete Kaffeetasse hinterlassen hatte.
Was genau irritierte sie so sehr an diesem Mann? Verunsicherte er sie, weil er ihr Vorgesetzter war? Oder steckte doch mehr hinter ihrem flüchtigen Gefühl, dass der smarte Geschäftsmann mit dem sorgfältig gekämmten Seitenscheitel und den ebenso präzisen Bügelfalten in der Leinenhose irgendwie nicht echt wirkte?
Allein der Gedanke verursachte ihr ein unangenehmes Bauchkribbeln, weshalb sie fast dankbar war, als Sasha draußen im Gang stehen blieb und zu ihr herüberwinkte. Claire zog die Stirn in Falten, bis die Haut an den Schläfen spannte. Sasha sah sich verstohlen um, grinste frech und drückte einen lipglossfettigen Kussmund auf die Scheibe, ehe sie mitsamt dem Kaffeetablett das Weite suchte. Kopfschüttelnd erhob Claire sich aus dem Bürostuhl und ging zum Fenstersims, wo sie den kalt gewordenen Kaffee mit einem winzigen Gefühl der Genugtuung in Sashas Topfpflanze kippte.