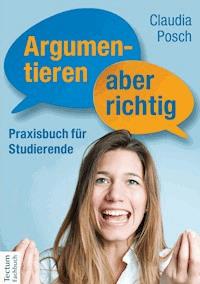
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kennst Du das? Du sitzt in einem Seminar an der Uni, die Professorin oder ein Mitstudent sagt etwas, womit Du nicht einverstanden bist. Du möchtest widersprechen, aber weißt nicht wie? Oder Du hast das Gefühl, andere formulieren viel logischer als Du es könntest? Dann ist Argumentieren, aber richtig die Lösung! Mit viel Praxisbezug erklärt Claudia Posch, wie Argumentation funktioniert, wie man Argumente von anderen erkennt, versteht, bewertet und auf sie treffsicher reagiert. Kompakte Tipps und Überblicke zeigen, wie gute Argumente aufgebaut sind, welche Scheinargumente es gibt und wie man eine Diskussion voranbringt. Die Kunst der Argumentation ist eine zentrale Schlüsselkompetenz für Akademiker, die aber leider an der Universität nicht gelehrt wird. Dieses Buch schafft Abhilfe! So macht jede Debatte Spaß.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Claudia Posch
Argumentieren, aber richtig
Claudia Posch
Argumentieren, aber richtig
Praxisbuch für Studierende
Claudia Posch
Argumentieren, aber richtig. Praxisbuch für Studierende
© Tectum Verlag Marburg, 2014
ISBN 978-3-8288-6093-3(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3351-7 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: fotolia.com © style-photography.de, photocase.de © simonthon (Dame)Umschlaggestaltung: vogelsangdesign.de
Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.dewww.facebook.com/tectum.verlag
Bibliografische Informationen der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhalt
Weitere Übersichten
Worum es in diesem Buch geht und wie Sie es benutzen
Argumentieren, Argument und Argumentation
1Was heißt eigentlich Argumentieren und wozu brauchen wir es?
2Warum wird in der Wissenschaft überhaupt argumentiert?
3Wann und wo findet Argumentation im Studium statt?
4Sind wissenschaftliche Fakten nicht einfach wahr?
5Wie funktioniert Argumentation und was ist eigentlich logisch?
6Wie funktioniert Argumentationslogik?
7Wie können wir Logik in einer Argumentation nachzeichnen?
8Was ist eine Prämisse?
9Vom einfachen Argument zur wissenschaftlichen Argumentation
10 Behauptungen begründen – wozu brauchen wir das?
11 Was bedeutet Schlussfolgern und was folgt woraus?
12 Welche Arten von Argumenten gibt es?
13 Ist eine eigene Meinung haben bereits argumentieren?
Argumente formulieren
1Gut strukturiert ist halb argumentiert
2Das Dreischrittmodell zum Planen strukturierter Argumentation
3Wie baue ich meine Argumentation inhaltlich auf?
4Argumente stichhaltig untermauern: Was ist ein Beleg?
5Womit begründe ich Behauptungen am sinnvollsten?
6Beide Seiten einer Debatte aussagekräftig darstellen
7Aus einfachen Argumenten komplexere basteln
8Was macht gutes argumentatives Formulieren aus?
9Argumentieren als sprachliches Handeln – ein Werkzeugkasten
Argumente kritisch beleuchten
1Die Sprache dahinter verstehen
2Was sind Vorannahmen?
3Welche Analysemethode ist geeignet? Kritisches Denken
4Argumentative Texte kritisch prüfen – leicht gemacht
5Argumentation rekonstruieren im Detail
6Rhetorische und stilistische Mittel hinterfragen
7Angreifen, was ich lese: alternative Argumente
8Den Quellen einfach mal nicht zustimmen
9Papers checken mit STEAM
Missverständnisse und Fehlschlüsse
1Was heißt falsch schließen?
2Welche Argumentation ist ungültig?
3Was wir in Worten verstecken: emotionale Appelle
4Verwechslung von Ursache und Wirkung
5Im Kreis argumentiert
6Auf den Strohmann hereingefallen
7Ist etwas richtig, nur weil niemand das Gegenteil bewiesen hat?
8Autoritäten und Namedropping
9Auf der schiefen Bahn einer falschen Spur nachgehen
Literatur
Weitere Übersichten
Checklisten und Überblicke
Vier Kriterien von Wissenschaftlichkeit
10 Regeln für vernünftiges Argumentieren
Behaupten und Begründen
Was bei Schlussfolgerungen vermieden werden sollte
Fragen für Zahlen und Fakten
Wie aus einer Meinung eine Argumentation wird
Fünf Kriterien für eine gelungene Argumentation
Argumentation strukturieren
Makrostruktur der Argumentation
Grundlegende Argumentationsstruktur überprüfen
Integrität von Belegen prüfen
Argumentationsstützpfeiler
Aufbau einer vertieften Argumentation
Lesefreundlichkeit und Präzision
10 Fragen für kritisches Denken
Kritisches Denken
Trudy Goviers Strategien, um Argumente zu finden und zu entschlüsseln
Ursache-Wirkung Fehlschluss
So funktionieren Strohmann-Argumente
Autorität zitieren
Wie Sie Belege im Hinblick auf Autoritätsargumente bewerten können
Formulierungsbausteine
Argumentieren
Hauptsätze verbinden
Haupt- und Nebensätze verbinden
Idiome
Begründen
Folgern
Bedingungen
Absichten
Einschränken
Gewissheit ausdrücken
Ablehnung
Zweifel ausdrücken
Zustimmung
Verweisen
Vorschlagen und empfehlen
Hervorheben
Bewerten und beurteilen
Aktivitäten
Welche der folgenden Sätze sind Aussagen?
Risiko bei Skitouren
Welcher Planungstyp bin ich?
Beispielsatz verständlicher machen
Begriffssklärung
Genaue Begriffe
Haken Sie die Vorannahmen ab
Wie verhalten Sie sich bei schwierigen Themen? Testen Sie sich selbst!
Schürfe ich beim Lesen nach Gold?
Muss frau/man für folgende Tätigkeiten eigentlich kritisch denken können?
Analytisches Lesen mit STEAM
Welches der folgenden Beispiele ist ein Post-hoc-Fehlschluss?
Selbsttest Ursache-Wirkung-Fehlschluss
Ursache-Wirkung Fehlschluss
Wie Sie ganz sicher kein Getränk spendiert bekommen
Worum es in diesem Buch geht und wie Sie es benutzen
Wer studiert, argumentiert viel und muss viel über Argumentation nachdenken. Das mag Ihnen vielleicht, während Sie es tun, gar nicht bewusst sein, es ist aber eine der Hauptbeschäftigungen in Ihrem Studium. Argumentation ist das verbindende Element, das die unterschiedlichen Wissens- und Lernbereiche eines jeden Studiums verbindet. Das beginnt mit der Recherche und reicht bis zum eigenständigen Erstellen von Texten. Sie werden in Ihrem Studium unterschiedlichsten Argumentationen begegnen. Zum Beispiel müssen Sie für ein Referat zwei Artikel lesen, die völlig gegensätzliche Ansichten vertreten. Beide sind gut formuliert, flüssig zu lesen und klar geschrieben – kurz gesagt, sie klingen absolut überzeugend. Was tun? Wem soll frau/man recht geben? Was soll frau/man glauben? Oder Sie haben auch schon für eine wissenschaftliche Arbeit selbst eine These aufgestellt, zu der Sie aufgrund Ihrer gesammelten Daten gekommen sind. Dabei haben Sie die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, eigene Thesen überzeugend zu vertreten. Es ist außerordentlich schwer, andere davon zu überzeugen, dass die eigene Gedankenfolge logisch nachvollziehbar ist und Sinn ergibt. Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Leserinnen und Leser uns einfach zustimmen, wenn sie unsere Texte lesen, auch wenn wir uns sehr bemüht haben, einen wirklich guten Text zu produzieren. LeserInnen verlangen Argumente, sie wollen wissen, warum sie ausgerechnet Ihrer Argumentation folgen sollen.
Viele verwechseln überzeugen mit überreden. Ob unsere Argumente überzeugen, hängt davon ab, ob es uns gelingt, bei unseren ZuhörerInnen oder LeserInnen das Gefühl zu wecken, dass wir aufgrund logisch nachvollziehbarer Kriterien glaubwürdig sind. Ein wichtiges Anliegen dieses Bandes ist, Ihnen dabei zu helfen, Argumentation im vorhandenen Wissen zu entdecken. Das ist gar nicht so leicht, denn Sie lesen auch im Studium vieles, das nicht argumentativ ist.
Ein weiteres Ziel dieses Buches ist es, Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie argumentieren können, um über das bloße Wahrnehmen und Wiedergeben hinauszukommen. Argumentieren beinhaltet die Vorgänge Analysieren, Synthetisieren und Bewerten. Beim Analysieren wird von Ihnen erwartet, dass Sie Strukturen und Prinzipien erkennen. Beim Synthetisieren kommt es darauf an, dass Sie unterschiedliche Aussagenelemente zusammenfügen und eigene Hypothesen daraus entwickeln. Und beim Bewerten schließlich sollen Sie Aussagen anhand von Kriterien beurteilen können.
Sie lernen in diesem Buch, wie und mit welchen Mitteln Sie diese Vorgänge erlernen und durchführen können. Sein inhaltlicher Aufbau ist so, dass Sie je nach Bedürfnis wählen können: Wollen Sie wissen, wie Sie selber gute Argumente erzeugen, oder wollen Sie erfahren, wie Sie Argumente finden und kritisch hinterfragen? Im ersten Teil (Kapitel I und II) lesen Sie, wie Argumente aufgebaut sind und wie Sie vorgehen können, wenn Sie selber argumentieren wollen. Im zweiten Teil (Kapitel III und IV) erfahren Sie, wie Sie die Argumentation von anderen kritisch hinterfragen und Argumentationsfehler und Trugschlüsse identifizieren. Fragen, die Ihnen dieser Band beantwortet, sind die folgenden:
*Was ist eigentlich unter Argumentation zu verstehen?
*Warum ist Argumentation im Studium wichtig?
*Wie ist Argumentation aufgebaut?
*Welche Strukturen finden sich hinter der Argumentation?
*Welche unterschiedlichen Arten zu argumentieren gibt es?
*Wie kann ich Argumentation planen und aufbauen?
*Wie kann ich Argumentation überprüfen?
*Wie kann ich Argumentation kritisieren?
Was dieses Buch nicht ist: eine Einführung in die Rhetorik oder die Argumentationstheorie. Es ist auch kein Ratgeber und kein Trainingsbuch, das Ihnen zeigt, wie Sie überzeugend Waschmaschinen verkaufen können. Vielmehr soll es Ihnen beratend zur Seite stehen, wenn Sie mit schwierigen Inhalten in Ihrem Studium konfrontiert sind und nicht wissen, wie Sie diese gedanklich weiterverarbeiten sollen. Bei der Erstellung dieses Buchs sind natürlich weitaus mehr Texte eingeflossen, als im Rahmen der Literaturtipps erwähnt werden können. Abgesehen von wissenschaftlicher Literatur sind auch Beispiele aus der Belletristik und aus Internetseiten entnommen.
Argumentieren, Argument und Argumentation
Argumente müssen nicht neu sein – nur gut und richtig
Um Teil einer Wissensgemeinschaft zu werden, müssen Sie lernen, logisch und folgerichtig zu denken. Nur wenn wir unsere Behauptungen begründen, können unsere ZuhörerInnen und LeserInnen von unseren Erkenntnissen überzeugt werden. Wir brauchen dies im Studium, um selbstständig wissenschaftliche Arbeiten verfassen und unsere Thesen verteidigen zu können. In diesem Kapitel finden Sie heraus, warum sie argumentieren können sollten und wie das eigentlich funktioniert.
1Was heißt eigentlich Argumentieren und wozu brauchen wir es?
Um uns dem Argumentieren im Studium anzunähern, müssen wir uns zuerst der Frage widmen, was von Ihnen als Studentin oder Student verlangt wird. Studierende haben meist das Gefühl, sich ständig in einer Art Krisensituation zu befinden, weil sie einerseits nicht ganz genau wissen, was die Lehrenden von ihnen wollen, andererseits aber regelmäßig schriftliche Arbeiten abliefern müssen. Viele Studierende fühlen sich gezwungen, sich selbst aus den eigenen Texten herauszuhalten. Sie haben das Gefühl, absolut nichts beitragen zu können. Die wissenschaftlichen Konventionen verlangen Objektivität und Faktizität, und wie soll da eine einfache Studentin oder ein einfacher Student einen Beitrag leisten können – vor allem wenn frau/man das Gefühl hat, einfach noch nicht genug zu wissen?
Dies scheint im Widerspruch mit der Anforderung zu stehen, stets seine eigene Meinung unterzubringen und etwas in eigenen Worten zu sagen. Hier liegt das Problem oft darin, dass die Studierenden glauben, noch nicht (lange) genug studiert zu haben, um eine (begründete) eigene Meinung vertreten zu können. Die Wissenschaft erscheint ihnen wie eine geschlossene Gemeinschaft, die nach ganz eigenen Regeln und Gesetzen funktioniert. Es haftet ihr eine gewisse Exklusivität an, und das Gefühl entsteht, nur „Auserwählte“ hätten hier Zugang. Fragen Sie sich also: „Wie kann ich ein Teil dieser Gemeinschaft werden?“, liegen Sie genau richtig, wenn Sie sich eingehend mit dem Argumentieren beschäftigen wollen.
Das Wort „argumentieren“ kommt aus dem Lateinischen (lat. arguere) und bedeutet in etwa „erhellen“ oder „beweisen“.
Vielleicht haben Sie den Eindruck, Sie müssten plötzlich auf einen fahrenden Zug aufspringen. Der Einstiegspunkt fehlt. Es wird von Ihnen an der Universität verlangt, dass Sie sich am laufenden wissenschaftlichen Gespräch beteiligen – nicht mehr und auch nicht weniger. Zuallererst fällt hier auf, dass von einem „Gespräch“ die Rede ist. Die Wissenschaft ist ein Gespräch, welches – beispielsweise – in schriftlicher Form einer Publikation geführt wird. In diesem Fall heißt das ganz banal, dass es keine unmittelbaren Reaktionen geben kann, sondern Antworten, Rückfragen, Gegendarstellungen usw. erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sind. Das Ziel von wissenschaftlichen Texten ist es, Wissen auszutauschen und für andere Mitglieder der Forschungsgemeinschaft zugänglich zu machen, um diesen die Teilnahme an einem Dialog zu ermöglichen. Wissenschaft ist also Text, und um einen Beitrag leisten zu können, ist es notwendig, sich mit den Texten anderer auseinanderzusetzen und selbst einen Text verfassen zu können.
Sie müssen natürlich über ein bestimmtes Maß an Vorwissen verfügen. Üblicherweise werden Sie sich das grundlegende Wissen zum Beispiel in einer Vorlesung erarbeiten. In anderen Lehrveranstaltungstypen hingegen wird erwartet, dass Sie eigenständig arbeiten. Deshalb ist es wichtig, für oder gegen eine Sache zu argumentieren und die eigenen Aussagen begründen zu können. Sie müssen, um eigenständig arbeiten zu können, zwei Dinge lernen: Argumente zu analysieren (= kritisches Denken) und selbst Argumente aufzubauen.
Für den Einstieg in die Wissenschaft benötigen Sie also zwei zentrale Fertigkeiten:
1.Kritisches Denken: wird sichtbar beim Lesen (bzw. Hören)
2.Argumentieren: wird sichtbar beim Schreiben (bzw. Sprechen)
Der Begriff des kritischen Denkens (engl. critical thinking) bedeutet übersetzt nicht einfach nur kritisch sein, sondern mehr als das. Er beinhaltet Kompetenzen, vor allem im Lesebereich, wie das Finden von Problemlösungsstrategien, das Analysieren von Argumenten und letztendlich auch das kreative Denken. Diese Fertigkeiten sind die Basis für das spätere eigenständige Argumentieren in Texten. Sie können also gar nicht erst anfangen, selbst zu argumentieren, ohne Techniken und Möglichkeiten der Argumentationsanalyse und des kritischen Lesens zu kennen (wie Sie Ihr kritisches Denken schulen können, erfahren Sie in Kapitel 3). Insofern könnte kritisches Denken zwar der Lesekompetenz zugeordnet werden, es ist jedoch zugleich schon ein Teil des Argumentierens. Die Verknüpfung dieser beiden Fertigkeiten – genauer: der Schritt vom Lesen zum Schreiben oder vom Hören zum Sprechen – ist nämlich Ihr Einstiegspunkt in die Wissenschaft. Es gibt verschiedene Arten des Lesens und Schreibens, die im Studium mit diesen Kernkompetenzen zu tun haben.
Sie lesen beispielsweise einen Artikel oder ein Thesenpapier, um für eine Seminardiskussion gerüstet zu sein. Schließlich wollen Sie nicht nur passiv konsumieren, sondern auch etwas zur Diskussion beitragen. Dies verlangt, dass Sie die Fertigkeit des kritischen Denkens beherrschen. Wenn Sie verstehen, um was es geht, und sich ihre eigene Meinung bilden, dann können Sie in der Diskussion argumentieren und überzeugen. Etwas Ähnliches gilt für die schriftliche Arbeit: Auch hier lesen Sie wichtige Quellen kritisch und arbeiten die argumentative Struktur heraus. Sie erwerben Wissen über das Thema, stellen Fragen und bereiten sich dadurch auf das Schreiben vor. Im Schreibprozess schließlich setzen Sie ihre eigenen Ideen um und argumentieren für oder gegen eine bestimmte Position.
2Warum wird in der Wissenschaft überhaupt argumentiert?
Argumentiert wird also überall dort, wo im Hinblick auf ein bestimmtes Thema Konflikte oder Uneinigkeit bestehen und Menschen versuchen sich zu einigen. Zentral ist dabei die Vorstellung, dass diese Einigung auf vernünftige Weise erreicht wird. Argumentieren heißt eben gerade nicht, sich gegenseitig kleinzukriegen. Der Versuch, eine Einigung in einem Streitthema zu erreichen, läuft im Idealfall vernünftig und nach bestimmten Bedingungen und Regeln ab. Eine dieser Bedingungen ist das Argumentieren: Die Beteiligten bringen Argumente vor, führen Beweise für ihre Argumente an und versuchen so, andere Menschen von ihren Argumenten zu überzeugen. Die folgende Definition von Kienpointner beschreibt präzise, was der Begriff Argumentieren meint.
Argumentieren eröffnet die Chance, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wir versuchen eine gemeinsame Sprache durch den Austausch von Argumenten zu finden und somit die Sicht auf die Welt in Gleichklang zu bringen.
Kienpointner (1996)
Das Ziel ist also, sich in einer Frage oder an einem Punkt einig zu werden und am Ende des Gesprächs weiter ist als am Anfang. Das heißt nun nicht unbedingt, dass wir an einer endgültigen Lösung angelangt sein müssen, sondern dass wir etwas weiterbringen wollen – im weitesten Sinne das Wissen.
Im Alltag haben Begriffe wie Argumentieren, Argumentation, Diskussion oder Debatte manchmal einen negativen Beigeschmack. In unserer wettbewerbsorientierten Gesellschaft vermuten wir oft dahinter etwas Manipulatives, das nur darauf abzielt zu „gewinnen“. Die negative Einstellung diesen Begriffen gegenüber sind besonders gut an folgenden Beispielen zu erkennen, allesamt Metaphern, die wir im Alltag häufig verwenden:
– „Ich kann diese Aussage nicht verteidigen!“
– „Sie attackierte wirklich jeden Schwachpunkt in meiner Argumentation.“
– „Seine Kritik traf punktgenau ins Ziel.“
– „Ich konnte sein Argument vernichten.“
– „Gegen sie habe ich noch nie in einer Diskussion gewonnen.“
– „Du hast das Killer-Argument.“
– „Versuch mich nicht schon wieder mit Argumenten zu beschießen.“
– „Sie will das Argument torpedieren.“
Solche Sätze und Phrasen zeigen, dass das Argumentieren im Alltag oft nur unter den Vorzeichen von Konflikt und Konkurrenz abläuft. Manche dieser Metaphern vermitteln ausschließlich die Vorstellung von Angriff und Attacke. Genau das ist der Grund, warum viele Studierende Angst davor haben. Die meisten von uns wollen Konflikte eher vermeiden, als diese in direkter Konfrontation austragen zu müssen.
Das Verständnis von Argumentieren als „Krieg“ ist aber nur ein winziger Teil von dem, was Argumentieren eigentlich ausmacht. Es gibt nämlich auch ganz andere Arten, über das Argumentieren nachzudenken. Wie oft haben Sie sich schon in aller Ruhe über ein Thema unterhalten, etwa über die Vor- und Nachteile von sozialen Netzwerken wie Facebook? Alle Personen, die an der Unterhaltung teilnahmen, haben ihre Ansichten dazu geäußert. Es wurden Beispiele genannt und von eigenen Erfahrungen berichtet. Vorteile wurden erörtert, aber auch Fragen nach noch nicht absehbaren Auswirkungen auf die Gesellschaft gestellt. Auch wenn unterschiedliche und sogar gegensätzliche Meinung vertreten wurden, ging niemand als VerliererIn nach Hause oder fühlte sich gar herabgesetzt oder gekränkt. Alle hatten das Gefühl, eine gute Unterhaltung geführt und dabei auch noch etwas gelernt zu haben. Das ist Argumentieren! Das friedliche Abwägen und Diskutieren von Möglichkeiten, Alternativen und der Versuch, die Meinungen der anderen zu verstehen, sowie das gemeinsame Bestreben, auf einen „grünen Zweig“ zu kommen.
Argumentieren ist eine kommunikative Handlung, bei der wir versuchen, eine strittige Frage zu klären.
Argumentieren im alltäglichen Sinn ist also eine Handlung, die wir alle ständig verrichten. Für wissenschaftliche Diskussionen ist ein alltägliches Verständnis von Argumentieren nicht genug. Die Wissenschaft will zwar auch auf friedliche Art und Weise Möglichkeiten und Alternativen abwägen. Forschende versuchen dabei, unterschiedliche und gegensätzliche Meinungen und Alternativen in die Diskussion mit einzubeziehen. In der Wissenschaft und im Studium muss jedoch das Argumentieren zuallererst den Ansprüchen von Wissenschaftlichkeit entsprechen. Was bedeutet das aber genau?
Was als wissenschaftlich akzeptabel gilt, lässt sich in vier Punkten zusammenfassen. Erstens: Die Wissenschaftlerin oder der Forscher muss mit den Methoden des jeweiligen Faches vertraut sein und diese auch anwenden. Zweitens: Wissenschaftliche Beiträge müssen auf vorhandenem Wissen (also auf dem, was andere publiziert und gesagt haben) aufbauen; möglicherweise sind Teilaspekte eines Themas schon sehr gut erforscht. Theorien, die andere aufgestellt haben, müssen in Betracht gezogen und diskutiert werden. Drittens: Die formalen Kriterien des jeweiligen Faches müssen beachtet werden. Und viertens: Wir müssen bereit sein, unsere Standpunkte und Ergebnisse einer Öffentlichkeit zu präsentieren und sie gegen Kritik zu verteidigen.
Vier Kriterien von Wissenschaftlichkeit
•Methoden des Fachs kennen und anwenden
•auf vorhandenem Wissen aufbauen
•formale Kriterien beachten
•das Erarbeitete vor einer Öffentlichkeit präsentieren und verteidigen können
Das Argumentieren ist nun gewissermaßen der rote Faden, der diese Forderungen verbindet. Wird beispielsweise eine Methode ausgewählt, so muss argumentativ dargelegt werden, warum sie angewendet wurde. Wenn wir auf dem Wissen anderer aufbauen, müssen wir begründen, warum wir das tun, und für oder gegen die Position, die eine andere Person vertritt, argumentieren. Die Strukturierung unseres Denkens in Form von Argumenten ist bereits formales Kriterium, das für alle wissenschaftlichen Disziplinen gilt. Und zu guter Letzt: Wenn wir unsere Arbeit präsentieren, müssen wir sie mit Argumenten verteidigen können. Wissenschaft ist ein kommunikativer Prozess, in dem das Argumentieren eine zentrale Rolle spielt.
Um zu verstehen, was beim Argumentieren in der Wissenschaft vor sich geht, müssen wir zwei weitere Begriffe kennen und unterscheiden: Argument und Argumentation. Auf den ersten Blick ist das gar nicht so einfach. Natürlich haben Sie diese beiden Begriffe im Kontext der Universität schon gehört und auch im Alltag schon verwendet, sich vielleicht aber nur wenige Gedanken darüber gemacht. Lehrende sprechen beispielsweise gerne von einer „klar strukturierten Argumentation“ oder von einem „guten Argument“. Manchmal ist auch mit „Argumentation“ und „Struktur“ ein und dasselbe gemeint. Oder wie ist es mit jenen Arbeiten, die zwar gut bewertet werden, in denen aber nicht argumentiert wird? In einem Literaturüberblick zu einem Thema gibt es nicht viel zu argumentieren. Es wird nacherzählt, was bis jetzt zu dem Thema gesagt wurde, sich aber nicht näher mit den einzelnen Positionen auseinander gesetzt.
Es gibt genauso viele verschiedene Begriffe von Argument und Argumentation, wie es Disziplinen und Studienfächer gibt. Ein mathematisches Argument ist etwas ganz anderes als ein Argument in der Biologie. Leider wird in den einzelnen Fächern oft nicht klar vermittelt, was wir unter Argument und Argumentation genau zu verstehen haben. Dazu kommt noch, dass beide oft auch noch anders bezeichnet werden, zum Beispiel als „Strukturierung“ oder „Struktur“. Manchmal wird Argumentation sogar mit dem Begriff des „kritischen Denkens“ oder mit „kritisch sein“ gleichgesetzt, besonders dann, wenn es darum geht, an der Oberfläche von wissenschaftlichen Texten zu kratzen und sich intensiver mit einer Frage auseinanderzusetzen. All diese verschiedenen Arten, Argumentation zu verstehen, treffen gewissermaßen zu.
Für unsere Zwecke ist vorerst folgende Unterscheidung zwischen Argument und Argumentation von Georg Brund und Gerlinde Hirsch Hadorn sinnvoll:
Wenn eine Aussage durch andere Aussagen begründet wird, dann ist dies zunächst einmal ein einfaches Argument. Ein Argument ist natürlich auch eine Aussage.
Eine Argumentation besteht aus mehreren solchen Aussagen und kann ein geschriebener oder gesprochener Text sein. Wir versuchen darin die echten oder fiktiven GesprächspartnerInnen davon zu überzeugen, eine Aussage, für oder gegen die argumentiert wird, zu akzeptieren oder zu verwerfen. Nämlich wenn wir gegen sie argumentieren.
Brun/Hirsch Hadorn (2009)
In der Wissenschaft genügt es nicht, einfach nur fest an die Richtigkeit einer Tatsache oder Aussage zu glauben. Sie sind in der Wissenschaft dazu verpflichtet, Begründungen anzugeben, wieso Sie etwas glauben (und behaupten) und wieso andere Ihre Behauptung akzeptieren sollen. Auch wenn Sie überzeugt sind, dass eine Aussage falsch ist, müssen Sie begründen, warum Sie zu dieser Überzeugung gekommen sind und warum Sie sie für korrekt halten. Wenn Sie also für oder gegen eine Aussage Begründungen formulieren, dann sind Sie schon mitten im Argumentieren! Sie bringen einzelne Argumente für oder gegen eine Position an, und so entsteht ihre Argumentation – als mündlicher oder schriftlicher wissenschaftlicher Text.
Wissenschaftliche Argumentation besteht also aus Behauptungen und Gegenbehauptungen – und nicht, wie oft geglaubt wird, aus Tatsachen, die über jede Kritik erhaben sind. Es ist ein wesentliches Kennzeichen von wissenschaftlicher Kommunikation, dass die Teilnehmenden die Diskussion auf ein differenzierteres Niveau heben und sich fundiert mit einem Thema auseinandersetzen – in der Hoffnung, dadurch zu gültigen und brauchbaren Erkenntnissen zu gelangen. Eine Argumentation besteht dabei aus einem oder mehreren Argumenten, die inhaltlich zusammenhängend einen Standpunkt darlegen. Ein Argument wiederum ist eine Aussage, die eine Person trifft, um zu zeigen:
*dass eine getätigte Behauptung vernünftig und akzeptabel ist oder
*dass eine getätigte Behauptung unvernünftig und inakzeptabel ist.
Was bedeutet Argumentation für Ihr Studienfach?
Was glauben Sie, warum Sie Argumentation brauchen?
Wie werden die Begriffe Argumentation und Argument in Ihrem Fach verwendet?
Argumentationen finden in der Wissenschaft Einbettung in einem größeren Konstrukt: in der wissenschaftlichen Diskussion oder im wissenschaftlichen Diskurs. Diskussion (von spätlateinisch discussio „Untersuchung, Erörterung“) bedeutet so viel wie „Zwiegespräch/Zweiergespräch“. Wie anfangs erwähnt, ist Wissenschaft ein Gespräch, das meistens in Form eines Austausches von einzelnen Texten stattfindet. In diesem Sinne können wir sagen, dass eine wissenschaftliche Diskussion aus mehreren Argumentationen besteht, die miteinander „sprechen“. Der Austausch ist nicht immer direkt und unmittelbar, sondern kann durchaus mit einem gewissen zeitlichen Abstand erfolgen. In einer wissenschaftlichen Diskussion werden verschiedene Themen schriftlich erörtert und diskutiert, und es wird versucht, sich über gewisse Fragen einig zu werden – grundsätzlich ganz wie bei jeder anderen Diskussion. Dabei gelten aber etwas andere Spielregeln als im Alltag – die Kriterien der Wissenschaftlichkeit.
Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im Studium gelehrt werden, sind in Diskussionen entstanden und sind selbst Teil von Diskussionen.
Eine Diskussion ist eine erweiterte Form des Zwiegesprächs und reicht vom Alltagsgespräch bis zum Streitgespräch. Diskutieren heißt, Wissensinhalte zu verhandeln und sich darüber zu verständigen.
Ziel der Wissenschaft ist es, das, was frau/man über die Welt weiß, durch beständige Diskussion ihrer Forschungsresultate zu verbessern und zu erweitern. Dabei geht es aber nicht um die Anhäufung von Ideen und Erkenntnissen, sondern um die Entwicklung von Theorien und Modellen, die ein Problem beschreiben und gegebenenfalls auch lösen. Dies geschieht einerseits mündlich, etwa in Form von Vorträgen oder Workshops bei Konferenzen, andererseits aber vor allem in Form von schriftlichen Veröffentlichungen, wie z. B. Monografien, Zeitschriftenartikeln oder Buchbeiträgen.
Um das mündliche Diskutieren im Studium zu erlernen, empfiehlt es sich, einem Debattierklub beizutreten. Das macht Spaß und Sie treffen Leute! Dort lernt frau/man die Grundlagen von Streitkultur kennen und übt, sich sachlich mit Themen auseinanderzusetzen. An den meisten Universitäten gibt es inzwischen solche Klubs.
Die wissenschaftliche Diskussion findet also in einem ganz bestimmten, klar definierten Rahmen statt. Ein Überbegriff für diesen Rahmen ist „Diskurs“: Der wissenschaftliche Diskurs, das sind also die Texte hinter den Texten. In diesen Diskurs sind die einzelnen Fachdiskussionen eingebettet, sie beziehen sich aufeinander und sie diskutieren miteinander.
3Wann und wo findet Argumentation im Studium statt?
Vereinfacht gesagt ist ein Studium also eine Ausbildung dafür, wie Sie am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen. Um dabei zu einem bestimmten Thema einen anerkannten Beitrag zu leisten, müssen Sie wissen, wann und wo Sie in Ihrem Studium argumentieren. Argumentieren im Studium kann sich auf der mündlichen oder schriftlichen Ebene abspielen.
Manchmal werden Sie an mündlichen Diskussionen im Studium teilnehmen müssen. Im wissenschaftlichen Bereich gibt es unterschiedliche Formen, wie mündliche Diskussionen geführt werden, zum Beispiel:
Eine Diskussion im Anschluss an einen Vortrag
Normalerweise gibt es nach einem Vortrag bei einer Tagung oder einem Kongress Gelegenheit zu einer Diskussion, und es wird meist eine bestimmte Zeit dafür vorgesehen. Hier kann es vorkommen, dass das Publikum Verständnisfragen stellt oder die Person, die referiert hat, um Zusatzinformationen bittet. Manchmal werden Thesen aber auch kritisch hinterfragt und die Vortragenden müssen diese verteidigen, relativieren oder ergänzen. Im Studium werden Sie dies vielleicht in Form von Referaten üben – dabei halten Sie selbst den Vortrag oder Sie sitzen im Publikum, das nachher diskutieren soll.
Eine Podiumsdiskussion
Bei einer Podiumsdiskussion findet sich eine Gruppe mit Expertenwissen zu einem Thema zusammen. Ziel ist ein Austausch von unterschiedlichen Ansichten und Argumenten. Oft wird versucht, Anknüpfungspunkte zwischen verschiedenen Disziplinen zu finden oder auch zwischen auf den ersten Blick unvereinbar erscheinenden Aspekten. Im Studium kann es sein, dass Sie aufgefordert werden, ein solches Podium zu bilden! Vielleicht wird Ihnen sogar vorgegeben, welche Ansicht Sie vertreten sollen.
Im Studium werden Sie diese beiden Diskussionsformen wahrscheinlich probehalber durchspielen. Am häufigsten geschieht dies in der Form eines mündlichen Referats, in dem Sie vor Ihren Mitstudierenden zu einem bestimmten Thema sprechen müssen. Das Referat gleicht am ehesten einem Vortrag. Auch hier werden die Anwesenden aufgefordert, Fragen zu stellen oder ergänzende Kommentare zu geben.
Auf der schriftlichen Ebene gibt es gibt zwei verschiedene Typen von Texten, in denen in unterschiedlichem Ausmaß argumentiert wird: Es kann zwischen empirischen und theoretischen Texten unterschieden werden. Sie werden diese Form der wissenschaftlichen Diskussion am häufigsten in Form von Seminararbeiten, Bachelorarbeiten oder Diplomarbeiten üben.
Theoretische Arbeit
Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit rein auf andere Theorien beziehen oder selbst eine Theorie entwickeln, sprechen wir von einer Theoriearbeit. Es werden hierfür ausschließlich wissenschaftliche Quellen recherchiert und gegeneinander abgewogen. Dies ist Argumentieren in Reinform. Sie vergleichen beispielsweise Theorie A zu einem Thema mit Theorie B: Der berühmte Soziologie Niklas Luhmann gilt beispielsweise als einer der wichtigsten Vertreter der soziologischen Systemtheorie. Die Forschung des französischen Soziologen Pierre Bourdieu hingegen wird als Theorie der Praxis bezeichnet. Um Vergleichsmöglichkeiten zwischen diesen beiden Theorien zu finden, müssen Sie argumentieren.
Empirische Arbeit
Bei einer empirischen Arbeit haben Sie üblicherweise (von Ihnen selbst) gesammelte Daten als Grundlage, die Sie auswerten. In empirischen Arbeiten gibt es meist auch einen sogenannten Theorieteil, in dem Sie argumentativ begründen müssen, warum Ihr Thema relevant ist. Ebenso müssen Sie in der Konklusion, dem Resultat oder Ergebnisteil erklären, was Sie herausgefunden haben, und begründen, warum Ihre Ergebnisse relevant sind bzw. inwiefern sie Ihre Behauptung oder Hypothese stützen.
Wahrscheinlich werden Sie auf beide Arten von Texten im Studium stoßen, entweder beim Lesen oder beim Schreiben. Beiden ist gemeinsam, dass Sie auf jeden Fall erklären und begründen müssen, wie Sie zu Ihren Ergebnissen gekommen sind und warum Sie glauben, dass diese einleuchtend sind. Das heißt also, beide Texttypen sind argumentativ – Sie müssen darin argumentieren.
4Sind wissenschaftliche Fakten nicht einfach wahr?
Vielleicht kennen Sie die Vorstellung, dass das, was die Wissenschaft sagt, als „wahr“ gilt. Aber ist dies wirklich so? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst mit den darin enthaltenen Vorannahmen auseinandersetzen. Vorerst müssen wir nicht genau definieren, was Wahrheit ist. Die Philosophie zerbricht sich darüber seit Jahrhunderten den Kopf, und diese Frage soll für uns außer Acht bleiben. Wir gehen zuerst einmal von der Vorannahme aus, dass es Wahrheit gibt. Die zweite Vorannahme ist, dass die Wissenschaft auf der Suche nach der Wahrheit ist und sich ihr schrittweise annähert. Die Aussage, dass wir uns an etwas annähern, ist für das Verstehen von wissenschaftlichen Fakten von großer Bedeutung. Eine Theorie in der Wissenschaft, egal welche, kann immer nur einen Annäherungswert an die Wahrheit darstellen.
Jede wissenschaftliche Theorie bleibt nur so lange gültig, bis sie von einer besseren Theorie ersetzt wird. Aus einer gegenwärtigen Perspektive ist es sehr schwer vorstellbar, dass die wissenschaftlichen Wahrheiten, die wir momentan kennen, irgendwann einmal als falsch gelten könnten. Leichter fällt die Erklärung mit einem Blick zurück: Im 19. Jahrhundert galt es beispielsweise als wissenschaftlich erwiesen, dass Gefühle und Stimmungen einer Mutter bei einem ungeborenen Kind Defekte hinterlassen könnten. So ging die Forschung zum Beispiel davon aus, dass die Mutter des berühmten Elefantenmannes (ein Mann mit schweren körperlichen Missbildungen) sich vor einem Elefanten gefürchtet haben müsse und sich so der Eindruck des Gesehenen im Kind manifestierte. Abgesehen davon, dass diese Idee heute naiv und sexistisch anmutet, war sie zu jener Zeit state of the art (wenngleich sie im Beispiel sehr simplifiziert dargestellt wird). Diese damalige „Vererbungstheorie“ wurde im 20. Jahrhundert durch die moderne Genetik verdrängt und widerlegt. Obwohl wissenschaftliches Arbeiten den Anspruch stellt, möglichst objektiv zu sein, ist hundertprozentige Objektivität nicht möglich. Wissenschaft wird von Menschen betrieben, und Menschen sind subjektiv, auch wenn es ihnen gelingt, sich durch Methoden, Werkzeuge und durch die Sprache sehr stark von ihrer eigenen Person zu distanzieren.
Am Beginn ihres Studiums aber wollen viele Studierende die eine, einzige Wahrheit erfahren. Sie kommen mit folgenden Überzeugungen an die Universität:
*Wissenschaft ist Wahrheit
*Wahrheit ist immer und überall gültig
*Wissenschaftliche Wahrheit ist die einzig richtige Wahrheit





























