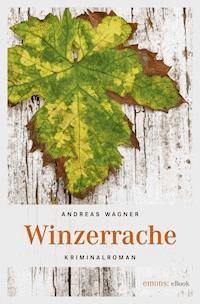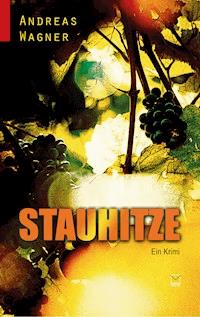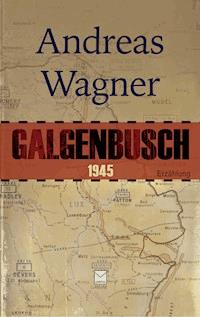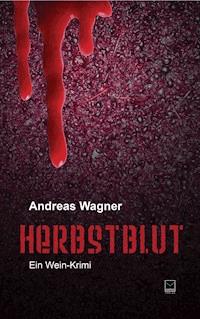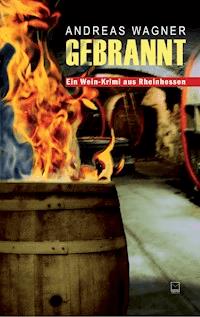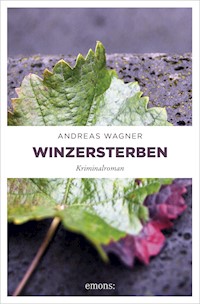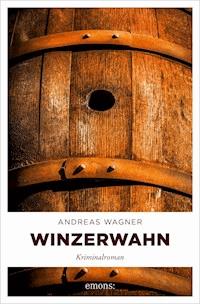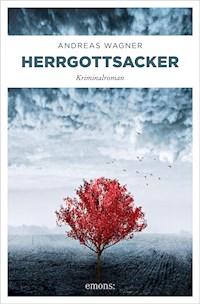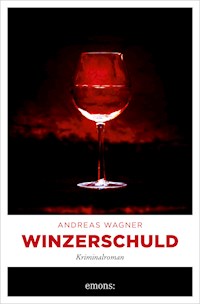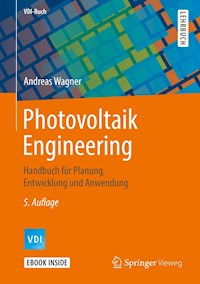14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Das letzte Rätsel der Evolution – gelöst! »Wagner stößt bis ins Herz der Innovationen bei lebendigen Systemen vor. Unterhaltsam, brillant.« Rolf Dobelli Bislang blieb ein Rätsel der Evolutionstheorie ungelöst: Ist wirklich nur zufällige Mutation die Ursache von Flügeln, Facettenaugen, Photosynthese und des ganzen Reichtums der Arten? Jetzt wissen wir: nein! Der renommierte Evolutionsbiologe Andreas Wagner hat Gesetze entdeckt, die es der Natur gestatten, neue Moleküle und Mechanismen herauszubilden, die eine schnelle Anpassung der Arten ermöglichen: wie der Kabeljau, der im Eiswasser dank eines Proteins überlebt, das den Gefrierpunkt seiner Körperflüssigkeit herabsetzt. Sorgfältig argumentiert und mit vielen Beispielen veranschaulicht, präsentiert Andreas Wagner jetzt den letzten Baustein der Darwinschen Theorie – er zeigt, wie das Neue in die Welt kommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Ähnliche
Andreas Wagner
Arrival of the Fittest
Wie das Neue in die Welt kommt. Über das größte Rätsel der Evolution
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel
FISCHER E-Books
Inhalt
Prolog
Genug Welt, genug Zeit
Im Frühjahr 1904 hielt Ernest Rutherford einen Vortrag vor der ältesten wissenschaftlichen Gesellschaft der Welt: der Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. Der zweiunddreißigjährige, in Neuseeland geborene Physiker, der damals an der McGill University in Kanada arbeitete, sprach über Radioaktivität und das Alter der Erde.
Zu jener Zeit hatten die Wissenschaftler sich längst von den biblischen Berichten abgewandt, in denen behauptet wurde, die Erde sei nur 6000 Jahre alt. Das weithin anerkannte Datum hatte ein anderer Physiker berechnet: William Thomson, besser bekannt als Lord Kelvin. Er hatte die Gleichungen der Thermodynamik und die Erkenntnisse über die Leitfähigkeit der Erde zugrunde gelegt und abgeschätzt, dass unser Planet ungefähr 20 Millionen Jahre alt ist.
In der Geologie ist das keine besonders lange Zeit, und aus seiner Schätzung ergaben sich weitreichende Folgerungen. Die geologischen Merkmale der Erde konnten in einem solchen Zeitraum nicht entstanden sein, wenn Prozesse wie Vulkanismus und Erosion immer mit der gleichen Geschwindigkeit abgelaufen waren wie heute.[1] Das wahre Opfer von Kelvins Schätzung jedoch war Charles Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Selektion. Darwin selbst hatte geschrieben, er sei »stark beunruhigt über die kurze Dauer der Welt nach Sir W. Thomson«.[2] Er wusste, dass die Lebewesen sich seit den letzten Eiszeiten kaum verändert hatten, und aus diesen geringfügigen Veränderungen hatte er den Schluss gezogen, dass ein wahrhaft gewaltiger Zeitraum verstrichen sein musste, damit alle Organismen, die heute leben oder als Fossilien erhalten geblieben sind, entstehen konnten.[3]
Rutherford jedoch hatte erst wenige Jahre zuvor das Phänomen der radioaktiven Halbwertszeit entdeckt und wusste, dass Kelvin um mindestens einige Zehnerpotenzen danebenlag. Später erinnerte er sich:
Ich kam in den halb dunklen Saal und machte sofort Lord Kelvin im Publikum aus. Da wurde mir klar, dass ich im letzten Teil meines Vortrages Schwierigkeiten bekommen würde, denn dort behandelte ich das Alter der Erde, und meine Ansichten standen im Widerspruch zu seinen … Die Entdeckung der radioaktiven Elemente, die bei ihrem Zerfall ungeheure Energiemengen freisetzen, verschiebt die mögliche Grenze für die Dauer des Lebens auf unserem Planeten und stellt die Zeit zur Verfügung, die von Geologen und Biologen für den Prozess der Evolution gefordert wird.[4] (Hervorhebung hinzugefügt).
Das war es dann aber auch. Kelvin starb 1907. Rutherford erhielt 1908 den Nobelpreis, und schon in den 1930er Jahren hatte man mit seinen radiometrischen Methoden gezeigt, dass die Erde rund 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Darwins Theorie war gerettet: Zufällige Mutationen und Selektion hatten jetzt die notwendige Zeit, um die ungeheure Komplexität und Vielfalt des Lebens zu schaffen.
Oder nicht?
Betrachten wir einmal den Wanderfalken Falco peregrinus, eines der großartigen Raubtiere in der Natur und ein Lebewesen von atemberaubender Vollkommenheit. Seine kraftvolle Muskulatur macht ihn in Verbindung mit einem äußerst leichten Skelett zum schnellsten Tier der Welt: Bei seinem charakteristischen Sturzflug kann er Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern erreichen. Und wenn der Falke seine Beute im Flug mit seinen rasiermesserscharfen Krallen ergreift, setzt er die gesamte Geschwindigkeit in eine ungeheure kinetische Energie um. Wenn der Stoß allein noch nicht tödlich wirkt, kann der Raubvogel die Wirbelsäule seiner Beute bequem mit seinem hakenförmigen Schnabel durchtrennen.[5]
Bevor F. peregrinus sich auf seinen tödlichen Sturzflug begibt, muss er seine Beute ausfindig machen. Sein Zielmechanismus besteht aus einem Augenpaar, das zu räumlichem Farbensehen in der Lage ist und ein fünfmal größeres Auflösungsvermögen besitzt als die Augen der Menschen; deshalb kann der Falke eine Taube noch aus einer Entfernung von mehr als eineinhalb Kilometern erkennen.[6] Wie viele andere Raubvögel hat der Falke in seinen Augen eine Nickhaut, ein drittes Augenlid, das ein wenig wie ein Scheibenwischer wirkt: Es entfernt bei der Hochgeschwindigkeitsjagd den Schmutz und hält das Auge gleichzeitig feucht. Außerdem enthalten die Augen eines Falken mehr Lichtrezeptoren – die Stäbchenzellen, die Bilder bei sehr schwachem Licht einfangen, und die Zapfen, die das Farbensehen ermöglichen.[7] Seine Lichtrezeptoren machen sogar langwelliges Ultraviolettlicht sichtbar.
Ein Wunder, allerdings. Noch staunenswerter ist aber etwas anderes: Wir wissen, dass jede dieser hervorragenden Anpassungen die Summe unzähliger winziger Schritte ist, die durch die natürliche Selektion erhalten geblieben sind und jeweils eine Veränderung in einem einzigen Molekül widerspiegeln. Der tödliche Schnabel und die Krallen von F. peregrinus bestehen aus dem gleichen Baumaterial wie seine Federn, Proteinmolekülen namens Keratin, die in ihrer menschlichen Version auch unsere Haare und Fingernägel bilden.[8] Für das Farbensehen sind die außergewöhnlichen Augen auf Opsine angewiesen, Proteinmoleküle in den Stäbchen und Zapfen. Für ihre ungeheure Sehschärfe sind die Augenlinsen verantwortlich, und die bestehen aus durchsichtigen Proteinen, die man Crystalline nennt.[9]
Im 17. Jahrhundert klagte der Lyriker Andrew Marvell: »Hätten wir doch Welt genug, und Zeit«, um die »großen Wüsten der weiten Ewigkeit« zu vermeiden, die vor ihm lagen. Damit wollte er aber keinen Zugang zu den Geheimnissen der Natur, sondern nur zum Schlafzimmer seiner Geliebten erlangen. Dennoch war er auf der richtigen Spur. Die allgemein verbreitete Weisheit besagt, dass die natürliche Selektion in Verbindung mit dem Zauberstab des zufälligen Wandels zu gegebener Zeit das Auge des Falken hervorbringt. Das ist die etablierte Sichtweise für die darwinistische Evolution: Ein winziger Bruchteil der kleinen, zufälligen erblichen Veränderungen verschafft den Lebewesen, die in der genetischen Lotterie gewonnen haben, einen Fortpflanzungsvorteil, und wenn solche Veränderungen sich im Laufe der Zeit summieren, bieten sie eine Erklärung für das Auge des Falken – und auch für alles andere, vom ganzen Falken bis zur gesamten Vielfalt des Lebendigen.
Die Kraft der natürlichen Selektion steht außer Zweifel, aber diese Kraft hat ihre Grenzen. Natürliche Selektion kann Neuerungen bewahren, aber nicht erschaffen. Und wenn wir uns auf den Wandel berufen, der Neuerungen nach dem Zufallsprinzip erzeugt, räumen wir damit eigentlich nur ein, dass wir nichts darüber wissen. Die vielen Innovationen der Natur – von denen manche geradezu gespenstisch vollkommen sind – schreien nach natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die die Fähigkeit des Lebens, Neuerungen hervorzubringen – seine Innovationsfähigkeit –, verstärken.
Während der letzten 15 Jahre hatte ich das Glück, dass ich an der Aufklärung dieser Prinzipien mitwirken konnte – zuerst in den Vereinigten Staaten und später zusammen mit einer Gruppe höchst begabter Wissenschaftler in meinem Institut an der Universität Zürich. Mit experimentellen Methoden und einer Computertechnik, die Darwin oder Rutherford sich nie hätten träumen lassen, wollen wir nicht einzelne Neuerungen aufspüren, sondern den Ursprung sämtlicher biologischer Innovationen finden. Aus unseren bisherigen Befunden können wir ablesen, dass hinter der Evolution viel mehr steckt, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Sie sagen uns, dass die Gesetzmäßigkeiten der Innovationsfähigkeit sogar noch jenseits des molekularen Aufbaus der DNA in einer geheimen Architektur des Lebendigen verborgen sind, die eine überirdische Schönheit hat.
Von diesen Gesetzmäßigkeiten handelt das vorliegende Buch.
Kapitel 1
Was Darwin noch nicht wusste
Der erste Filmstar der Welt hieß Sallie Gardner. Ihr anmutiges Debüt im Jahr 1878 war auch der Beginn des Kinos, sie war damals allerdings erst sechs Jahre alt. Sallie war nämlich zufällig das Rassepferd, das der in England geborene Fotograf Eadweard Muybridge in vollem Galopp mit seinem Zoopraxiskop aufnahm, einer Reihe von 24 Kameras, die entlang ihres Laufweges aufgestellt waren. Damit wollte er eine drängende Frage beantworten, die zweifellos noch heute vielen Menschen schlaflose Nächte bereitet: Hebt ein galoppierendes Pferd irgendwann einmal alle vier Beine vom Boden? (Die Antwort lautet ja.) Sein grobkörniger, wackliger Stummfilm ist insgesamt ungefähr eine Sekunde lang und um Welten von der High-Definition-Digital-Surround-Filmkunst entfernt, die wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts für eine Selbstverständlichkeit halten. Und doch trennt nur etwas mehr als ein Jahrhundert Muybridges fotografische Studie von modernen Spielfilmen, ein Zeitraum, nicht viel länger als der, seit Darwin seine Entstehung der Arten veröffentlichte –, das Werk erschien nur 19 Jahre vor Sallie Gardners Starauftritt.
In der gleichen Zeit wandelte sich die Biologie durch eine Revolution, die noch größer war als die des Kinos.[13] Diese Revolution hat uns eine Welt gezeigt, die für Darwin ebenso unzugänglich war wie der Weltraum für Höhlenmenschen. Und sie hat dazu beigetragen, die wichtigste Frage im Zusammenhang mit der Evolution zu beantworten, eine Frage, an die Darwin und die Wissenschaftlergenerationen nach ihm nicht rührten und nicht rühren konnten: Wie bringt die Natur das Neue, das Bessere, das Überlegene hervor? Wie wird das Leben zum Schöpfer?
Manch einer ist jetzt vielleicht verblüfft. Bestand Darwins große Leistung nicht gerade in der Erkenntnis, dass das Lebendige eine Evolution durchmacht, und konnte er nicht auch erklären, wie das geschieht? Ist das nicht sein Vermächtnis? Ja und nein. Darwins Theorie ist sicher die wichtigste intellektuelle Leistung seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten. Aber das größte Rätsel der Evolution wurde auch durch sie nicht fassbar. Er konnte nicht einmal in die Nähe einer Lösung gelangen. Um zu erkennen, warum das so ist, müssen wir uns zunächst ansehen, was Darwin wusste und was er nicht wusste, was neu war an seiner Theorie und was nicht, und warum wir erst jetzt, mehr als ein Jahrhundert später, allmählich begreifen, wie die Welt des Lebendigen zum Schöpfer wird.
Erste gedankliche Ansätze, die von einer Evolution der Natur ausgingen, gab es schon lange vor Darwin. Vor nicht weniger als 25 Jahrhunderten glaubte der griechische Philosoph Anaximander – der vor allem als Urgroßvater des heliozentrischen Weltbildes bekannt ist –, dass Menschen sich aus Fischen entwickelt haben. Im 14. Jahrhundert war der islamische Historiker Ibn Khaldun überzeugt, dass das Leben allmählich von den Mineralien über die Pflanzen zu den Tieren voranschreitet. Viel später, im 19. Jahrhundert, leitete der französische Anatom Etienne Geoffroy Saint-Hilaire aus den Fossilien von Reptilien die Erkenntnis ab, dass diese Tiere sich im Laufe der Zeit verändert hatten.[14] Im Jahr 1850, nur wenige Jahre, bevor 1859 Darwins Entstehung der Arten erschien, vertrat der Wiener Botaniker Franz Unger die Ansicht, dass alle Pflanzen von Algen abstammen.[15] Und der französische Zoologe Jean-Baptiste Lamarck postulierte, dass Evolution aus dem Gebrauch und Nichtgebrauch von Organen erwächst. Es scheint, als hätten einige der ältesten Denker sogar die Evolutionstheorie vorweggenommen, aber wenn man ein wenig tiefer gräbt, stößt man auf einige bizarre Fundstücke wie die Vorstellung von Anaximander, dass die ersten Menschen bis zur Pubertät innerhalb von Fischen lebten und dass ihre Wirtstiere danach platzten und sie freiließen. Ansichten, die der heutigen Naturwissenschaft völlig fremd erscheinen, blieben noch bis weit in Darwins Zeit hinein erhalten, darunter eine, die viele Wissenschaftler von den alten Griechen bis zu Lamarck teilten: Danach werden einfache Lebewesen spontan aus feuchtem Schlamm und anderer unbelebter Materie erschaffen.[16]
Auch die Evolutionstheorie hatte nicht nur ihre Befürworter, sondern bis in Darwins Zeit hinein ebenso lautstarke Gegner. Und nein, damit meine ich nicht Leute wie die heutigen Junge-Erde-Kreationisten mit ihrer Halbbildung und ihrem völligen Unwissen, die glauben, dass die Erde an einem Samstagabend im Oktober 4004 v. Chr. erschaffen wurde (und dass die Arche Noah mehr als eine Million Arten retten konnte, wobei Noah aber aus irgendeinem Grund die riesigen Dinosaurier vergaß, was man ihm vielleicht angesichts der Tatsache, dass er schon 600 Jahre alt war, nachsehen kann). Ich meine vielmehr die führenden wissenschaftlichen Köpfe jener Zeit. Einer von ihnen war der französische Geologe Georges Cuvier, der Begründer der Paläontologie – was wörtlich »Wissenschaft der uralten Lebewesen« bedeutet (man denke nur an die Dinosaurier).[17] Er entdeckte, dass Fossilien, die in älterem Gestein eingebettet sind, ganz anders aussehen als solche aus jüngeren Schichten, die eher den heutigen Lebensformen ähneln. Dennoch glaubte er, jede Spezies habe ihre eigenen, unveränderlichen Eigenschaften, und Schwankungen gebe es nur in oberflächlichen Merkmalen. Ein anderes Beispiel ist Carl von Linné, der nur ein Jahrhundert vor Darwin lebte. Er ist der Vater des Systems, mit dem wir noch heute die Vielfalt des Lebendigen einteilen, aber er glaubte bis ins hohe Alter nicht an die große Evolutionskette der Lebewesen.[18]
Der bekannteste Grund für solche Widerstände ist der christliche Glaube. Für Cuvier war die biologische Vielfalt kein Beleg für die Evolution, sondern ein Beweis für die große Begabung des Schöpfers. Tiefere Wurzeln hat jedoch ein anderer Grund. Er geht zurück bis auf den griechischen Philosophen Platon, der auf die abendländische Philosophie einen so großen Einfluss hatte, dass der Philosoph Alfred North Whitehead noch im 20. Jahrhundert die gesamte europäische Philosophie auf den Status »einer Reihe von Fußnoten zu Platon« degradierte.[19] Platons Philosophie stand zutiefst unter dem Einfluss der idealen, abstrakten Welt von Mathematik und Geometrie. Sie behauptet, die sichtbare, materielle Welt sei nur ein schwacher, flüchtiger Schatten einer höheren Realität, die aus abstrakten geometrischen Formen wie Dreiecken und Kreisen besteht. Für einen Platoniker haben Basketbälle, Tennisbälle und Tischtennisbälle eine gemeinsame Essenz oder Wesensform, nämlich ihre Ballform. Real ist demnach diese – vollkommene, geometrische, abstrakte – Wesensform, nicht aber die greifbaren Bälle, die so flüchtig und austauschbar sind wie Schatten.
Das Ziel von Wissenschaftlern wie Linné und Cuvier, die chaotische Vielfalt des Lebendigen zu organisieren, lässt sich viel einfacher erreichen, wenn jede Spezies eine platonische Wesensform hat, die sie von allen anderen unterscheidet; damit würde beispielsweise das Fehlen von Beinen und Augenlidern zur Wesensform von Schlangen gehören und sie von anderen Reptilien unterscheiden. Nach dieser platonischen Weltanschauung ist es die Aufgabe des Naturforschers, die Wesensform jeder Spezies zu finden. Und selbst diese Aussage ist noch zu schwach: In einer essentialistischen Welt ist eigentlich die Wesensform die Spezies.[20] Im Gegensatz dazu steht eine Welt der ständigen Veränderung und Evolution, in der biologische Arten unaufhörlich neue Arten hervorbringen, die sich miteinander vermischen können.[21] Die Schlange Eupodophis aus der späten Kreidezeit, die noch rudimentäre Hinterbeine besaß, und die Glasschleichen, die heute leben und keine Beine haben, sind nur zwei von vielen Tieren, die Zeugnis von den unscharfen Grenzen zwischen den Arten ablegen. Die chaotische Welt der Evolution ist dem Essentialismus, der nach klarer, jungfräulicher Ordnung strebt, ein Gräuel. Deshalb ist es kein Zufall, dass Platon und sein Essentialismus zum »großen Antihelden des Evolutionismus« wurde, wie der Zoologe Ernst Mayr es im 20. Jahrhundert formulierte.[22]
In der Kontroverse zwischen den Darwinisten und ihren Gegnern waren Fossilien wie Eupodophis nur einzelne Brocken in einem Berg der Belege, mit deren Hilfe Darwins Anhänger die Oberhand gewannen.[23] Zu Darwins Zeit hatten die Systematiker bereits Tausende von biologischen Arten klassifiziert und tiefgreifende Ähnlichkeiten zwischen ihnen aufgedeckt. Die Geologen hatten entdeckt, dass die Erdoberfläche aus Gesteinsschichten besteht, die sich in Aufruhr befinden, sich ständig neu erschaffen, sich falten und zermalmt werden. Paläontologen hatten unzählige ausgestorbene Arten gefunden, manche von ihnen in jungem Gestein und mit großen Ähnlichkeiten zu Lebensformen, die wir kennen, andere in uraltem Gestein und mit großen Unterschieden. Die Embryologen hatten nachgewiesen, dass so unterschiedliche Lebewesen wie freischwimmende Garnelen und die an einen Schiffsrumpf gehefteten Rankenfußkrebse auffallend ähnliche Embryonen haben.[24] Entdecker, unter ihnen auch Darwin, waren in der Biogeographie auf viele faszinierende Gesetzmäßigkeiten gestoßen. Auf kleinen Inseln sind weniger Arten zu Hause, die gegenüberliegenden Küsten des gleichen Kontinents beherbergen eine ganz unterschiedliche Tierwelt, Europa und Südamerika sind die Heimat völlig unterschiedlicher Säugetiere.[25]
Mit der Annahme, dass jede Spezies eigens erschaffen wurde, hätte man alle diese Erkenntnisstränge in einem chaotischen Wirrwarr belassen. Darwin, einer der größten synthetischen Denker aller Zeiten, verwob sie zu dem wunderschönen Geflecht seiner Theorie. Er warf den Kreationisten den Fehdehandschuh hin und behauptete, alle Lebensformen hätten einen gemeinsamen Vorfahren, womit er den biblischen Schöpfungsbericht vom Tisch fegte.
Das war Darwins erste große Erkenntnis. Die zweite betraf die zentrale Rolle der natürlichen Selektion und bezog ihre Anregung aus den spektakulären Erfolgen der Tier- und Pflanzenzüchter.[26] Das ganze erste Kapitel der Entstehung der Arten verherrlicht die Vielfalt der Haushunde, Tauben, Nutzpflanzen und Zierblumen, die menschliche Züchter erzeugt hatten. Es ist tatsächlich ein erstaunlicher Gedanke: Menschen konnten Dänische Doggen, Deutsche Schäferhunde, Windhunde, Bulldoggen und Chihuahuas erschaffen, und das alles aus einem gemeinsamen, wolfsähnlichen Vorfahren, und alles innerhalb weniger Jahrhunderte. Darwin erkannte, dass die natürliche Selektion sich nicht sonderlich stark von der Selektion durch Menschen unterscheidet, abgesehen davon, dass sie in viel größerem Maßstab und über ungeheuer lange Zeiträume wirkt. Die Natur bringt unaufhörlich neue Varianten von Lebewesen hervor; die meisten davon sind unterlegen, wenige sind überlegen, und alle müssen das Sieb der natürlichen Selektion passieren. Nur Individuen, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind, überleben, pflanzen sich fort und bringen weitere Varianten hervor. Wenn genug Zeit zur Verfügung steht, kann man mit diesem Prozess die gesamte Vielfalt des Lebendigen erklären, und das so gründlich, dass der Genetiker Theodosius Dobzhansky 1973 sagen konnte: »Nichts in der Biologie hat einen Sinn, außer im Licht der Evolution.«
Dieses Licht leuchtete von Anfang an über einigen Rätseln des Lebendigen heller als über anderen. Insbesondere eines blieb im tiefen Schatten: der Mechanismus der Vererbung. Ohne einen Mechanismus, der die originalgetreue Vererbung von den Eltern auf die Nachkommen gewährleistet, können Anpassungen – der Flügel eines Vogels, der Hals einer Giraffe, die Fangzähne einer Schlange – nicht über längere Zeit bestehen bleiben. Und ohne Vererbung wäre die Selektion machtlos. Darwin selbst hatte keine Ahnung, warum Kinder ihren Eltern ähneln, und räumte diese Unkenntnis auch mit entwaffnender Offenheit ein. In der Entstehung der Arten schreibt er: »Die Gesetze, welche die Vererbung der Charaktere regeln, sind zum größten Teil unbekannt.«[27]
Darwins Theorie ähnelt ein wenig jenem ersten Film von einem galoppierenden Pferd: Er war revolutionär im Vergleich zur unbewegten Fotografie, aber nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu abendfüllenden Spielfilmen. Den nächsten Schritt auf dem Weg der Biologie – die Erklärung der Vererbung – hatte man zur Zeit von Darwins Tod bereits vollzogen, aber das wusste er nicht. Ebenso wenig wusste es irgendein anderer angesehener Wissenschaftler, und das, obwohl die entscheidenden Experimente bereits 1856 begonnen hatten, drei Jahre bevor Die Entstehung der Arten erschien.[28] Und auch der Wissenschaftler, der die bahnbrechenden Versuche gemacht hatte, erlebte die von ihm losgetretene Lawine des Fortschritts, die schließlich die gesamte Biologie mitreißen sollte, nicht mehr mit.
Dieser Wissenschaftler war der österreichische Mönch Gregor Mendel. Er studierte in Wien, trat dann in die Abtei St. Thomas in Brünn ein und experimentierte dort mit mehr als 20000 Erbsenpflanzen, bevor er schließlich Abt wurde. Für seine Experimente suchte er sich gezielt Pflanzen aus, die sich in mehreren gut erkennbaren Eigenschaften unterschieden: Eine Pflanze brachte glatte, runde, gelbe Erbsen hervor, die andere runzelige, grüne Erbsen, aber keine produzierte solche mit einer mittleren Farbe oder Form. Andere Erbsenpflanzen unterschieden sich deutlich in der Blütenfarbe, der Form der Schoten oder der Länge des Stammes. Mendel nahm Kreuzbefruchtungen zwischen diesen Pflanzen vor und analysierte ihre Nachkommen – Tausende und Abertausende von Pflanzen.
Wie er dabei erkannte, findet bei den Nachkommen häufig keine Vermischung der Merkmale statt.[29] Die erste oder zweite Nachkommengeneration produziert entweder runde oder runzelige Erbsen, aber keine mit einer Mischform. Und verschiedene Merkmale können unabhängig vererbt werden, so dass sich bei den Nachkommen unter Umständen Kombinationen zeigen – rund und grün, runzelig und gelb –, die bei keinem Elternteil vorhanden waren. Die Ursachen der Vererbung verhielten sich also wie getrennte, unteilbare Teilchen. Jeder Elternteil trug zwei Teilchen, die für Merkmale wie runde Form oder Farbe verantwortlich waren, gaben aber jeweils nur eines davon an die Nachkommen weiter. Verschiedene Merkmale wurden durch verschiedenartige Teilchen vererbt und konnten sich deshalb unabhängig voneinander kombinieren und neu kombinieren.
Mendel arbeitete in der akademischen Provinz weit weg von den geistigen Strömungen seiner Zeit. Außerdem beging er einen Fehler, der damals wie heute so manche akademische Laufbahn zum Stillstand brachte: Er veröffentlichte zu wenig und an der falschen Stelle – in diesem Fall in einer lokalen Zeitschrift für Naturforscher.[30] Und wie das Pech es wollte, verbrannte der Abt, der sein Nachfolger wurde, nach Mendels Tod dessen Unterlagen. Aber 34 Jahre nach der Erstveröffentlichung von 1865 wurde Mendels Entdeckung von dem niederländischen Botaniker Hugi de Vries, der unabhängig ähnliche Experimente wie Mendel durchgeführt hatte, aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Die Historiker streiten noch heute darüber, ob er Mendels Gesetze wirklich wiederentdeckte oder ob er während seiner eigenen Experimente von Mendels Arbeiten erfuhr und sein Wissen zu verbergen versuchte.[31] Die nagende Enttäuschung, wenn einem jemand nicht nur knapp, sondern sogar um drei Jahrzehnte zuvorgekommen ist, wäre sicher eine Erklärung für den Impuls, die Geschichte neu zu schreiben. Aber wie dem auch sei: Mendels Gesetze wurden wiederentdeckt und verbreiteten sich nun wie ein Lauffeuer. Sie wurden zur Grundlage eines ganz neuen Teilgebiets der Biologie: der wissenschaftlichen Genetik. Merkmale mit einem Verhalten, wie es von Mendel beschrieben wurde, gibt es bei vielen Pflanzen und Tieren einschließlich des Menschen. Manche unserer Mendel’schen Merkmale sind so seltsam wie die Konsistenz des Ohrenschmalzes (feucht oder trocken), andere aber auch so wichtig wie die Hauptblutgruppen (A oder B), oder es handelt sich um Krankheiten wie die Sichelzellenanämie.
Immerhin erhielt de Vries am Ende noch einen Trostpreis. Er ist der Großvater des Begriffs Gen, dessen große Bedeutung sowohl in der Wissenschaft als auch in der volkstümlichen Kultur sich bis heute erhalten hat. De Vries bezeichnete die von Mendel beschriebenen Teilchen der Vererbung als »Pangene«, und einige Jahre später ließ der dänische Genetiker Wilhelm Ludvig Johannsen das »Pan« einfach weg.[32]
Johannsen nahm noch zwei weitere wichtige Wörter in die Sprache der modernen Biologie auf. Er prägte den Begriff Genotyp und unterschied ihn vom Phänotyp. Im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet man als Genotyp sämtliche Gene eines Organismus, das heißt, seine gesamte DNA; zum Phänotyp dagegen gehört alles, was man an dem Organismus beobachten kann: seine Größe, seine Farbe, ob er einen Schwanz, Federn oder einen Panzer besitzt. Der Unterschied ist von entscheidender Bedeutung, denn mit seiner Hilfe können wir Ursache und Wirkung auseinanderhalten, wenn Lebewesen sich verändern. Ein Beispiel ist das Wort Mutation, das bereits 200 Jahre zuvor für jede dramatische Veränderung im äußeren Erscheinungsbild eines Lebewesens verwendet wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts wandte man es manchmal auf Mendels Erbeinheiten an, manchmal aber auch auf das Lebewesen (den Phänotyp), und das führte zu einer endlosen Verwirrung im Zusammenhang mit den Ursachen und Wirkungen von Veränderungen.[33]100 Jahre später wissen wir, dass Mutationen den Genotyp verändern, beispielsweise den Bauplan für die lichtempfindlichen Opsinproteine bei manchen unserer entfernten Vorfahren unter den Tieren. Solche Genotypveränderungen können auch zu einem Wandel des Phänotyps führen, und manche Veränderungen des Phänotyps werden zu Innovationen – neuen, nützlichen Eigenschaften – wie unserer Fähigkeit, die Welt farbig zu sehen.
Nachdem wir nun den Unterschied zwischen Genotyp und Phänotyp kennen, können wir eine Frage stellen, die für die Innovationsfähigkeit des Lebendigen von entscheidender Bedeutung ist: Wie verursachen Mutationen eine Veränderung im Phänotyp und erzeugen damit eine Innovation? Das war die andere große Frage, die man zur Zeit von Darwins Tod noch nicht beantwortet hatte: Woher kommen die Neuerungen? Woher stammen die neuen Varianten, auf die die Selektion angewiesen ist? Und woher stammen insbesondere diejenigen Varianten, die einen Organismus verbessern, ihm zu einem etwas längeren Überleben verhelfen, einem Paarungspartner attraktiver erscheinen oder zu mehr Nachkommen führen? Die Frage könnte man mit einer inhaltsleeren Plattitüde beantworten: Neue Varianten entstehen zufällig. Diese Formel hört man auch heute noch, aber sie war schon Darwin vertraut. Und er wusste, dass damit eigentlich nichts erklärt ist. Das Kapitel über die Gesetze der Abänderung in der Entstehung der Arten eröffnet er mit den Worten:
Ich habe bisher von den Abänderungen … zuweilen so gesprochen, als ob dieselben vom Zufall abhängig wären. Dies ist natürlich eine ganz inkorrekte Ausdrucksweise; sie dient aber dazu, unsere gänzliche Unwissenheit über die Ursache jeder besonderen Abweichung zu beurkunden.
Das ist kein geringfügiges Problem, denn die natürliche Selektion ist keine kreative Kraft. Sie bringt keine Neuerungen hervor, sondern wählt nur unter dem bereits Vorhandenen aus. Darwin erkannte, dass die natürliche Selektion den Neuerungen die Verbreitung ermöglicht, aber woher sie ursprünglich stammen, wusste er nicht.
Um einschätzen zu können, was für ein großes Problem das ist, müssen wir nur daran denken, dass jeder einzelne Unterschied zwischen den Menschen und den ersten Lebensformen auf der Erde irgendwann einmal eine Innovation war, eine Anpassung an irgendeine einzigartige Herausforderung, vor der ein Lebewesen stand. Das könnte die Herausforderung gewesen sein, die Lichtenergie der Sonne in lebende Materie umzuwandeln. Oder die Herausforderung, ein anderes Lebewesen in Nährstoffe umzuwandeln. Oder sich einfach von einem Ort zum anderen zu bewegen. Jeder Quadratmeter der Erdoberfläche, jeder Kubikmeter der Ozeane, jede Wiese, jeder Wald und jede Wüste, jede Stadt und jedes Wohnviertel ist zum Bersten voller Lebewesen, und jedes Lebewesen besitzt unzählige derartige Neuerungen. Grundlegende Innovationen wie Photosynthese und Atmung. Schützende wie Reptilienschuppen und isolierende Federn. Stützende wie Bindegewebe und Skelett. Manche sind kompliziert und bestehen aus Hunderten von beweglichen Teilen, andere sind einfach. Aber ganz gleich, wie groß oder klein die Innovationen sind, von den drei Metern der Schwanzfluke eines Blauwals bis zu den zehn Mikrometern der Flagellen eines Bakteriums, jede einzelne existiert nur deshalb, weil irgendwann seit der Entstehung des Lebendigen die richtige Variation auf der Bildfläche erschien.
Die Selektion hat alle diese Variationen nicht erschaffen – das kann sie nicht. Am besten formulierte es Hugo de Vries einige Jahrzehnte nach Darwin, als er sagte: »Die natürliche Selektion erklärt vielleicht das Bestehen des Geeignetsten, aber nicht das Entstehen des Geeignetsten« (Hervorhebung hinzugefügt).[34] Und wenn wir nicht wissen, wie seine Entstehung zu erklären ist, dann verstehen wir auch nicht die eigentlichen Ursprünge der Vielfalt des Lebendigen.
Leben kann Neuerungen hervorbringen – es ist innovationsfähig. Und damit nicht genug: Es kann Neuerungen hervorbringen und gleichzeitig alles, was funktioniert, durch originalgetreue Vererbung beibehalten. Es kann das Neue erkunden und das Alte erhalten. Es ist fortschrittlich und konservativ zugleich. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die Biologen keine Ahnung, wie so etwas möglich ist. Wie wir noch genauer erfahren werden, konnten sie es nicht wissen. Die Entdeckungen eines ganzen Jahrhunderts waren notwendig, bevor das experimentelle und theoretische Werkzeugarsenal der Biologie so leistungsfähig war, dass man diese Frage angehen konnte.
Im Rückblick ist es sogar bemerkenswert, dass die Wissenschaftler zu Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt zwischen Genotyp und Phänotyp unterscheiden konnten. Von der materiellen Grundlage der Mendel’schen Vererbung wussten sie ebenso wenig wie Muybridge von der Farbfotografie. Es war nicht einmal klar, ob Gene immaterielle Begriffe wie die Schwerkraft waren oder physische Objekte, die man aus einem Organismus isolieren und untersuchen kann.[35] Erst sehr viel später wurde klar, dass Gene sehr handfest sind: Sie liegen auf den Chromosomen und bestehen aus DNA.
Schon bevor man die physische Realität der Gene kannte, fachte Mendels Entdeckung eine alte Kontroverse wieder an, die seit Darwin vor sich hingeköchelt hatte. Die Vererbung abgegrenzter, teilchenartiger Faktoren widerspricht einer naheliegenden Tatsache, die uns allen vertraut ist. Wenn ein 1,80 Meter großer Mann und eine Frau von 1,50 Metern Kinder bekommen, würde die Vererbung abgegrenzter Faktoren verlangen, dass die Kinder so groß sind wie ein Elternteil – entweder 1,80 oder 1,50 Meter –, aber nicht irgendwo dazwischenliegen.[36] Andererseits wissen wir aber alle, dass die Größe von Kindern ein ununterbrochenes Spektrum bildet, und das Gleiche gilt für die Form des Gesichts, die Hautfarbe, die Umrisse der Knochen und so weiter. Seit Darwin fanden die Naturforscher überall um sich herum eine solche kontinuierliche, von Vermischung geprägte Vererbung, sei es beim Ertrag von Getreidepflanzen, dem Gewicht von Eiern, der Größe von Blättern – kurz gesagt, in den meisten Eigenschaften der Lebewesen.[37] Solche Variationen sind in der Natur mit Sicherheit von großer Bedeutung.
Die Kontroverse drehte sich um die Frage, welche Form der Variation, die kontinuierliche oder die abgegrenzte, für die Evolution wichtiger ist. Die naturalistische oder gradualistische Denkschule – einer ihrer ersten Anhänger war Darwin – legt das Schwergewicht auf die kleinen, kontinuierlichen Schwankungen, die wir überall um uns herum beobachten. Die andere Schule – die »Mendelisten«, »Mutationisten« oder »Saltationisten« – glaubte an große, abgegrenzte Varianten, wie Mendel sie studiert hatte. In einer Karikatur der Diskussion würde der Gradualist sich vorstellen, dass die vielen Blütenblätter einer Zierrose aus dem Vorfahren mit seinen fünf Blütenblättern dadurch entstanden ist, dass im Laufe vieler Generationen immer mehr Blütenblätter hinzukamen. Der Mutationist dagegen würde die Ansicht vertreten, dass die Rose mit ihren vielen Blütenblättern durch eine einzige sprunghafte »Makromutation« aus ihrem Vorfahren entstanden ist.[38]
Im Rückblick scheint diese Diskussion die gleiche Wichtigkeit zu haben wie eine Frage, die den Gelehrten des Mittelalters eine Beschäftigung gab: Wie viele Engel können auf einem Stecknadelkopf tanzen? Damals jedoch zielte sie auf das Kernstück des Darwinismus. Die Mendelisten glaubten weniger an die natürliche Selektion als vielmehr an die Möglichkeit, dass Mutationen neue Merkmale hervorbringen. Für die eigentlichen Triebkräfte hinter der Evolution des Lebendigen hielten sie große Mutationen, durch die Individuen entstanden, die weit außerhalb der Norm ihrer Spezies standen. Der deutschstämmige Zoologe Richard Goldschmidt bezeichnete solche Exemplare als hopeful monsters oder »hoffnungsvolle Ungeheuer«, und als Beispiel nannte er die Plattfische, die am Meeresboden leben und beide Augen auf derselben Kopfseite tragen.[39]
Am Ende stellte sich zwar heraus, dass die Mendelisten unrecht hatten – evolutionärer Wandel läuft tatsächlich meist ganz allmählich und unter Beteiligung der natürlichen Selektion ab –, aber in einem Punkt lagen sie richtig. Das eigentliche Rätsel der Evolution ist nicht die Selektion, sondern die Entstehung neuer Phänotypen. Aber die Wissenschaftler jener Zeit waren zu früh geboren. Sie konnten wild spekulieren, hatten aber keine Möglichkeit, das Rätsel zu lösen. Die Kontroversen zwischen den beiden Lagern setzten sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fort und wurden erst durch weitreichende neue Erkenntnisse beigelegt. Das begann, als man einer seit langem bekannten Tatsache neues Gewicht beilegte: Genetische Veränderungen spielen sich nicht einfach in Individuen ab, sondern in Populationen.
Der helle Birkenspanner ist ein ganz und gar unauffälliges Insekt; seine weißen Flügel sind mit schwarzen Flecken gesprenkelt. Vor dem Hintergrund von Baumrinden und Flechten tarnt sich der Schmetterling mit seinem Fleckenmuster vor gefräßigen Vögeln. Bei manchen Birkenspannern kann ein Gen, das Auswirkungen auf die Flügelfarbe hat, mutieren und erzeugt dann dunkle Flügel. Eine solche Mutation ist in der Regel für den Schmetterling schlecht, denn die mutierten Exemplare sind nicht mehr getarnt und werden für die Vögel zur leichten Beute. Im 19. Jahrhundert jedoch verschaffte die Industrielle Revolution in England den dunklen, mutierten Schmetterlingen die dringend benötigte Atempause. In dieser Epoche herrschte eine so starke Luftverschmutzung, dass die meisten Flechten verschwanden und Baumrinden schwarz wurden. Jetzt waren die dunklen Schmetterlinge auf einmal gut versteckt, und ihre weißen Vettern wurden zur Nahrung für die Vögel.
Wenn die natürliche Selektion eine Rolle spielte, würden wir damit rechnen, dass die schwarzen Schmetterlinge im Laufe der Zeit häufiger wurden. Sie würden sich in der Population der Schmetterlinge ausbreiten, während die weißen Exemplare seltener wurden. Das geschah während des 19. Jahrhunderts in England tatsächlich: Der Anteil der schwarzen Schmetterlinge in der Population stieg zwischen 1848 und 1895 von 2 auf 95 Prozent an.[40] Aber diese Information ist nicht annähernd so wichtig wie die Frage, die von ihr aufgeworfen wird: Können wir voraussagen, wie schnell die Mutation sich in der Population ausbreitet? Oder umgekehrt: Angenommen, wir haben beobachtet, wie schnell sie sich ausbreitet – können wir dann Rückschlüsse darüber ziehen, wie stark die dunkle Farbe sich auf die Fitness auswirkt, das heißt auf die Chancen des Schmetterlings, sich vor den Vögeln zu verbergen? Solche quantitativen, mathematischen Fragen waren in der Evolutionsforschung etwas Neues. Und sie ließen in der Biologie ein neues, quantitatives Teilgebiet entstehen: die Populationsgenetik.
Eine der zentralen Erkenntnisse der Populationsgenetik lautet: Eine Population ist nicht nur eine Ansammlung einzelner Lebewesen, sondern auch ein gemeinsamer Vorrat an Genen (ein »Genpool«). Die Gene, die beispielsweise über die Flügelfarbe eines Schmetterlings bestimmen, kommen in unterschiedlichen Formen vor – der Fachbegriff lautet Allele –, und diese Formen sorgen für die hellen oder dunklen Flügel, die in der Population mit unterschiedlicher Häufigkeit oder Frequenz vorkommen. Stellen wir uns einmal vor, zu einem bestimmten Zeitpunkt seien beide Allelformen in der Population in gleicher Anzahl vorhanden, und nun kommt ein neuer Faktor hinzu – ein neuer natürlicher Feind oder eine Veränderung der Luftverschmutzung –, der Schmetterlingen mit dunkleren Flügeln ein längeres Leben und damit auch die Produktion von mehr Nachkommen ermöglicht. Der Vorteil muss nicht groß sein: Schon ein Anstieg des Allels für dunkle Flügel um nur ein Prozent, also von 50 auf 51 Prozent in der ersten Generation, kann sich im Laufe der Zeit summieren, so dass die Varianten mit dunklen Flügeln einen immer größeren Anteil der Population stellen. So funktioniert die natürliche Selektion: Sie verändert Allelhäufigkeiten und damit im Laufe der Zeit das äußere Erscheinungsbild der einzelnen Exemplare.
Das war ein revolutionärer Gedanke. Bisher hatte man sich bei der Erforschung des Lebendigen seit Aristoteles mehr oder weniger der gleichen Hilfsmittel bedient: genaue Beobachtung und Sezieren im Freiland und im Labor, alles festgehalten in Skizzenbüchern und Notizen. Jetzt kamen die mathematischen Methoden der Differentialgleichungen und der Varianzanalyse hinzu. Durch die Arbeiten überragender Köpfe, darunter Sewall Wright, J.B. S. Haldane und der Statistiker R.A. Fisher, entwickelte sich die Populationsgenetik zu einer Theorie, mit der man gezielte, quantitative Fragen nach der natürlichen Selektion beantworten konnte. Parallel dazu studierten Naturforscher die Allelhäufigkeit in wilden Populationen wie denen des Birkenspanners, und experimentelle Wissenschaftler vollzogen die Evolution im Labor nach, indem sie dort Populationen kleiner, sich schnell vermehrender Tiere wie der Taufliegen erforschten. Dabei war die mathematische Theorie der Mörtel, der die Bausteine solcher Beobachtungen zu einem Gedankengebäude verband.
Die neuen Befunde der Populationsgenetik machten deutlich, dass es ein breites Spektrum verschiedener Variationen gibt, von der »reinen« Mendel’schen Variation als einem Extrem bis hin zu kontinuierlichen Schwankungen auf der anderen Seite. Mendel’sche Phänotypen – die Farbe der Flügel, die Form von Erbsen – werden durch ein einziges Gen beeinflusst, das große Auswirkungen hat. Über kontinuierlich schwankende Phänotypen wie die Körpergröße bestimmen dagegen mehrere Gene, von denen jedes nur einen geringfügigen Effekt hat. Mit den Methoden der Populationsgenetik konnte man zeigen, dass die natürliche Selektion sich auf Gene beider Typen auswirkt. Wirklich überraschend war aber, wie stark der Einfluss sein kann. Wenn ein Allel für dunkle Flügel die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schmetterling gefressen wird, nur um wenige Prozent vermindert, kann es das Allel für helle Flügel innerhalb weniger Dutzend Schmetterlingsgenerationen völlig verdrängen. Und sowohl Naturforscher als auch experimentelle Wissenschaftler fanden in ihren Populationen weitaus mehr Gene mit kleinen Wirkungen als solche, die einen großen Effekt haben. Mendel hatte seine Erbsen eindeutig besonders sorgfältig ausgewählt, denn Mendel’sche Merkmale, die unter dem Einfluss eines einzigen Gens stehen, machen nur einen winzigen Anteil aller Merkmale aus.[41] In den meisten Fällen macht Evolution keine großen Sprünge, sondern sie verläuft ganz allmählich.[42]
In den 1930er Jahren waren die Kenntnisse über natürliche Selektion, das Wesen der Vererbung und die Populationsgenetik in ein Gedankengebäude eingeflossen, das nach einem maßgeblichen Buch des Biologen Julian Huxley als moderne Synthese bezeichnet wurde.[43] Anders als der Name besagt, ist diese Synthese also schon bald ein Jahrhundert alt. Aber im Gegensatz zu den meisten Hundertjährigen zeigt sie keinerlei Alterserscheinungen. Durch mathematische Verfeinerungen und moderne Daten gestärkt, ist sie von ungebrochener Vitalität und nach manchen Maßstäben sogar stärker als je zuvor. Sie spielt eine immer wichtigere Rolle für unsere Erkenntnisse über die Biologie des Menschen: So hilft sie mit, den Ursprung der Menschen zu rekonstruieren, ihre Wanderungsbewegungen zu verfolgen und genetisch bedingte Krankheiten zu verstehen. Wäre dieses Gedankengebäude ein physisch greifbares Bauwerk, es könnte mit allem mithalten, was Architekten sich jemals ausgedacht haben, von den Palästen von Angkor Wat und dem Grabmal des Taj Mahal bis zu den großartigen gotischen Kathedralen des 13. Jahrhunderts. Es ist eine der großen geistigen Errungenschaften der Menschheit.
Aber hinter dem Erfolg der modernen Synthese steht ein schmutziges Geheimnis. Ihre Architekten konzentrierten sich auf Kosten des einzelnen Lebewesens und seines Phänotyps auf den Genotyp. Sie übersahen die großartige Komplexität der Lebewesen mit ihren Billionen Zellen, von denen jede Milliarden Moleküle enthält, deren Funktionen wiederum unglaublich komplex sind. Und sie übersahen, wie die ganze Komplexität aus einer einzigen befruchteten Zelle hervorgeht und wie die Gene zu dieser Entfaltung beitragen. Indem sie die Komplexität außer Acht ließen, ignorierten die Architekten der modernen Synthese letztlich auch ihr Produkt: das Lebewesen als solches. Das taten sie wissentlich, denn sie wollten verstehen, wie sich Genhäufigkeiten im Laufe der Zeit verändern. Indem sie sich auf den Genotyp konzentrierten, vereinfachten sie den Phänotyp eines Lebewesens auf eine Reihe einfacher Größen wie der Fitness, das heißt der durchschnittlichen Zahl von Genen, die ein typisches Individuum an die nächste Generation weitergibt. (Fittere Lebewesen tragen mehr Gene zum Genpool der nächsten Generation bei.) Und das ist noch nicht alles: Sie gingen auch davon aus, dass einzelne Gene auf einfache Weise über die Fitness mitbestimmen, zum Beispiel weil die Fitness die Gesamtsumme vieler kleiner Genwirkungen ist.
Damit ich nicht falsch verstanden werde: Die moderne Synthese wäre kaum möglich gewesen, ohne dass man das einzelne Lebewesen außer Acht ließ. Der Preis des Verstehens ist immer die Abstraktion, mit der man den größten Teil einer atemberaubend komplexen Welt missachtet, um ein winziges Bruchstück davon zu begreifen. Oder um es mit den Worten von Albert Einstein zu sagen – auch er ein Theoretiker, der wusste, wovon er sprach: »Man sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher.«[44] Die moderne Synthese war gerade so einfach, wie sie sein musste, damit man Tausende von Fragen nach der Evolution der Gene und Genotypen beantworten konnte. Dass sie so viel dazu beitrug, die Wirkungsweise der natürlichen Selektion aufzuklären, lag gerade daran, dass man die Komplexität der Lebewesen beiseiteließ. Aber wenn eine Theorie erfolgreich ist, vergisst man nur allzu leicht ihre Grenzen. Genau das geschah in der Blütezeit der modernen Synthese, als man die Pracht der Evolution des Lebendigen neu definierte und zur »Veränderung der Genhäufigkeit in einem Genpool« degradierte.[45] Ihre grundlegende Beschränkung – die ein hoher Preis war – lag in der Unmöglichkeit, mit ihr die zweite große Frage zu beantworten, die in der Entstehung der Arten offengeblieben war: Woher kommen neue Phänotypen? Die moderne Synthese konnte erklären, wie Neuerungen sich verbreiten, aber nicht, wie sie entstehen.
Dennoch wäre die Behauptung, alle Evolutionsforscher hätten den Organismus unter den Tisch fallenlassen, unfair gegenüber einer Minderheit von ihnen: Diese Wissenschaftler stellten vergleichende Untersuchungen darüber an, wie sich die Komplexität der einzelnen Lebewesen in ihren Embryonen entfaltet. Aber die Embryologen, deren Vorläufer dazu beigetragen hatten, dass Darwin die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen erkannte, wurden von der modernen Synthese und ihren Anhängern ins Abseits gedrängt, denn die hatten an Embryonen keinen Bedarf. Im Jahr 1932, ein Jahr bevor er den Nobelpreis bekam, weil er gezeigt hatte, wie Gene in Chromosomen organisiert sind, erklärte der Fliegengenetiker Thomas Hunt Morgan, es spiele keine große Rolle, »ob man sich für einen Menschenaffen oder den Fetus eines Menschenaffen als Vorläufer des Menschengeschlechts entscheidet«.[46]
Aber auch wenn die Populationsgenetiker in den Machtzentren der Biologie das Sagen hatten, nahmen einige Embryologen aus der zweiten Reihe die Meinungsführer weiterhin in die Zange: Diese, so erklärten sie, ignorierten genau das, was sie zu erklären versuchten. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden ihre Stimmen lauter. Zu jener Zeit entwickelte sich die evolutionäre Entwicklungsbiologie, nach dem englischen evolutionary developmental biology häufig kurz »Evo-Devo« genannt; das neue Fachgebiet bemüht sich darum, Embryonalentwicklung, Evolution und Genetik unter einem Dach zu vereinigen. Die Evo-Devo lieferte großartige neue Erkenntnisse darüber, wie Gene nach Art von Orchestermusikern zusammenwirken und so die Embryonalentwicklung möglich machen.
Bisher sind solche Erkenntnisse allerdings nicht in einer Theorie zusammengeflossen, die es mit der modernen Synthese aufnehmen könnte. Und nur eine Theorie kann einen Haufen Tatsachen zu einem Turm des Wissens machen. Schuld ist wieder einmal die ungeheure phänotypische Komplexität ganzer Lebewesen. Selbst heute haben wir noch Mühe, den Phänotyp selbst der einfachsten Lebewesen vollständig zu verstehen, und Hunderttausende von Biologen konnten trotz jahrzehntelanger Bemühungen nicht vollständig aufklären, wie die Gene einen solchen Phänotyp gestalten.[47] War die moderne Synthese eine Theorie ohne Phänotypen, so haben die Embryologen Phänotypen ohne eine Theorie.
Dennoch hat uns die Evo-Devo eine wichtige Lehre erteilt. Wenn wir die Innovationsfähigkeit verstehen wollen, dürfen wir die Komplexität der Phänotypen nicht außer Acht lassen, sondern wir müssen sie einbeziehen. Und auch wenn wir die Komplexität eines Lebewesens noch nicht vollständig verstehen, wissen wir etwas über die Teile seines Phänotyps, die letztlich sämtliche Neuerungen hervorbringen. Davon wird im nächsten Kapitel die Rede sein.
In demselben Jahrhundert, das die Biologie von Darwin über Mendel zur modernen Synthese führte, wurde auch die Biochemie geboren, eine Wissenschaft, die man eigentlich schon Jahrtausende zuvor erdacht hatte, als die Menschen erstmals Bier und Wein herstellten. Aber der Mechanismus, durch den Hefe den Zucker in Alkohol verwandelt, blieb rätselhaft. Erst drei Jahre bevor Darwins Entstehung der Arten erschien, konnte Louis Pasteur nachweisen, dass Lebewesen die Gärung bewerkstelligen. Und selbst diese Erkenntnis wurde einige Jahrzehnte später über den Haufen geworfen, denn 1897 zeigte Eduard Buchner, dass Gärung keine Lebewesen erfordert: Auch Hefeextrakte, die keine lebenden Zellen enthalten, können Zucker vergären lassen. Seine Entdeckung trug dazu bei, dem Vitalismus ein Ende zu machen, der Vorstellung, Leben erfordere eine rätselhafte Lebenskraft und unterliege Gesetzen, die sich von denen der unbelebten Welt unterscheiden.
Die Erkenntnis, dass Leben auf prosaischer Chemie basiert, ist wichtig, aber besser blieb Buchner als Pionier bei der Entdeckung der Enzyme in Erinnerung, riesiger Proteinmoleküle, die aus Dutzenden bis Tausenden von Aminosäuren bestehen.[48] Sie beschleunigen chemische Reaktionen, durch die Atome getrennt, verbunden oder neu angeordnet werden, und das manchmal milliardenfach. In der Biochemie wird Buchner bis heute dadurch geehrt, dass man weiterhin sein Benennungssystem für Enzyme verwendet: An die von ihnen katalysierte Reaktion wird die Endung -ase angehängt. Ein Enzym, das den Zucker Saccharose verarbeiten kann, heißt also Saccharase, wenn es Lactose verarbeitet, wird es Lactase genannt, und so weiter.
Aus Buchners Entdeckungen ging auch ein weiterer Zweig der Biochemie hervor. Hier konzentrierte man sich nicht auf die Enzyme, sondern auf die von ihnen katalysierten Reaktionen und drang damit in eine ganz neue chemische Welt vor – die Welt des Stoffwechsels mit seiner verwirrenden Komplexität. Grob gesagt, besteht der Stoffwechsel oder Metabolismus eines Organismus – der Fachbegriff stammt von dem griechischen Wort für »Wandel« ab – aus zwei Typen chemischer Umwandlungen. Bei den einen werden energiereiche Moleküle wie der Zucker Glucose gespalten, wobei Energie gewonnen wird. Die anderen verwenden diese Energie, um Nährstoffmoleküle in die eigenen Molekülbausteine einer Zelle umzuwandeln, darunter Dutzende von Molekülen wie die Aminosäuren in den Proteinen. Nebenbei muss der Stoffwechsel mit den Abfallstoffen des Organismus umgehen können und giftige Moleküle durch Umwandlung in harmlose Verbindungen unschädlich machen. Insgesamt erfordern diese komplizierten Abläufe mehr als 1000 chemische Reaktionen – einschließlich der Enzyme, von denen sie katalysiert werden –, um unseren Körper aufzubauen und instand zu halten.[49]
Die Entdeckung, dass Enzymproteine für den Aufbau unseres Phänotyps sorgen, war in der Biochemie des 20. Jahrhunderts von gewaltigem Gewicht. (Sie führte auch zu einer entscheidenden Erkenntnis über die Kreativität des Lebendigen: Selbst die größten Veränderungen in einem Organismus sind die Folgen der Abwandlung einzelner Moleküle.) Aber selbst diese Entdeckung wurde durch eine noch größere in den Schatten gestellt: die Aufklärung der chemischen Struktur unserer Gene.
Auch diese Geschichte beginnt zu Darwins Zeit, genauer gesagt 1869, im gleichen Jahr, in dem auch die fünfte Auflage der Entstehung der Arten erschien.[50] Damals identifizierte der Schweizer Chemiker Friedrich Miescher erstmals eine rätselhafte neue Substanz, die sich von den Proteinen unterschied.[51] Er bezeichnete sie als Nuklein, ihr chemischer Aufbau wurde aber erst Jahrzehnte später geklärt. Im Jahr 1910 erfuhr man, dass die Substanz – die man jetzt in Desoxyribonukleinsäure (DNA) umbenannt hatte – die vier Basen Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T) enthält, Moleküle, von denen wir heute wissen, dass sie die vier Buchstaben des DNA-Alphabets darstellen. Und erst 1944 wurde den Biologen klar, dass die DNA der Stoff der Vererbung ist. In jenem Jahr wies Oswald Avery nach, dass DNA aus einem krankheitsverursachenden Stamm des Bakteriums Streptococcus pneumoniae einen anderen, ansonsten harmlosen Stamm in die Lage versetzt, Mäuse zu töten.[52]
Ein weiteres knappes Jahrzehnt später machten James Watson und Francis Crick klar, dass die DNA ein Molekül von überragender Schönheit ist. Ihre beiden Stränge bilden die berühmte Doppelhelix, eine Art verdrehte Strickleiter, in der jeweils zwei Basen aus den beiden Strängen sich paaren und die einzelnen Sprossen bilden. In jeder Sprosse sind immer die gleichen Basen gepaart: A mit T und C mit G. Aufgrund ihrer Struktur ist auch sofort klar, wie die DNA kopiert werden kann und wie die Vererbung demnach auf der Ebene der Moleküle funktioniert.[53] Damit hatte sich herausgestellt, dass Gene viel mehr sind, als Johannsen geglaubt hatte.
70 Jahre hatte es von Muybridges Zoopraxiskop bis zum Farbfernsehen gedauert – von der Aufzeichnung einzelner Schwarzweißbilder auf Silberplatten bis zur Codierung farbiger Bilder als elektrische Signale, die drahtlos übertragen und mit Kathodenstrahlröhren angezeigt wurden. In den gleichen 70 Jahren hatte auch die Biologie dramatische Fortschritte gemacht und neue Entdeckungen mit ebenso viel Begeisterung in sich aufgenommen. Sie hatte die Vermählung mit der Mathematik der Populationsgenetik vollzogen und die moderne Synthese geboren. Sie hatte die Funktion der Enzyme aufgeklärt und die Struktur der DNA entdeckt (und das ungefähr zur gleichen Zeit, die auch das Farbfernsehen gebracht hatte). Sie hatte sich Kenntnisse über die Chemie zu eigen gemacht, die unentbehrlich werden sollten, wenn man die Ursprünge der Neuerungen verstehen wollte. So weit war sie noch nicht. Aber sie kam dem Ziel näher.
Die Entdeckung von Watson und Crick leitete das Zeitalter der Molekularbiologie ein. Während der nächsten zwölf Jahre lernten die Biologen, dass DNA in die eng mit ihr verwandte Ribonucleinsäure (RNA) umgeschrieben oder transkribiert wird, die dann ihrerseits in Abschnitten von jeweils drei Nucleotidbuchstaben in die Aminosäurekette eines Proteins übersetzt oder translatiert wird (Abbildung 1). Die Translation erfolgt nach einem genetischen Code, in dem die meisten der 64 möglichen Wörter aus jeweils drei Buchstaben eine einzige Aminosäure codieren. Nur wenige Wörter erfüllen andere Funktionen und signalisieren Anfang und Ende einer Proteinkette.
Wenn man die Reihenfolge oder Sequenz der DNA-Buchstaben eines Gens kennt, kann jedes Kind daraus die Aminosäuresequenz eines Proteins ableiten. Damit ist der einfache Teil aber auch schon zu Ende. Proteine falten sich zu komplizierten dreidimensionalen Formen, die in sich wackeln und vibrieren. Um zu verstehen, wie sie ihre Aufgabe erfüllen und beispielsweise chemische Reaktionen beschleunigen, muss man sowohl die Form als auch ihre Schwingungen verstehen. Bis heute sind wir nicht in der Lage, das eine oder andere anhand der Reihenfolge der Aminosäurebausteine in der Kette vorauszusagen – so kompliziert und raffiniert sind die Regeln, die der Faltung zugrunde liegen. Natürlich ging man schon in den 1950er Jahren daran, die Faltung der Proteine mit Experimenten zu erforschen; den Anfang machten die Sauerstoff bindenden Globinproteine aus Blut und Muskeln.[54] Aber das waren mühsame Arbeiten, die vielfach Jahre dauerten. Die Aminosäurekette zu finden, die von einer DNA-Buchstabensequenz codiert wird, ist so einfach wie das Nachschlagen eines Wortes im Wörterbuch, aber daraus die Proteinfaltung abzuleiten ist weitaus schwieriger und ähnelt ein wenig dem Versuch, ein Gedicht von Yeats ins Chinesische zu übersetzen.
Das ist keine gute Nachricht, wenn man verstehen will, woher neuartige Phänotypen kommen. Den Phänotyp eines Lebewesens mit allen seinen Aspekten zu verstehen, sei es die Farbe eines Flügels, die Sehschärfe der Augen oder die Stabilität eines Knochens, bedeutet letztlich, dass man die Moleküle versteht, die den Organismus aufbauen, denn sie sind die kleinsten Bausteine des Phänotyps. Wenn wir ihre Form nicht voraussagen können, ist es unmöglich, den ganzen Weg vom Genotyp bis zum Phänotyp nachzuzeichnen. Aber entlang dieses Weges findet die Natur ihre Neuerungen. Solange wir seine Windungen und Wendungen, seine Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrszeichen nicht kennen, wissen wir über die Innovationsfähigkeit des Lebendigen kaum mehr als Darwin.
Und es kommt noch schlimmer, denn Proteine arbeiten nicht allein. Wenn es um die Bewältigung komplexer Aufgaben geht, kooperieren sie wie die Arbeiterinnen in einem Bienenstock. Ein Beispiel ist das Hormon Insulin, eine Botensubstanz, die von der Bauchspeicheldrüse produziert wird und unseren Leberzellen die Anweisung erteilt, Glucose aufzunehmen und zu verarbeiten. Insulin dringt aber nicht unmittelbar in die Leber ein, sondern es bindet an der Oberfläche der Leberzellen an ein weiteres Protein, den Insulinrezeptor. Der Rezeptor wandelt daraufhin im Zellinneren ein anderes Protein ab, und damit beginnt eine Kette von Interaktionen zwischen verschiedenen Proteinen; am Ende werden schließlich die Gene aktiviert, die für die Verarbeitung von Glucose notwendig sind. In jedem Augenblick unseres Lebens wandern Tausende solcher Signale kreuz und quer durch unseren Organismus und werden im Inneren der Zellen weiterverarbeitet. Seit der Entdeckung von Watson und Crick klären die Molekularbiologen zunehmend solche Prozesse auf. Sie gingen von einigen offenen Fragen aus und brachten die molekularen Netzwerke ans Licht, die es uns ermöglichen, zu essen, uns zu bewegen, zu sehen, zu hören, zu denken, zu schmecken, zu schlafen und allen unseren sonstigen Tätigkeiten nachzugehen.
Aber die Sache war schwieriger als erwartet. Tausende von Mannjahren sind bereits in solche Projekte geflossen, und ein Ende ist nicht annähernd in Sicht. Im Gegenteil: Je mehr wir in Erfahrung bringen, desto mehr Maschen des Netzes werden sichtbar, desto komplizierter und verworrener sieht es aus. Die Straße vom Genotyp zum Phänotyp erstreckt sich bis zum Horizont und darüber hinaus.
Während des ganzen 20. Jahrhunderts ließen sich viele Evolutionsbiologen von so viel Komplexität nicht beirren. Sie sonnten sich im Glanz der modernen Synthese und konzentrierten sich glückselig auf den Genotyp. Noch größer wurde die Konzentration, nachdem Watson und Crick mit ihren Arbeiten den Ozean unseres Unwissens aufgewühlt hatten und nachdem man neue technische Verfahren entwickelt hatte, mit denen man die Buchstabenfolge der DNA-Moleküle besser ablesen konnte. Diese Methoden wurden zum Ausgangspunkt für das neue Forschungsgebiet der molekularen Evolutionsbiologie, die sich mit den Varianten von Aminosäure- und DNA-Ketten beschäftigt. In ihrer ersten Ausprägungsform war die neue Technologie ungefähr ebenso ineffizient wie Muybridges Zoopraxiskop: Mit der Arbeit eines Jahres brachte man nicht mehr als ein paar hundert Buchstaben in Erfahrung. Mitte der 1980er Jahre jedoch war ihre Leistungsfähigkeit auf mehr als das Zehnfache gestiegen, genug, um kurze DNA-Sequenzen mehrerer Individuen aus einer Population aufzuklären.[55]
Als die Molekular-Evolutionsbiologen sich dieser Methodik bedienten, entdeckten sie etwas, womit niemand gerechnet hatte: Überall gibt es eine ungeheure Menge von genetischen Variationen, selbst in Lebewesen, die sich seit vielen Jahrtausenden nicht verändert haben.
In einem der ersten Forschungsprojekte aus der molekularen Evolutionsbiologie ging es um die Alkoholdehydrogenase, ein Enzym, das am Abbau von Ethanol mitwirkt. Wir besitzen ein Gen für dieses Enzym, und Taufliegen besitzen es auch. Ob sie sich an vergorenen Früchten ebenso berauschen können wie ein Wermutbruder am Schnaps, weiß niemand, aber mit Sicherheit lassen sie sich damit anlocken, und sie brauchen das Enzym, um keine Alkoholvergiftung zu erleiden. Wie Martin Kreitman von der Harvard University 1983 entdeckte, enthält die DNA einer kleinen Stichprobe von Taufliegen in dem betreffenden Gen mehr als 43 verschiedene Varianten des DNA-Textes.[56] Ähnliche Varianten kommen auch bei Menschen vor. Eine davon verursacht eine Form der Alkoholunverträglichkeit: Bei den Betroffenen bilden sich auf Gesicht und Körper rote Flecken, eine Krankheit, die bei Menschen mit asiatischer Abstammung so verbreitet ist, dass man sogar vom »asiatischen Ausschlag« spricht.[57]
Noch aufschlussreicher aber war, was Kreitman in dem Gen für die Alkoholdehydrogenase nicht fand. Die meisten Mutationen in diesem Gen waren stumm. Durch sie veränderte sich zwar die Sequenz der DNA, aber nicht die Aminosäuresequenz des Enzyms. Das ist möglich, weil der genetische Code redundant ist: Mehrere Wörter aus jeweils drei Buchstaben können die gleiche Aminosäure codieren. Der Befund kam überraschend. Trotz des redundanten Codes hätte es viel mehr Mutationen geben müssen, durch die sich Aminosäuren veränderten, denn in der Regel sorgen Mutationen nach dem Zufallsprinzip für Buchstabenveränderungen in den Genen. Irgendetwas war mit diesen Mutationen geschehen.
Das Etwas war die natürliche Selektion. Da die fraglichen Veränderungen das Enzym beeinträchtigten, hatte die natürliche Selektion sie ausgemerzt, lange bevor Kreitman sie hätte sehen können.
Kreitmans Entdeckung und andere machen eine Tatsache deutlich, die häufig übersehen wird: Die Umwälzungen in den Vorstellungen über Evolution unterscheiden sich von anderen wissenschaftlichen Revolutionen. Während beispielsweise die Revolution der Quantenphysik zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Weltbild entstehen ließ, das sich mit dem der klassischen Physik nicht verträgt, lassen die Revolutionen in der Evolutionsbiologie viele Kernelemente der früheren Theorien unangetastet.[58] Sie werfen Vergangenes nicht über den Haufen, sondern vertiefen und präzisieren es. Durch sie kommen neue Klarheit und Genauigkeit hinzu, aber auch neue Dimensionen. Mit dem Film Seabiscuit – Mit dem Willen zum Erfolg kamen zur ersten Aufzeichnung von Salie Gardners Ritt zwar Farbe, Musik, Dialoge und das Geräusch von Hufen hinzu, aber damit wurde Muybriges Erkenntnis über den Ablauf des Galopps nicht ungültig. Wo Darwin aus der Beobachtung der Natur die Wirkungsweise der Selektion ableitete, sah die moderne Synthese darin das Auf und Ab der Genhäufigkeiten, und die molekularen Evolutionsforscher fanden charakteristische Eigenschaften der DNA wie eine übergroße Zahl stummer Mutationen. Damit lösten sie einen Nebel der Verwirrung auf, den Darwin zurückgelassen hatte. (Oder wenigstens einen Teil des Nebels, denn die molekularbiologische Revolution hat uns über die Veränderungen des Genotyps mehr gelehrt als über die des Phänotyps, die das Kernstück der Frage nach der Herkunft bilden.)
Dass Kreitman im Gen für die Alkoholdehydrogenase so viele Variationen fand, ist nichts Ungewöhnliches. Tier- und Pflanzenpopulationen sind prall gefüllt mit genetischen Abweichungen. Genetische Varianten findet man sogar in Populationen lebender Fossilien, deren Phänotypen sich seit Jahrmillionen nicht verändert haben, so beispielsweise beim Quastenflosser, einer seltsamen Fischart, die als ausgestorben galt, bis man 1939 ein lebendes Exemplar fand.[59] Die große Zahl der Varianten wirft Fragen auf, mit denen sich die molekularen Evolutionsforscher bis heute beschäftigen. Sind die meisten von ihnen von Bedeutung für die Evolution des Phänotyps? Sind sie für die Innovationen des Lebendigen notwendig oder bedeutungslos? Schon ihre bloße Existenz macht deutlich, welche Schwierigkeiten sich auftun, wenn man verstehen will, was phänotypische Neuerungen sind und wie sie aus genetischen Veränderungen erwachsen.
In den 1980er Jahren verfügte man bereits über eine beeindruckende Fähigkeit, rund 1000 Buchstaben des DNA-Textes gleichzeitig zu lesen. Aber 1000 Buchstaben sind nichts im Vergleich zum Genom eines Lebewesens, der Gesamtheit seiner DNA. Sie ist beim Menschen 3 Milliarden Buchstaben lang und damit zehnmal so umfangreich wie die Encyclopaedia Britannica. Jede einzelne der Billionen Zellen in unserem Körper enthält eine Kopie davon, die in unseren 46 Chromosomen verpackt ist. Selbst die DNA eines Bakteriums wie Escherichia coli besteht aus viereinhalb Millionen Buchstaben, mehr als Krieg und Frieden, einer der längsten Romane, die jemals geschrieben wurden. Die Methoden zur DNA-Sequenzierung mussten sich noch stark verbessern, damit man auch nur das Genom eines einzigen Individuums lesen konnte, von der Katalogisierung der Variationen in einer Population ganz zu schweigen.[60] Den Anreiz zur Entwicklung einer solchen Technologie lieferte das Human-Genomprojekt, eines der größten internationalen Forschungsprojekte, das 1990 aus der Taufe gehoben und federführend von den US-amerikanischen National Institutes of Health betrieben wurde. Das ist kein Zufall, denn das Projekt zielte vor allem auf die Untersuchung von Genen ab, die Krankheiten – eine ganz besondere Art neuer Phänotypen – verursachen. Heftige Konkurrenz zu dem staatlich finanzierten Projekt ging seit 1998 von dem Unternehmen Celera Genomics und ihrem Gründer, dem Biologen und Unternehmer Craig Venter, aus. Ihnen gelang es, das Genom mit einem Zehntel der Kosten zu sequenzieren; im Jahr 2000 gingen sie gleichzeitig mit dem staatlich finanzierten Projekt durchs Ziel, und ein erster Entwurf der Sequenz des menschlichen Genoms wurde veröffentlicht.[61]
Die Sequenzierung des menschlichen Genoms war ein weiterer wichtiger Meilenstein in der biologischen Forschung: Sie lieferte eine Fülle von Informationen darüber, wie viele Gene wir besitzen, was für Proteine sie codieren, und so weiter. Als »Bauplan des Lebens« bezeichnete Präsident Bill Clinton sie im Jahr 2000 in seinem Bericht zur Lage der Nation. Aber wenn das stimmt, ist es ein sehr seltsamer Bauplan: Wir können ihn nicht dazu benutzen, das Dargestellte nachzubauen, ja er ist noch nicht einmal eine Reparaturanleitung, mit der ein Mechaniker ein Problem beheben könnte. Bisher hat das Genom die Geheimnisse unseres Phänotyps vielmehr gut bewahrt. Vielfach hatte man beispielsweise gehofft, das Genom werde uns Ja-Nein-Antworten auf die Frage liefern, ob jemand eine genetisch bedingte Krankheit bekommt. Aber Craig Venter selbst sagte 2010 in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel:
In Wirklichkeit haben wir aus dem Genom nichts erfahren außer Wahrscheinlichkeiten. Und wie soll man klinisch umsetzen, dass Sie ein um drei Prozent erhöhtes Risiko für irgendetwas haben? Solche Information ist nutzlos.[62]
Das ist eine krasse Einschätzung, aber sie enthält ein Körnchen Wahrheit. Den Grund kann man sich denken: Die Zusammenhänge zwischen Genotyp und Phänotyp sind so kompliziert, dass es unser Vorstellungsvermögen überschreitet. Das Human-Genomprojekt war nur ein Meilenstein auf dem Weg vom Genotyp zum Phänotyp. Wir sind aber damit noch nicht einmal annähernd am Ende des Weges angelangt.
Bei allen Beschränkungen hatte das Genomprojekt auch viele andere nützliche Wirkungen. Unter anderem peitschte es die Entwicklung der DNA-Sequenzierungstechnologie zu einer atemberaubend schnellen Methodik voran. Im Jahr 2000 konnte ein Mensch in 24 Stunden bis zu einer Million DNA-Buchstaben ablesen, mit den 2008 lieferbaren Sequenzierungsautomaten waren es bereits eine Milliarde Buchstaben, und seitdem haben die Methoden sich weiter beschleunigt. Zu der Zeit, da dieses Buch entsteht, kostet die vollständige Sequenzierung eines menschlichen Genoms nur etwas mehr als 1000 Dollar, und wenn es gelesen wird, sind die Kosten wahrscheinlich auf wenige Cent gesunken. Mit einer solchen Technologie können wir die Variationsbreite der Genome in großen Populationen von Menschen und vielen anderen Lebewesen erforschen. Sie hat die Populationsgenetik in eine Populationsgenomik verwandelt.
Die Populationsgenomik ist für die Untersuchung von Genotypen das Ende des Weges. Für den Phänotyp kann man das nicht behaupten. Die molekularbiologische Forschung, die Mitte der 1950er Jahre mit der Aufklärung der Funktionen und Interaktionen von Proteinen begann, setzt sich unvermindert fort. Aber in den 1990er Jahren musste sie eine neue Wendung nehmen, um weiter voranzukommen. Für Prozesse wie die vom Insulin ausgehende Signalübertragung hatte man bereits die wichtigsten Gene und die von ihnen codierten Proteine identifiziert, und man wusste, welche Wirkung diese Proteine haben und wie sie in Wechselbeziehung treten.[63] Alle diese Kenntnisse summieren sich zu einer Art Wer-ist-Wer und Wer-kennt-Wen der Zelle. In den 1990