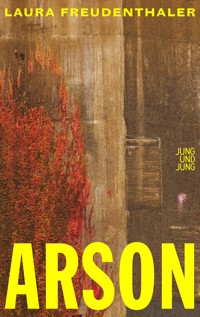
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich muss zu überleben beginnen.« Nüchtern, ruhig und gefasst beobachtet die Frau, deren Stimme wir in Laura Freudenthalers Buch hören, wie die Dinge außer Kontrolle geraten. Die Dinge in ihrem Umfeld, in ihrem Leben, die Dinge, die eine globale Katastrophe ankündigen: Überall brennen Feuer, herrscht Dürre, macht sich Hitze breit. Die Frau, die hier erzählt, registriert es mit kalter Verzweiflung und wachsender Besessenheit. Sie sucht Zuflucht, wechselt, von Träumen getrieben, ständig ihren Wohnort, tauscht die Zudringlichkeiten der Stadt gegen die Isolation am Land und entfernt sich zunehmend von der Welt, in der man bei Abendeinladungen und Festen über Beziehungen und Psychotherapien spricht. Stattdessen findet sie einen Komplizen ihrer Obsession in einem Mann, der als Experte für Wildfeuer am meteorologischen Institut arbeitet. Er leidet unter Schlaflosigkeit, weiß aber auch, dass viereinhalb Stunden Schlaf genügen, um zu überleben. Und so wacht er über den Feuerkarten, die weltweit jeden Brand verzeichnen. Als ließe sich kontrollieren, was längst außer Kontrolle geraten ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARSON
© 2023 Jung und Jung, Salzburg
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlagbild: © Laura Freudenthaler
Umschlaggestaltung: Gerald Baumgartner
ISBN 978-3-99027-304-3
LAURA FREUDENTHALER
Arson
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Kapitel 126
Kapitel 127
Kapitel 128
Kapitel 129
Kapitel 130
Kapitel 131
Kapitel 132
Kapitel 133
Kapitel 134
Kapitel 135
Kapitel 136
Kapitel 137
Kapitel 138
Kapitel 139
Kapitel 140
Kapitel 141
Kapitel 142
Kapitel 143
Kapitel 144
Kapitel 145
Kapitel 146
Kapitel 147
Kapitel 148
Kapitel 149
Kapitel 150
Kapitel 151
Kapitel 152
Kapitel 153
Kapitel 154
Kapitel 155
Kapitel 156
Kapitel 157
Kapitel 158
Kapitel 159
Kapitel 160
Kapitel 161
Kapitel 162
Kapitel 163
Kapitel 164
Kapitel 165
Kapitel 166
Kapitel 167
Kapitel 168
Kapitel 169
Kapitel 170
Kapitel 171
Kapitel 172
Kapitel 173
Kapitel 174
Kapitel 175
Kapitel 176
Kapitel 177
Kapitel 178
Kapitel 179
Kapitel 180
Kapitel 181
Kapitel 182
Kapitel 183
Kapitel 184
Kapitel 185
Kapitel 186
Kapitel 187
Kapitel 188
Kapitel 189
Kapitel 190
Kapitel 191
Kapitel 192
Kapitel 193
Kapitel 194
Kapitel 195
Kapitel 196
Kapitel 197
Kapitel 198
Kapitel 199
Kapitel 200
Kapitel 201
Kapitel 202
Kapitel 203
Kapitel 204
Kapitel 205
Kapitel 206
Kapitel 207
Kapitel 208
Kapitel 209
Kapitel 210
Kapitel 211
Kapitel 212
Kapitel 213
Kapitel 214
Kapitel 215
Kapitel 216
Kapitel 217
Kapitel 218
Kapitel 219
Kapitel 220
Kapitel 221
Kapitel 222
Kapitel 223
Kapitel 224
Kapitel 225
Kapitel 226
Kapitel 227
Kapitel 228
Kapitel 229
Kapitel 230
Kapitel 231
Kapitel 232
If the keeper of the flame goes berserk,so does fire.
Stephen J. Pyne
Eine breite Straße, ansteigend, am höchsten Punkt ist das Bild gerahmt von Gebäuden, die Kulisse der Ausschnitt eines mächtigen steinernen Runds. Von links tritt ein kleiner Pulk auf, voran der Fremdenführer, rückwärts gehend, eine Standarte tragend. Wendet sich um, verschwindet am rechten Bildrand, die Gruppe ihm nach. Rufe branden auf, eine Menge berauscht sich am Klang ihrer Stimmen, verebben. Ich wache auf und weiß nicht, wo ich bin. Der Tag liegt so weit zurück, wie er noch fern ist, ich habe den Übergangsschlaf geschlafen und bin fremd. Meine Glieder liegen um mich herum, von der Mitte aus finde ich zurück. Ich bewege ein Bein, ziehe das andere heran, hole die rechte Hand ein, berühre die Hüfte, den Hals, die Stirn, ich stütze mich auf den Unterarm. Versuche, in der Dunkelheit Linien auszumachen und zu deuten. Der untere Rand des Fensters zeigt sich nach einer Weile als Tischkante, über mir löst sich ein Balken aus der Schwärze, die sich in den Ecken verdichtet, die durch Wände verbunden werden, die ein Zimmer ergeben, von dem aus man über einen Gang in den größeren Raum gelangt, wo die Tür nach draußen ist. Seit mehreren Wochen bin ich schon in dieser Landschaft, in der die Häuser weit verstreut und vereinzelt stehen. Das Geräusch muss mich geweckt haben. Ein Streifen. Die Katze, die wartet, bis der Morgen graut und sie zu fressen bekommt.
Ein Streifen ist kein Geräusch. Zu dieser Stunde wartet nichts und niemand. Es gibt welche, die ausharren, und es gibt welche, die sind in ihrem Element. Die Katze bleibt morgens in sicherer Entfernung, bis ich mich ins Haus zurückgezogen habe, ehe sie herankommt, um zu fressen. Keine Vertraulichkeit. Ich lege den Kopf zurück auf den Polster, ziehe die Beine vor den Bauch und die dünne Decke fester. Zu spät, der schützende Schlaf ist abgefallen. Ich gehöre nicht hierher. In der Gegend gibt es Wölfe, sie sind zurückgekommen und werden mehr. Bewegen sich lässig und lautlos, die Schulterblätter unter dem Fell heben und senken sich bei jedem Schritt, selten bekommt sie jemand zu Gesicht. An der Wange spüre ich die Berührung der Gelse, die mich geweckt hat. Wenn ich nicht schlafe, werde ich zum Monstrum. Will einen Stecker anbringen, der die Luft im Raum vergiftet. Verlasse das Schlafzimmer und gehe hinüber, schalte das Deckenlicht ein. Mitten im Raum, reglos, eine Spinne, groß wie die Fläche meiner ausgestreckten Hand, zwischen ihren Kieferklauen eine Beute. Wir halten still. Ich senke den Kopf. Meine bloßen Füße auf dem Fliesenboden. Ich lösche das Licht und gehe zurück ins Bett. Meinen Kreis für die Nacht bezeichnen mein gerundeter Rücken und meine vor den Oberkörper gebeugten Arme und Beine. Die Gelse lässt sich auf der rechten Schulter nieder.
Ich stehe vor dem Haus, den linken Arm über die Brust gekreuzt, um mich an der rechten Schulter zu kratzen. Unten auf dem Feld hat es in der Nacht gebrannt, von schwarzen Haufen steigt Rauch auf, den der Wind über die offene Fläche nach Osten treibt. Aus der anderen Richtung kommt ein Hund gelaufen, mit wehender Rute, ein verirrtes Rauchfähnchen, zurückgeflogen, um mit dem Wind davonzuziehen. Lege die Hand an die Stirn, um die Augen zu beschatten. Der Himmel ist weiß, eine einzelne Wolke ebenso wenig auszumachen wie die Sonne hinter der Bedeckung. Der Hund trottet den Feldweg entlang, die Spuren der Räder und Schritte sind trocken und alt. Der Hund gehört zu einem Mann mit weißem Haar. Nicht nur das Alter hat jede unnötige Bewegung und jegliche Hast von ihm genommen, außer dem Gleichmut gibt es nichts mehr zu teilen. Der Mann, der zu dem Hund gehört, kann den anderen, der sein Gast ist, nicht bewirten. Es gibt keinen Wein, kein Brot, kein Wasser. Es gibt nichts, außer die Wege in der flachen Landschaft, die sie miteinander gehen, über den Boden, der nichts mehr hervorbringt.
Ehe es dunkel wird, gehe ich hinunter, schaue nach Glutnestern, finde in der Asche einige in noch warme Kohlen verwandelte Stücke Holz, die ich mit Erde bedecke. Rex Nemorensis nannten sie den König des Waldes, der ein entlaufener Sklave und ein Mörder war, weil er einzig durch Mord am alten König der neue werden konnte. Die Freiheit, eines Tages, der jeden Tag sein kann, getötet zu werden. Die Bar am Hauptplatz heißt Zum Goldenen Zweig, der Ort ist berühmt für den Wald und für die Erdbeeren, die darin wachsen. Ein Klima, in dem auch Misteln gut gedeihen. Die Eichen nicht mehr, die Eichen sterben hier wie anderswo. Ich fahre zurück in die Stadt, in den Norden.
Es ist kalt geworden. Wie in ein Bad aus Metall getaucht, wo ich mich bewege, gerate ich an die eisige Hülle. Nach dem Aufwachen nicht zu wissen, wo man sich befindet, setzt eine Vorstellung von Raum und vom eigenen Körper voraus. Ich stelle fest, dass ich mich aufgesetzt habe und vor mich hinschaue. Das Mindeste ist das beständige Bemühen, sich zurechtzufinden. Man sollte den Ort, an dem man aufwacht, schon einmal gesehen haben und wiedererkennen oder aber begreifen, dass man an einem unbekannten Ort aufgewacht ist. Man sollte wissen, dass man geschlafen hat. Ich weiß nicht, wie lange ich im Bett sitzend vor mich hinschaue, aber ich weiß jetzt wieder, dass es kurze und lange Dauer gibt. Ich habe geschlafen und ich bin aufgewacht. Ich friere.
Die Vorräte sind aufgebraucht, was es noch gibt, ist schwer zu bekommen. Ich muss zu überleben beginnen. Ich ziehe die Wollsocken an, die da liegen. Neben dem Bett stehen feste Schuhe bereit, sie anzuziehen bereitet wegen der dicken Socken Mühe, aber es gelingt. Die nächtlichen Straßen sind verlassen, die Luft ist trocken und kalt. Der Boden hier ist versiegelt. Im Wald ist der Boden feucht, im Wald gibt es Bäche und Quellen. Es gilt, Wald zu suchen. Vorne an der Ecke, neben dem geschlossenen Supermarkt, ein Gittertor, durch das ein Schatten verschwindet, schmal und lautlos. Auf allen Vieren. Es kostet Überwindung. In dunkler Nacht knie ich auf dem Gehsteig, den Oberkörper aufrecht, die kalten Kniescheiben auf dem Asphalt. Tiere riechen das Wasser und wittern mich. Es gilt, ihrer Spur zu folgen. Ich lasse mich fallen, auf die Hände, ein Reißen in den Sehnen. Los.
Andrea hat Weihnachten nicht mehr mit ihrer Familie verbracht, seit sie alt genug dafür ist. Andrés heißt ihr Freund, der in diesen Tagen seine Familie in Spanien besucht. Miriams Freundin arbeitet an den Feiertagen, die Kollegen sind ihr dankbar, dass sie Dienst macht. Sie verbringt so wenig Zeit wie möglich in der Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter lebt, die auf sie angewiesen ist und mit der sie nur das Nötigste spricht. Miriam kennt die Wohnung mit der Mutter bloß aus Erzählungen. Wenn sie und die Freundin zusammen sind, dann in Miriams Wohnung. Andrea hat teuren Wein gekauft, sie öffnet eine weitere Flasche. Wir sprechen über staatliche Unterstützungsleistungen und schwarz bezahlte Honorare, und Andrea sagt, sie will ein wenig Leichtigkeit heute Abend. Zum Nachtisch gibt es Schokoladenkuchen. Andrea erzählt von der Ausstellung, die sie machen will. Eine Frau, besessen von Selbstportraits, von der Suche nach dem einen Foto, das sie so zeigt, wie sie sich selbst sieht. Das spießt sich an der Perspektive. Deshalb will Andrea Fotos, die sie von sich selbst macht, jeweils verdoppeln und einander gegenüberstellen. Die Fenster sind weit geöffnet, es ist eine milde Nacht. Wir halten inne, wenn die Sirenen ganz nahe sind, sprechen weiter, wenn das Heulen sich wieder entfernt. Miriam fragt, ob ich mich wohlfühle in meiner neuen Wohnung. Bis jetzt schon. Andrea lacht. Sie legt spanische Musik auf und erhebt ihr Glas. Auf das Leben, das uns verbraucht. Miriam singt zur Musik und Andrea fordert mich auf. Sie legt beide Hände auf meine Hüften, wir tanzen Bauch an Bauch, in einer Umarmung.
Morgens sitze ich am Tisch, meine Hand hält einen Stift, ich halte den Blick gesenkt. Schemenhafte Gestalten am oberen Blickfeldrand, die stete Täuschung, dort, am Horizont, wären sie. Der Horizont trennt Beobachtbares von Unbeobachtbarem. Schaue ich hoch, sind die Gestalten verschwunden, erst über dem Papier tauchen sie erneut auf. Versuche, den Blickfeldrand hinauszuschieben, ein kleines Stück nach oben und noch eines. Die Hand hält den Stift, ich halte die Verbindung, hebe den Blick weiter, zum Fenster, auf die Straße hinaus, weiter.
Der Übergang zwischen Himmel und Erde. Nicht in die Ferne schauen, sondern möglichst viel Atmosphäre sehen. Die Luft beginnt zu tanzen, das sind die Wellen im Raum und in meinem Körper das Blut. Die Bewegung hinter den Augen, an den Trommelfellen, unter der Haut und außerhalb. Glast, winzige, helle Punkte, die sich nicht fixieren lassen, nicht einen Augenblick. Wegschauen, um zu sehen, tiefer in den Raum. Ruß ist wie Schneeflocken, nicht zwei, die einander gleichen, und noch kleiner, Kristallisationskerne, die bis in die mittlere Atmosphäre aufsteigen und die Wolken besonders hell erscheinen lassen. Kalte Luft führt dazu, dass die Bronchien sich zusammenziehen. In Australien legen sie nasse Tücher an die Türen, damit der Rauch nicht hereindringt. Draußen einundfünfzig Grad Celsius, dort ist leuchtender Tag, während du träumst. Die größten Löschflugzeuge heißen Bomber und laden fünfzehn Tonnen. Ich frage mich, woher sie das Wasser nehmen.
Du solltest fliegen. Andrea bittet mich, mir das zu gönnen. Es ist doch ohnehin vorbei, sage ich. Dann betrachte es als Abschiedsurlaub. Ich fliege mit Ulrich auf eine karibische Insel, er hat die Flüge gekauft, eine Wohnung in einem Appartmenthaus gebucht, siebter Stock, Blick aufs Meer. An der Rezeption gebe ich dem Angestellten meine Kreditkarte. Ich bestehe darauf, sage ich auf Deutsch, Ulrich neben mir, und bestätige auf Englisch meine Nationalität. Ich verstehe dich nicht, sagt Ulrich, während wir mit dem Lift hinauffahren. Wir legen uns schlafen, ohne etwas von der Umgebung gesehen zu haben, es war schon Nacht, als wir gelandet sind. Ich wache auf in einem weiten Raum aus Licht. Spiele mit den Fingern einer Hand, spüre einen Arm zu viel vor meiner Brust. Öffne die Augen. Zwei Arme auf einem fremden Leintuch, ich bewege beide Hände. Strecke einen Fuß nach hinten, die nackten Zehen durch die Luft. Setze mich auf, an den Bettrand, zucke zusammen, als Finger meinen Rücken berühren. Wirklich? Ulrich rückt näher. Schon so spät?
Wie jeden Morgen trinken wir auf der Terrasse Kaffee und Ulrich liest die Zeitung von gestern. Ich gehe nach drinnen, um Milch zu holen. Schließe den Kühlschrank und bleibe davor stehen, die Milchpackung in der Hand. Ich sage dir, zum dritten Mal, da ist etwas unter dem Kühlschrank. Mit der Dunkelheit kommen der nächtliche Lärm und die Luft des Ozeans durch die offene Terrassentür. Ulrich sagt, das sind die Käserinden und Brotkrumen beim Schimmeln. Am Sofa sitzen wir nebeneinander, auf dem Tisch eine Flasche Wein und zwei Gläser. Er trinkt aus einem und sagt, du hörst die Myzele wachsen, das ist, weil du so naturverbunden bist. Wir lachen. In der Mitte des Zimmers brechen sich die Wellen an den Geräuschen der Wohnung.
Da ist etwas, sage ich, wir liegen im Bett, und Ulrich steht auf und geht in die Küche. Er macht Licht und sagt laut, ich knie mich jetzt auf den Boden, ich schaue jetzt unter den Kühlschrank, aber ich glaube ihm nicht, denn ich habe schon gesehen, dass er nicht hören will, was ich höre. Er hat das Licht ausgemacht und ist zurückgekommen. Die Dunkelheit ist nicht vollständig, ich sehe ihn. Er sagt, da ist nichts. Er steht vor dem Bett und berührt mit den Fingerspitzen meine nackten Zehen. Ich weiß, was es ist, sage ich, es sind Mäuse. Unsinn. Ulrich hasst Nagetiere, fürchtet den Kot und die Mikroben. Es sind Mäuse. Er geht zwischen dem Bett und der Zimmertür hin und her, er sagt, was machst du hier für ein Theater. Ich höre es rascheln, obwohl er auf und ab geht, ich stehe jetzt im Bett und mache schwankende Schritte auf der Matratze, während er durchs Zimmer marschiert, von der Tür zum Bett und zurück. Ich sage dir, da ist etwas, und das sind Mäuse, sage ich, immer lauter, und immer strenger ruft er, das hast du nicht zu sagen, das ist nicht dein Text! Ich springe auf der Matratze, da ist etwas, ich hüpfe auf und ab, das sind Mäuse, rufe ich, und weil die Matratze so weich ist, knicke ich ein und falle und liege plötzlich auf dem Rücken. Ulrich stürzt zum Bett und hält mir den Mund zu, er legt sich auf mich, um mich ganz zu bedecken.
Willst du noch Kaffee? Oh ja, sage ich so rasch und freundlich, dass Ulrich befremdet in mein Gesicht schaut und sogleich wieder in die Zeitung. Er vergisst den Kaffee, er liest konzentriert, und ich betrachte ihn von der Seite und frage mich, ob er nur so tut, als ob er von nichts wüsste.
Wirklich? Ich schnipse die Wörter mit dem Fingernagel von meinem Handrücken. Warum? Weil sie keinen Sinn ergeben. Ich habe Ulrich verlassen. Ich muss lachen. Es ist wirklich ein Unterschied zwischen, ich lache, und, ich muss lachen, oder nicht? Andrea fragt, ob etwas vorgefallen ist. Ich will ihn nicht mehr sehen und ich will nichts mehr hören, Telefongespräche, Nachrichten, SMS, E-Mails, all das. Der feine Staub hängt noch in der Luft, im Gegenlicht kann ich ihn als Trübung sehen. Tatsächlich hatte eure Geschichte immer etwas Ungreifbares, als könnte es jeden Augenblick vorbei sein. Jede Geschichte kann jeden Augenblick vorbei sein, enden oder abgebrochen werden, aus Unlust oder durch Tod des Erzählers oder zur Strafe. Unsere Geschichte hat zu lange gedauert. Dauernde Unverbindlichkeit ist immer noch Unverbindlichkeit, sagt Andrea. Ich sehe Ulrich zwischen Tür und Bett hin und her marschieren. Das sollst du nicht sagen. Was? Entschuldige, das wollte ich nicht sagen. Eine Erinnerung. Unverbindlichkeit, ergibt auch keinen Sinn. Unverbindlichkeit und das Gefühl von Sinnlosigkeit können durchaus zusammenhängen, sagt Andrea. Wie fühlt sich Sinnlosigkeit an? Feinstaub ist keine Empfindung, man spürt nur seine Auswirkungen. Es kann viel Zeit vergehen, bis sich Schäden an der Gesundheit zeigen. Ich sage, Langeweile, und, Gewöhnung. Andreas Therapeutin meint, Beziehungen bräuchten gemeinsame Projekte, um zu wachsen. So wie jedes Individuum im Leben Ziele braucht.
In jeder Wohnung, die ich beziehe, gibt es einen Tisch, an dem gearbeitet, gegessen und getrunken wird. Auf dem Boden rundherum viel Platz für das, was gerade nicht gebraucht wird. In der rechten Hand halte ich den Bleistift, den ich jetzt hinlege, um den Arm quer über den Tisch nach der Kaffeetasse auszustrecken. Während ich trinke, betrachte ich die linke, die als lockere Faust auf der Tischplatte liegt. In jeder Wohnung gibt es eine Matratze auf dem Boden, zwei Decken, zwei Pölster.
Aus dem Schlaf drehe ich mich ins Wach, einen Arm nach hinten gestreckt. Mit herüber nehmen, was zu retten ist. Gehe an den Tisch, mit der lockeren Faust, hart anfassen darf man es nicht, sonst löst es sich auf. Die Gestalten der Nacht sind heute dunkel, keine Gesichter auszumachen, eine wandelt gebeugt im Schatten auf und ab. Wenn ich die Erinnerung herüberführe, weiß ich bereits, dass es hier keine Wörter dafür gibt. Die Sprache von drüben schafft nie den Übergang. Bilder kann ich mitnehmen und fälschen, indem ich sie aufschreibe. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Dunkel, und, Schatten, ich schreibe, Gestalten, und, gebeugt, Höhle, das Graphit ist die Verbindung, ich halte den Bleistift, bis die Nacht sich zu weit zurückgezogen hat. Zu Mittag gehe ich landeinwärts. Räume die Papiere vom Tisch auf den Boden und vom Boden auf den Tisch einen Taschenkalender, den Computer, andere Papiere. Telefoniere, kaufe Lebensmittel, grüße, beantworte Nachrichten, lese Zeitung, bestelle einen Kaffee, gehe zu einem Abendessen.





























