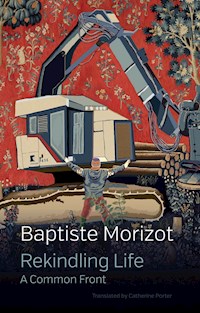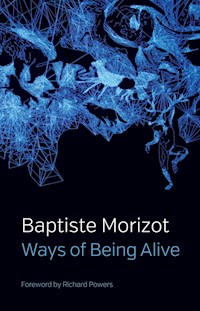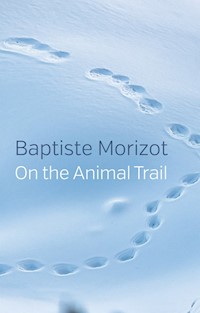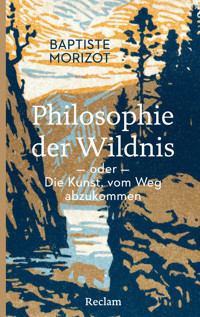Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Kinder unserer städtischen Gesellschaften können mehr als tausend Markenlogos erkennen, aber weniger als zehn Pflanzenblätter. Das ist nur eines von vielen Symptomen der von Baptiste Morizot statuierten »Krise der Sensibilität«. Diese Krise hat dramatische ökologische Folgen, wie Massenaussterben oder Klimawandel, um deren Überwindung die Politik sich vergeblich bemüht. Der blinde Fleck bei all den Bemühungen um Klimaziele und Artenrettung besteht darin, dass die aktuelle ökologische Krise nicht so sehr eine Krise der Menschen auf der einen Seite und der Lebewesen auf der anderen, sondern vielmehr eine Krise unserer Beziehungen zum Lebendigen ist. Denn in den anderen zehn Millionen Arten auf der Erde, unseren Verwandten, »nur Natur« zu sehen, also nicht Lebewesen, sondern Dinge, bloß verfügbare Ressourcen, ist eine Fiktion, deren Gewalt zu den ökologischen Katastrophen der Gegenwart beigetragen hat. Es gilt einen Kulturkampf über die Frage, was Leben eigentlich bedeutet, zu führen. Dafür begibt sich Morizot nicht nur ins Dickicht des wissenschaftlichen und philosophischen Diskurses, sondern auch tatsächlich in die Wälder, um die Spuren der Wölfe zu lesen. In seinem faszinierenden, zwischen Erzählung, Nature Writing und philosophischem Traktat changierenden Buch gelingt es ihm, den Blick für die vielfältigen Arten des Lebendigseins zu schärfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARTEN DES LEBENDIGSEINS
BAPTISTE MORIZOT
ARTEN DES LEBENDIGSEINS
Annäherung an das verwobene Leben
Aus dem Französischen
von Richard Steurer-Boulard
INHALT
EinführungDie ökologische Krise als Krise der Sensibilität
Eine Zeit bei den Lebewesen
Die Versprechen eines Schwammes
Mit seinen Raubtieren zusammenlebenSpinozas diplomatische Ethik
Auf die andere Seite der Nacht wechselnFür eine Politik der Interdependenzen
Ein Diplomat-Werden
Politische Philosophie der Nacht
EpilogAngepasste Rücksichtnahmen
Nachwort
Anmerkungen
Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste
Hölderlin, Sokrates und Alcibiades
HINWEIS FÜR DEN LESER
Dieses Buch versammelt sechs Texte unterschiedlicher Art, von denen man meinen könnte, einige seien bereits an anderer Stelle, in Zeitschriften oder Zeitungen, veröffentlicht worden. Die Wahrheit ist komplexer.
Der Schriftsteller Jean-Christophe Bailly sagte mir einmal, als wir über die Rätsel des Schreibens diskutierten, dass er einen gewissen Spielraum habe, wenn er Prosa schreibe, aber wenn er Poesie schreibe, der Text sich ihm aufzwinge, sodass er nichts entscheiden könne, so als diktiere man ihm die Worte. Seine genaue Formulierung, die mich beeindruckt hat, war: »Wenn ich Poesie schreibe, ist jemand am anderen Ende der Leitung.« Wenn ich schreibe, bin ich oft in einer ähnlichen Situation. Ich habe das seltsame Gefühl, dass bestimmte Ideen mich erwählen und von mir verlangen, dass ich ihnen gerecht werde. Sie sind am anderen Ende der Leitung. In meinem Fall spricht die Stimme in einer Fremdsprache, die ich nicht verstehe. Doch sie fordert gebieterisch von mir, dass ich ihr Kauderwelsch mit der größten Genauigkeit übersetze, als hinge mein Leben davon ab. Ich darf nicht aufhören, auszubessern, wiederaufzunehmen, umzuschreiben, bis ich spüre, dass ich der Idee, der Vision, der Einsicht gerecht geworden bin, selbst wenn es immer schmerzlich unvollkommen ist (jedenfalls von ihrem Standpunkt aus). Die offiziellen Formate interessieren sie leider nicht. Was die Ideen von mir verlangen, führt zu einem Text, der immer zu lang für einen Artikel und zu kurz für ein Buch ist. Vom »anderen Ende der Leitung« tyrannisiert, gelingt es mir nie, dem geforderten Format zu entsprechen (auch wenn das für Schriftsteller und Forscher ein ziemlich banales Problem ist). Ich schreibe also eine komplette, vollendete Version, die in meinen Augen die einzig »wahre« ist, die einzige, die der Idee wirklich gerecht wird, und danach muss ich sie mit der Axt zurechtstutzen, sie manchmal auf ein Drittel oder Viertel kürzen (das bricht mir das Herz), damit sie in die editorischen Formate passt (was ich hier nicht kritisiere, der Umfang ist mit Anforderungen verbunden, die sich verteidigen lassen).
Es handelt sich hier also um diese kompletten, vollendeten, vollständig entfalteten Texte. Sie sind so etwas wie ein director’s cut beim Film.
Der Romanautor Jim Harrison stellte eines Tages fest, dass seine Geschichten zu lang für Novellen und zu kurz für Romane sind. Er hat eine sonderbare literarische Gattung zwischen den beiden entdeckt, ein Mischwesen, das er Novella nannte. Als ich das las, fand ich ein Wort für die Textgattung, die Sie lesen werden: es handelt sich um philosophische Novellas.
Ich habe sie ausgewählt und zusammengestellt, damit sie gemeinsam eine größere Wirkung bei denen entfalten, die sie durchstreifen, nämlich die Wirkung, auf die Begegnungen mit dem Lebendigen in uns und außerhalb von uns vorzubereiten, indem sie auf eine andere Art von Aufmerksamkeit, auf eine anderen Aufmerksamkeitsstil hinarbeiten, auf so etwas wie eine Aufgeschlossenheit für die Arten des Lebendigseins. Mehr verrate ich nicht.
EINFÜHRUNG
DIE ÖKOLOGISCHE KRISE ALS KRISE DER SENSIBILITÄT
Die Welt besteht aus so vielen verschiedenen Arten,
jede einzelne ein verrücktes Experiment.1
Richard Powers
Wir befinden uns auf dem Col de la Bataille2, es ist Spätsommer, es ist kalt, starke Nordwinde treffen hier auf Südwinde. Es ist ein trostloser, im Paläolithikum verbliebener Gebirgspass, über den eine kleine asphaltierte Straße führt, die oft gesperrt ist. Aber es ist keine Wüste, sondern eine Drehscheibe für das Leben in den Lüften. Hier kommen nämlich viele Vögel, unzählige Arten, auf ihrer langen Reise Richtung Afrika vorbei. Es ist eine mythische Pforte, durch die man auf die andere Seite der Welt gelangt. Wir sind hier, um sie zu zählen. Ausgerüstet mit einem manuellen Personenzähler, wie man ihn in Diskotheken und Theatersälen verwendet, klicken wir wie wild, in einer Art fröhlicher Trance für jede Schwalbe, die vorbeifliegt. Es sind Tausende, Zehntausende. Meine Begleiterin zählt 3547 in drei Stunden: Rauchschwalben, Mehlschwalben, Felsenschwalben. Sie kommen aus dem Norden, in Trauben, in Schwärmen, sie drängen sich in den Sträuchern unterhalb des Passes zusammen und warten auf Zeichen, die uns rätselhaft sind. Sie schätzen den Wind ab, das Wetter, ihre Anzahl, was weiß ich noch, sie füllen ihre winzigen Fettreserven während des Halts auf; und in einem bestimmten Augenblick, aus Gründen, die sich unserem Verständnis entziehen, stürzt sich ein ganzer Schwarm Schwalben in die Bresche, die sich in der Zeit aufgetan hat, um den Pass im richtigen Moment zu überqueren, gerade im richtigen Moment. Die Vögel bedecken den Himmel wie Sterne. Sobald die Windwand, die sie vom Süden trennt, überwunden ist, sind sie auf der anderen Seite. Sie haben es geschafft, sie haben eine Schwelle überschritten. Es wird weitere geben. Weiter unten, dicht am Boden, spielt sich die schleichende Migration der Sperlinge ab: Sie flattern von Baum zu Baum, kaum wahrnehmbar, als wären sie auf einem Spaziergang, aber von Baum zu Baum gelangen sie bis ans Ende der Welt. Manche Blaumeisen überqueren die Passstraße zu Fuß, um unter der Windwelle durchzukommen. Sie brauchen eine Minute, um stur den Asphalt zu überqueren. Sie zögern nicht, aber sie beeilen sich auch nicht. Sie haben eine Reise vor sich, die bis nach Nordafrika führt. Wie kann man einen Kontinent von Mut in elf Gramm Leben unterbringen? Die Greifvögel sind auch hier, der Fischadler, der heimliche König der Flüsse, der seine Krallen zu kräftigen, fischenden Bärentatzen entwickelt hat, ist eine reine Verkörperung der Tat: zwei Flügel, die vom Himmel stürzen, gepaart mit zwei unermüdlichen Klauen. Die Turmfalken und die Baumfalken mischen sich in den Schwarm, Jäger inmitten der Beute, so wie die Löwen mit den Gazellen reisen. Dies ist nur eine von vielen Schwellen im langen Zug von einem Ende der Erde zu einem anderen: die Migration von allem, was uns von den Dinosauriern bleibt, die noch ziemlich lebendig sind, obwohl einige Naive glauben, sie seien ausgestorben (sie haben sich bloß in Spatzen verwandelt). In diesem Zug findet man Pieper, Stelzen, Braunellen, riesige Geier und winzige Finken, Goldhähnchen, Girlitzen, Mauerläufer und Rotmilane, die wie gallische Stämme in ihren Farben stolzieren, jeder mit seinen Sitten, seiner Sprache, seinem ichlosen, spiegellosen Stolz – jeder mit seinen Ansprüchen. Und jede dieser Lebensformen hat ihre einzigartige Perspektive auf diese miteinander geteilte Welt, und beherrscht die Kunst, Zeichen zu lesen, die alle anderen ignorieren.
Die Schwalben zum Beispiel müssen während der ganzen Dauer des Flugs Nahrung aufnehmen; als Klimaexperten kennen sie die Tageszeiten, zu denen Insektenschwärme ihren Weg kreuzen werden, um sich im Flug von ihnen zu ernähren, ohne die Richtung zu ändern, ohne anzuhalten, ohne langsamer zu werden.
Plötzlich zieht ein Motorengeräusch unsere Aufmerksamkeit auf sich. Unten auf der Straße erklimmt eine Schlange Oldtimer den Pass. Es handelt sich um eines jener Treffen von Sammlern, die am Sonntag ausfahren, um ihre aufgetakelten Klapperkisten auf den Bergstraßen funkeln zu lassen. Sie machen am Pass Halt. Sie verlassen die Autos für ein, zwei Minuten, um ein paar akrobatische Selfies zu schießen, indem sie versuchen, Kühlerhaube, Lächeln und Landschaft auf dem Bildschirm zusammenzubringen. Sie sind rührend, und glücklich, hier zu sein. Dann brechen sie wieder auf. Meiner Freundin neben mir steht ein Bild vor Augen, das uns im schrecklichen Wind lähmt: »Sie haben es nicht bemerkt. Sie haben nicht bemerkt, dass sie sich inmitten von so etwas wie dem lebendigsten, kosmopolitischsten, buntesten Hafen des Mittelmeers befanden, von dem aus unzählige Völker nach Afrika aufbrechen.«3 Völker, die gegen die Elemente kämpfen, sich mit den Energieströmen vermählen, in der Sonne jubilierend mit der Kraft des Windes gleiten.
Als Primaten, die von ihresgleichen verblendet sind, haben sie nur einen trostlosen Gebirgspass gesehen, eine leere Kulisse, eine stumme Landschaft, einen Bildschirmhintergrund. Diese Bemerkung impliziert keinerlei Klage gegen diese Leute. Sie sind weder besser noch schlechter als wir. Wie oft haben denn nicht auch wir nichts von dem mitbekommen, was sich an Lebendigem an einem Ort abspielte? Wahrscheinlich jeden Tag. Unser kulturelles Erbe, unsere Sozialisierung hat uns so geprägt, es gibt Gründe und Ursachen dafür. Aber das ist kein Grund, nicht dagegen zu kämpfen. Kein Vorwurf, aber eine gewisse Traurigkeit angesichts dieser Blindheit, ihrer Tragweite und ihrer unschuldigen Gewalt. Die große Herausforderung besteht darin, dass wir als Gesellschaft wieder lernen, die Welt von Entitäten bevölkert zu sehen, die wunderbarer als Autosammlungen und Museumsgalerien oder auf andere Weise wunderbar sind. Und anzuerkennen, dass sie eine Wandlung unserer Lebensweisen und unseres Zusammenlebens erfordern.
EINE KRISE DER SENSIBILITÄT
Aus dieser Erfahrung lässt sich eine Idee skizzieren. Unsere ökologische Krise ist tatsächlich eine Krise der menschlichen Gesellschaften: Sie bringt das Schicksal zukünftiger Generationen, geradezu unsere Existenzgrundlagen und unsere Lebensqualität durch verschmutzte Umwelt in Gefahr. Sie ist auch eine Krise des Lebendigen: in der Form des sechsten Massenaussterbens, des Verschwindens von Wildtieren sowie der Störung ökologischer Dynamiken und Evolutionspotenziale der Biosphäre durch den Klimawandel. Doch sie ist auch eine Krise von etwas anderem, von etwas, das unscheinbarer, aber vielleicht grundlegender ist. Ich stelle die Hypothese auf, dass dieser blinde Fleck darin besteht, dass die aktuelle ökologische Krise nicht so sehr eine Krise der Menschen auf der einen Seite und der Lebewesen auf der anderen, sondern vielmehr eine Krise unserer Beziehungen zum Lebendigen ist.
Sie ist auf spektakuläre Weise vor allem eine Krise unserer produktiven Beziehungen zur lebendigen Umwelt, die sich im finanzgetriebenen Ausbeutungswahn des vorherrschenden Wirtschaftssystems zeigt. Sie ist aber auch eine Krise unserer kollektiven und existenziellen Beziehungen, unserer Verbindungen und Zugehörigkeiten zu den Lebewesen, die die Frage nach ihrer Bedeutung aufwerfen, Beziehungen, durch die sie zu unserer Welt gehören oder außerhalb unserer Wahrnehmungs- und Gefühlswelt sowie außerhalb der politischen Welt stehen.
Diese Krise ist schwierig zu benennen und zu verstehen. Doch jeder spürt deutlich, wozu sie uns aufruft: Wir müssen unsere Beziehungen zu den Lebewesen ändern.
Die aktuelle Begeisterung, die hervorgerufen wird durch politische Experimente innovativer Arten des Zusammenlebens und In-Beziehung-Tretens mit den Lebewesen, das Aufkommen von Formen alternativen gemeinschaftlichen Lebens, das Interesse an ökologischer Landwirtschaft und subversiven Wissenschaften – die die lebendige Natur neu beschreiben, nämlich als reich an Kommunikation und Bedeutungen –, das alles sind frühe und doch kräftige Signale für diesen Wendepunkt in dieser besonderen Zeit, die die unsere ist.
Ein Aspekt dieser Krise wird jedoch weniger wahrgenommen, weil er unscheinbarer und in seiner politischen Dimension, das heißt in seinen Politisierungsmöglichkeiten kaum vernehmbar ist. Das ist der Aspekt, der darin besteht, die Krise als eine Krise der Sensibilität4 zu verstehen.
Die Krise unserer Beziehungen zum Lebendigen ist eine Krise der Sensibilität, weil die Beziehungen zu den Lebewesen, die wir uns angewöhnt haben, zu ihnen zu unterhalten, Beziehungen zur »Natur« sind. Wie der brasilianische Anthropologe Eduardo Viveiros de Castro erklärt, denken wir Erben der abendländischen Moderne, dass wir »natürliche« Beziehungen zur Welt der nichtmenschlichen Lebewesen unterhalten, weil jede andere Beziehung zu ihnen unmöglich wäre. Im Kosmos der Modernen gibt es zwei mögliche Arten von Beziehungen: entweder natürliche oder gesellschaftspolitische, und die gesellschaftspolitischen Beziehungen sind ausschließlich den Menschen vorbehalten. Das impliziert folglich, dass man die Lebewesen im Wesentlichen als Kulisse, als ein Reservoir an Ressourcen ansieht, das für die Produktion zur Verfügung steht, als einen Ort der Erholung oder als eine emotionale und symbolische Projektionsfläche. Als Kulisse und als Projektionsfläche haben sie ihre ontologische Konsistenz verloren. Etwas verliert seine ontologische Konsistenz, wenn man die Fähigkeit verliert, es als ein vollwertiges Wesen zu achten, das im Gemeinschaftsleben zählt. Das Ereignis, mit dem die Krise der Sensibilität beginnt, besteht darin, dass die lebendige Welt aus dem Bereich der kollektiven und politischen Aufmerksamkeit, aus dem Bereich des Wichtigen und Bedeutsamen herausgefallen ist.
Unter »Krise der Sensibilität« verstehe ich die Verarmung der Möglichkeiten, wie wir Lebendiges fühlen, wahrnehmen und verstehen können, welche Beziehungen wir zum Lebendigen knüpfen können; eine Verringerung der Bandbreite an Affekten, Perzepten, Konzepten und Praktiken, die uns mit ihm verbinden. Wir besitzen eine Vielfalt von Wörtern, von Relationstypen und von Gefühlsweisen, um die Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Gemeinschaften, zwischen Institutionen, die Beziehungen zu technischen Gegenständen oder zu Kunstwerken zu bezeichnen, aber viel weniger für unsere Beziehungen zum Lebendigen. Diese Reduktion der Spanne der Sensibilität fürs Lebendige, das heißt der Palette an Formen der Aufmerksamkeit und der Qualitäten der Aufgeschlossenheit gegenüber dem Lebendigen, ist sowohl eine Wirkung als auch ein Teil der Ursachen unserer ökologischen Krise.
Ein erstes Symptom dieser Krise der Sensibilität, vielleicht das spektakulärste, drückt sich im Begriff des »Aussterbens der Naturerfahrung«5 aus, den der Schriftsteller und Schmetterlingsforscher Robert Pyle vorgeschlagen hat: das Verschwinden der alltäglichen und erlebten Beziehungen zum Lebendigen. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt etwa, dass ein nordamerikanisches Kind zwischen 4 und 10 Jahren fähig ist, im Nu mehr als tausend Markenlogos zu erkennen und zu unterscheiden, aber unfähig ist, die Blätter von zehn Pflanzen, die in seiner Gegend wachsen, zu identifizieren.6 Die Fähigkeit, Existenzformen und -stile anderer Lebewesen zu erkennen und zu unterscheiden, verschiebt sich massiv hin zu industriellen Produkten. Gleichzeitig ist die Sensibilität für die Lebewesen, die mit uns die Erde bevölkern, sehr schwach ausgeprägt. Auf die Auslöschung der Erfahrung und auf die Krise der Sensibilität zu reagieren, bedeutet, die Palette der Arten und Weisen zu erweitern, in denen wir die Vielfalt der Lebewesen empfinden, verstehen und Beziehungen mit ihr eingehen können.
Es besteht eine unscheinbare, aber tief reichende Verbindung zwischen dem gegenwärtigen massiven Verschwinden der Feldvögel, das von wissenschaftlichen Studien dokumentiert wird, und der Fähigkeit eines Vogelgesangs, fürs menschliche Ohr Sinn zu erzeugen. Wenn ein Koyukon-Indianer den Schrei eines Raben in Alaska hört, dringt der Ton in ihn ein und ruft sowohl die Identität des Vogels, die Mythen, die seine Sitten und ihre gemeinsame Abstammung erzählen, als auch ihre unvordenklichen Bündnisse in der mythischen Zeit in Erinnerung.7
In unseren Städten gibt es überall Raben, ihre Rufe dringen täglich an unsere Ohren, aber wir hören nichts, weil wir sie in unserer Vorstellungswelt zu Tieren gemacht haben, zu »Natur«. Es ist traurig, dass die zehn Vogelgesänge, die man jeden Tag hört, nur als weißes Rauschen auf unser Gehirn treffen, oder bestenfalls an einen bedeutungslosen Vogelnamen erinnern: so wie alte Sprachen, die niemand mehr spricht und deren Schätze unsichtbar sind.
Die Gewalt unseres Glaubens an die »Natur« kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Gesänge der Vögel, Grillen und Heuschrecken, in die man im Sommer eingebettet ist, sobald man sich von den Stadtzentren entfernt, in der Mythologie der Modernen als erholsame Stille erlebt werden. In Wirklichkeit bilden sie, für denjenigen, der versucht, sie zu übersetzen und sie aus dem Status des weißen Rauschens herauszuholen, eine Myriade von geopolitischen Botschaften, territorialen Verhandlungen, Serenaden, Einschüchterungen, Spielen, gemeinschaftlichen Freuden, Herausforderungen und wortlosen Verhandlungen. Die geringste Blumenwiese ist eine kosmopolitische, vielsprachige Karawanserei, die von unermüdlicher Aktivität der unterschiedlichen Arten wimmelt. Es ist wie ein Raumschiff an den Rändern des Universums, wo Hunderte unterschiedliche Lebensformen sich begegnen und einen Modus Vivendi herstellen, indem sie mit Lauten kommunizieren. In den Frühlingsnächten hört man in diesem Raumschiff die Laser-Gesänge der Nachtigallen, die gewaltlos, mit Schönheit, um Weibchen kämpfen, die nach ihnen von der Migration zurückkommen und in der Nacht in den Wäldern herumirren, um ihre Männchen zu finden; man hört verblüfft das Bellen der Rehe, ein gutturales Knurren intergalaktischer Wildtiere, die die Verzweiflung des Begehrens heulen.
Was man »das Land« an einem Sommerabend nennt, ist der bunteste und lärmigste Suk voller Spezies, voller geschäftiger Energien, ein nichtmenschlicher Times Square am Montagmorgen – und die Modernen sind so verrückt, ihre Metaphysik so selbstbestätigend, dass sie darin eine erholsame Stille, eine kosmische Einsamkeit, einen zur Ruhe gekommen Raum sehen; einen Ort ohne reale Anwesenheit, einen stummen Ort.
Die Stadt zu verlassen bedeutet also nicht, sich bukolisch von Lärm und Belästigung zu entfernen, bedeutet nicht, auf dem Land zu leben, sondern in der Minderheit zu leben. Sobald die Natur denaturalisiert wird – keine kontinuierliche Fläche mehr ist, keine eindimensionale Kulisse, vor deren Hintergrund sich die menschlichen Abenteuer abspielen –, sobald man das Lebendige zu Lebewesen macht und nicht zu Dingen, wird der artenreiche Kosmopolitismus für den Geist überwältigend, fast erstickend, erdrückend, denn dann sind wir in der Minderheit. Ein gutes Heilmittel für die Modernen, die die schlechte Angewohnheit angenommen haben, alle »anderen« in Minderheiten zu verwandeln.
Von einem gewissen Gesichtspunkt aus gesehen stimmt es, dass wir eine bestimmte Sensibilität verloren haben: Die massive Urbanisierung, die Tatsache, im Alltag nicht im Kontakt zu zahlreichen Lebensformen zu leben, hat uns die Fähigkeiten des Spurenlesen verlernen lassen. Ich verstehe Spurenlesen in einem angereicherten philosophischen Sinn als die Sensibilität und die Aufgeschlossenheit für die Zeichen anderer Lebensformen. Diese Kunst des Lesens ist verloren gegangen. Man »sieht nichts«, und es ist wichtig, Wege der Sensibilität wiederherzustellen, um wieder sehen zu lernen. Wir sehen nicht nur deshalb nichts in der »Natur«, weil wir über keine ökologischen, ethologischen und evolutionären Kenntnisse verfügen, sondern weil wir in einer Kosmologie leben, in der es vorgeblich nichts zu sehen gibt, das heißt hier, dass es nichts gibt, was zu übersetzen wäre, keinen Sinn, der zu deuten wäre.8 Die ganze philosophische Herausforderung besteht darin, es wieder sinnlich fassbar und offensichtlich zu machen, dass es in der uns umgebenden lebendigen Umwelt etwas zu sehen und reichhaltige Bedeutungen zu übersetzen gibt. Es genügt jedoch, diesen Schritt zu machen und die ganze Landschaft verändert sich. Das ist der ganze Gegenstand des ersten Texts dieses Sammelbands, der den Leser auf eine Expedition mitnimmt, auf der die Spuren eines Wolfsrudels im Schnee des Vercors-Gebirges gelesen werden. Der Text ist zwischen einem ethologischen Thriller und der Erzählung vom ersten Kontakt mit Alien-Lebensformen angesiedelt.
Die Vorstellung eines »Verlusts« von Sensibilität ist jedoch in ihrer Formulierung selbst zwiespältig. Das Missverständnis dieser Vorstellung liegt nämlich darin, dass sie so etwas wie einen nostalgischen Primitivismus zu bergen scheint, der in dieser Angelegenheit nicht angebracht ist. Es war nicht unbedingt »früher besser« und es geht nicht darum, zu Lebensformen zurückzukehren, wo man nackt in den Wäldern lebt. Alles, worum es geht, ist gerade, neue Lebensformen zu erfinden.
TIERE ALS VERMITTLER
Ein anderes Symptom der Krise der Sensibilität, das fast unsichtbar geworden ist, weil wir es so sehr naturalisiert haben, zeigt sich in der Kategorie, in die wir die Tiere einordnen. Unabhängig von der Frage der Behandlung des Viehs (das weder die einzige Form der Animalität noch gar ihr Modell darstellt), besteht die große unsichtbare Gewalt unserer Zivilisation gegenüber den Tieren darin, sie zu Figuren für Kinder gemacht zu haben. Das Interesse für Tiere würde Unernsthaftigkeit ausdrücken, bedeute Gefühlsduselei. Es wäre den »Tierfreunden« vorbehalten. Es wäre regressiv. Unsere Beziehungen zur Animalität und zu den Tieren sind infantilisiert und primitivisiert. Das ist jedoch sowohl für die Tiere als auch für die Kinder beleidigend.
Unsere Palette der Sensibilität gegenüber den Tieren reduziert sich zusehends: entweder abstrakte und vage Schönheit und kindliche Gestalt oder Gegenstand des moralischen Mitleids. Die Ethnografie der Beziehungen zwischen Menschen und Lebewesen bei den Touvains des Hohen Nordens, wie Charles Stépanoff sie untersucht hat, oder bei den Runa im Amazonasgebiet bei Eduardo Kohn zeigt eine unendlich reichere, größere, nuanciertere und intensivere Vielfalt. Die Tiere bevölkern dort die Träume, Fantasievorstellungen, Praktiken und philosophischen Systeme der Autochthonen.9
Unsere Vorstellungskraft für Lebensformen ist vermindert. Unsere Träume sind arm an Lebewesen. Sie sind nicht bevölkert von Wölfen, die unsere Führer sind, oder von Bären, die unsere Mentoren sind, von nährenden Wäldern, von Insekten, von unseren vormenschlichen Vorfahren, die uns bis in die Gegenwart getragen haben. Eine Bresche zu brechen, um ihnen neue Räume in unserer Vorstellungswelt zu schaffen, zum Beispiel in Form von Riten ohne Mystizismus – darum wird es im zweiten Teil dieses Bandes gehen.
Denn die Tiere sind nicht bloß einer kindlichen oder moralischen Aufmerksamkeit würdig. Sie sind die Mitbewohner der Erde, mit denen wir die gleichen Aszendenzen10, das Rätsel des Lebendigseins und die Verantwortung, mit Anstand zusammenzuleben, teilen. Das Rätsel, ein Körper zu sein, ein Körper, der sein Leben deutet und lebt, wird mit allen Lebewesen geteilt. Es ist das allgemeine Los allen Lebens und es verdient, das stärkste Zugehörigkeitsgefühl hervorzurufen. Das Tier ist somit ein privilegierter Vermittler zum Urrätsel, dem Rätsel unserer Art des Lebendigseins. Das Tier weist eine unverständliche Andersheit auf und zugleich steht es uns ausreichend nahe, sodass Tausende Formen von Parallelen und Konvergenzen zu den Säugetieren, Vögeln, Tintenfischen und sogar Insekten spürbar sind. Sie ermöglichen es uns, Wege der Sensibilität für das Lebendige im Allgemeinen wieder zu errichten, gerade aufgrund ihrer Grenzposition, ihrer intimen Andersheit zu uns. Sie ermöglichen es uns, in Abstufungen unsere Zugehörigkeit zu den Pflanzen und Bakterien, die in unserer gemeinsamen Genealogie weiter entfernt sind, zu spüren, die so ferne Verwandte sind, dass es weniger offensichtlich ist, sich wie sie lebendig zu fühlen. Dazu braucht es so etwas wie Schlepper oder Fährmänner: Die Tiere sind die Vermittler, die über diese Macht verfügen.
Wir haben jedoch eine Weltanschauung geerbt, die das Tier erniedrigt hat. Sie ist deutlich in unserer Sprache sichtbar, die die Denkreflexe kristallisiert. Alle diese unglaublichen Formulierungen wie »nur ein Tier sein« oder »sich wie ein Tier benehmen«, diese ganze herabblickende Verachtung, diese vertikale Metaphorik der Überwindung einer niederen Animalität in uns, sind bis in die alltäglichsten Ecken unserer Ethik und unseres Selbstverständnisses gegenwärtig. Sie beruhen jedoch auf einem metaphysischen Missverständnis. Darum wird es im dritten Text dieses Bandes gehen, der unserer inneren Animalität in der Geschichte der abendländischen Moral nachspürt, die uns auffordert, unsere Raubtierinstinkte zu zähmen.
Diese komplizierten Beziehungen zur Animalität haben nämlich einen Teil ihrer Ursprünge im Monopol der dualistischen philosophischen Anthropologie, die vom Juden- und Christentum bis zum Freudianismus verläuft. Diese abendländische Auffassung denkt die Animalität als innere Bestialität, die der Mensch überwinden müsse, um »zivilisiert« zu werden, oder umgekehrt als eine reinere Ursprünglichkeit, in der er neue Kräfte schöpfen kann, indem er eine authentischere Wildheit wiederfindet, die von den Gesellschaftsnormen befreit ist. Diese zwei Vorstellungsweisen scheinen einander entgegengesetzt, doch nichts ist weniger richtig: Die zweite ist nur die Kehrseite der ersten, sie wird als Reaktion und symmetrischer Gegensatz konstruiert. Reaktive Schöpfungen verfestigen bekanntlich jedoch nur das Weltbild des Feindes, der uns reagieren lässt, hier den hierarchischen Dualismus, der Menschen und Tiere entgegensetzt.
Dualismen geben vor, die Gesamtheit der Möglichkeiten zu kartografieren, obwohl sie nie etwas anderes sind als die Vorder- und Rückseite derselben Münze, deren Außen verdunkelt, verleugnet und dem Denken selbst verboten wird.
Was das von uns verlangt, ist ziemlich schwindelerregend. Das Außen jedes Terms eines Dualismus ist nie sein gegenteiliger Term, sondern das Außen des Dualismus selbst. Das Zivilisierte zu verlassen bedeutet nicht, sich ins Wilde zu werfen, genauso wenig wie den Fortschritt zu verlassen impliziert, sich dem Zusammenbruch hinzugeben, sondern bedeutet, den Gegensatz zwischen den beiden hinter sich zu lassen. Man muss die Welt aufbrechen, die als das binäre und ungeteilte Herrschaftsgebiet dieses Dualismus verstanden wird. Man muss in eine Welt eintreten, die nicht ausgehend von diesen Kategorien organisiert, strukturiert und einzig durch sie verstehbar ist. Es geht darum, wie eine Säbelklinge zwischen die beiden Blöcke des Dualismus zu fahren, um auf die andere Seite der Welt zu gelangen, die sie zu umschließen beanspruchen, und zu schauen, was dahinter liegt. Man muss die Kunst des Ausweichens beherrschen, man muss wie ein Schmetterling fliegen, um es zu vermeiden, von den Zwillingsmonolithen Natur und Kultur zermalmt zu werden, von der Charybdis des MENSCHEN zur Skylla des homogenisierten Tiers zu schwanken, vom Kult der wilden Natur im Gegensatz zur notwendigen Verbesserung einer mangelhaften Natur. Man muss in den Seilen tanzen, um den Dualismus der Animalität als niedrige Bestialität und als höhere Reinheit zu vermeiden. Man muss einen Raum auftun, der noch unerforscht ist, den Raum von Welten, die zu erfinden sind, sobald man auf die andere Seite gelangt ist. Es geht darum, sie zu erahnen, sie sichtbar zu machen – und freies Atmen zu ermöglichen.
Meines Erachtens sind die zwei Formulierungen des Problems der Beziehungen zwischen Mensch und Tier falsch und toxisch: Die Tiere sind nicht bestialischer als wir, sie sind aber auch nicht freier. Sie verkörpern keine zügellose und grimmige Wildheit (das ist der Mythos des Zähmers), genauso wenig wie eine reinere Unschuld (seine reaktive Kehrseite). Sie sind dem Menschen weder an Authentizität überlegen noch niedriger in der Erhebung, sondern sie verkörpern schlicht andere Arten des Lebendigseins.
Das Wort »andere« ist dabei wesentlich. Es spricht eine ganze ruhige Logik des Unterschieds vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Aszendenz aus. Es handelt sich um eine stille grammatische Revolution. In all den kleinen Alltagssätzen wie »der Mensch und die Tiere«, »im Unterschied zum Tier«, »was ein Tier nicht besitzt« etc. blüht der Zusatz eines kleinen Wortes auf.
Dieses kleine Wort ist »anders«.
»Die Unterschiede zwischen dem Menschen und den anderen Tieren«; »was die anderen Tiere nicht besitzen«; »was den Menschen mit den anderen Tieren gemeinsam ist«.
Stellen Sie sich alle möglichen Sätze vor und fügen Sie andere hinzu. Ein ganz kleines Pronomen, das so elegant in seiner Arbeit der kartografischen Neugestaltung der Welt ist: Es gestaltet ganz alleine sowohl eine Logik des Unterschieds als auch eine gemeinsame Zugehörigkeit. Es schlägt Brücken und öffnet Grenzen zwischen den einander in der Erfahrung begegnenden Lebewesen. Niemand wird etwas verloren haben. Es ermöglicht uns zwar nicht, die Ähnlichkeiten und Unterschiede tiefgehend zu erforschen, aber es ermöglicht uns, eine adäquate Logik zu verinnerlichen, einen schweren Fehler in biologischer Taxonomie zu vermeiden; als Zivilisation eine mentale Karte zu integrieren, die weitreichende politische Auswirkungen hat, und als Individuen eine weitere kleine stille Wahrheit zu verinnerlichen (die zur Rundheit der Erde, zum Heliozentrismus, zum Evolutionismus, zur Toxizität des Neoliberalismus und zur Demokratie als schlechtestem politischen Modell abgesehen von allen anderen hinzutritt).
Wenn man diese Überlegung weiterentwickelt, kann man meiner Meinung nach vertreten, dass die Wandlung unserer Verhältnisse zur Animalität des Menschen also eine politische Wirkung hat. Unsere Beziehungen zur Animalität in uns korrelieren mit unseren Beziehungen zum Lebendigen außerhalb von uns. Die Veränderung der einen bedeutet die Veränderung der anderen. Vielleicht ist einer der psychosozialen Schlüssel zur abendländischen Moderne die Unfähigkeit, sich lebendig zu fühlen, sich als Lebendiger zu lieben. Unsere Identität als Lebewesen zu akzeptieren, an unsere Animalität wieder anzuknüpfen, die weder als zu überwindende Primitivität verstanden wird noch als reinere Wildheit, sondern als ein reiches Erbe, das anzutreten und zu gestalten ist, heißt, unser gemeinsames Schicksal mit dem Rest der Lebewesen zu akzeptieren; zu akzeptieren, dass der Mensch nicht auf die geistige Beherrschung seiner Animalität hinstreben muss, sondern Einverständnis mit den Kräften des Lebendigen in uns finden kann, bedeutet, das grundlegende Verhältnis zu den Kräften des Lebendigen außerhalb von uns zu verändern. Das würde zum Beispiel dazu führen, keinen Mangel der »Natur« zu postulieren, der eine Verbesserung durch vernünftige Organisation verlangen würde, sondern ein Vertrauen in die Dynamiken des Lebendigen wiederzufinden. Ein Vertrauen in die ökologischen und evolutionären Dynamiken, mit denen wir Modi Vivendi verhandeln müssen, die wir teilweise beeinflussen und manchmal für unsere Bedürfnisse abändern müssen, aber in Hinsicht eines Zusammenlebens, das auf angepasste Rücksichtnahmen achtet, die es gegenüber den anderen Lebensformen zu erfinden gilt, die mit uns die Erde bevölkern.
Es geht darum, die Tausenden Formen der Animalität und die Tausenden Beziehungen zu diesen Formen auf kultureller und politischer Ebene zu einem Thema für Erwachsene zu machen. Die Animalität ist eine große Frage: Das Rätsel des Menschseins wird klarer, erträglicher und lebendiger im Licht der Tausenden tierischen Lebensformen, die uns ebenso rätselhaft sind. Und das politische Rätsel schlechthin, gemeinsam in einer Welt von Andersartigkeiten zu leben, findet darin andere Implikationen und andere Ressourcen.
DIE ÖKOLOGISCHE KRISE ALS KRISE DER POLITISCHEN AUFMERKSAMKEIT
Man muss aber feststellen, dass Aufgeschlossenheit und Sensibilität für das Lebendige, diese vollwertigen Künste der Aufmerksamkeit, von denjenigen, die für andere mögliche Welten kämpfen, gerne als bürgerliche, ästhetische oder konservative Problematiken hintangestellt werden. Tatsächlich sind sie jedoch höchst politisch.
Diese Künste der Aufmerksamkeit sind politisch, denn das diskrete und vorinstitutionelle Wesen des Politischen kommt in den Verschiebungen der Schwellen zum tragen, die darüber entscheiden, was Aufmerksamkeit verdient. Die Frage des Feminismus hat in den letzten Jahrzehnten diese Verschiebungen offenbar gemacht, und die Frage der Unterschiede in der Behandlung zwischen den Geschlechtern ist plötzlich zu einem politischen Leitstern geworden, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Frage der entfremdeten Arbeit, die Frage der Lage jener, die über keine Produktionsmittel verfügen, sondern ihre Arbeitskraft verkaufen, die sich im frühen Kapitalismus eingebürgert hat, ist mit Marx und danach zu einem Gegenstand lebhaftester kollektiver Aufmerksamkeit geworden. Die tektonischen Verschiebungen in der Kunst der Aufmerksamkeit einer menschlichen Gemeinschaft manifestieren sich in einem vielsagenden Symptom, nämlich im Sinn für das Erträgliche und das Unerträgliche.
Ein König von Gottes Gnaden ist heute unerträglich: Das unbewusste Gefüge von Erträglichem und Unerträglichem ist ein feiner Mechanismus, der in jedem von uns sitzt und von den sozialen und kulturellen Strömungen beeinflusst wird. Es geht darum, dass unsere aktuellen Beziehungen zum Lebendigen unerträglich werden müssen. Die Vorstellung, dass die Feldvögel, die europäischen Insekten und umfassender gesprochen ganze Lebensformen um uns herum verschwinden, aufgrund von Untätigkeit, von Fragmentierung der Lebensräume und von Extraktivismus (der Besessenheit der Industrie, alles als auszubeutende Ressource anzusehen), muss uns ebenso unerträglich werden wie die Monarchie von Gottes Gnaden. Wir müssen Begegnungen vorbereiten, die die Lebewesen in den politischen Raum dessen eingehen lassen, was Aufmerksamkeit verdient, das heißt dessen, was dazu aufruft, achtsam und aufmerksam mit ihm umzugehen. Das Zugehörigkeitsgefühl ermöglicht es, zu einer Art erweitertem Selbst zu gelangen. Ich erinnere mich an einen Zugpassagier, der durchs Fenster ängstlich den regenverhangenen Frühlingshimmel betrachtete. Als er mir den Grund für seine Sorge nannte, blieb mir der Mund offen stehen: Das schlechte Wetter verdarb ihm nicht seine Ferien, sondern er eröffnete mir, als handle es sich um einen nahen Verwandten von ihm: »Ich mag kein verregnetes Frühjahr, das ist schlecht für die Fledermäuse. Es gibt viel weniger Insekten. Und die Mütter können ihre Kleinen nicht mehr ernähren.« Ein erweitertes Ich, in dem andere Lebewesen einziehen, bedeutet sicherlich mehr Sorgen, aber es ist auch sonderbar befreiend. Erst dann verändern sich die Grundwerte und nicht deshalb, weil man Apokalypsen ankündigt, die Wesen betreffen, die im Kosmos der Menschen nicht als Seiendes vorkommen.
Die Künste der politischen Aufmerksamkeit werden sich dann verändert haben, wenn wir die Plünderung des ozeanischen Lebens oder die Krise der Bestäuber als ebenso unerträglich empfinden werden wie die Monarchie von Gottes Gnaden. Die Verachtung eines Teils der industriellen, inputorientierten Landwirtschaft gegenüber der Bodenfauna muss ebenso unerträglich werden wie das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs.
Man könnte somit behaupten, dass in demokratischen Gesellschaften, die von großen Informationsflüssen durchzogen werden, das Politische zu einem gewissen Teil unterhalb der Kultur angesiedelt ist, im Sinne von Vorstellungen über ein wünschenswertes Leben und von Schwellen des Erträglichen und Unerträglichen. Folglich muss man, um die Politik zu verändern, nicht nur engagiert sein, kämpfen, sich anders organisieren, Alarm schlagen, bei den Mächtigen intervenieren oder andere Weisen des Wohnens erfinden, sondern auch das Feld der Aufmerksamkeit dafür, was bedeutsam ist, verwandeln. Das wird der Gegenstand des vierten Texts dieses Bandes sein. Er handelt von einer Forschung an der frischen Luft, im Kontakt mit den Wölfen, Schafen, Schäfern, Wiesen und dem nächtlichen Himmel, und versucht, die Umrisse einer Politik der Interdependenzen11 zu entwerfen. Das ist eine Arbeit, die einen langen Atem verlangt, doch sie ist es wert, in Angriff genommen zu werden, weil wir noch ein paar Jahrtausende gemeinsamen Lebens auf diesem kosmopolitischen Planeten vor uns haben.
In welche Richtung hin sollen wir das Feld unserer kollektiven politischen Aufmerksamkeit öffnen? Das Problem unserer systemischen ökologischen Krise muss, wenn es in seiner strukturellsten Dimension verstanden werden soll, als ein Problem des Habitats, der Wohnstätte aufgefasst werden. Unsere Art des Wohnens selbst befindet sich in einer Krise. Und vor allem die grundlegende Blindheit gegenüber der Tatsache, dass Wohnen immer bedeutet, mit anderen Lebensformen zusammenzuleben, weil das Habitat eines Lebewesens nur die Verflechtung mit anderen Lebewesen ist. Tatsächlich ist einer der Hauptgründe der gegenwärtigen Verarmung der Biodiversität die Fragmentierung der ökologischen Lebensräume, das heißt die unsichtbare Zersplitterung der Habitate anderer Lebewesen, die sie zerstört, ohne dass wir es merken, weil wir unsere Straßen, unsere Städte und unsere Industrien in die unscheinbaren und vertrauten Wege gestellt haben, die ihre Existenz, ihr dauerhaftes Wohlergehen als Populationen sicherstellen.
Diese Bedeutung der Fragmentierung der ökologischen Lebensräume im Artensterben hat philosophische Implikationen, die kaum jemals aufgegriffen werden. Die Fragmentierung entspringt nicht direkt der produktivistischen und extraktivistischen Gier (obwohl das das gegenwärtige und vielfältige Gesicht der Zerstörung der Habitate ist, das unsere entschlossenste Bekämpfung verlangt). Sie hat ihren Ursprung vor allem in unserer Blindheit gegenüber der Tatsache, dass andere Lebewesen wohnen. Die Krise unserer Art des Wohnens läuft darauf hinaus, den anderen den Status von Bewohnern zu verweigern. Es geht also darum, wiederzubevölkern, in dem philosophischen Sinne, dass man es sichtbar werden lässt, dass die Myriaden von Lebensformen, die unsere nährende Umwelt ausmachen, auch und immer schon nicht nur eine Kulisse für unsere menschlichen Abenteuer sind, sondern vollwertige Bewohner der Welt. Denn sie machen die Welt durch ihre Anwesenheit. Die Mikrofauna des Bodens macht buchstäblich die Wälder und Felder. Die Wälder und das Pflanzenleben der Ozeane fabrizieren die atembare Atmosphäre, die uns umfasst. Die Bestäuber machen buchstäblich das, was wir naiv »Frühling« nennen, als wäre es ein Geschenk des Universums oder der Sonne: Nein, es ist ihre brummende, unsichtbare und weltumspannende Tätigkeit, die jedes Jahr am Ende des Winters die Blumen, Früchte, die Gaben der Erde und ihre unvordenkliche Wiederkehr auf die Welt bringt. Die Bestäuber – Bienen, Hummeln, Vögel – stehen nicht wie Möbel in den natürlichen und unveränderlichen Kulissen der Jahreszeiten, sondern sie fabrizieren diese Jahreszeit in dem, was sie Lebendiges an sich hat. Ohne sie hätten wir vielleicht Schneeschmelze, wenn die Sonneneinstrahlung im März zunimmt, aber sie fände in einer Wüste statt: Wir hätten keine Kirschblüten, überhaupt keine Blüten, keine Fremdbestäubung, die die Grundlage des Zyklus der Bedecktsamer bildet (alle Blütenpflanzen des Planeten, die neun Zehntel der pflanzlichen Biodiversität der Erde bilden). Wir hätten nur einen endlosen Winter. Eine Art des Seienden, die »mit eigenen Händen«, könnte man sagen, den Frühling macht, darf nicht auf ein Element einer Kulisse, auf eine Ressource reduziert werden. Sie konstituiert einen Bewohner, der ins politische Feld der Kräfte eintritt, mit denen man die Formen unseres gemeinsamen Lebens aushandeln muss.
DIE POLITISCHE UNAUFMERKSAMKEIT GEGENÜBER DEN LEBEWESEN
Ein Teil dessen, was die Moderne Fortschritt nennt, bezeichnet vier Jahrhunderte einer Disposition, die es möglich macht, nicht achtzugeben – weder auf die Andersheiten noch auf die anderen Lebensformen oder auf die Ökosysteme.
Die Begriffsperson, die wir hier meinen, könnte man den »durchschnittlichen Modernen« nennen (wir sind das alle in einem bestimmten Maße in dem Kulturraum, der beansprucht, modern zu sein). Wir werden ihn hier der Prägnanz wegen »Dumo« nennen.
Beobachten wir ein typisches Kolonialphänomen, da sich hierbei oft am besten die Sonderbarkeit des Dumo zeigt. Für einen abendländischen Kolonisten, der in die Urwälder Afrikas oder in die Monsun-Reisfelder Asiens gelangt, bedeutet traditionellerweise die Zivilisierung eines Raums, in dem er sich niederlässt, alles daran zu setzen, dass man leben kann, ohne sich um die nichtmenschlichen Mitbewohner kümmern zu müssen. Sie bedeutet, Kontrolle über die Wildtiere, Insekten, Regenfälle und Fluten auszuüben und sie zu kanalisieren. Zu Hause zu sein, heißt, so zu leben, dass man nicht achtgeben muss. Für die Einheimischen impliziert das Zuhause umgekehrt eine flimmernde Wachsamkeit, eine Aufmerksamkeit auf die Verflechtung mit den anderen Lebensformen, die die Existenz bereichern, selbst wenn man mit ihnen Kompromisse eingehen muss, selbst wenn das oft anstrengend und manchmal kompliziert ist. Eintracht kostet viel diplomatisches Geschick zwischen Menschen, aber auch mit den anderen Lebewesen.
Viele Techniken und Weltvorstellungen der Modernen dienen dazu (das ist ihre Funktion), sich der Aufmerksamkeit zu entledigen, das heißt überall, an jedem Ort, trotz der Ahnungslosigkeit völliger Sorglosigkeit, das heißt ohne Kenntnis des Orts und seiner Bewohner vorgehen zu können. Der Dumo strebt an, sich von dem abzukoppeln, was in der umgebenden lebendigen Welt eine großzügige Aufgeschlossenheit, Verflechtungen mit den Bestäubern, mit den Pflanzen, den ökologischen Dynamiken, dem Klima erfordert. Die geheime, aber mächtige Funktion seiner praktischen Metaphysik ist die Austauschbarkeit. Alles muss austauschbar sein: alle Orte, Techniken und Praktiken, alle Fertigkeiten, alle Lebewesen, die Honigbienen, die Apfelsorten, die Weizenarten. Es geht darum, überall zu Hause zu sein, indem man die Existenzbedingungen angleicht, sodass man weder die Ethologie der anderen noch die Ökologie eines Ortes kennen muss, das heißt die Sitten der Völker und Lebewesen, die ihn bewohnen und ausmachen. Dafür kann man sich auf das konzentrieren, was in den Augen des Dumo das »Wesentliche« ist, auf die Beziehungen zwischen den menschlichen Artgenossen: Beziehungen der Macht, der Akkumulation, des Prestiges, der Liebe, der Familie, vor einem unbelebten Hintergrund, der aus den zehn Millionen anderen Arten besteht, die, beiläufig erwähnt, unsere Verwandten sind.
Dieses Phänomen ist sehr zwiespältig, denn in gewisser Hinsicht hat es bequeme und vorteilhafte Wirkungen gezeitigt. Es geht nicht darum, dumm und radikal das Gegenteil zu predigen, um von der triumphierenden Moderne zur reuevollen Antimoderne überzugehen. Es geht darum, abzuwägen, denn es gibt Lebewesen, die wir wieder zu achten lernen müssen. Derzeit kehrt sich der Komfort der Moderne nämlich um. Da wir der lebendigen Welt, den anderen Arten, den Umwelten, den ökologischen Dynamiken, die unsere gemeinsame Welt ausmachen, keine Achtung mehr schenken, erschaffen wir einen stummen und absurden Kosmos, in dem es sowohl auf individuell als auch kollektiv existenzieller Ebene sehr unbequem zu leben ist. Doch vor allem erzeugen wir eine Klimaerwärmung und eine Biodiversitätskrise, die konkret die Bewohnbarkeit der Erde für die Menschen bedrohen.
Das Paradox ist also, dass in der Kunst der Modernen, sich von der Achtung zu befreien, die die Umwelt und ihre Bewohner erfordern, gewissermaßen ein schätzenswerter Komfort liegt, der aber, sobald er eine bestimmte Schwelle überschritten hat oder eine gewisse Form angenommen hat, schlimmer als unbequem wird – er macht die Welt unbewohnbar. Die Frage ist dann: Was ist diese Schwelle eigentlich und welche Formen sind das, streng gesprochen? Wie kann man intelligent die Moderne beerben, aus unseren geschichtlichen Erbteilen auswählen zwischen den schätzenswerten Emanzipationen und den toxischen Verirrungen? Das ist die Frage, die uns als Kompass dient und uns hilft, Kurs zu halten zwischen den zwei manichäischen Positionen: die, die auf der einen Seite die »Moderne« als Ganzes verurteilen, obwohl man ihre Produkte genießt; auf der anderen Seite die hypermodernen Attitüden, die den Pfeil des Fortschritts beschleunigen wollen, von dem man doch weiß, dass er aufs Schlimmste zusteuert, und dabei eine hassenswerte TINA-Doktrin (»There is no alternative«) verteidigen, die es einem erspart, nachzudenken, aktiv zu werden oder das infrage zu stellen, was an unserem Erbe toxisch ist.
AUS DER GESCHLOSSENEN GESELLSCHAFT HERAUSKOMMEN
Eine Spezies hat die zehn Millionen anderen Arten, die ihre erweiterte Familie, ihre nährende Umwelt, ihre alltäglichen Mitbewohner bilden, zur Kulisse und zum Material für ihre menschlichen Abenteuer verwandelt. Und genauer gesagt hat eine bestimmte kleine Population dieser Art, die Trägerin einer lokalen geschichtlichen Kultur ist, das getan. Denn das Phänomen, alle anderen Arten unsichtbar zu machen, ist nicht das Werk der gesamten Menschheit, es ist ein provinzielles und spätes Phänomen. Stellen Sie sich ein Volk vor, das ein von Myriaden anderer Völker bewohntes Land betritt und erklärt, dass sie nicht wirklich existieren, nicht nicht in der selben Weise, dass sie bloß die Bühne und nicht die Schauspieler sind (oh ja, das ist keine Fiktion, die viel Vorstellungskraft verlangt, das ist auch Teil unserer Geschichte). Wie haben wir dieses Wunderwerk der Blindheit gegenüber den anderen Völkern des Lebendigen vollbracht? Man könnte hier, um die Sonderbarkeit unseres Erbes noch schärfer herauszustellen, eine Kürzestgeschichte der Beziehungen wagen, die unsere Zivilisation zu den anderen Arten unterhält und die zur Moderne führt: Sobald das Lebendige ontologisch erniedrigt war, das heißt als mit einer Existenz zweiten Ranges, geringeren Wertes, geringerer Konsistenz ausgestattet angesehen wurde, das heißt zu »Dingen« verwandelt war, fand sich der Mensch als derjenige wieder, der als Einziger wirklich im Universum existiert.
Es hat genügt, dass das jüdisch-christliche Abendland Gott aus der »Natur« vertrieb (das ist die Hypothese des Ägyptologen Jan Assmann), damit sie profan wird, sodann dass die wissenschaftliche und industrielle Revolution die übrige Natur (die scholastische physis) in eine Materie verwandelte, die ohne Intelligenzen, ohne unsichtbare Einflüsse ist und dem Extraktivismus zur Verfügung steht, damit der Mensch sich als einsamer Reiter im Kosmos wiederfindet, der von dummer und böser Materie umgeben ist. Der letzte Akt impliziert, die letzte Zugehörigkeit zu töten: Alleine gegenüber der Materie blieb der Mensch doch in einem vertikalen Kontakt zu Gott, der ihn als sein Geschöpf heiligte (natürliche Theologie). Der Tod Gottes führt zu dieser schrecklichen und vollkommenen Einsamkeit, die man die anthroponarzisstische geschlossene Gesellschaft nennen könnte.12
Diese falsche Klarsichtigkeit gegenüber unserer kosmischen Einsamkeit hat die seelenruhige Ausschließung von allem Nicht-Menschlichen aus dem Feld des ontologisch Wesentlichen unterschrieben. Sie erklärt diese ganze Philosophie und Literatur der »geschlossenen Gesellschaft« der großen europäischen und angelsächsischen Hauptstädte. Meine Wahl des Ausdrucks ist nicht willkürlich: Es handelt sich nunmehr um eine geschlossene Gesellschaft im Sinne von Sartres Theaterstück, aber der verschlossene Raum ist die Welt selbst, das Universum, das nur von uns und unseren krankhaften Beziehungen zu den menschlichen Artgenossen bevölkert ist, die vom Verschwinden unserer pluralen, affektiven, aktiven Zugehörigkeiten zu den anderen Lebewesen, den Tieren und Umwelten verursacht werden.
Diese in der Literatur und Philosophie des 20. Jahrhunderts allgegenwärtige These der kosmischen Einsamkeit des Menschen, die der Existenzialismus hochgehalten hat, ist von einer verstörenden Gewalt. Unter dem Deckmantel des Camus’schen13 Heroismus des Absurden besteht diese Gewalt – die blind ist und sich weigert, die Existenzformen der anderen sehen zu lernen – darin, die anderen nicht als Mitbewohner anzuerkennen, indem postuliert wird, dass sie keine Kommunikationsfähigkeiten, keine »autochthonen Sinne«, keine kreative Perspektive, keine Eignungen zum Modus Vivendi, keine politischen Angebote14 besäßen. Hierin liegt die große Kunst und folglich auch die verdeckte Gewalt des abendländischen Naturalismus, dessen Aufgabe darin besteht, zu rechtfertigen, dass die ganze Natur als vorhandener Rohstoff ausgebeutet wird und im Dienste unseres Zivilisationsprojekts steht. Damit werden die anderen Lebewesen als Materie aufgefasst, die von biologischen Gesetzen regiert wird, und man weigert sich, ihre geopolitischen Angebote, vitalen Bündnisse und alle Aspekte zu sehen, durch die man mit den Lebewesen an einer großen diplomatischen Gemeinschaft teilhat, in der zu leben man wiedererlernen müsste.
Das menschliche Subjekt, das umgeben von reiner Materie – die als Ressourcenvorrat vorhanden oder die ein Refugium ist, in dem man geistig Kraft schöpfen kann – sich alleine in einem absurden Universum befindet, ist eine phantasmatische Erfindung der Moderne. Von diesem Gesichtspunkt aus stecken die großen Denker der Emanzipation, die Sartre oder Camus auch gewesen sein mögen und deren Ideen die französische Tradition wahrscheinlich tiefreichend geprägt haben, objektiv unter einer Decke mit dem Extraktivismus, der eine wesentliche Ursache für die ökologische Krise darstellt. Es ist beunruhigend, diese Emanzipationsdiskurse als Vektoren großer Gewalt neu zu deuten. Doch sie haben den Mythos, dem zufolge wir die einzigen freien Subjekte in einer Welt voller lebloser und absurder Objekte wären, zu einem Grundglauben des späten Humanismus gemacht, in dem wir der lebendigen Welt, die sinnlos wäre, durch unser Bewusstsein einen Sinn verleihen müssten. Wir haben der Welt genommen, was sie immer besessen hat. Die von Viveiros de Castro und Descola beschriebenen Schamanen und Animisten wissen das ganz genau: Es handelt sich um komplexe soziale Beziehungen der Gegenseitigkeit, des Austausches und des Beutemachens, die nicht friedlich und friedfertig sind, keineswegs so wie in Jesajas Prophezeiung, die aber in einem noch rätselhaften Sinn politisch sind und die Formen der Befriedung, Versöhnung, der gegenseitigen Achtung und des respektvollen Zusammenlebens verlangen. Darum wird es im Nachwort dieses Bandes gehen.
Denn im Lebendigen gibt es überall Bedeutungen. Man muss sie nicht hineinprojizieren, sondern wiederfinden, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, nämlich Übersetzen und Deuten. Es geht darum, Diplomatie anzuwenden. Man braucht Dolmetscher, Mittelsmänner, Zwischenhändler, die die Arbeit der Gesprächsaufnahme mit dem Lebendigen leisten, um zu überwinden, was man Lévi-Strauss’ Fluch nennen könnte: die Unmöglichkeit, mit den anderen Arten, mit denen wir die Erde teilen, zu kommunizieren. »Trotz der Tintenwolken, die von der jüdisch-christlichen Tradition verspritzt wurden, um sie zu verdecken, scheint keine Situation tragischer, verletzender für Herz und Geist als die einer Menschheit, die mit anderen, auf ein und derselben Erde lebenden Gattungen koexistiert, deren Genuss sie teilen, und mit denen sie nicht kommunizieren kann.«15
Doch diese Unmöglichkeit ist eine Fiktion der Modernen, sie trägt dazu bei, die Reduktion des Lebendigen auf seinen Warencharakter zu rechtfertigen, um die globalen Wirtschaftsströme anzutreiben. Die Kommunikation ist möglich, sie findet immer statt, sie ist von Geheimnis, unerschöpflichen und auch unübersetzbaren Rätseln, aber schließlich auch von schöpferischen Missverständnissen gesäumt. Sie ist nicht so flüssig wie eine Kaffeehausdiskussion, aber sie ist deshalb nicht weniger reich an Sinn.
Als Rätsel unter den Rätseln erhält die menschliche Art des Lebendigseins nur dann Sinn, wenn sie mit den Tausenden anderen Arten des Lebendigseins verwoben ist, die die Tiere, Pflanzen, Bakterien und Ökosysteme um uns für sich beanspruchen.
Das weiterhin bestehende Rätsel des Menschseins ist reicher und ergreifender, wenn man es mit den anderen Lebensformen der großen Familie teilt, wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt, wenn man ihrer Andersheit Gerechtigkeit widerfahren lässt. Dieses Spiel von Verwandtschaft und Andersartigkeit mit den anderen Lebewesen, das gemeinsame Anliegen einer Lebenspolitik, trägt zum unerschöpflichen Reichtum des »zu lebenden Rätsels«, ein Mensch zu sein, bei.
EINE ZEIT BEI DEN LEBEWESEN
1. EPISODE
Im Nebel der Begegnung
Wir brechen an jenem Tag ziemlich spät auf, die Sonne steht schon hoch am Himmel. Wir sind schwerfällig wie zu Saisonanfang, noch nicht vom Schnee geschärft, noch nicht aus weißen Winden gewebt. Wir sind im Süd-Vercors, weil wir Informationen erhalten haben, Gerüchte gehört haben: Bestimmte Anzeichen scheinen darauf hinzudeuten, dass sich Wölfe hier niedergelassen und vielleicht sogar vermehrt haben. Ist ein neues Rudel entstanden, das sich sein Revier auf diesen vertrauten Pfaden erfindet? Kenner der Region haben uns auf der Karte jene Schlucht als ein mögliches Zentrum der winterlichen Wolfsabenteuer gezeigt.
Wir verlieren Sonnenzeit, als wir auf unseren kleinen Tourenskiern, die perfekt fürs Fährtenverfolgen sind, den komplizierten Spuren eines Fuchses und den Abdrücken seines vertikalen Sprungs im Schneemantel folgen, die beim Jagen einer Wühlmaus entstanden sind. In der Pause tauchen wir unter dem Vordach einer Hütte unsere eisigen Wurstbrötchen in den heißen Tee. Der Aufstieg im Zwielicht des Unterholzes ist mühsam. Wir wechseln auf eine Skipiste, um in der Sonne vorwärts zu kommen. Das Skigebiet ist geschlossen wegen Schneemangels, wie so oft in den letzten Jahren. Die Pfosten des Schlepplifts stehen schief wie die Schafotte einer barbarischen Vergangenheit oder wie Totems eines vergessenen Kults. Wir haben das Gefühl, durch die »Ruinen des Kapitalismus« zu wandern. Wir steigen in der kalten Sonne hinauf, das regelmäßige Knirschen der Skier bildet ein Wanderlied, das den Rhythmus vorgibt.
Wir wollten in der Schlucht in einer Grotte schlafen. Doch die Schneebeschaffenheit ändert sich unter den Skiern, das Robbenleder greift nicht mehr. Wir entscheiden uns, über den steilen Hang mitten in die Schlucht zu fahren. Der erste Teil der Abfahrt im Unterholz ist eine reine Freude, man gleitet lautlos zwischen den Nadelbäumen, die wie schwerelos über dem Pulverschnee aufragen, nur die Skiklinge, die Schneewolken aufsprüht, macht ein Geräusch wie ein samtener Flügel. Und dann wird es kompliziert, wir verheddern uns im Gestrüpp, wir beleidigen die Wildrosen, es gerät zum »Wildschwein-Ski«, wo wir mühsam versuchen, den Klauen des Dornengestrüpps, die uns in den Wald verstricken, zu entkommen.
Als wir ans Ende der Schlucht gelangen, finden wir keine Spur vom Rudel, der Schnee ist tief, der Wald ist noch dicht, der Hang steil, das sieht überhaupt nicht so aus, wie auf der Karte. Wir suchen stundenlang auf dem gegenüberliegenden Hang die Öffnung zur Höhle, die wahrscheinlich vom Schnee verdeckt ist. Die Sonne geht hinter unserem Rücken unter. Das tierische Auge, das die Nackenhaut und der Handrücken ist, spürt sie mit ihrer perfekten Langsamkeit untergehen. Schön langsam wächst die Furcht vor der Nacht im Schneesturm. Wir ziehen uns auf Plan B zurück: eine unbewirtschaftete Hütte auf der Hochebene, hinter der Tête du Faisan.
Es ist schwierig, sich zu orientieren, man muss den Geist trainieren, an mehreren Orten der Karte gleichzeitig zu sein, um nicht Gefahr zu laufen, die Anhaltspunkte zu missdeuten. Wir gelangen schließlich zur Hütte, wo bereits die übliche Fauna der Bergbewohner anzutreffen ist. Auf dem Weg Spuren der ganzen Gilde der Huftiere, von Mardern und Füchsen, aber keine Wolfsspur. Kein Zeichen den ganzen Tag lang, keine Beute trotz der Durchquerung ganzer Landschaften. In der Sprache eines sibirischen Jägervolks heißt »Glück«: »Stille des Waldes«. Morgen werden wir leiser sein.
Wir kochen in der unbewirtschafteten Schutzhütte, alle teilen, werden sanft gezwungen, von allen savoyardischen Fondus, allen Wurstgerichten mit Weißwein und Zwiebelsauce zu kosten, von den fünf unterschiedlichen Schnapssorten, die in den Rucksäcken bis hierher geschleppt worden sind. Man kann nicht Nein sagen, am Herd sind wir mit Unbekannten verbunden, gerade der Kälte draußen entronnen, einander nah, weil wir so weit von allem sind, und um zehn Uhr gehen wir beide in den unberührten Schnee hinaus, um den Weißwein abzubauen.
Ungeschickt beschreiten wir einen kleinen Weg gegen Norden, auf dem der Schnee von Schneeschuhen zusammengedrückt worden ist. Ein dicker Mond zeichnet die Kontraste scharf, Wolken und Horizonte sind wie gestochen, als ob ein japanischer Maler mit Kalligrafiepinsel die Baumlinie hinter uns verfeinern würde, sobald wir ihm den Rücken zuwenden. Wir reden über Soziologie oder so etwas, eingepackt in die Daunenjacken und Mützen, zwei leicht schwankende und fröhliche Freunde.
Plötzlich durchdringt es die Nacht. Ein perfektes Wolfsheulen, gleich neben uns. Wir bleiben stehen wie vom Blitz getroffen, jeder reißt die Mütze des anderen runter, wir halten uns an den Schultern fest. Eine große Stille folgt, so wie beim Warten auf das Responsorium der Messe. Also antworte ich. Ich heule, wie ich es gelernt habe, um dem Gehabe, dem Gerüst, dem besonderen Ablauf ihrer Sprache zu entsprechen. Ich ahme nach, so gut es geht, wie ein mittelalterlicher Reisender auf dem Weg ins Morgenland, der einen diplomatischen Begrüßungssatz in der Sprache des mythischen Volks der Kynokephalen (jener Tier-Menschen mit Hundekopf, die in den weiten Steppen nördlich des Baikalsees leben sollen, wie Marco Polo in seinem Buch der Wunder erzählt) auswendig auszusprechen gelernt hätte. Aber ohne ein einziges Wort zu verstehen.
Neuerlich eine Stille, wie die verliebte Erwartung einer Antwort auf eine Aufmerksamkeit. Und er singt. Ein großartiger, sehr monotoner, fast zu perfekter Schrei. Also antworte ich, man muss ja höflich bleiben, aber wie soll man diese Farce beenden? Er singt neuerlich, höher dieses Mal, mit Sorgfalt modulierend, ganz nahe, gleich hinter einem Kamm, dreißig Meter von uns entfernt. Dann antwortet ein zweiter Wolf, weiter im Süden: ein stärkeres, gefestigteres Heulen, das auch tiefer ist. Darauf antworten wir, der versteckte Wolf und ich, gemeinsam. Ein dritter Wolf antwortet im Südosten, aber nicht sehr weit weg, höchstens ein paar Hundert Meter entfernt. Der Dialog setzt sich noch weiter fort, er antwortet immer gerne.