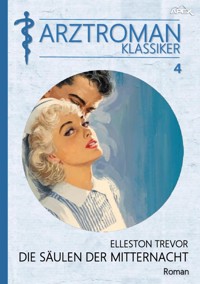
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dr. Steven Monk hat eine Liebesaffäre mit der Frau eines Kollegen. Seine eigene Ehe ist seit langem gefährdet. Da bricht eine Pocken-Epidemie über die Stadt herein, die durch den Steward einer Fluglinie nach Indien eingeschleppt worden ist. Ärzte, Schwestern, Männer und Frauen, alle Betroffenen werden von der Seuche vor Entscheidungen gestellt. Auch Liebe und Leidenschaft stehen plötzlich entblößt da: Die Menschen müssen Farbe bekennen...
Die Säulen der Mitternacht erschien erstmals im Jahre 1957; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1966 (unter dem Titel Die nackten Seelen). Der Roman erscheint in der Reihe ARZTROMAN-KLASSIKER aus dem Apex-Verlag, in der klassische Arztromane aus der goldenen Ära dieses Genres als durchgesehene Neuausgaben wiederveröffentlicht werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ELLESTON TREVOR
DIE SÄULEN DER MITTERNACHT
- Arztroman-Klassiker, Band 4 -
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE SÄULEN DER MITTERNACHT
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Das Buch
Dr. Steven Monk hat eine Liebesaffäre mit der Frau eines Kollegen. Seine eigene Ehe ist seit langem gefährdet. Da bricht eine Pocken-Epidemie über die Stadt herein, die durch den Steward einer Fluglinie nach Indien eingeschleppt worden ist. Ärzte, Schwestern, Männer und Frauen, alle Betroffenen werden von der Seuche vor Entscheidungen gestellt. Auch Liebe und Leidenschaft stehen plötzlich entblößt da: Die Menschen müssen Farbe bekennen...
Die Säulen der Mitternacht erschien erstmals im Jahre 1957; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1966 (unter dem Titel Die nackten Seelen). Der Roman erscheint in der Reihe ARZTROMAN-KLASSIKER aus dem Apex-Verlag, in der klassische Arztromane aus der goldenen Ära dieses Genres als durchgesehene Neuausgaben wiederveröffentlicht werden.
DIE SÄULEN DER MITTERNACHT
Erstes Kapitel
An jenem Tag, als das Grauen begann, erwachte Steven Monks zu spät. Das ärgerte ihn. »Ich hatte dich gebeten, mich rechtzeitig zu wecken«, sagte er zu seiner Frau.
»Ich brachte es nicht fertig, dich zu stören, Darling. Du schliefst so fest, und heute brauchst du doch nicht in die Klinik«, verteidigte sich Julie.
»Für die nächsten zwei Wochen brauche ich nicht in die Klinik. Soll ich darum meinen ganzen Urlaub verschlafen?«
Ihr Lächeln war kühl und zärtlich. »Schaden würde es dir nicht.«
Er trank seinen Kaffee, während sie am Fenster saß und die letzten Anweisungen niederschrieb; für die Haushilfe, die Wäscherei, den Zeitungsboten und an ihre Schwester, die morgen kommen würde, damit das Haus nicht leer stünde.
»Ist der Wagen überholt?«, fragte er. Irgendwie musste er seinem Ärger Luft machen.
»Ja, Darling.«
»Weiß Joanna, wo sie den Schlüssel zur Garage findet, falls sie ihn braucht?«
»Ich habe es eben auf geschrieben.« Julies Bleistift fuhr rasch und sicher über das Papier. Die Sonne schien durch das Fenster und ließ ihr Haar noch heller erscheinen, wie sie so mit gebeugtem Kopf dasaß. Sie war zu tüchtig, zu zuverlässig und - verdammt - zu hübsch. Er stand auf. »Ich muss noch einmal in die Klinik.«
Sie blickte nicht auf, wandte nicht einmal den Kopf, »Warum das, Steven?«
»Ich habe meine Kamera dagelassen.«
»Wolltest du sie denn mitnehmen?« Sie schob die Zettel in Briefumschläge.
»Wann soll ich denn fotografieren, wenn nicht im Urlaub?«
»Hast Recht. Aber zu hetzen brauchst du dich nicht, wir haben vierzehn herrliche Tage vor uns, ausgefüllt mit Nichtstun, da kannst du Aufnahmen machen noch und noch.«
Er sah auf sie nieder, wie sie die Umschläge leckte; frischrosa war die Zunge, die Augen klar. Zart wie ein Kind wirkte sie - wie ein unschuldiges Kind.
Sie schnitt ein Gesicht. »Das gummierte Zeug schmeckt scheußlich.« Sie strich über die zugeklebten Umschläge.
»Du brauchst es ja nicht abzulecken.«
»Nein.«
Er verließ das Haus - eilig wie immer. Erst auf halbem Weg fiel ihm ein, dass er Urlaub hatte und dass es auf eine Stunde mehr oder weniger nicht ankam. Er wollte schon den Wagen wenden und zurückgehen, um Julie zu sagen, dass er nach sieben Monaten angespanntester Arbeit eben reizbar sei, dass er jedoch sehr wohl wisse, wie hübsch und zuverlässig sie sei. Aber er fuhr weiter - sie wusste das ja sowieso.
Das Krankenhaus lag am Fuße des Hügels, hell schien die Morgensonne darauf. Ein Krankenwagen fuhr eben zurück in die Stadt. War es möglich, dass er tatsächlich Urlaub hatte? fragte sich Steven unwillkürlich, dass man seine Pflichten - diese Pflichten - einfach abstreifen und wegwerfen konnte? Natürlich konnte man, und wenn er seine Kamera nicht Preston geliehen hätte, dann hätte er gar nicht erst zurückzufahren brauchen.
Er betrat die Halle; es war kühl. Patienten warteten schon, einige grüßten ihn. Er lächelte, hastete weiter. Lächerlich, dass man sich die Eile nicht abgewöhnen konnte. Er ging in Prestons Zimmer; die Kamera war nicht im Schrank. Er nahm sich nicht die Zeit, danach zu suchen. Verdammter Kerl. Er würde sehen, dass er ihn bei seiner Besuchsrunde abfangen konnte. Ohne Apparat fuhr er nicht in Urlaub.
Und wenn es auch nur Cornwall war. Er wäre lieber nach Frankreich gefahren, aber Julie hatte gesagt, dass sie sich das in diesem Jahr nicht leisten könnten. Tüchtig, zuverlässig! Alle Fäden hatte sie in der Hand, wusste genau, wie das Bankkonto stand, was man sich leisten konnte und was nicht. Wenn sie bloß manchmal ein wenig großzügiger wäre und die Dinge treiben ließe. Er schaltete diese Gedanken ab. Es war unfair und ungerecht, an Julie herumzukritteln. Wohin käme er, wenn ihm nicht diese eminent verlässliche Frau alle Sorgen abnähme? Ruth freilich...
Wieder einmal ärgerte er sich über sich selbst. Konnte er es denn nicht lassen, Julie dauernd mit Ruth zu vergleichen? Ruth - dass er von dieser Frau nicht loskam, wenigstens nicht in Gedanken. Er musste vernünftig bleiben! Julie war die weitaus wertvollere der beiden Frauen. Aber kam es darauf an? Kam es für einen Mann darauf an?
Da trat Preston ein. »Hallo, Steven. Hast du vergessen, dass du Urlaub hast?«
»Natürlich nicht.«
»Wär' ja auch komisch!« Preston schien verlegen zu sein, hatte die Hände in den Taschen zur Faust geballt. »Hast du vielleicht fünf Minuten Zeit für mich, Steven?«
»Ich wollte nur meine Kamera holen.«
»Ach so.« Das Licht der Sonne fiel auf Prestons Brillengläser, so dass Steven Monks seine Augen nicht sehen konnte. »Ich habe sie in deinen Schrank zurückgelegt.«
Er entschuldigt sich nicht einmal, dachte Steven. Er wandte sich um und ging in sein Zimmer. Preston folgte ihm. Der Mann war nervös; irgendetwas stimmte da nicht. Preston sagte: »Ehrlich gestanden - ich bin sehr beunruhigt.«
Als Monks seinen Schrank öffnete, dachte er: Was gehen mich deine Sorgen an! Ich fahre in Urlaub, auf mich kannst du nicht zählen. Aber wenn Preston sagte »ehrlich gestanden«, dann hatte er ein Problem, mit dem er nicht fertig wurde. Da stand der Fotoapparat. - Merkwürdig, dass er ihn gestern nicht gesehen hatte. Wahrscheinlich hatte Preston ihn erst heute dort hingestellt.
Wenn Monks sich jetzt auf lange Erörterungen einließ, verlor er weitere Minuten. So fragte er kurz: »Was hast du denn eigentlich?«
»Du warst doch im Krieg in Ostasien, nicht wahr?«
»Ja.« Monks legte den Riemen der Kamera über die linke Schulter.
»Ich wollte dich schon anrufen - ja, ich weiß, du hast deinen Urlaub verdient, aber ich wäre dir dankbar, wenn du dir einen meiner Patienten ansehen würdest.« Clifford Preston wurde immer verlegener.
»Tut mir leid, Junge, ich muss machen, dass wir fortkommen. Unser Hotelzimmer ist bestellt, und wir wollen vor Abend dort sein.« Er wollte gehen, doch Clifford stellte sich zwischen ihn und die Tür. »Kannst du nicht Ruddling fragen, er vertritt mich doch.«
»Aber er war nicht in Ostasien. Ich fürchte, man hat da etwas eingeschleppt, und darin bist du nun einmal Autorität.« Prestons sonst so frisches Gesicht war grau, die Augen blickten den anderen besorgt an. Monks ärgerte sich; wegen Preston hatte er herkommen müssen, um seinen Apparat zu holen; wegen Preston sollte er sich hier einen Patienten ansehen und verlor wertvolle Zeit seines Urlaubs.
»Nur fünf Minuten, Steven«, drängte Clifford. »Ich wäre dir wirklich sehr dankbar.«
Draußen wurde eine Bahre vorbeigefahren; Gummireifen knirschten auf dem Parkettboden; Metall klirrte auf Glas. Ich könnte längst weg sein, das alles nicht mehr hören, dachte Monks und fragte gleichmütig: »Was ist das für ein Patient?«
»Er heißt Prebble und liegt auf der Wingfield Station. Du wirst ihn noch nicht gesehen haben.« Preston öffnete die Tür, ging hinaus und wartete darauf, dass Monks ihm folgte. Auf dem Flur stand Schwester Cateridge.
»Guten Morgen, Doktor Monks. Ich dachte, Sie wären auf Urlaub.«
»Habe ich auch gedacht.«
Schweigend gingen die Männer weiter, Clifford Preston immer ein paar Schritte vor Steven Monks. Die Hände hatte er immer noch in den Taschen, den Kopf hielt er gesenkt. Er war ganz in seinen Fall vertieft, das sah man ihm an. Sie betraten das Krankenzimmer.
»Der hier«, murmelte Preston. Breitbeinig stand er da, blickte unverwandt auf den Mann im Bett. Eines der Fenster war geöffnet, die Sonnengardine streifte über das Fensterbrett. Ein Vogel sang, flog fort, aufgescheucht durch den Lärm. Männer luden Koks ab. Monks sah sich den Mann an, blickte auf die Tafel über dem Bett; Preston ging und schloss das Fenster.
»Wann wurde der Mann eingeliefert?«, fragte Steven.
»Vor drei Tagen«, sagte Schwester Gill, die im Zimmer war. »Am Freitag.«
Steven las den Bericht. Charles Ernest Prebble, neunundvierzig Jahre, Eisenbahnangestellter, hatte zuerst über heftige Kopfschmerzen in der Stirn und im Nacken geklagt, vier Tage, bevor er eingeliefert wurde wegen eines nicht diagnostizierten Ausschlags. Nun lag er im Fieber, das freilich seit Samstag gesunken war. Monks schlug die Bettdecke zurück. Der Mann schwitzte tüchtig, aber seine Augen gingen unablässig von einem Arzt zum anderen und dann zur Schwester. Als Monks die Pyjamajacke öffnete, versuchte Prebble, den Kopf zu heben, um hinsehen zu können.
Monks sagte: »Sehen Sie erst gar nicht hin, bunt genug sehen Sie schon aus.« Er ließ Schwester Gill die Jacke wieder zuknöpfen und die Decke gerade legen; dann vertiefte er sich wieder in die Tabelle. Längst vergessene Szenen tauchten vor ihm auf. Nur undeutlich empfand er, dass Prebble ihn beobachtete. Warum war es so still im Raum? Ach so, jemand hatte das Fenster geschlossen. Er fühlte ein Gewicht auf seinen Schultern - ja, die Kamera. Er stellte sie auf den Boden neben dem Nachttisch. Blumen standen da - also hatte Prebble Angehörige. »Sind Sie letzthin mit jemandem in Kontakt gewesen, der aus Ostasien kam?«, fragte er und merkte gleichzeitig, wie Preston aufhorchte.
Prebble wollte sprechen, aber es fiel ihm schwer. Er räusperte sich hörbar und sagte dann: »Mein Junge.«
»Wer?«
»Mein Sohn. Indienroute.« Er sagte es stolz.
Monks beugte sich tiefer. »Welchen Beruf hat Ihr Sohn?«
»Steward. Zu Hause auf Urlaub. Aber er ist nicht krank, Doktor.«
»Ich glaube es Ihnen. Schiffssteward?«
»Nein. BEC-Luftlinie nach Indien. Er ist nicht krank.«
Auf der Tabelle stand, dass Prebble vor zehn Stunden zuletzt Morphium bekommen hatte. Langsam fragte Monks: »Wann ist er nach Hause gekommen?«
»Weiß nicht genau. Hat Urlaub. Ist nicht krank. Was ist denn mit mir?«
»Nichts Schlimmes. Können Sie sich nicht erinnern, wann Ihr Sohn nach Hause gekommen ist?«
»Seit er Urlaub hat. Bin ich sehr krank, Doktor?«
»Nein, halb so schlimm.«
Schwester Gill trat hinter Monks und sagte über seine Schulter: »Er spricht viel von seinem Sohn, der mindestens vierzehn Tage zu Hause sein muss.«
»Indien-Route«, sagte Prebble und schauderte.
Monks blickte ihn an. Was musste alles getan werden, während dieser Mann starb?
»Ich friere«, sagte Prebble.
Monks bewegte sich, stieß mit dem Fuß irgendwo an, blickte zu Boden, sah seine Kamera und hob sie auf.
Mit gespielter Gleichgültigkeit fragte er Preston: »Wer ist der nächste?«
Doch als sie außer Hörweite waren, sagte er: »Zur Oberin.«
Beide Männer gingen schnell. »Was ist deine Diagnose?«, fragte Clifford.
»Habt ihr eine Blutprobe genommen?«
»Klar. Wir haben auch eine Probe nach Colindale geschickt. Nun warten wir auf die Antwort. Was hat der Mann, Steven?«
»Pocken - die Blattern.«
Clifford Preston blieb wie angewurzelt stehen, und auch Monks verhielt den Schritt. So standen sie mitten im Korridor, Preston mit gesenktem Kopf, als ob er eine große Schuld auf sich geladen hätte. Seine Hände steckten immer noch in den Taschen. Unwillkürlich dachte Steven, wenn man Clifford Preston je ein Denkmal setzen würde, dann müsste er in dieser Stellung stehen, den Kopf gesenkt, die Hände in den Taschen.
»Bist du ganz sicher?«
»Nein, aber ich nehme es an. »Setze dich mit Colindale in Verbindung - das heißt, zuerst gehen wir zur Oberin.«
»In einer solchen Lage bin ich noch nie gewesen. Was tut man da, Steven?«
»Man versucht, eine Panik zu verhindern.«
Auf dem Korridor schrillte das Telefon. Julie war am Apparat »Wo bleibst du so lange, Darling?«
»Ich bin aufgehalten worden. In zwei Stunden bin ich zu Hause.« Er legte auf, und eine Schwester reichte ihm einen Bademantel. Er dachte: Wie wird sie es aufnehmen, wenn wir sie fragen, ob sie sich freiwillig zum Dienst hier meldet? Seine Kleider waren schon im Desinfektionsraum, nun stand er im Bademantel vor der Oberin, die die Sache mit bewundernswerter Gelassenheit aufnahm.
»Diese Katastrophen werden uns geschickt, damit wir uns bewähren.« Und dazu hatte sie die Achseln gehoben. Auch den Leiter der Gesundheitspolizei hatte sie bereits zu sich gebeten. Draußen vor der Tür hatte Preston leise gefragt: »Steven, was mache ich mit Ruth?«
»Wieso? Wo ist sie?«
»Bei einer Freundin in London, aber sie kommt heute Nachmittag zurück.«
»Dann rufe sie an und sage ihr, sie soll entweder dableiben oder sich vorher impfen lassen. Mache es dringend, denn du weißt, wie sie die Dinge auf die leichte Schulter nimmt. Sage ihr, wenn sie ungeimpft kommt, wird sie zwei Wochen isoliert.«
Preston runzelte die Stirn. »Ist das dein Ernst?«
»Nein, aber es ist die schlimmste Drohung, die du ihr antun kannst. Das weißt du.«
»Ja - schon.« Aber sehr überzeugt klang es nicht. Preston hatte nur an Prebble gedacht, nicht an Ruth, seine Frau.
Dann landete Monks wieder im Desinfektionsraum. Schauderhaft roch es hier. Nun dachte auch er an Prebble, an den Ausdruck auf dem Gesicht des Kollegen Ruddling, als die Oberin diesem gesagt hatte, um was es ging. Er sah Ruth mit aufgerolltem Ärmel, wie sie geimpft wurde - er sah die Route nach Cornwall...
Wenn er zurückkam, würde alles vorüber sein, er hatte seinen Urlaub gerade zur rechten Zeit genommen.
Charles Ernest Prebble lag auf der Wingfield Station; er würde sterben, zu retten war da nichts mehr. Drei Tage hier, vier Tage zu Hause im Bett, vorher die Inkubationszeit von etwa elf Tagen. Achtzehn Tage, vielleicht zwanzig. Seit zwanzig Tagen lag das Grauen über der Stadt, und kein Mensch hatte etwas davon geahnt. Der Junge hatte es eingeschleppt. Steward auf der BEC India Route. Charles Ernest Prebble würde sterben - voll Stolz auf seinen Sohn.
*
Das Fenster des Wagens war heruntergelassen; Julies Arm lag auf dem Rahmen, denn jetzt gegen Mittag hatte die Sonne schon Kraft. Der frische Luftzug tat gut. Kingsbourne lag bereits hinter ihnen, als sie Steven fragte: »Wo hast du die Kamera hingelegt?«
Eine Eisenbahnüberführung verdunkelte die Straße, dann lag wieder die blanke Sonne auf der Fahrbahn.
»Ich habe sie vergessen«, lachte Steven ein wenig verlegen.
»Was war denn eigentlich in der Klinik los?«
»Wieso?«
»Nun, es muss doch etwas losgewesen sein, wenn du den Apparat vergessen hast. Du bist doch um seinetwillen hingefahren.«
Steven Monks straffte die Schultern. Ein herrlicher Tag zum Fahren - Gott sei Dank, dass er Urlaub hatte!
»Sie haben einen Patienten mit Verdacht auf Pocken. Ich konnte es dir am Telefon nicht sagen, denn wenn mich jemand gehört hätte, wäre sehr leicht eine Panik fällig gewesen, bevor man alle Vorbereitungen getroffen hatte.« Er wusste, dass seine Worte nicht sehr überzeugend klangen.
Es verging geraume Zeit, ehe Julie antwortete. Steven sah, dass sie ihm den Kopf zuwandte und ihn scharf musterte. »Seit wann hat der Mann die Pocken?«
Es war sinnlos, Julie belügen zu wollen, »Er ist bereits im letzten Stadium.«
Kühl und sachlich fragte sie: »Hast du ihn untersucht?«
»Ich habe ihn mir angesehen, da Clifford mich darum bat.«
»Also hast du den Patienten berührt.«
»Ja, aber keine Angst, alles was zu mir gehört, ist ausgiebig durch die Desinfektionsmühle gedreht worden: Kleider, Wäsche, alles!«
Sie hob die Hand, und er fühlte, wie ihre Finger über seinen linken Oberarm strichen. »Ach, Darling, manchmal bist du unglaublich dumm«, sagte sie. »Du weißt doch, dass wir jetzt nicht weg können.«
Unbewusst gab er Gas. »Warum nicht? Ist doch alles in Ordnung.« Er lächelte. »Du selbst hast dich eben davon überzeugt, dass ich geimpft worden bin. Also kann auch dir nichts geschehen. Nun sag mir bloß nicht, ich soll auf unseren wohlverdienten Urlaub verzichten, weil sie in der Klinik alle Hände voll zu tun haben.«
Sie legte die Hände gegen die Windschutzscheibe, breitete die Finger aus und stellte ihm ein paar sachliche Fragen, auf die er die Wahrheit sagen musste. Schließlich meinte sie: »Also liegt die Gefahr schon fast drei Wochen über der Stadt.«
»Nicht das infektiöse Stadium. Erst vor vier Tagen zeigte sich bei dem Mann der Ausschlag, und man hat ihn sogleich in die Klinik gebracht.«
»Steven, seien wir doch ehrlich. Der Sohn des Mannes ist der Träger - seit fast drei Wochen. Es wird kein Einzelfall bleiben. Was wir jetzt haben, ist erst der Anfang.«
Die Straße zog sich durch belaubtes Hügelland, aber Steven machte es keine Freude mehr, das Wechselspiel von Licht und Schatten zu beobachten. »Also gut, es wird sich ausbreiten. Ist das unsere Sache?«, fragte er.
»Ich gehe zurück«, sagte sie.
Mit gespieltem Gleichmut fragte er: »Warum?«
»Weil ich helfen kann und helfen will.«
»Wie das?«
»Man wird freiwillige Hilfskräfte brauchen, und ich war ja schließlich Schwester, bevor wir heirateten.«
»Meinst du nicht, du hättest den Urlaub verdient?«
»Doch, aber nicht in dem Maße wie du.« Sie holte tief Luft. »Steven, ich kann nicht zu meinem Vergnügen verreisen, nicht jetzt.«
»Du fühlst dich berufen - ist es das? Oder fasziniert dich die Aufgabe?«
Sie fasste seinen Arm, aber diesmal, weil sie Kontakt zu ihm finden wollte. »Liebster, wir können den ganzen Tag reden - an meinem Entschluss ändert das nichts. Ich fühle mich nicht berufen, ich bin nur entschlossen, zu tun, was ich für richtig halte. Du hast wie ein Kuli geschuftet; deinen Urlaub will ich dir nicht nehmen. Setze mich irgendwo ab, es wird mich schon jemand mitfahren lassen.«
»Du lieber Gott! Du...«
»Lass gut sein, Steven. Mich kannst du im Urlaub gut entbehren, wenn du am Ufer sitzt und fischst. Du findest Gesellschaft. Ich kenne euch passionierte Angler doch!«
Er fuhr den Wagen an den Straßenrand. Sie waren fünf Meilen von Kingsbourne entfernt, schon ganz in ländlicher Umgebung. Die Angelruten waren verstaut, Köder wollte er in Cornwall kaufen. Er freute sich auf die neue Gegend, auf neue Betten, auf Wasser und Wald, auf Vögel und...
»Den Urlaub könntest du mir wirklich gönnen«, sagte er trotzig.
»Ich gönne ihn dir, aber wenn du es so auffasst...« Sie schluckte. »Gut, ich komme mit.«
Ohne ein Wort zu sagen, wendete er jedoch und fuhr zurück. Auch sie blieb lange still. »Darling, du hättest jemanden heiraten sollen, der von deinem Beruf nichts versteht«, sagte sie nach längerem Schweigen.
»Ich wollte nichts weiter als meinen verdienten Urlaub.«
»Ich weiß, und ich hätte es gern gesehen, wenn du ohne mich gefahren wärst.«
Seit elf Jahren waren sie verheiratet, so dass er mit größerer Überzeugung als ein Jungverheirateter Ehemann sagen konnte: »Das wäre nicht dasselbe.«
Wieder legte sie ihm die Hand auf den Arm, und dann wurde kein Wort mehr zwischen ihnen gewechselt, bis sie zu Hause waren.
Steven rief sogleich im Krankenhaus an, um zu erfahren, wie sich die Dinge entwickelt hatten. Man verband ihn direkt mit der Oberin. Sie sagte ziemlich nervös: »Colindale bestätigt nach dem Test, dass es sich tatsächlich um Pocken handelt. Inzwischen haben wir einen zweiten Fall eingeliefert bekommen, und das Hospital steht unter Quarantäne. Der Amtsarzt hat alle praktischen Ärzte verständigt. Er kann Ihnen erschöpfende Auskunft geben, Doktor Monks.«
»Wer ist dieser neue Fall?«
»Ein junges Mädchen, Miss Williams, die als Platzanweiserin im Royalty arbeitet.«
Er dankte und legte auf. So weit also war der Erreger schon gewandert; das Royalty-Kino lag am anderen Ende der Stadt; zwischen Kino und Bahnhof wohnten hundertfünfzigtausend Menschen. Julie trat ein. »Was gibt’s?«
»Es breitet sich aus.«
Zweites Kapitel
Oberinspektor Buckridge vom Gesundheitsamt stand in dem großen Kreis von Männern. Merkwürdig, wie sich die Bräuche wandeln: während einige der Beamten sich noch an die alte Tradition des dunklen Anzugs hielten, trugen andere Pullover oder Sportjacketts, in seltenen Fällen auch bloß ein Freizeithemd mit offenem Kragen. Einige der Herren rauchten meist kurze Pfeifen mit flachen Köpfen. Brillengläser funkelten in der Sonne; keiner sprach, alle blickten auf Buckridge.
Er war ein unscheinbarer Mann, aber mit stahlhartem Körper. Die klaren Augen verrieten keltische Abstammung. Seine ungewöhnlich langen und dichten Brauen beherrschten das Gesicht. Unwillkürlich hefteten sich alle Blicke darauf. In seiner Brusttasche steckte ein goldener Füllhalter - ein Geschenk seiner Frau, wie alle anderen Kleinigkeiten, die er mit sich herumtrug: die Armbanduhr, die Krawattennadel, das Feuerzeug, die Manschettenknöpfe. »Meine Frau schenkte es mir.« Das war ein Ausdruck, den jeder kannte, und der kennzeichnend war für diese Ehe. Der ungewöhnlich tüchtige Mann wurde von seiner Frau vergöttert. Darauf war er stolz, wenn er auch so tat, als ob er diese Bewunderung nicht verdiene.
Noch einmal schweifte sein Blick über die Männer - noch wussten sie nichts. Die wenigen, die informiert waren, befanden sich bereits irgendwo in der Stadt und kämpften gegen den unsichtbaren Feind.«
»Ich werde Sie nicht lange aufhalten.«
Alle Gesichter wandten sich ihm zu. Eine Hand drückte eine Zigarette im Aschenbecher aus, ein Brillenetui schnappte zu, es hörte sich an wie eine winzige Bombe. Ein Feuerzeug klickte. Von draußen drang der Lärm der Straße in den Büroraum.
»Ich habe Ihnen die Mitteilung zu machen, dass wir einen Pockenfall in der Stadt haben.«
Ein Flugzeug dröhnte, die Scheiben vibrierten. Niemand achtete darauf, alle waren mit Buckridges wenigen Worten beschäftigt. »Einige unter Ihnen werden wissen, was das bedeutet, die anderen kann ich schnell informieren. Pocken - der Typ, mit dem wir es zu tun haben, ist ein Killer. Wenn wir nicht sozusagen die ganze Bevölkerung impfen, hoffentlich noch rechtzeitig, ist die Sterbeziffer der von der Seuche Befallenen etwa siebzig Prozent.« Seine klugen Augen wanderten von einem zum anderen. Einige waren in Ostasien, das wusste er, aber die überwiegende Mehrzahl verließ sich auf die aus Amerika kommenden Patentarzneien. Das waren die gefährlichen Leute; sie würden die Sache erst ernst nehmen, wenn es zu spät war. »Das Kings Hospital hat diesen ersten Fall; er ist ernst. Wir haben bereits einen zweiten
Fall, doch steht noch nicht fest, ob er gefährlich ist. Was wir wissen ist dies: es werden weitere Fälle kommen. Verursacht werden die Pocken durch einen Erreger; er ist übertragbar und ansteckend. Seit drei Wochen ist die Gefahr latent in der Stadt.«
Einer der Männer murmelte: »Großer Gott!«
Buckridge blickte ihn an. »Ja, seine Hilfe werden wir brauchen.«
Alle Gesichter hatten sich mehr oder weniger gewandelt. Die Zigaretten zwischen den Fingern waren vergessen. Ein Bus fuhr vorbei, die Scheiben klirrten, keiner nahm Notiz davon. Fragende Augen blickten den Mann an, der nun zu dem Stadtplan an der Wand trat. »Der erste Kranke arbeitete bei der Eisenbahn, aber er hatte Gott sei Dank nichts mit dem Publikum zu tun.« Seine schmalen, sehnigen Hände fuhren über den Plan. »Die zweite Patientin war Platzanweiserin hier im Kino. Damit umfasst die Gefahrenzone praktisch die ganze Stadt.«
Er ließ die Hand sinken. »Wir kennen den Träger, den Mann also, der die Seuche eingeschleppt hat. Er kam vor drei Wochen aus Indien und ist noch hier. Mit wie vielen Leuten mag er in diesen drei Wochen Kontakt gehabt haben? Sind es hundert, sind es tausend?« Seine dichten Brauen schoben sich zusammen. »Wir können mit Sicherheit sagen, dass tausend Einwohner unserer Stadt in direkter Gefahr sind. Das sind die Leute, die zu dem Träger oder seinem ersten Opfer Kontakt gehabt haben. Es gilt, diese Leute zu finden, sie zu untersuchen, zu impfen und mindestens sechzehn Tage zu isolieren.«
Unwillkürlich sagte einer der Männer: »Das machen die nicht mit.«
Buckridge fuhr herum und zwang den Sprecher, ihn anzusehen. Er ließ sich Zeit, bis er sehr ernst, doch nachsichtig, wie man zu einem Kind spricht, sagte: »Wir haben eine Seuche!«
Seine Augen funkelten, blickten einen nach dem anderen an mit einem Blick, dem nichts entging. Als er überzeugt zu sein schien, dass sie sich der Tragweite seiner Worte bewusst waren, fuhr er fort: »Verwaltungsmäßig ist von medizinischer Seite aus alles getan worden, was als erstes zu geschehen hat. Es sind ausreichende Mengen Serum angefordert worden, die Besatzung und Passagiere des betreffenden Flugzeuges sind ermittelt, ebenso das gesamte Personal des Flughafens. Sie stehen unter ärztlicher Aufsicht. Der Oberpostmeister von Kingsbourne ist verständigt, und alle Ärzte der Stadt wissen Bescheid. Personal und alle Patienten des Hospitals sind geimpft. Das Krankenhaus befindet sich unter Quarantäne. Im Erdgeschoss dieses Hauses warten zwei hübsche Schwestern auf Sie. Wenn Sie mich verlassen, ziehen Sie Ihr Jackett aus und rollen den linken Hemdärmel auf.«
Ein verlegenes Lächeln auf allen Gesichtern. Die Männer sahen sich schon wie eine Herde Schafe zur Schlachtbank gehen. Einige schienen erleichtert zu sein. Immerhin hatte Buckridge nüchtern und verständnisvoll gesprochen, sie waren im Bilde.
Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte; er nahm den Hörer ab und sagte: »Ja, sie kommen nach unten.« Als er aufgelegt hatte, sagte er: »Ich bitte die Inspektoren und ihre Assistenten, sich in einer halben Stunde wieder bei mir zu melden. Was wir dann machen, erläutere ich Ihnen, wenn Sie wiederkommen.«
*
Früh am Nachmittag war Monks mit dem Amtsarzt von Kingsbourne unterwegs zu Charles Prebbles Haus. Ihrem Dienstwagen folgte der Desinfektionswagen, dunkelgrün, mit sehr viel Chrom, das Stadtwappen auf der Tür. Sie gelangten in das übervölkerte Viertel der Stadt in der Nähe des Bahnhofs.
Steven dachte an Prebble, der in seinem Krankenhausbett lag und auf den Tod wartete. Er dachte an Schwester Gill und an Prestons bekümmertes Gesicht, als er sich über den Kranken beugte. Er dachte auch an Ruth - weil sie Prestons Frau war. Sie war in London. Er hatte Clifford Preston am Telefon gefragt, ob er mit Ruth gesprochen habe. Die Antwort war: »Nein, mit ihrer Freundin, sie war in der Stadt, einkaufen.«
Später, als Monks gerade im Begriff war, mit Tewson wegzufahren, hatte Preston ihn noch einmal angerufen: »Ich habe deine Kamera desinfizieren lassen. Holst du sie ab?«
Und dann: »Ruth kommt nicht eher nach Hause, bevor nicht alle Gefahr vorüber ist.«
»Sehr vernünftig. Hat sie dir das gesagt?«
»Nein, sie hat in der Aufnahme Nachricht für mich hinterlassen.
Preston schien auf ein Wort des Verständnisses zu warten, deshalb sagte Monks: »Na, viel Zeit hättest du sowieso nicht für sie.«
»Nein.« Dann hatte Clifford plötzlich aufgelegt.
Steven musste die Gedanken an diese Frau verdrängen. Tewson fragte plötzlich: »Ist dies die Straße?«
Eine armselige Straße mit schmalen Bordsteigen, auf denen Kinder spielten. Die Häuser verwahrlost, die Fenster schmutzig, der Anstrich abgeblättert. Monks entgegnete: »Wahrscheinlich.«
Steven nahm seine Tasche und ging mit Tewson ins Haus. Die Menge machte ihnen Platz, befriedigt, dass ihr nichts entgangen war.
Das Vorzimmer war hell und freundlich, mit neuen Möbeln und ein paar Andenken aus China. Beherrschend war der Fernsehapparat, doch standen wenigstens keine Kinkerlitzchen drauf. Man hatte zu viel Achtung vor diesem auf Raten gekauften modernen Altar. Es roch nach Ruß und Pfefferminze.
»Wie geht es meinem Mann, Doktor?«, fragte die hagere Frau.
»Wir können nicht erwarten, dass sich viel geändert hat, Mrs. Prebble«, sagte Steven. Sie sah schon jetzt wie eine gebeugte Witwe aus.
»Ja, ich verstehe.« Sie verstand nicht, sie nahm es nur hin, wie sie alles im Leben hingenommen hatte - mit dumpfer Ergebenheit.
Tewson fragte: »Sind Sie sich klar über alles, was hier geschieht?« Seine Stimme war nachsichtig, gütig, so gütig wie Steven ihn nie hatte sprechen hören.
»Die Polizei hat uns gesagt, dass es sehr schlimm steht.«
Tewson nickte. »Trotzdem könnte es schlimmer sein.« Er dachte: Wenn es den Jungen getroffen hätte, dann wäre das für sie und den Mann schwerer. »Ich schätze Ihr Verständnis dafür, dass Sie uns nur helfen können, wenn Sie etwa zwei Wochen lang im Haus bleiben und jeden Kontakt meiden.«
»Ja, Doktor.« Sie nahm auch dies hin; zudem waren die Männer Beamte, also würden sie schon wissen, was richtig war und was nicht.
»Ich möchte anfangen«, murmelte Steven, und Trewson sagte:
»Mrs. Prebble, der Doktor möchte alle, die hier wohnen, kurz untersuchen.«
Sie nickte.





























