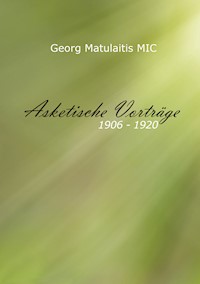
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der selige Georg Matulaitis behandelt in seinen asketischen Vorträgen, die er vor Ordensfrauen gehalten hat, eine Vielfalt von geistlichen Themen. Man meint ihn selbst sprechen zu hören, wenn man die von Schwestern erstellten Mitschriften liest. Welch großer Kenner des Ordenslebens ergreift hier das Wort! Er weiß um die Schwierigkeiten im Gebet und die Spannungen im Zusammenleben. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern gibt Hilfen, die Herausforderungen anzunehmen und für eine Vertiefung des Glaubens und ein Wachsen in der Selbsterkenntnis nutzbar zu machen. Die Liebe Gottes ist es, die immer wieder einen Neuanfang schenkt. Die Ratschläge des Seligen sind hochaktuell und für alle Christen eine Fundgrube - ob in Ordensgemeinschaften oder in der Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Von der Heiligkeit
Vom Leben in der Gemeinschaft
Von der Liebe Gottes
Von der schwesterlichen Liebe
Vom Ziel des Menschen
Von der Notwendigkeit, den Charakter zu formen
Vom Ziel der Exerzitien
Vom Eifer
Von der Lauheit und ihren Gründen
Von der Berufung, die Vollkommenheit zu erlangen
Vom Leben nach den evangelischen Räten
Von der Armut
Vom Gehorsam
Von der Schönheit des gottgeweihten Lebens
Von der Aufrechterhaltung der Gottesbeziehung
Von Zeichen des Fortschritts auf dem Weg zur Vollkommenheit
Von der Treue in der Einhaltung der Regel
Von der Nächstenliebe
Vom Leben in der Gemeinschaft
Von der gegenseitigen Liebe in der Kongregation
Das Bessere, das Maria erwählt hat
Über den Autor
Vorwort
"Jesus Christus, der im Allerheiligsten Sakrament verborgen ist und den ihr in besonderer Weise verehren sollt, vereine euch zu einer göttlichen Familie. Es gibt kein Leben ohne Schwierigkeiten".
Seliger P. Georg Matulaitis
Das 100-jährige Bestehen der Kongregation der Dienerinnen Jesu in der Eucharistie ist eine willkommene Gelegenheit, die "Asketischen Vorträge" des seligen P. Georg Matulaitis zu veröffentlichen. Ein Dank gilt der Kongregation der Marianer, welche die Mitschriften der Vorträge gesammelt und 1967 in Schreibmaschinenschrift und später in gedruckter Form herausgab. Die Mitschriften stammen von Zuhörerinnen aus verschiedenen Kongregationen. 2002 tippte Sr. Halina Strzelecka SJE diese Vorträge für die Zwecke unserer Kongregation mit dem Computer ab und nahm kleine stilistische Anpassungen vor, um das Verständnis zu erleichtern.
Besonders lag dem seligen P. Georg Matulaitis am Herzen, dass seine geistigen Töchter auf ihre eigene geistliche Entwicklung, die religiöse Disziplin und innere Formung sowie die Treue zur bräutlichen Liebe Jesu Christi achten.
Er selbst schöpfte aus der eucharistischen Anbetung die innere Kraft für die Umsetzung seiner Mission in der Kirche. Er war ein tiefgläubiger Seelsorger mit einem reichen geistlichen Leben und einem umfassenden pastoralen Blick auf die Kirche seiner Zeit. Mit dem großen Wunsch, die Ehre Gottes zu mehren und den Menschen zu dienen erneuerte der selige Georg die aussterbende Kongregation der Marianer, gründete die Kongregation der Armen Schwestern von der Unbefleckten Empfängnis der seligen Jungfrau Maria und die Kongregation der Dienerinnen Jesu in der Eucharistie.
Er hinterließ unserer Kongregation den geistlichen Reichtum seines Lebens, d.h. eine tiefe Erfahrung des Opfertodes Christi, der in der Messfeier gegenwärtig wird, eine große Hingabe an die heilige Kirche und das Verlangen, den eucharistischen Jesus Christus zum Mittelpunkt des geistlichen Lebens und des apostolischen Dienstes zu machen.
Die Lektüre der asketischen Vorträge zeigt uns die liebevolle Sorge des seligen Georg um das Ordensleben und dessen Niveau. Der Inhalt der Vorträge zeigt, dass ihm die Probleme des Ordenslebens, die Fehlhaltungen und Unzulänglichkeiten der Ordensleute nicht fremd waren. In den Vorträgen gibt er Weisungen für die Arbeit an sich selbst und zeigt die Notwendigkeit der geistlichen Formung auf.
Möge dieses spirituelle Vermächtnis unseres Gründers künftigen Generationen von Eucharistinerinnen ermöglichen unsere Wurzeln immer tiefer zu erspüren und nach dem Geist unseres Gründers zu leben.
Ich vertraue darauf, dass die aufmerksame Lektüre der Texte des seligen Georg nicht nur zur geistlichen Erneuerung unserer Kongregation beiträgt, sondern auch den Sinn des Ordenslebens tiefer verstehen lässt und uns dazu anregt, Gott für das Geschenk unseres „Vaters Georg“ zu danken. Möge dieses Buch uns allen ein geistlicher Wegweiser werden, der uns zeigt, wie wir ein wahres Ordensleben führen können, um die Mühen des Apostolats auf uns zu nehmen und das geistliche Leben vereint mit dem Opfer Christi zu pflegen.
Ich danke allen, denen die Bewahrung des Vermächtnisses unseres Vaters und Gründers am Herzen liegt und die sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre darum bemüht haben, Material über das Werk des seligen Georg Matulaitis zu sammeln.
Mein besonderer Dank gilt Sr. M. Thekla Hofer und Pfr. Anton Heinz sowie Sr. Maria Feist SJE und Sr. Sandra Friedrich SJE für die Vorbereitung der Herausgabe dieses Werkes.
Pruszkow, Herbst 2022
Sr. Małgorzata Wawryk
Generaloberin
Kongregation der Schwestern
Dienerinnen Jesu in der Eucharistie
Vorwort zur ersten polnischen Ausgabe, 1967
Die hier gesammelten asketischen Vorträge hielt P. Georg Matulaitis gemäß den Datumsangaben der zuhörenden Warschauer Ordensschwestern zwischen 1906 und 1920.
P. Matulaitis hielt sich mehrfach für längere Zeit in Warschau auf: zwei Jahre im Priesterseminar (von 1893 bis 1895) und von Ende November 1904 bis Ende August 1907 sowie von Anfang Mai 1914 bis Ende Februar 1918 im Institut von Cecilia Plater Zyberk in der Piekna-Straße 24. Dort verbrachte er auch die Sommer- und Winterferien während seiner Zeit an der Geistlichen Akademie in St. Petersburg von 1907 bis 1910. Zwischen 1921 und 1925 weilte er bei seinen Kurzaufenthalten in der Hauptstadt als Bischof von Vilnius ebenfalls dort.
Die hier abgedruckten Vorträge wurden entweder als einzelne Ansprachen oder als Vortragsreihe im Rahmen von Exerzitien für Ordensschwestern gehalten. Es bereitet einige Schwierigkeiten, ihre Zusammenstellung, Reihenfolge und Entstehungszeit exakt festzulegen. Nur wenige Vorträge tragen ein Datum. Der Text der Vorträge wurde nicht von P. Matulaitis geschrieben und auch nicht von ihm autorisiert. Es sind Mitschriften der Schwestern, die während der Konferenzen entstanden sind. Später wurden sie durch einige Teilnehmerinnen aus dem Gedächtnis vervollständigt. Der Redner bediente sich gewöhnlich nur einiger Stichworte oder vorbereiteter Punkte, die er dann in freier Rede entfaltete.
Die Schwestern schrieben ihre Notizen in kleine Heftchen. Nach dem Tod von P. Matulaitis bemühten sich einige Priester der Kongregation der Marianer, diese Mitschriften im selben Format abzutippen. Es existieren auch spätere Abschriften, ungeheftet und im normalen Schreibmaschinenformat. Die Originalniederschriften der Hörerinnen sind nicht erhalten.
Einige Ansprachen in den beiden Bänden wurden von zwei unterschiedlichen Hörerinnen abgefasst. Beim Vergleich dieser Texte stellte man nur geringfügige Abweichungen fest. Das ist eine glückliche Entdeckung, die zu der Annahme berechtigt, dass wir – obwohl wir es formell nicht mit einem authentischen Text zu tun haben – tatsächlich von einem unmittelbar von P. Matulaitis stammenden Text ausgehen können.
Den Inhalt dieser Ansprachen bilden wesentliche Fragestellungen des Ordenslebens: Fundament, Ziel, wichtige Elemente sowie Mängel und Unzulänglichkeiten im Verhalten von Ordensleuten. In der Exerzitienreihe behandelte der Autor auch allgemeine Themen wie die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, die Notwendigkeit der Reflexion über sich und seine Taten, der Buße und der Arbeit an sich selbst.
In manchen Punkten erscheint dem modernen Leser die Sichtweise von P. Matulaitis vielleicht etwas befremdlich. Nicht alles sehen wir heute noch so wie vor 50 Jahren, auch bezüglich des Ordenslebens. Wir dürfen von P. Matulaitis nicht Aussagen erwarten, die das II. Vatikanische Konzil verkündet hat. Dennoch sind die Vorträge für uns wertvoll. Aus ihnen leuchtet die Persönlichkeit von P. Matulaitis hervor: sein Charakter, seine Haltung. Wir lesen darin, wie realistisch dieser Erneuerer, der unsere Ordensgemeinschaft reformiert hat, das Ordensleben, das Verhalten der Ordenschristen in den Klöstern, ihre Unvollkommenheiten und Mängel wahrnahm. Zwar trug er seine Gedanken Mitgliedern anderer ihm besonders vertrauter Kongregationen vor, aber wir können mit Recht annehmen, dass er heute zu den Mitgliedern der von ihm gegründeten Kongregationen genauso sprechen würde. Er hätte die gleichen Ideale aufgezeigt, die gleichen Ermahnungen gegeben und die gleichen Forderungen gestellt.
Die Information über Zeit und Ort der Vorträge sowie die Art der Niederschrift der Notizen bekam ich von den Schwestern, die P. Matulaitis hörten. Die vorliegende Fassung der Vorträge stammt aus den Niederlassungen unserer Kongregation in Bielany, Skórca, in der Vilniuser Straße und aus Rom. Es sind nicht alle Vorträge, die P. Matulaitis in Warschau gehalten hat. Es ist aber wohl auch nicht alles erhalten geblieben, was notiert wurde.
Die Sprache der Vorträge blieb unverändert, genauso, wie sie in den Notizen festgehalten war, ohne jegliche Stilkorrekturen oder Änderung einzelner Worte.
P. Jan Bukowicz MIC
Nachtrag, 2002
Die asketischen Vorträge des sel. Erzbischofs Georg Matulaitis wurden von P. Dr. J. Bukowicz in Warschau 1967 im V. Band der Materialien zur Geschichte der Marianer gesammelt und in gedruckter Form veröffentlicht. Dies geht aus dem Titelblatt des Exemplars hervor, das unserer Gemeinschaft geschenkt wurde.
Die Kongregation empfing die Vorträge des Gründers mit großer Freude und Ehrfurcht und bemühte sich, sich durch sie seinen Geist und seine Grundsätze des Ordenslebens so anzueignen, wie er es versteht. Der unzweifelhafte Nutzen dieser Lektüre wurde im Laufe der Zeit durch den als verwirrend und unklar empfundenen Stil der Vorträge gemindert, das Verständnis der enthaltenen Gedanken erschwert.
Der erwähnte Mangel ist nicht verwunderlich, wenn man den letzten Satz der Einführung von P. Bukowicz liest. Da die Sammlung nur auf Notizen der Hörerinnen beruht und weder korrigiert noch autorisiert noch vom Autor redigiert wurde, kann man diesen Text im Hinblick auf den Stil nicht als authentisch betrachten. Die Originalwerke des Gründers wie seine Briefe, Abhandlungen und andere Texte sind gekennzeichnet durch einen deutlichen und klaren Stil, was man von den Notizen der Hörerinnen nicht behaupten kann, obwohl sie sicher den Inhalt und die Grundsätze richtig wiedergegeben haben.
Im Bemühen, diese Inhalte an die Schwestern weiterzugeben, hat die Ordensleitung zwischen 1983 und 1985, kurz vor der Seligsprechung, den Versuch unternommen, den Stil der Vorträge zu glätten, und sie in dieser neuen Fassung in der Zeitschrift der Gemeinschaft veröffentlicht. Es scheint mir, dass der Sinn dessen, was der selige Georg uns sagen wollte, darunter nicht gelitten hat. Heute, da ich dies schreibe, ist der 3. Januar des Jahres des Herrn 2002. Die Generaloberin Halina Sklepkowska SJE wünschte, dass die Lesbarkeit dieser Vorträge durch das Abtippen der Texte am Computer verbessert wird.
Sr. Halina Strzelecka SJE
Von der Heiligkeit
In diesem wichtigen Augenblick des Eintritts in das Noviziat bzw. der Professablegung möchte ich einige Worte zum Thema „Was ist Heiligkeit?“ sagen.
„Seid heilig, weil ich heilig bin“, spricht der Herr. Das ist das erhabene Ziel, nach dem wir streben müssen und worauf wir unsere Gedanken und unser Handeln richten sollen.
Heiligkeit hat viele Aspekte. Wenn wir auf die Heiliggesprochenen und ihre Verehrung schauen, entdecken wir in jedem von ihnen Merkmale der Heiligkeit.
Sie ist eine Eigenschaft des Menschen und eine Disposition der Seele, die das Besondere des Charakters ausmacht. Spezifische Tugenden wie Güte, Gerechtigkeit und andere sind sehr wichtig, aber sie formen uns nur in eine bestimmte Richtung. Die Heiligkeit aber umfasst die ganze Seele und das Wesen des Menschen. Alle seine Werke, Pläne, Gedanken, seine Sehnsucht und Wünsche ordnet er einem einzigen Ziel unter: der Ehre Gottes.
Gott wird dann zur Mitte der Existenz, auf ihn hin richten sich alle Gefühle, und alles Tun ist ihm geweiht. Der Heilige erfasst mit seinem Verstand die Ehre und Majestät Gottes und die Erbärmlichkeit der Geschöpfe, die unbegrenzte Allmacht Gottes und die eigene Nichtigkeit und die der anderen Menschen. Wenn jemand zu dieser Erkenntnis gelangt, erlebt er sozusagen das erste Zittern der Heiligkeit. Erleuchtet vom lebendigen Glauben, sahen die Heiligen den Glanz der Macht Gottes, und in diesem Glanz erkannten sie die Größe Gottes und die Nichtigkeit des Geschaffenen noch deutlicher. Oft wurden sie von den Menschen hoch verehrt, doch wir erschrecken, wenn wir sehen, wie unwürdig sie sich selbst in ihren Schriften beschrieben. Waren sie unwahrhaftig? Nein, sie schrieben das ehrlich! Ihre Demut kam aus der Erkenntnis der Vollkommenheit Gottes, in dessen Licht sie ihren eigenen Schatten, jede kleinste Untreue sahen. Erleuchtet von diesem Licht und angesichts der Vollkommenheit Gottes und der eigenen Nichtigkeit, lernten sie die besondere Sprache der Demut.
Wahre Heiligkeit besteht darin, unseren Willen vollkommen mit dem Willen Gottes zu vereinen und Gott ins Zentrum zu rücken. Wer zwar Gott verehrt, aber sich nicht bemüht, seinen Willen dem Willen Gottes anzugleichen, ist nicht heilig. Wer will, was Gott will, der ist heilig, so der hl. Thomas. Ein Heiliger ist konsequent. Er führt gern und mutig alles aus, was Gott von ihm verlangt. Sein Wille, der durch die Liebe Gottes entzündet ist, wird Beweggrund und Quelle seiner Taten.
Ein zweiter Aspekt ist, sich an die Gedanken Gottes „anzuschmiegen“ und den eigenen Willen so zu bilden, dass er freudig und schnell den Willen Gottes erfüllt. Gott ist dann nicht etwas Abgetrenntes, Abstraktes, sondern der Lebensinhalt des Menschen, der zwar in der Welt lebt, aber sich nicht der Welt angleicht und sich deshalb von den „weltlichen“ Menschen unterscheidet.
In der Kirche Christi gibt es verschiedene Stufen der Heiligkeit.
Die erste Stufe der Heiligkeit besteht darin, dass man die schweren Sünden flieht und die Standespflichten treu erfüllt.
Die zweite Stufe ist gekennzeichnet durch das Vermeiden der lässlichen Sünde und das Ausführen von Tugendakten.
Die wahre Heiligkeit ist aber erst auf der dritten Stufe erreicht. Hier vereint sich die Seele vollkommen mit dem Willen Gottes und ist fähig zur heroischen Übung der Tugenden.
Das grundlegende Merkmal der Heiligkeit ist die Loslösung von allem Geschöpflichen und die vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Wenn Gott jemanden zur Heiligkeit ruft, schafft er ihm eine Umgebung, in der er heilig werden kann. Es gibt verschiedene Wege der Berufung zum Dienst Gottes. Einige umgibt Gott schon am Anfang ihres Lebens mit solch einer Fürsorge, dass sie rein bleiben. Andere zieht er aus dem Sumpf der Sünde heraus. Es kommt aber vor, dass Seelen, die viel sündigen, Gott mehr lieben, wie wir am Beispiel vieler Büßer sehen können. Es gibt auch solche, deren Wiege vom Heiligenschein beleuchtet war, die aber später fielen und sich erst am Ende wieder zu Gott bekehrten. Andere wiederum widersetzten sich lange der Gnade Gottes, zweifelten und hatten Angst, bis die Gnade Gottes sie endlich überwältigte.
Am häufigsten ist das allmähliche Wirken Gottes: Wie sich ein Kristall im Laufe der Zeit bildet, so verhält es sich auch mit der Gnade Gottes und dem Ruf zur Heiligkeit. Gott gießt in das Herz das Verlangen nach Höherem. Und die Unruhe aufgrund der Mängel veredelt allmählich die Seele, bis sie zum Kristall wird. Wenn sie sich dieser Eingebung nicht widersetzt, dann beginnt sie sich von der Welt zu lösen. Langsam lockern sich die Bande, die sie an die Welt binden, und die Gnade Gottes leitet sie an, sich der Führung Gottes zu unterstellen, und bringt sie auf den Weg der Heiligkeit. Ohne diese Gnade sind wir zu nichts fähig. Und deswegen müssen wir mit ihr stets mitarbeiten, damit wir uns langsam immer mehr zu Gott erheben.
Bei den Heiligen sehen wir ein beständiges Loslösen von der Welt: dass ich über meinen Wünschen und Schwächen stehen kann und mich zu dem erhebe, der die Quelle der Wahrheit und Heiligkeit ist. In der Betrachtung, beim Empfang der Sakramente, im geistlichen Leben erhoben sich die Heiligen über die Welt und über sich selbst, bis sie zu Gott gelangten. Sie schauten nicht auf sich selbst, sondern auf Christus. Pascal, der ein Gelehrter war und alles tat, um heilig zu werden, wurde nicht heilig, weil er auf sich selbst konzentriert war, nicht auf Gott.
Die Heiligen unterscheiden sich dadurch, dass sie in der Gegenwart Gottes lebten. Sie schauten die Heiligkeit Gottes, weshalb sie sich auch so innig mit ihm vereinten, mit ihm „ein Geist“ wurden. Mit vollem Recht können sie die Worte des heiligen Paulus wiederholen: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ Sie eigneten sich immer mehr den Geist und das Empfinden Gottes an und wurden schon hier auf Erden gleichsam ein zweiter Christus.
Wenn die Heiligen auch ganz in Gott versunken waren, so behielten sie doch die Eigenschaften ihrer Natur. Gott vernichtet die Natur nämlich nicht, sondern erhebt und veredelt sie. Ein Beispiel: Manche hatten ein offenes und einfaches Gemüt und warfen sich voller Vertrauen in die Arme des himmlischen Vaters, schenkten aber ihren kleinen Unvollkommenheiten keine Aufmerksamkeit. Dank ihres Schauens auf Gott wurden diese jedoch immer kleiner und verschwanden schließlich, weil die Liebe Gottes, die ihre Herzen erfüllte, die Schwächen versenkte. Andere sahen in Gott ihren Richter, zitterten vor seiner Majestät und nahmen deswegen schwere Bußübungen und Opfer auf sich, um ihre Seele zu reinigen. Das Fundament war bei allen die Liebe.
Bei manchen Heiligen blieb der Charakter in gewisser Weise rau und ungehobelt, was sie nicht überwinden konnten oder manchmal auch noch nicht einmal bemerkten. Das darf uns eine gewisse Ermutigung sein: Man kann auch dann heilig sein, wenn man nicht allzu umgänglich ist. Dieses Ungehobelt-Sein hat seine Ursache manchmal in mangelnder Bildung oder auch einfach in der Unfähigkeit, mit Menschen umzugehen. Aber wir sind verpflichtet, an uns zu arbeiten, unsere Fehler immer mehr zu erkennen und so anderen ein Beispiel und Vorbild im Umgang sein zu können. Unsere Natur muss geformt und gebildet werden, damit die Gnade Gottes aus uns herausstrahlt. Wir sollen Engel der Liebe und Güte werden, indem wir unsere Seele immer mehr gestalten, sodass sich dies auch auf andere auswirkt.
Die Heiligen haben verschiedene Gesichter, und jedes ist anders. Trotz dieser Vielfalt waren sie untereinander harmonisch. Über dieser Harmonie standen der Geist, der sie belebte, und das Ziel, das sie einte. Das war die innige Gottes- und Nächstenliebe. Unter diesem Einfluss erstrebten sie die Ehre Gottes und die Rettung der Seelen. Gott erweckt verschiedene Berufungen entsprechend den Nöten der Menschen. Wir sehen, dass die hl. Theresia von Avila die äußere Sauberkeit in hohem Maß verlangte. Der hl. Benedikt Labre hingegen verabscheute diese und wählte den Schmutz der Straße. Ein hl. Benedikt von Nursia sah die Leidenschaft, die die Welt erfasst hatte, und gelobte die Keuschheit. Der hl. Franziskus pries in einer Zeit des Luxus und der Verschwendung die Armut. Der hl. Ignatius, der sah, dass der Protestantismus liberale Ideen verbreitete, lernte den Gehorsam schätzen und unterwarf sich der Führung der Kirche.
Die Heiligen widersetzten sich dem vorherrschenden Trend. Wir können ihren Mut bewundern, aber ihre Taten nicht immer nachahmen. Gott erweckt Heilige gemäß den Nöten der Zeit. Das, was damals notwendig war und dem Willen Gottes entsprach, kann heute nicht einfach kopiert werden. In allem aber können wir ihnen im Glauben, mit dem die Heiligen ihre Taten vollbrachten, nacheifern. Und wann, wenn nicht heute, in unserer Zeit, ist der Glaube notwendiger, wo der Unglaube die ganze Menschheit zu erfassen beginnt? Wer außer uns selbst kann in uns diesen starken Glauben entfachen?
Im Einklang mit der Kirche praktizieren wir eine vernünftige Frömmigkeit, die die kritischen und vom Unglauben angesteckten Menschen für Gott gewinnen kann. Bemühen wir uns mit einem durch Gottvertrauen gestärkten Willen, den Pessimismus und Unglauben zu überwinden, die immer breitere Schichten der Gesellschaft erfassen. Wenn wir mit unerschütterlichem Glauben damit beginnen, können wir des Sieges sicher sein, weil der Glaube alle Schwierigkeiten überwindet. Ein Vorbild haben wir in der Heiligen Schrift, in den Patriarchen und Propheten, die so große Taten für Gott vollbrachten.
Heute ist Eifer eine Tugend, die eine Seele, die Gott und den Nächsten liebt, kennzeichnet. „Seid vollkommen, wie auch unser Vater im Himmel vollkommen ist!“ Gott sehen wir nur im Lichte des Glaubens. Er ist für uns ein unerreichbares Vorbild, aber wir müssen ihm nachfolgen. Um dies unserer armen Natur zu erleichtern, ist Gott Mensch geworden. Und so haben wir ein erreichbares Vorbild – den fleischgewordenen Gott, den menschgewordenen Gott. Im Streben nach Heiligkeit schauen wir auf Christus, weil er unser Ideal ist. Die Heiligen aller Zeiten schauten auf ihn und wollten nichts wissen außer Jesus, den Gekreuzigten. Wem das zu schwer ist, der kann auf das Beispiel der Heiligen schauen, um sich durch sie zu Christus zu erheben, weil der Wille der Heiligen mit dem Willen Gottes vereint war.
Die Liebe ist vollkommene Heiligkeit. Und Frucht dieser Heiligkeit sind die Werke. Es gibt kein Elend, keine Bedürfnisse, keine Umgebung, in die die Heiligen nicht vorgedrungen sind, um Seelen aus Liebe zu Christus zu retten. Sie waren wirkliche Helden und Wohltäter der Menschheit.
Der Nachweis der Heiligkeit, ihre Quelle und ihr Fundament, ist die Liebe Gottes. Es gibt Heilige, die nicht nach außen wirkten. Wenn die Liebe im Herzen aber erloschen ist, dann gelten alle Taten nichts im Hinblick auf die Heiligkeit, weil man nur aus Liebe zu Gott heilig sein kann.
Heiligkeit ist unabhängig von den Fähigkeiten. Heilig kann ein Gelehrter sein, aber auch ein ganz einfacher Mensch: Denken wir an Johannes Vianney.
Die Heiligkeit baut auf der Natur auf. Manche Menschen haben einen weiten Horizont, andere haben eine eingeschränkte Sicht. Es gibt auch verschiedene Charaktere, aber nur den einen Geist. Die Äußerlichkeiten bilden den Rahmen, die Färbung, den Untergrund, die Voraussetzungen. Entscheidend ist das Bild.
Aufgrund der Verschiedenheit der Sichtweisen und Neigungen entstehen oft Reibungen, sogar unter Menschen guten Willens. Sie sind die Ursache von Kreuz und Leid. Wir müssen allerdings wie Christus leiden, um das Maß seiner Leiden zu ergänzen. Wie das Korn: Wenn es nicht stirbt und nicht eins mit der Erde wird, bleibt es trocken und bringt keine Frucht. Die Heiligen unterschieden sich dadurch, dass sie sich verloren, im Willen Gottes untergingen und dadurch hundertfache Frucht brachten. Es gibt keine Berufung ohne Verzicht. Wenn Gott uns ruft, müssen wir alles verlassen, vor allem aber uns selber. Dann erhalten wir neues Leben.
Wenn wir das Leben des hl. Franz von Sales anschauen, sehen wir, wie die Gnade Gottes allmählich sein Herz ergriff. Als junger Mann wurde er Kanoniker und versank im Reichtum, weil die geistlichen Ämter damals viel Pfründe hatten. Menschlich gesehen öffneten sich ihm Wege zu weiteren Würden, aber er sah die Not der armen Kinder, versammelte um sich Menschen guten Willens und bildete sie zu Lehrern für diese armen Kinder aus. Schon viele Personen widmeten sich dieser Arbeit, doch immer wieder überfiel sie Angst vor der Zukunft, weil sie arme Menschen waren. Der heilige Franz ermunterte sie zum Vertrauen auf die Vorsehung Gottes, als einer von ihnen einwandte: „Du hast leicht reden, Vater. Du hast eine reiche Familie und bist abgesichert.“ Der Heilige verstummte und sagte sich daraufhin von seinem Reichtum und den Ämtern los. Er achtete nicht auf den Spott der Menschen, die dieses ihnen seltsam erscheinende Verhalten nicht verstehen konnten und ihn für verrückt erklärten. Als er allem entsagt hatte, stand er erneut unter den Armen und ermunterte sie dazu, der Vorsehung Gottes zu vertrauen. Er ist sich selbst gestorben, aber nur, um zum neuen Leben in Christus aufzuerstehen. Es ist wichtig, keine Angst davor zu haben, sich der Gnade Gottes zu unterwerfen, denn wenn wir auf diese Art uns selbst sterben, werden wir hundertfache Frucht bringen.
Die vollkommene Harmonie im Leben der Heiligen sorgte dafür, dass zwischen ihrer Überzeugung und ihren Taten keine Kluft entstand. Was die Vernunft für gut befand, verfolgte ihr Wille beharrlich.
Je mehr der Mensch seinen Willen vollkommen mit dem Willen Gottes vereinen kann, desto geformter ist er und desto stärker leuchtet die Heiligkeit.
Heiligkeit ist der Wille, der von der Liebe zu Gott und zum Nächsten entflammt ist. Ihre Eigenschaft ist es, sich zu Gott zu erheben und Christus nachzufolgen. Bemühen wir uns, Gott durch immer größere Vollkommenheit zu gefallen. Der Inhalt unseres Lebens soll allein die Suche nach Gott sein und die Erfüllung seines Willens in allem, was er von uns erwartet.
Vom Leben in der Gemeinschaft
„Euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott“ (Kol 3,3).
Wir wissen, dass das Leben des Menschen seiner Natur entsprechend aus innerem und äußerem Leben besteht. Dabei schöpft Ersteres all seinen Wert aus dem Zweiten. Unser äußeres Leben endet im Augenblick des Todes, während unser inneres Leben dann zur Blüte gelangt, um ewig weiterzubestehen. Leider pflegen nicht alle Menschen das innere, geistliche Leben. Man könnte sagen, dass diese zwei Lebensarten während unserer Pilgerschaft zur Ewigkeit in ständigem Kampf miteinander stehen.
Der Grund dafür ist unsere durch die Sünde verdorbene Natur, die Verbündete Satans, der sich mit allen Kräften darum bemüht, das geistliche Leben in uns zu zerstören oder in die falsche Richtung zu lenken. Wie soll denn auch Satan, der ewig alte Feind Gottes, unserem geistlichen Leben gegenüber gleichgültig sein, wo er genau weiß, dass Christus das Ideal des Lebens ist – weil er von sich selbst sagte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ „Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt in Fülle.“ Laut Paulus ist es „das Leben mit Christus, verborgen in Gott“.
Der Apostel spricht auch von dem schon erwähnten Kampf dieses Lebens mit der Natur: „Wir haben ein anderes Gesetz in unseren Gliedern, das sich unserem Geist widersetzt.“
Wenn man erfolgreich an der Entfaltung des eigenen inneren Lebens arbeiten will, muss man den Verstand, das Herz und den Willen auf dieses Werk hinlenken. Somit muss man versuchen, unseren Erlöser Jesus Christus zu erkennen und zu lieben, der das einzige Ideal des geistlichen Lebens ist, und ihm mutig und beständig trotz aller Versuchungen und Schwierigkeiten folgen. Was ist denn geistliches Leben? Es ist ein Leben der Besinnung und Vertiefung in Gott, der Wunsch, nur in ihm wirken zu wollen und sich die Grundsätze und den Geist Christi im Leben vielfältig anzueignen. Dazu ist eine fundierte Kenntnis Christi notwendig, die man durch Gebet, Betrachtung und Kontemplation Christi im Evangelium und in der Eucharistie sowie durch die häufige Vereinigung mit ihm in der hl. Kommunion erlangen kann. Aber besonders bemühen wir uns darum, dass Gott unser Herz mit der Flamme seiner reinen Liebe entzündet.
Um diese Liebe flehen wir Gott ununterbrochen an, weil sie uns grundlegend mit Gott vereint und am stärksten auf unsere Seele wirkt. Sie spornt uns dazu an, zu den erhabensten Höhen des geistlichen Lebens aufzusteigen, in denen wir dann die reine Luft Gottes atmen dürfen und alles aus der Perspektive der Ewigkeit beurteilen.
Ein wirksamer Hebel des geistlichen Lebens ist das gewissenhaft gehaltene Stillschweigen. Leider verstehen jedoch viele Ordenschristen nicht die ganze Bedeutung dieses Mittels. Übertretungen der Vorschriften, die das Stillschweigen bezüglich Zeit, Ort und Art betreffen, misst man wenig Bedeutung bei. Dadurch erleidet die Seele einen irreparablen Schaden, und ihr geistliches Niveau sinkt.
Das Stillschweigen bringt große Genies und große Heilige hervor. Geschwätzigkeit macht die Seele leer und träge. Wie könnte sie denn auch diese unentbehrliche Bedingung des geistlichen Lebens erreichen, wenn sie sich ununterbrochen zerstreuenden Äußerlichkeiten hingibt? Wie kann sie es lernen, in ihrem Inneren mit Gott in Beziehung zu treten, wenn sie durch Ablenkungen fast nie bei sich ist? Wie kann diese arme, geschwätzige und zerstreute Seele den Geist des Gebetes erreichen, der der Schlüssel zum geistlichen Leben ist, wenn sie sich nur mit Gesprächen und ihren Beziehungen zur Welt beschäftigt? Irgendwann spürt die Seele das Elend ihres Zustandes. Sie beschwert sich, dass sie nicht beten kann, dass sie durch tausend Zerstreuungen bei der Betrachtung geplagt wird, selbst bei der hl. Kommunion. Vielleicht sieht sie sich auch als Opfer, das Gott auf eine besondere Probe stellt. Aber sie will nicht glauben, dass sie eigentlich nur erntet, was sie gesät hat; dass ihr, wenn sie ihre Art, das klösterliche Stillschweigen zu halten, nicht überdenkt und ändert, alle empfohlenen Hilfsmittel entweder wenig oder gar nicht nützen werden.
An dieser Stelle sind auch andere Hemmnisse des geistlichen Lebens zu erwähnen: die Neugier und die übertriebene Eile bei der Arbeit. Für Seelen, die davon betroffen sind, scheint das Ziel des eifrigen Apostolats darin zu bestehen, alles zu sehen, alles zu hören, alles zu lesen, überall zu sein und ununterbrochen nach außen zu wirken. Aber die geistlichen Übungen und die Selbsterziehung werden auf den zweiten Platz verwiesen. Wie folgenschwer ist doch dieser Irrtum! Diese Seelen töten in sich das geistliche Leben und werden dadurch unfähig, die Hilfe Gottes im Apostolat zu empfangen. Dabei soll man an die Worte Christi denken: „Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen (Mt 16,26)?
Durch das Stillschweigen konzentriert sich die Seele auf Gott, beherrscht ihre Leidenschaften, Triebe und Neigungen und widersteht den Stürmen des Lebens und segelt sicher der Ewigkeit entgegen. Durch die Sammlung kann die Seele im Licht des Glaubens Gott in seiner Tiefe schauen, weil wir tatsächlich der Tempel Gottes sind. Der Vater wohnt in uns. Christus wohnt in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns. Die Heiligen verkehren im Tempel ihres Herzens mit der Heiligsten Dreifaltigkeit, mit Christus. Wollen wir ihnen nachfolgen, trennen wir uns von den Äußerlichkeiten durch Schweigen und Sammlung! Lernen wir, oft in diesen mystischen Tempel Gottes einzutreten, der wir selber sind! Lernen wir, dort in Vereinigung mit dem Herzen Jesu zu leben, damit unsere Mängel vor der göttlichen Majestät mit Liebe zugedeckt sind. Dann werden wir noch in diesem Leben erfahren, wie gütig der Herr zu der Seele ist, die ihn sucht.
Warum sollen wir ein geistliches Leben führen, ein Leben der Besinnung? Zu unserer Zufriedenheit? Zum eigenen Nutzen oder aus Bequemlichkeit? Nein! Vor allem, um den Willen Gottes zu erfüllen: „Das ist der Wille Gottes: Eure Heiligung!“
Sodann: Wir sollen dieses Leben führen, um unserer Berufung zu entsprechen, die von uns eine besondere, im Leben sich auswirkende Vereinigung mit Gott verlangt, dem wir uns am Tag der Ordensprofess geweiht und den wir als unser Erbteil erwählt haben für Zeit und Ewigkeit. „Was habe ich denn im Himmel, oder was will ich auf Erden? Der Herr ist mein Erbteil jetzt und in Ewigkeit.“
Schließlich müssen wir uns, um Gott zu finden, seinem Wirken hingeben wie den heilsamen Strahlen der Sonne. Wir müssen uns um die Entfaltung unseres geistlichen Lebens bemühen. Wie wunderbar ist doch das Wirken Gottes in der Seele, die sich ihm großzügig hingibt! Gott bleibt uns nichts schuldig und lässt sich nicht an Großzügigkeit übertreffen. Wenn er unseren Verstand, unseren Willen und unseren Geist erfüllt, dann pfropft er der Seele neues Leben auf, erhebt sie über alles Geschaffene, weitet ihren Horizont, veredelt sie, macht sie Christus ähnlich, verwandelt sie in sich selbst und bestätigt ihre Teilhabe an der göttlichen Natur, damit die Seele nicht mehr für die Sünde und das Böse zugänglich ist. In dieser ihr verliehenen Reinheit kann sie sich immer höher erheben, bis zur vollkommenen Teilnahme am ewigen Sein und an der unbegreiflichen Heiligkeit der Dreifaltigkeit.
Die Vertiefung und Vereinigung mit Gott strahlen in Menschen, die ein intensives geistliches Leben führen, oft nach außen. Es umgibt sie eine Atmosphäre der Ausgeglichenheit, der Heiterkeit und Demut. Die Ahnung einer Verheißung begleitet selbst ihre gewöhnlichen Handlungen und erfüllt sie mit einer hoheitlichen Würde. Daher rühren auch der Glanz der Unschuld und Einfachheit, den wir bei manchen Heiligen bewundern, und der klare Weitblick ihrer Seele, der uns staunen lässt.





























