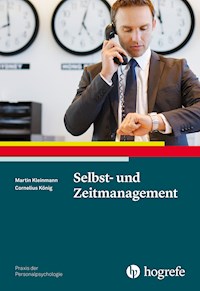23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Personalauswahl und Personalentwicklung sind zentrale Aufgaben des HR-Managements. Assessment-Center, die zunehmend Verbreitung im deutschen Sprachraum finden, leisten seit vielen Jahren wertvolle Hilfe bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Dieser Band gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze dieser Methode und stellt alle notwendigen Vorüberlegungen, Ablaufschritte und Folgeprozesse zur Durchführung und Implementierung von Assessment-Center-Verfahren vor. Aktuelle internationale Forschungsergebnisse werden praxisnah aufbereitet, Handlungsempfehlungen entwickelt sowie konkrete Lösungsoptionen für die Praxis vorgestellt. Im Einzelnen werden die Schritte der Anforderungsanalyse, der Erstellung und Auswahl von Beobachtungsdimensionen, der Konstruktion von Übungen, der Durchführung eines Beobachtertrainings, der Maßnahme selbst sowie der Beobachterkonferenz und der Feedbackphase dargestellt. Darüber hinaus werden mehrere Fallbeispiele für Gruppen- und Einzel-ACs ausführlich beschrieben und verschiedene AC-Übungsmaterialien zur Verfügung gestellt. Ziel des Bandes ist es, sowohl Einsteigern in diese Thematik ein leicht verständliches, aktuelles und fachlich fundiertes Werk an die Hand zu geben, als auch für Unternehmensberater und Personalspezialisten zusätzlich Anregungen bereitzustellen, was bei der fachgerechten Konstruktion von Assessment-Centern zu beachten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Assessment-Center
Praxis der Personalpsychologie
Human Resource Management kompakt
Band 3
Assessment-Center
von Prof. Dr. Martin Kleinmann
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Heinz Schuler, Dr. Rüdiger Hossiep,
Prof. Dr. Martin Kleinmann, Prof. Dr. Werner Sarges
Assessment-
Center
von
Martin Kleinmann
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Prof. Dr. Martin Kleinmann, geb. 1960. 1981–1987 Studium der Psychologie und Informatik an den Universitäten Kiel und Konstanz. 1988 –1989 Betriebspsychologe bei der Henkel KGaA, Düsseldorf. 1989–1997 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kiel. 1991 Promotion. 1995 Habilitation. 1997–2003 Professor für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Philipps-Universität Marburg. Seit 2003 Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Zürich. Darüber hinaus war Martin Kleinmann mehrere Jahre als Unternehmensberater im Bereich Personalauswahl sowie als Sprecher der Fachgruppe Arbeits- und Organisationspsychologie der DGPs und Herausgeber der Zeitschrift für Personalpsychologie tätig.
© 2013 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Göttingen • Bern • Wien • Paris • Oxford • Prag • Toronto • Boston
Amsterdam • Kopenhagen • Stockholm • Florenz
Merkelstraße 3, 37085 Göttingen
http://www.hogrefe.de
Aktuelle Informationen • Weitere Titel zum Thema • Ergänzende Materialien
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Umschlagbild: © Bildagentur Mauritius GmbH
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
EPUB-ISBN 978-3-8444-2484-3
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Inhaltsverzeichnis
1Assessment-Center
1.1Einführung
1.2Definition
1.3Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen
1.4Bedeutung für das Personalmanagement
1.5Betrieblicher Nutzen
1.6Weitere Ziele
2Modelle
2.1Simulationsorientierter Ansatz
2.2Indirekte Kriterienkontamination
2.3Direkte Kriterienkontamination
2.4Genereller Leistungsfaktor
2.5Verwendete Dimensionen
2.6Selbsterfüllende Prophezeiungen
2.7Soziale Intelligenz
3Analyse und Maßnahmenempfehlung
3.1Beobachter und Teilnehmer
3.2Anforderungsdimensionen
3.3Situative Übungen
3.3.1Gruppendiskussionen
3.3.2Präsentationen
3.3.3Zweiergespräch
3.3.4Fallstudien
3.3.5Postkorb
3.3.6Weitere Aufgaben: computersimulierte Szenarios, Business Games und gruppendynamische Aufgaben
3.3.7Anzahl und Art der Übungen
3.3.8Assessment-Center in Kombination mit anderen eignungsdiagnostischen Instrumenten
3.4Aufgaben der Beobachter
3.4.1Beobachtertraining
3.4.2Individuelle Bewertung
3.4.3Datenintegration
3.5Reaktionen und Akzeptanz von Feedback
4Vorgehen
4.1Darstellung der Interventionsmethoden
4.2Wirkungsweise der Methoden
4.3Effektivität und Prognose
4.4Varianten der Assessment-Center-Methode
4.5Probleme bei der Durchführung
5Fallbeispiele aus der Unternehmens- und Beratungspraxis
5.1Fallbeispiel: Implementierung und Positionierung eines Assessment-Centers
5.2Fallbeispiel: Zielsetzung und Ablauf eines Einzel-Assessments
5.3Gruppendiskussion: Gemeinsames Lösen einer Aufgabe
5.4Gruppendiskussion: Gemeinsames Optimieren eines computersimulierten Szenarios
6Literaturempfehlung
7Literatur
Karten:
Checkliste für Assessment-Center (Teil 1 + 2)
Standards zur Durchführung von Assessment-Centern
Empirische Ähnlichkeit von Assessment-Center-Anforderungsdimensionen
1Assessment-Center
1.1Einführung
Weit verbreitete Methode zur Managementdiagnostik
Assessment-Center sind stark nachgefragt. Schuler, Hell, Trapmann, Schaar und Boramir (2007) zeigen in einer groß angelegten Untersuchung im deutschen Sprachraum, dass Assessment-Center von mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen genutzt werden. Sie erleben zudem gegenüber einer Untersuchung eine gute Dekade zuvor (Schuler, 1993) und im Vergleich zu allen anderen untersuchten Personalauswahlverfahren den stärksten prozentualen Zuwachs bzgl. der Einsatzhäufigkeit. Wenn im Personalmanagement Führungsnachwuchskräfte ausgewählt werden, eine einzelne hochrangige Position zu besetzen ist oder individuelle Entwicklungspläne für die persönlichen Stärken und Entwicklungsfelder von Managern aufgezeichnet werden sollen, immer dann wird der Einsatz von Assessment-Center-Verfahren diskutiert und häufig kommen diese dann auch zum Einsatz, sei es als „klassisches“ Gruppen-Assessment, Einzel-Assessment, Potenzial-Assessment oder auch als Personalentwicklungs-Assessment-Center. Eine Vielzahl von Unternehmen in den deutschsprachigen Ländern arbeitet mit Assessment-Centern (Schuler et al., 2007). Assessment-Center stellen somit eine diagnostische Methode dar, die weit verbreitet genutzt wird und deren Einsatzfelder immer weiter definiert werden (Arthur & Day, 2010). Sie findet (meist) Akzeptanz bei den Personalverantwortlichen, den Entscheidern und den Betroffenen. Ob sie Akzeptanz findet oder nicht, hängt aber entscheidend davon ab, wie Assessment-Center durchgeführt werden.
Aber sind die Vorhersagen, welche mithilfe von Assessment-Center-Verfahren getroffen werden, zutreffend? Werden die richtigen Personen ausgewählt? Wird der Personalentwicklungsbedarf zutreffend diagnostiziert? Die Antwort ist einfach, gilt aber nicht für jedes Verfahren, das sich Assessment-Center nennt. Thornton (1992, S. ix), einer der etabliertesten Forscher in diesem Feld, gab sie vor ca. 20 Jahren: „Assessment centers work!“. Diese Aussage gilt nach wie vor, wie eine aktuelle Metaanalyse zur Validität von Assessment-Centern für den deutschen Sprachraum zeigt (Becker, Höft, Holzenkamp & Spinath, 2011). Unter welchen Bedingungen Assessment-Center den Entscheidern helfen, wie gut die Vorhersagen tatsächlich sind, was bei der fachgerechten Konstruktion von Assessment-Centern zu beachten ist, all dies wird im Folgenden eingehend diskutiert. Dabei wird deutlich werden, dass Assessment-Center diagnostische Verfahren sind, deren Einsatz Fingerspitzengefühl und Know-how erfordert, deren Nutzen jedoch bei sinnvoller Anwendung die Kosten mit Sicherheit übersteigt. Der Wissensbedarf zu Assessment-Center-Verfahren ist nach wie vor groß, was sich unter anderem darin zeigt, dass jährlich internationale Kongresse dazu stattfinden (http://www.assessmentcenters.org/) und der Arbeitskreis Assessment Center e. V. in Deutschland bereits acht Kongresse zu dieser Thematik durchgeführt hat und plant weitere Kongresse zu veranstalten.
1.2Definition
Definition
Assessment-Center sind multiple diagnostische Verfahren, welche systematisch Verhaltensleistungen bzw. Verhaltensdefizite von Personen erfassen. Hierbei schätzen mehrere Beobachter gleichzeitig für einen oder mehrere Teilnehmer seine/ihre Leistungen nach festgelegten Regeln in Bezug auf vorab definierte Anforderungsdimensionen ein.
Unter multiplen diagnostischen Verfahren wird eine Vielzahl diagnostischer Instrumente subsumiert, welche meist eine realitätsnahe Ausrichtung (Simulationsprinzip) aufweisen, um damit den potenziellen Arbeitsalltag bestmöglich abzubilden. Geläufige Verfahren sind hierbei Postkorb, Gruppendiskussion, Rollenspiel, Präsentation, Fallstudie, manuelle Arbeitsprobe, computergestütztes Szenario, um nur einige zu nennen.
Zur systematischen Erfassung gehört die Beurteilung derselben Anforderungsmerkmale in verschiedenen Verhaltensaufgaben (meist auch „Übungen“ genannt), die zeitliche Trennung von Beobachtung und Bewertung, die Unabhängigkeit der Einzelbeobachtungen voneinander sowie die vorherige Schulung der Beobachter.
Ähnliche, teils wesentlich ausführlichere Definitionen mit dazugehörigen Standards gibt es von internationalen Gruppen aus Forschern und Praktikern (vgl. International Task Force on Assessment Center Guidelines, 2009, sowie die Standards des Arbeitskreises Assessment Center e. V.). Aus diesen geht auch hervor, dass Assessment-Center aus Simulationen, einerseits in Kombination mit anderen diagnostischen Verfahren (meist Tests und Interviews) bestehen können, wie auch andererseits nur aus situativen Aufgaben, ohne zusätzliche Verfahren. Im vorliegenden Buch wird in erster Linie auf Assessment-Center im engeren Sinne ohne zusätzliche diagnostische Verfahren fokussiert, was auch der gängigen eignungsdiagnostischen Praxis entspricht, nach der Simulationen in größerem Maße in Assessment-Centern eingesetzt werden als klassische Tests (vgl. Höft & Obermann, 2010).
Standards zur Durchführung von Assessment-Centern
Die Standards des deutschsprachigen Arbeitskreises werden in Anlehnung an Neubauer und Höft (2006) in Abbildung 1 wiedergegeben.
Die Standards selbst stellen Erfahrungswerte der Personalmanager dar und können als Versuch verstanden werden, Qualitätsstandards in der praktischen Durchführung umzusetzen. Diese Standards haben sich offensichtlich aus Sicht der Anwender in der Praxis bewährt. Inwieweit jedes der Postulate oder auch nur einzelne dieser Postulate empirisch untermauert werden können, zeigen Höft und Obermann (2010) bzw. Obermann (2009) teilweise auf.
Abbildung 1:
Standards des Arbeitskreises Assessment-Center in Anlehnung an Neubauer und Höft (2006)
1.3Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen
Multipler diagnostischer Ansatz
Kernelement des Assessment-Centers ist der multiple diagnostische Ansatz. Insofern können andere Verfahren wie Leistungstests, Interviews, Leistungsbeurteilungen sowie einzelne Bausteine von Assessment-Center-Verfahren wie Gruppendiskussionen, Postkörbe, computersimulierte Szenarien, Arbeitsproben etc. klar von ihnen abgegrenzt werden, sofern sie singulär dargeboten werden. Die Mehrfachmessung von Verhaltensleistungen in unterschiedlichen Verfahren fehlt bei der separaten Darbietung dieser Verfahren als integraler Bestandteil eines Assessment-Centers.
Es gibt jedoch auch eine Reihe multipler diagnostischer Instrumente im Personalmanagement. Zu nennen sind hier insbesondere das Multimodale Interview, klassische Testbatterien, multimodale Leistungsbeurteilungssysteme sowie das 360°-Feedback.
Multimodales Interview
Das Multimodale Interview wurde im deutschsprachigen Raum 1992 von Schuler erstmals vorgestellt (Schuler, 1992, siehe auch Schuler, 1989a). Es umfasst acht Komponenten, von denen fünf in die diagnostische Urteilsbildung eingehen (Selbstvorstellung, Berufsorientierung und Organisationswahl, freier Gesprächsteil, biografiebezogene Fragen und situative Fragen). Das Multimodale Interview weist eine Reihe von Gemeinsamkeiten zu Assessment-Centern auf. So besteht es ebenfalls aus mehreren diagnostischen Verfahren, in denen jeweils für die Arbeit relevante Anforderungen geprüft werden. Auch wird es standardisiert dargeboten und die Eindrucksbildung findet durch zwei zuvor geschulte Beobachter statt.
Auf konzeptioneller Ebene ist es jedoch im Gegensatz zum Assessment-Center nicht vorwiegend simulationsorientiert, sondern es enthält sowohl biografieorientierte, konstruktorientierte wie auch simulationsorientierte Anteile. Auf Verhaltensebene werden die Unterschiede noch offensichtlicher. In den einzelnen Interviewteilen erfolgen überwiegend Äußerungen zu bereits gezeigten Verhaltensweisen und zu Verhaltensabsichten. Verhalten selbst ist nicht zentraler Beobachtungsgegenstand. Aufgrund der geäußerten Verhaltensweisen in der Vergangenheit und der geäußerten Verhaltensabsichten für die Zukunft wird auf das tatsächliche Verhalten geschlossen. Anders im Assessment-Center: Hier dienen die unterschiedlichen „Bauteile“ dazu, unterschiedliche Verhaltensstichproben zu nehmen und dadurch gesicherte Aussagen über zukünftige Verhaltensweisen zu bekommen. Nichtsdestoweniger ist das Multimodale Interview eine ernst zu nehmende Alternative zu Assessment-Center-Verfahren. Stellt es doch eine wesentlich kostengünstigere Alternative dar und ist bei sorgfältiger Konstruktion genauso in der Lage Verhalten zuverlässig zu prognostizieren wie Assessment-Center (vgl. Schmidt & Hunter, 2000).
Klassische Testbatterien
Klassische Testbatterien finden für unterschiedliche eignungsdiagnostische Fragestellungen Verwendung. Genau wie Assessment-Center versuchen sie durch Mehrfachmessungen identischer Konstrukte zu sichereren Aussagen zu kommen, als wenn ein Konstrukt/eine Anforderungsdimension nur einmal gemessen wird. Im Gegensatz zu Assessment-Centern sind die untersuchten Konstrukte meist wesentlich globaler und die Art der Datenerhebung erfolgt nicht durch eine möglichst realistische Verhaltensstichprobe (Simulationsprinzip), sondern durch Beantwortung einzelner Items, die zu homogenen Testskalen einzelner Konstrukte (Konstruktprinzip) zusammengefügt werden. Beobachter bei diesem diagnostischen Prozess werden nicht benötigt.
Multimodale Leistungsbeurteilungssysteme
Multimodale Leistungsbeurteilungssysteme (vgl. Schuler & Muck, 2001) sowie 360°-Feedback-Systeme (vgl. Scherm & Sarges, 2002) werden zur systematischen Beurteilung von Führungskräften einer Organisation herangezogen. Urteilsgegenstand sind tätigkeitsbezogene Kompetenzen der Zielpersonen und deren Auswirkungen auf Leistungsergebnisse. Die Einschätzungen der Stärken und Schwächen werden in der Regel auf der Grundlage schriftlicher, standardisierter Befragungen erstellt. An der Beurteilung beteiligt sind Vorgesetzte, Kollegen/Kunden, Mitarbeiter und die beurteilte Person selbst. Liegt der Fokus bei den 360°-Feedback-Systemen stärker auf dem Verhalten, wird er bei den multimodalen Leistungsbeurteilungssystemen zusätzlich um den Aspekt der Leistungsergebnisse bereichert. Gemeinsamkeiten zu Assessment-Centern finden sich im „Mehr-Augen-Prinzip“. Auch wird jeweils für den Arbeitsplatz relevantes Verhalten protokolliert. Unterschiede finden sich in den Verhaltensstichproben: Im Assessment-Center sind diese standardisiert und für alle Teilnehmer gleich, beim 360°-Feedback und bei multimodalen Leistungsbeurteilungssystemen ist dies nicht der Fall. Jede zu beurteilende Person hat im Betrieb andere Aufgaben zu bewältigen. Insofern ist die Schwierigkeit der zu bewältigenden Situationen bei der Leistungseinschätzung für verschiedene Personen unterschiedlich. Auch ist die Verhaltensstichprobe im Assessment-Center, welche der Einschätzung der Beobachter zugrunde liegt für alle Beobachter gleich; beim 360°-Feedback und bei multimodalen Leistungsbeurteilungssystemen sind die Verhaltensstichproben, welche den jeweiligen Einschätzungen zugrunde liegen, unterschiedlich. Ein Kunde erlebt eine zu beurteilende Person in anderen Situationen als ein Vorgesetzter. Dementsprechend liegen unterschiedliche Verhaltensstichproben identischer Personen vor. Einzelne Verhaltensweisen können jedoch oft nur von einer Person wahrgenommen werden. Einen Vergleich der erwähnten diagnostischen Instrumentarien gibt Tabelle 1 wieder.
Tabelle 1:
Vergleich von Assessment-Centern mit anderen diagnostischen Verfahren
1.4Bedeutung für das Personalmanagement
Zunehmender Verbreitungsgrad
Assessment-Center werden seit Ende der 50er Jahre in vielen Organisationen in den USA eingesetzt. Ende der 60er Jahre kam die Methode über die Töchter amerikanischer Konzerne nach Deutschland und erfreut sich seither stetig wachsender Beliebtheit.
Inzwischen gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit der Verbreitung dieser und anderer Personalauswahlinstrumente beschäftigten. Schuler et al. (2007) untersuchten den Einsatz verschiedener Personalauswahlverfahren im deutschen Sprachraum, Ryan, McFarland, Baron und Page (1999) veröffentlichten eine Befragung von 959 Unternehmen weltweit zum Einsatz von Personalauswahlverfahren, darunter auch dem von Assessment-Centern.
Im Ausland werden Assessment-Center häufiger eingesetzt
Ryan et al. (1999) stellten fest, dass Assessment-Center im Vergleich zu anderen eignungsdiagnostischen Verfahren in Deutschland seltener eingesetzt werden. In anderen europäischen Ländern, beispielsweise Frankreich, Spanien, Schweden, Belgien, Niederlande und Großbritannien hatten diese Verfahren in der Untersuchung aus den 90er Jahren eine deutlich größere Verbreitung. Diese Befunde sind in weitgehender Übereinstimmung mit den Ergebnissen einer älteren Untersuchung von Schuler, Frier und Kauffmann (1993). Eine Erklärung für solch abweichende Praktiken für identische Verfahren in verschiedenen Ländern bietet das Modell von König, Klehe, Berchtold und Kleinmann (2010). Nach diesem Modell spielen neben Validitätsüberlegungen auch andere Faktoren wie z. B. das Verhalten von Mitbewerbern oder die Akzeptanz des Verfahrens bei Bewerberinnen und Bewerbern für Personalmanager eine tragende Rolle. Für einen ausführlichen Vergleich der Anwendung von Personalauswahlverfahren in verschiedenen Ländern sowie zu Aspekten der Fairness und Akzeptanz der angewandten Verfahren in unterschiedlichen kulturellen Kontexten siehe Krause (2011).
Abweichend von der Studie von Ryan et al. (1999) zeigt die bereits erwähnte neuere Untersuchung von Schuler et al. (2007) in jüngster Zeit allerdings einen deutlichen Trend zu einer vermehrten Nutzung von Assessment-Centern im deutschen Sprachraum. So gaben 57,6 % der befragten Unternehmen an, dass sie Assessment-Center nutzen. Damit gehört das Assessment-Center zu den vergleichsweise häufig genutzten Personalauswahlverfahren. Lediglich der Einsatz verschiedener Interviewverfahren ist in Deutschland noch beliebter. Die Methode der Wahl scheint demnach in bundesdeutschen Betrieben neben Assessment-Centern nach wie vor das persönliche Gespräch bei Personalbesetzungsaktivitäten zu sein (vgl. auch Höft & Obermann, 2010).
Unterschiedliche Einsatzzwecke von Assessment-Centern in Westeuropa und Nordamerika
Über den internationalen Einsatz von Assessment-Center-Verfahren gibt eine aktuellere Untersuchung von Krause und Thornton (2009) Auskunft, die über den Stand der Praktiken und den Verbreitungsgrad von Assessment-Center-Verfahren in Westeuropa und Nordamerika informiert. Neben etlichen Gemeinsamkeiten zwischen diesen Regionen gibt es jedoch auch einige Unterschiede in der Handhabung dieser diagnostischen Instrumente. Offensichtlich scheinen in Westeuropa Assessment-Center in erster Linie zu Personalauswahl- (34 %) und Personalentwicklungszwecken (41 %) genutzt zu werden. Für Potenzialanalysen werden diese Verfahren nur von 25 % der Unternehmen verwendet. In Nordamerika ist dies jedoch der Haupteinsatzbereich von Assessment-Centern (59 %), während Personalauswahl (20 %) und Personalentwicklung (21 %) als Einsatzzweck weniger dominant sind.
Zentrale Einsatzgebiete: Personalauswahl und Potenzialanalyse
Zur Verbreitung von Assessment-Centern gibt es neben der bereits erwähnten Untersuchung von Schuler et al. (2007) eine etwas ältere Untersuchung von Krause, Meyer zu Kniendorf und Gebert (2001) sowie eine aktuellere Untersuchung von Höft und Obermann (2010), die einen Vergleich der Assessment-Center-Praktiken anhand von zwei Erhebungszeitpunkten (2001 und 2008) vornehmen. Nach diesen Untersuchungen sind Banken und Versicherungen die Branche, bei denen Assessment-Center am häufigsten verwendet werden. Anders als die Ergebnisse der Studie von Krause und Thornton (2009) dies für Westeuropa insgesamt nahezulegen scheinen, sind Personalauswahl und Potenzialanalyse offensichtlich die zentralen Einsatzgebiete für Assessment-Center im deutschen Sprachraum nach der Studie von Höft und Obermann (2010). Insbesondere für die Zielgruppe Führungsnachwuchskräfte werden die Assessment-Center im deutschen Sprachraum konzipiert und genutzt. Von der Entwicklung her ist ein Trend zwischen den zwei Befragungszeitpunkten im Jahr 2001 und 2008 zu beobachten. Demnach werden neben reinen Simulationsaufgaben zunehmend auch andere Testverfahren in das Assessment-Center integriert.
Akzeptanz von Assessment-Center-Verfahren