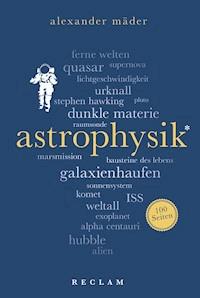
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
»Für mich ist die größte Mission die Suche nach Leben außerhalb der Erde.« Der Urknall und die rasante Ausdehnung des Universums, Einsteins Tempolimit für Licht, dann die Geburt, das Wachsen und Vergehen ganzer Galaxien sowie die Möglichkeit außerirdischer Intelligenz auf einer zweiten Erde im All – das sind die faszinierendsten Themen der Astrophysik: Der Wissenschaftsjournalist Alexander Mäder beginnt seine Reise durch Zeit und Raum in der ersten Sekunde und endet auf der Erde der Gegenwart. Ein Raumanzug, ja selbst ein Teleskop sind nicht erforderlich, auch keine astronomischen Vorkenntnisse – und nur keine Angst vor großen Zahlen! Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Alexander Mäder
Astrophysik. 100 Seiten
Reclam
Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:
www.reclam.de/100Seiten
2017 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung nach einem Konzept von zero-media.net
Infografiken: Infographics Group GmbH
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2018
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961214-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020434-4
www.reclam.de
Inhalt
Die Highlights des Universums
Am 14. Januar 2005 habe ich dann doch einmal durch ein Fernrohr geschaut. Ich war in Darmstadt auf dem Gelände des europäischen Satellitenkontrollzentrums und verfolgte dort mit 200 Journalisten eine Sternstunde der Raumfahrt: die Landung auf dem Titan. Als Neil Armstrong und Buzz Aldrin im Juli 1969 als erste Menschen den Mond betraten, war ich noch nicht geboren. Nun stand auch für mich eine Mondlandung an, denn der Titan umkreist den Ringplaneten Saturn, ist damit ein Mond des Planeten und sogar ein gutes Stück größer als der Mond der Erde. Im Unterschied zur Mondlandung 1969 ging es im Januar 2005 wirklich um Entdeckungen – und nicht bloß um ein riskantes Spektakel, das zwar die Menschen bewegte, aber die Wissenschaft kaum voranbrachte.
Der Titan ist von einem dichten, orangefarbenen Dunstschleier umgeben, und unter den sollte die Raumsonde Huygens zumindest kurz blicken. Fünf Minuten würden ihm schon genügen, sagte einer der Forscher. Fünf Minuten Messdaten und Fotos hört sich nach wenig an, wenn man bedenkt, dass auf dem Titan eine unbekannte Welt auf die Wissenschaft wartete. In so kurzer Zeit kann man einen Mond natürlich nicht richtig erfassen. Doch gerade wenn Wissenschaftler bisher nur mutmaßen konnten und tatsächlich nichts zuverlässig wissen, können fünf Minuten die Forschung enorm weiterbringen. Im Anschluss würde man wenigstens einige Anhaltspunkte haben, um weiter nachzudenken.
Astronauten waren für diese Mission nicht nötig. Huygens war unbemannt und hatte beim Start nur ein Fünfzigstel des Gewichts der alten Mondfähre Eagle. Vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus hatten die Piloten der europäischen Raumfahrtagentur die Sonde auf den richtigen Kurs gebracht. Sie war zur Mittagszeit an einem Fallschirm gelandet, so viel wusste man schon. Meinen Artikel mit dieser Nachricht hatte ich an die Redaktion geschickt und wartete nun mit den Wissenschaftlern und anderen Journalisten auf die ersten Daten.
Um Luft zu schnappen, ging ich nach draußen in den milden Winterabend. Einige Darmstädter Astronomen hatten am Zaun des Kontrollzentrums ihre Teleskope aufgebaut und auf den Titan gerichtet. Sie ließen mich durchs Objektiv gucken, und ich erkannte einen hellen Punkt neben dem Planeten mit den bekannten Ringen. Ich fragte, ob man den Saturn auch mit dem bloßen Auge sehen könne, und einer der Astronomen zeigte mir mit einem kräftigen grünen Laserpointer die Stelle am Himmel. Da saß Huygens also nach seiner siebenjährigen Reise durch das Sonnensystem. Wie würde es auf dem Titan wohl aussehen?
Außer bei solchen Ausnahmen habe ich mich nicht dafür interessiert, die Himmelskörper mit eigenen Augen zu sehen. Sich am Himmel auszukennen, die Technik der Teleskope zu beherrschen und am Ende vielleicht sogar schöne Fotos zu machen, wie es Hobbyastronomen können – diese Möglichkeit habe ich schon immer gerne eingetauscht gegen Reisen in Gedanken. Lieber schaue ich mir die künstlerisch angehauchten Darstellungen ferner Welten an, auch wenn ich weiß, dass die Künstler oft nur spekulieren, denn die meisten dieser Welten werden wir nie besuchen können, weil es die Gesetze der Physik verhindern: Sie sind schlicht und einfach zu weit weg. Doch diese Illustrationen regen meine Phantasie an, und in der Phantasie ist es kinderleicht, in ein anderes Sternensystem oder eine andere Galaxie zu fliegen. Auf eine solche Reise möchte ich Sie in diesem Buch mitnehmen.
Nur eins kann diese Spekulationen noch übertreffen: echte Nahaufnahmen der fernen Welten, wie sie die Raumsonde Huygens liefern sollte. Irgendwann haben es einige Journalisten nicht mehr ausgehalten und den Leiter des Kamerateams der Raumsonde gesucht. Eilig kam er mit einem Laptop unter dem Arm in einen Besprechungsraum, suchte sich einen Beamer und improvisierte eine Pressekonferenz. Er warf ein Bild an die Wand, das Huygens kurz nach seiner Landung aufgenommen hatte. Es zeigte eine weite Ebene mit verstreuten faustgroßen Brocken und sah bei weitem nicht so geheimnisvoll aus wie die künstlerischen Spekulationen. Es hätte das Foto einer irdischen Geröllwüste sein können.
Erst die Erläuterungen des Wissenschaftlers machten es zu etwas Besonderem: Denn die Brocken sind keine Steine, sondern Eisklumpen, und der Boden ist vermutlich mit Erdgas getränkt, das bei ungefähr minus 180 Grad flüssig oder gar gefroren ist. Auch wenn man als Journalist Distanz zu den Dingen wahren muss, über die man berichtet, hat mich dieses Bild berührt: Es zeigte eine ferne, fremde Welt, wie sie wirklich ist.
Natürlich lässt sich der Titan nicht verstehen, wenn man nur Fotos und Messdaten von einem einzigen Landeplatz zu Rate zieht. Man stelle sich vor, eine außerirdische Intelligenz hätte eine Sonde zur Erde geschickt und nach der Landung eine Düne in der Sahara oder das undurchdringliche Dickicht des Amazonas-Regenwalds fotografiert. Oder sie hätte gar ein dunkelblaues Bild empfangen, weil die Sonde ins Meer gestürzt ist. Dann wüssten die Aliens noch nichts über die Vielfalt der Erde. Sie hätten zum Beispiel kein Bild vom ewigen Eis am Nord- und Südpol und keins von unseren Millionenstädten. Aber sie könnten sich ausrechnen, dass es in den polaren Regionen ein gutes Stück kälter sein muss als an ihrem Landeplatz. Und vielleicht hätten sie sogar kurz vor der Landung einige Lichtpunkte auf der Erdoberfläche registriert und könnten aus der Analyse ermitteln, dass es kein natürliches, sondern künstliches Licht ist. So würden sie es zumindest handhaben, wenn sie so wären wie wir: Astronomen müssen im Grunde genommen immer das Beste aus den wenigen Daten machen, die sie herausholen. Aber es ist natürlich möglich, dass die Außerirdischen anders ticken und an uns Menschen gar kein Interesse haben. Vielleicht notieren sie in ihrem galaktischen Katalog für die Erde bloß, was Douglas Adams in seiner Bücherfolge Per Anhalter durch die Galaxis vermutete: »Überwiegend harmlos.«
Ein staunender Blick zum Himmel
Weil den Astronomen nur wenige Daten über die Himmelskörper zur Verfügung stehen, müssen sie in ihrer Argumentation manchmal größere Sprünge machen. Sie können ihre Theorien nicht lückenlos aus den Beobachtungen des Himmels herleiten. Das unterscheidet Astronomen und Astrophysiker (die Berufsbezeichnungen sind praktisch identisch) zum Beispiel von Chemikern und Genetikern, die im Labor experimentieren können. Ein Witz beschreibt diese Unterschiede sehr schön:
Da fahren ein Astronom, ein Ingenieur und ein Mathematiker durch die Lüneburger Heide und sehen aus dem Zugfenster ein schwarzes Schaf. »Guckt mal!« ruft der Astronom. »In der Lüneburger Heide sind die Schafe schwarz.« Der Ingenieur ist vorsichtiger und sagt: »Zumindest einige der Schafe hier scheinen schwarz zu sein.« Da meldet sich der Mathematiker zu Wort: »Meine Herren« – es sind in diesen Fächern leider immer noch meistens Herren –, »wir wissen bisher nur, dass es in der Lüneburger Heide mindestens ein Schaf gibt, das auf mindestens einer Seite schwarz ist.«
Sieht der Titan also auf der anderen Seite ganz anders aus als auf den Bildern, die Huygens zur Erde funkte? Diese Frage wird für viele Jahre unbeantwortet bleiben, denn eine zweite Mission zum Saturn ist nicht geplant. Zum einen sind die Missionen teuer: Die Mission der Landesonde Huygens und des Mutterschiffs Cassini, das seit 2004 den Saturn sowie dessen Ringe und Monde untersucht, hat die US-amerikanische und die europäische Raumfahrtagentur, die NASA und die ESA, knapp drei Milliarden Euro gekostet. Zum anderen gibt es viele andere interessante Ziele: die Kometen zum Beispiel, die uns nur kurz besuchen und dann wieder in der Tiefe des Alls verschwinden, oder den Zwergplaneten Pluto am Rand des Sonnensystems oder den Jupiter-Mond Europa, unter dessen Eiskruste ein Ozean vermutet wird. Und dann gibt es natürlich noch den riesigen Rest des Universums außerhalb unseres Sonnensystems, den wir zwar nicht mit Raumschiffen besuchen, aber den wir immerhin mit leistungsfähigen Teleskopen beobachten können.
Die Bilder von der Oberfläche des Titans haben damals gut eine Stunde zur Bodenstation auf der Erde gebraucht. Der Saturn-Mond war im Januar 2005 also rund eine Lichtstunde von der Erde entfernt. In der Astronomie ist das ein Katzensprung. Der nächste Stern, Alpha Centauri – um genau zu sein, handelt es sich um ein Sternsystem –, ist schon mehr als vier Lichtjahre entfernt. Und das Licht der beeindruckenden Quasare, die wir noch kennenlernen werden, war mehrere Milliarden Jahre zu uns unterwegs. Man kann sich vorstellen, dass Quasare sehr hell sein müssen, wenn wir sie aus dieser großen Entfernung noch sehen können. Und man fragt sich unwillkürlich, ob sie heute noch leuchten, denn man sieht das Licht, das sie vor Milliarden Jahren ausgestrahlt haben. Auf die Ankunft des Lichts, das sie eventuell heute ausstrahlen, werden wir auf der Erde also noch sehr lange warten müssen.
Am besten erkennt man Quasare übrigens mit Radioteleskopen, deren große, weiße Schüsseln nicht das Licht, sondern Radiowellen einsammeln. Vieles im Weltall zeigt sich nämlich nicht im Bereich des sichtbaren Lichts, sondern in anderen Formen der elektromagnetischen Strahlung. Zu dieser Art von Strahlung gehören auch Radiowellen, Infrarot- und Röntgenstrahlen. Deshalb nutzen Astronomen ganz unterschiedliche Instrumente.
Manche Teleskope sitzen auf Bergkuppen in trockenen Regionen, weil der Himmel dort seltener bedeckt ist und das Licht, das die Städte abstrahlen, nicht stört. In der chilenischen Atacama-Wüste, in 3000 Meter Höhe, baut die Europäische Südsternwarte (ESO) zum Beispiel gerade das Extremely Large Telescope, das 2024 sein erstes Sternenlicht empfangen soll. Im Unterschied zu früheren Observatorien wie dem Very Large Telescope in Chile, bei dem vier Teleskope mit einem Durchmesser von jeweils acht Metern zu einem virtuellen Großgerät zusammengeschaltet wurden, ist man inzwischen in der Lage, ein einzelnes Teleskop mit einem Durchmesser von sagenhaften 39 Metern zu bauen. Andere Observatorien schießt man gleich ins dunkle All, weil die geplanten Messungen nur dort möglich sind – wenn auch teurer und aufwendiger, weil man die Geräte nur unter großen Mühen reparieren kann. Die fliegende Sternwarte SOFIA, ein deutsch-amerikanisches Teleskop in einem umgebauten Jumbojet, bildet da einen Kompromiss: In zwölf Kilometer Höhe beobachten Astronomen an Bord die Sterne; damit lassen sie den größten Teil der Erdatmosphäre unter sich, die das Infrarotlicht aus dem All verschluckt. Allerdings können die Instrumente nach jedem Flug gewartet oder ausgetauscht werden.
Wie sehr das künstliche Licht bei der Beobachtung stört, kann man leicht selbst feststellen. In Städten wird zum Beispiel das leuchtende Band der Milchstraße überstrahlt, das sich über den Himmel zieht. Man sieht in klaren Nächten vielleicht einige Dutzend Sterne und, wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, noch ein paar mehr. Wenn ich im Urlaub wandern gehe, überrascht es mich dagegen immer wieder, wie viele es sein können. Allen Stadtmenschen sei versichert: der ungestörte Blick in den Nachthimmel hat auch für Nicht-Astronomen seinen Reiz! Australien hat einmal mit einem hübschen Slogan dafür geworben, die Hotels der Städte gegen ein Zelt im Outback einzutauschen: »Warum sich mit fünf Sternen begnügen, wenn man eine Million haben kann?« Die Werbung ist allerdings ein wenig übertrieben, denn selbst wenn es wirklich dunkel ist, sieht man mit dem bloßen Auge nur einige tausend Sterne.
Die sichtbaren Sterne gehören alle zur Milchstraße, unserer Heimatgalaxie. Sie stellen aber nur einen kleinen Ausschnitt aller Sterne dar, denn die Milchstraße beherbergt mehr als 100 Milliarden Sterne. Um sich zu vergegenwärtigen, wie viele das sind, kann man allerlei Vergleiche anstellen. Solche Vergleiche sind naturgemäß vage, geben im besten Fall aber immerhin ein Gefühl für die Größe. Probieren wir es aus: Wäre jeder Stern ein Sandkorn (nehmen wir einmal Feinsand in Form von kleinen Würfeln mit einer Kantenlänge von 0,2 Millimetern), könnte man damit mindestens ein Dutzend Umzugskartons mit einem Volumen von je 70 Litern füllen. Falls es doppelt oder dreimal so viele Sterne sein sollten – so genau weiß man das nicht –, dann sind es eben zwei oder drei Dutzend Kartons.
Und das ist noch nicht alles, es kommt noch ein gedanklicher Schritt hinzu: Es dürfte im Universum mehr als 100 Milliarden Galaxien geben – nach neuesten Schätzungen sogar mehr als eine Billion. Das wäre dann ein Würfel von Umzugskartons, der je neun Kilometer hoch, breit und tief ist. Manchmal muss man dann jedoch auch zugeben, dass die Vergleiche so absurd werden, dass sie am Ende kaum noch etwas vermitteln.
In jedem Fall sollte einen die schiere Menge der Sterne stutzig werden lassen: Warum sieht man so wenige von ihnen? Müssten sie – alle zusammengenommen – den Nachthimmel nicht taghell erleuchten? Vor 200 Jahren hat man vermutet, dass dichte Wolken einen Großteil des Lichts verschlucken. Solche Wolken gibt es tatsächlich, doch sie liefern nicht die Antwort auf die Frage. Wenn das Weltall unendlich viele Sterne enthielte, die schon seit einer Ewigkeit leuchten, dann wäre der Nachthimmel in der Tat ziemlich hell, weil sich die Wolken mit der Zeit aufheizen würden. Schaut man jedoch abends in den Himmel, macht man ganz nebenbei eine wichtige astronomische Beobachtung: dass es nicht so ist. Die Sterne leuchten nur einige Milliarden Jahre, manche sterben schon viel früher, und das Universum ist erst einige Sterngenerationen alt. Das Licht vieler Sterne hat die Erde daher noch gar nicht erreicht, und das Licht mancher Sterne wird es auch nie zu uns schaffen, weil das Universum immer weiter wächst und damit die Abstände zwischen den Sternen und Galaxien immer größer werden. Auch wenn es sehr viele Sterne geben mag, wirken sie in der Weite des Alls daher ziemlich verloren. Das Universum ist wirklich groß, und es ist größtenteils leer oder nur von einem ganz dünnen Gas erfüllt.
Und die Erde erst! Wie verloren ist sie? Mit dieser bangen Frage beginnt für mich die Astronomie. Sie ist nicht zuletzt der Versuch, unseren Platz im Universum zu bestimmen. Für ein solches Interesse spricht, dass anscheinend seit Jahrtausenden Menschen vom Nachthimmel fasziniert sind. Es gibt Archäologen, die in den prähistorischen Malereien in der französischen Höhle von Lascaux Konstellationen am Himmel erkennen. In jedem Fall haben viele spätere Kulturen versucht, Ordnung in den Himmel zu bringen. Sie erstellten auf diese Weise nützliche Kalender – und sie fanden auch einen Platz für den Menschen im kosmischen Gefüge. Heute sehen wir jedoch nicht mehr die Erde im Mittelpunkt des Universums, und ebenso wenig die Sonne. Aber wo stehen wir dann?
Zunächst liefert die Wissenschaft eine technische Antwort, eine Art kosmischer Ortsbestimmung: Die Erde kreist mit einer Geschwindigkeit von 100 000 Kilometern in der Stunde um die Sonne; sie braucht bekanntermaßen ein Jahr für eine Umrundung. Die Sonne mit ihren acht Planeten und vielen kleineren Asteroiden und Kometen fliegt wiederum mit 800 000 Kilometern in der Stunde um das helle Zentrum der Milchstraße; ein galaktisches Jahr dauert für das Sonnensystem mehr als 200 Milliarden Jahre. Unsere Heimatgalaxie ist eine flache Scheibe mit mehreren langen Armen, die in Spiralen nach außen gehen. Das Sonnensystem liegt im Orion-Arm und ist gut 25 000





























