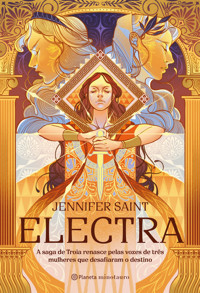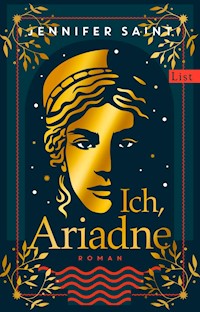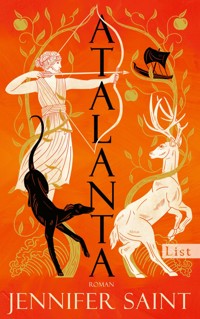
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jägerin, Liebende, Argonautin - eine Rebellin im antiken Griechenland Der König von Arkadien will einen Sohn und Erben. Er lässt seine Tochter Atalanta in der Wildnis aussetzen. Eine Bärin zieht das Mädchen auf, und Atalanta wird stark und wild, schneller und ausdauernder als jeder Krieger. Artemis, die jungfräuliche Göttin der Jagd, beschützt sie und schärft ihr ein, sich vor Männern in Acht zu nehmen. Doch Atalanta verliebt sich und geht mit den Argonauten auf Fahrt. Mit dem gestohlenen goldenen Vlies und der tödlichen Medea an Bord segelt Atalanta zurück nach Arkadien. Sie ist entschlossen, ihren Platz in der Welt zu finden, wo sie lieben und sie selbst sein kann. Hinter allen Göttern und Heroen stehen Frauen. Jennifer Saint gibt den Frauen der Antike eine Stimme. »Erzählt auf brillante Weise die starken Emotionen und die Komplexität der Frauen« Leipziger Volkszeitung »Der Autorin gelingt es, die Welt der Sagen in eine Wirklichkeit zu überführen, die nichts krampfhaft Modernes hat. Irgendwann ist man im Labyrinth und kann nicht aufhören zu lesen.« NDR Kultur »Ebenbürtig mit Madeline Millers Romanen.« Waterstones.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Atalanta
Jennifer Saint begeisterte sich schon als Kind für die griechische Mythologie, und während ihres Studiums der Altphilologie am King’s College in London hat sie ihre Liebe zu den antiken Sagen vertieft. Als Englischlehrerin versucht sie die Faszination für Geschichten aller Art und die reiche Erzähltradition seit Homer zu vermitteln. Jeder Erzähler hat die antiken Stoffe für sich neu interpretiert. Jennifer Saint stellt die weibliche Heldin in den Mittelpunkt.
König Iasos von Arkadien will einen Sohn und Erben, kein Mädchen. Gleich nach der Geburt lässt er seine Tochter Atalanta aussetzen. Sie wird von einer Bärin aufgezogen und wächst zu einem wilden, kräftigen schnellen Kind heran, das sich in der Natur zu Hause fühlt. Artemis, die jungfräuliche Göttin der Jagd, nimmt sich ihrer an. Artemis schärft ihr ein, dass wenn Atalanta ihr folgen will, sie sich an keinen Mann binden darf. Dann schickt Artemis die junge Frau hinaus in die Welt, Atalanta soll sich den Argonauten anschließen und in Kolchis das Goldene Vlies stehlen. Diese Heldentat würde Artemis’ Ruhm mehren und Atalanta zu einer Legende werden lassen. Jason, der Anführer der griechischen Helden, die sich die Argonauten nennen, will zunächst keine Frau an Bord haben, aber er wagt es nicht, Artemis zu verärgern. An Bord der Argo begegnet Atalanta den Söhnen von Königen und Göttern – und Meleagros, der ihren Schwur an die Göttin auf die Probe stellt.
Jennifer Saint
Atalanta
Roman
Aus dem Englischen von Simone Jakob und Anne-Marie Wachs
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Das übersetzte Zitat des Mottos ist aus: Ailianos, Vermischte Forschung, Buch XIII, herausgegeben und übersetzt von Kai Brodersen (De Gruyter: Göttingen, 2018)© 2023 by Jennifer Saint© der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Foto der Autorin: © Katie ByramUmschlaggestaltung: zero-media.net nach dem Entwurf und mit der Illustration von Micaela Alcaino für Headline Publishing/Hachette UKE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-3027-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Teil 1
1
2
3
4
5
6
Teil 2
7
8
9
10
11
12
13
Teil 3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Teil 4
23
24
25
26
27
28
29
Epilog
Anhang
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für Bee und Steph, meine Northern Writers Group, die den Roman von der ersten Inkarnation an geliebt und mich bei jedem Schritt ermutigt haben.Motto
Atalanta: Vom griechischen Ἀταλάντη (Atalante), was »gleich an Kraft« bedeutet.Zitat »Sie konnte sehr schnell laufen … so leicht bekam sie keiner zu Gesicht. Unvermutet und unvorhergesehen erschien sie, wenn sie ein Tier jagte oder jemanden abwehrte. Wie ein Stern vorüberhuschend, leuchtete sie auf wie ein Blitz.«Ailianos, Vermischte Forschung, Buch XIIIProlog
Nach meiner Geburt setzte man mich auf einem Berghang aus. Der König hatte sein Urteil gesprochen – Wenn es ein Mädchen wird, lasst es auf einem Berg zurück –, und so wurde irgendeine bedauernswerte Seele mit dem unerwünschten Bündel Menschheit aus dem Palast entsandt; es war nur ein kleines Mädchen statt des glorreichen Erben, den der König sich ersehnt hatte.
Auf dem nackten Erdboden zurückgelassen, schrie ich vermutlich, solange es meine kleine Lunge hergab. Oder ich lag nur ängstlich wimmernd da und sah zu, wie sie sich näherte – die Bärin. Die Augen ihrer Jungen waren noch geschlossen, das Fell noch feucht. Ihr Mutterinstinkt war auf dem Höhepunkt, und so kam sie, angelockt von den Klagelauten eines verlassenen Neugeborenen, auf mich zu.
Ich stelle mir gern vor, dass ich zu der Bärenmutter aufsah, ihren Blick erwiderte. Dass ich nicht vor ihrem heißen Atem, der rauen Liebkosung ihrer Pranke zurückschreckte. In ihrer mütterlichen Sorge mochte sie mich nicht zurücklassen, konnte das Wimmern eines hungrigen Säuglings nicht ertragen, und so hob sie mich auf und nahm mich mit.
Die Bärenmilch machte mich stark. Ich lernte, mit meinen Bärengeschwistern zu kämpfen, ein grobes Raufen und Toben, bei dem keine Rücksicht genommen wurde. Ich weinte nie, wenn ihre Klauen oder Zähne über meine Haut schrammten oder wenn sie sich knurrend auf mich stürzten. Stattdessen grub ich die gekrümmten Finger in ihr Fell, zerrte sie zu Boden, grub meine eigenen Zähne in ihre Flanken und biss zu, so fest ich konnte. Nachts schmiegten wir uns in einem warmen Nest aus Blättern und Erde aneinander, ein Gewirr aus tierischen und menschlichen Gliedmaßen, und ihre weichen Tatzen ruhten auf meiner sonnengebräunten Haut, ihre rauen Zungen fuhren über mein Gesicht.
Die Jahreszeiten vergingen, und von der Muttermilch entwöhnt, lernten meine Bärengeschwister, selbst auf die Jagd zu gehen. Anfangs noch zaghaft, lauerten sie auf glitschigen Felsen in dem rasch dahinströmenden Fluss, der durch unseren Wald rauschte. Ich dagegen saß mit überkreuzten Beinen am grasbewachsenen Ufer, suchte wie sie das Wasser nach aufblitzenden Fischschuppen ab und lachte über ihre missglückten Prankenhiebe und tropfnassen Schnauzen. Anfangs blieb die Bärin in der Nähe, ließ sie nicht aus den Augen, aber je mehr ihr Selbstvertrauen wuchs, desto weiter entfernte sich ihre Mutter. Eines Tages weckte etwas anderes ihre Aufmerksamkeit; sie hob die Schnauze, schnupperte und blickte zu den Bergen hinüber.
Die Jungen wussten noch vor mir Bescheid. Sie machten sich rar, noch ehe sich das riesige Männchen zeigte, das auf der Suche nach einer Gefährtin war. Sie suchten auf den Bäumen Schutz, als er, angelockt vom Geruch der Bärin, von den Bergen heruntergetrottet kam. Unwiderstehlich für dieses Ungetüm, das mir, als es sich aufrichtete, so hoch wie die Bäume selbst vorkam. Sein Brüllen erinnerte mich an das Donnergrollen, das im Winter die Zweige erzittern ließ, auf denen ich sicher zwischen meinen schlafenden Bärengeschwistern geruht hatte.
Die Bärin spürte es ebenfalls. Ihre liebevollen Liebkosungen wichen Knurren und Prankenhieben, und als ihre Jungen sie sehnsüchtig anblickten, jagte sie sie davon. Die Bärenjungen flüchteten in die Sicherheit der höchsten Zweige, ich dagegen hockte zitternd hinter einem riesigen Felsen, spürte den heißen Luftzug, als sie warnend brüllte. Die einzige Mutter, die ich in meinem kurzen Leben gekannt hatte, war unvermittelt wie der sich drehende Wind zu etwas Schrecklichem geworden.
Sie ließ zu, dass er ihr folgte. Von meinem Versteck aus sah ich, wie er den riesigen Kopf an ihrem Hals rieb und wie sie ihn ihrerseits beschnupperte.
Die Bärenjungen waren anfangs völlig aufgewühlt, doch nach einer Weile beruhigten sie sich und kletterten, eines nach dem anderen, nach unten. Ich sah zu, wie meine Geschwister sich nacheinander einen Weg durch die hohen Bäume bahnten und nach kurzer Zeit von dem Dickicht aus grünen Zweigen verschluckt wurden.
Verstört zog auch ich los, wanderte ziellos zwischen den Bäumen umher, und mit der Zeit trockneten meine Tränen, mein keuchender Atem beruhigte sich. Ich wusste, wo ich war, und die Vertrautheit der Umgebung wirkte tröstlich. Goldgrünes Licht fiel durch das Blätterdach, es roch nach Pinien, Zypressen und weicher schwarzer Erde. Eine dicke Spinne hockte in der Mitte ihres zwischen zwei Ästen aufgespannten Netzes, ihr haariger brauner Körper und die gestreiften Beine waren vor der Rinde fast nicht zu erkennen. Eine Schlange huschte über den Weg, rollte sich rasch zu einem schützenden Kreis zusammen, und ihre rautenförmigen Schuppen glänzten, sobald das Sonnenlicht darauf fiel. In den höheren Bergzügen, wo der Baumbewuchs dünner wurde, streiften lautlos und geschmeidig Löwen zwischen Büschen und Felsen umher. Ein Wald voller scharfer Fangzähne, Klauen, Gift, pulsierend vor Leben und Schönheit. Alles war durch Tausende verwobene Fäden miteinander verbunden: von den uralten Wurzeln, die das Wasser unter der Erde aufsaugten, damit die Bäume ihre gewaltigen Kronen der Sonne entgegenrecken konnten, über die Insekten, die tiefe Gänge in ihre Rinde bohrten, die Vögel, die in den Zweigen nisteten, die Hirsche, die leicht dahinschritten, bis hin zu den lauernden Raubtieren, die bereit waren zuzuschlagen.
Und im Herzen all dessen: ich.
Teil 1
1
Sie kam zu mir, nachdem die Bären verschwunden waren. Sie war ein imposanter Anblick, größer und stärker als jede Sterbliche – obwohl mir das damals nicht bewusst war –, einen glänzenden Bogen in der Hand, ein wildes Funkeln in den Augen, mit einem Rudel Hunde, das ihr auf den Fersen folgte. Schon als ich noch klein war, überwog meine Neugier meine Furcht. Als sie mir die Hand hinhielt, ergriff ich sie.
Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal den Hain sah, zu dem sie mich führte. Geblendet von dem goldenen Licht, das sich auf der schimmernden Oberfläche des Gewässers vor uns spiegelte, schloss ich kurz die Augen, blinzelnd öffnete ich sie wieder.
Auf der anderen Seite des Teichs klaffte eine große Höhle im Berghang, vor deren Eingang hier und dort große Felsen lagen. Auf den flachen Steinen saßen Frauen – Nymphen, wie ich später erfahren sollte. Die Luft war von ihrem leisen Geplauder und sanften Gelächter erfüllt. Ich sah zu der Frau auf, die mich hierhergebracht hatte, und sie lächelte mich an.
Sie gaben mir reife, süße Beeren zu essen. Ich erinnere mich an den Geschmack des kalten Wassers, das sie mir reichten, und wie ungeschickt ich mit dem Becher umging, den sie an der Quelle für mich gefüllt hatten. In jener Nacht schlief ich nicht an die zottigen, warmen Bärenkörper geschmiegt, deren schwerer Herzschlag mir noch in den Ohren klang, sondern auf einem Bett aus Tierhäuten, und ich wurde vom Gesang einer Frau geweckt.
Es war Artemis, die mich gerettet hatte, und ihr heiliger Hain, in den sie mich gebracht hatte. Artemis, die Göttin der Jagd, der der Wald mitsamt allen Bewohnern gehörte. Wir alle lebten unter dem Bann ihres silbernen Blickes, wir alle beugten uns ihrem Willen, von den wimmelnden Würmern unter der Erde bis hin zu den heulenden Wölfen. Schimmernd lag ihre Macht über dem Wald von Arkadien.
Sie hatte mich zu den Nymphen gebracht, die mich aufziehen sollten. Ihnen fiel die Pflicht zu, mir beizubringen, was Artemis zu mühsam war; sie unterrichteten mich in ihrer Sprache, sie zeigten mir, wie man den Stoff webte, aus dem die schlichten Tuniken bestanden, die alle trugen, und wie man die anderen Götter und Göttinnen verehrte, deren Namen sie mir beibrachten, obwohl sie sich nie in unseren Wald verirrten. Sie lehrten mich, welche Beeren ich pflücken durfte und von welchen man krank wurde, und warnten mich vor harmlos aussehenden Pilzen, die mein Tod sein konnten. Ich sah, wie sie ihr Leben Artemis widmeten; sie kümmerten sich um den Wald, um die Quellen, die Flüsse, die Pflanzen und alles Leben darin. Im Gegenzug wohnten sie darin, von ihr geliebt und beschützt.
Anfangs erschienen mir Artemis’ Besuche sporadisch, nicht vorhersehbar. Von der Höhle aus, in der ich neben den Nymphen schlief, beobachtete ich die Bahn des Mondes am Himmel, seine Verwandlung von der dünnen Sichel zur leuchtenden Kugel. Ich lernte, dass sie, noch ehe er erneut zur Sichel geworden war, wieder zu uns kommen würde. Wenn ich durch den Wald streifte, hielt ich wachsam Ausschau. Die Hunde, die an ihrer Seite waren, als sie mich gefunden hatte, folgten mir, als suchten auch sie nach ihrer Herrin. Es waren insgesamt sieben, und anfangs fiel es mir leichter, mit ihnen zusammen zu sein als mit den Nymphen. Ihr weiches Fell erinnerte mich an das der Bären, ihre scharfen Zähne machten mir keine Angst. Jedes Rascheln im Laub, jeder knackende Zweig fesselte meine Aufmerksamkeit, sodass ich wie angewurzelt stehen blieb und zwischen den knorrigen Bäumen nach Anzeichen für ihr Erscheinen suchte. Ich wartete ungeduldig auf ihre Rückkehr, damit ich ihr zeigen konnte, was ich in ihrer Abwesenheit gelernt hatte. Wenn sie dann in Erscheinung trat, aus heiterem Himmel wie ein plötzlicher Regenschauer im Frühling, spürte ich, wie mein Herz schneller schlug.
Sie befahl den Nymphen, ihr zu folgen, und sie ließen mich zurück, eilten leichtfüßig durch den Wald und kehrten bei Sonnenuntergang wieder, ihre Beute auf der Schulter. An solchen Abenden verbreitete sich der köstliche Geruch von gebratenem Fleisch im Hain. Ich sehnte mich danach, sie zu begleiten, fieberte dem Tag entgegen, an dem sie mich für nützlich genug hielt, um mich mit auf die Jagd zu nehmen.
Fünf Winter vergingen, bis sie an einem Frühlingsmorgen bei Sonnenaufgang zum Höhleneingang kam und »Atalanta?« flüsterte; hastig sprang ich auf. Ihre Wangen waren gerötet, ihre Augen blitzten, ihre Tunika war locker um ihre Hüften gegürtet, und ihr gewölbter Bogen lag in ihrer Hand. Sie begrüßte die Hunde, dann gab sie mir mit einem Nicken zu verstehen, ich solle ihr in den Wald folgen. Sie bedeutete mir, mich ebenso geräuschlos zu bewegen wie sie, häufig stehen zu bleiben und den Blick schweifen zu lassen. Ich spürte, wie meine Anspannung wuchs, und meine überschäumende Freude über diesen neuen Zeitvertreib drohte sich in einem ausgelassenen Lachen zu entladen, doch ich schluckte es hinunter, reckte das Kinn ebenso entschlossen vor wie sie und setzte meine Füße genau dorthin, wo auch sie gegangen war. Die Hunde eilten uns voran, die Ohren gespitzt und eifrig schnuppernd. Als sie witterten, was sie suchten, zog sie mich rasch zu sich, duckte sich hinter einen umgestürzten Baumstamm, spähte mit zusammengekniffenen Augen über das samtige Moos und nahm ihr Ziel mit Pfeil und Bogen ins Visier.
Der Hirsch brach in panischer Angst vor den Hunden aus dem Unterholz. Ein majestätisches Geschöpf mit dem prachtvollsten Geweih, das ich bis dahin gesehen hatte. Der Pfeil durchbohrte die Kehle des Tiers, noch ehe die schimmernden braunen Augen die Gefahr wahrgenommen hatten, und es sackte zusammen; ein rotes Rinnsal sickerte unter dem schmalen Pfeilschaft hervor.
Sie fing meinen bewundernden Blick auf und lächelte. Beim nächsten Mal zeigte sie mir, wie man den Bogen halten musste, der schwer in meiner Hand lag und zu vibrieren schien.
Von da an lebte ich für die Tage, an denen Artemis den Hain besuchte und mir mit dem Bogen in der Hand bedeutete, ihr in die stille Morgendämmerung zu folgen. Ihre Stimme, die mir, leise und eindringlich, Anweisungen ins Ohr hauchte, wie man nach den Hirschen Ausschau hielt, wie man völlig reglos blieb, sich unsichtbar machte, den Blick fest auf das Ziel gerichtet, den Bogen straff gespannt in der Hand, bis es nichts anderes mehr gab als die Beute und mich. Ich atmete auf, wenn der Pfeil direkt in die Kehle traf, so wie sie es mir gezeigt hatte. Es gab für mich nichts Schöneres auf der Welt als ihr entzücktes Lachen, wenn ich ins Ziel traf.
Neben dem Stolz auf meine Erfolge und der Befriedigung des Jagens wollte ich ihr auch gefallen. Wie die Nymphen mir erzählt hatten, konnte ich unter dem Schutz der Artemis in Freude und Freiheit leben. Sie war nicht so wie die anderen Götter, und auch mein Leben glich dem keines anderen Menschen. Artemis mied die goldenen Hallen des Olymps, den prächtigen, von Wolken umgebenen Palast, in dem die Unsterblichen weilten. Sie verbrachte ihre Zeit lieber im Wald, badete im mondbeschienenen Teich oder lief bei Tag anmutig zwischen den Bäumen hindurch, den Köcher auf dem Rücken, den Bogen stets griffbereit. Es gefiel ihr sichtlich, dass eine Sterbliche nach ihrem Vorbild heranwuchs, und ich war ebenfalls froh darüber, obwohl ich nicht ganz begriff, wie viel Dank ich ihr tatsächlich schuldete.
Ich hatte nie eine menschliche Behausung gekannt; hatte keine Vorstellung davon, wie selten Menschen zum Schützling einer Göttin werden, was es bedeutete, meine Kindheit in der wilden Einfachheit und dem rauen Zauber des Waldes verbringen zu können.
Artemis mochte die anderen Olympier meiden, doch sie hatte ihre Gefährtinnen im arkadischen Wald. Die Nymphen, die sich um mich kümmerten, hatten sich ganz dem Ziel verschrieben, ihr nachzufolgen: Dutzende alterslose Töchter von Flüssen, Quellen, Ozeanen und Winden, junge Frauen, die an der Seite der Göttin rannten, jagten und badeten.
Sie erzählten mir Geschichten. Anfangs gefiel mir die über mich selbst am besten – wie man mich auf einem Berg ausgesetzt hatte, wie die Bärin und später Artemis mich gerettet hatten. Sie hielt die Erinnerung an meine ersten Lebensjahre frisch und lebendig. Ich wollte nicht vergessen, wer ich war, bevor ich zu diesen sanften, heiteren Frauen gekommen war. Wollte nicht, dass mir die Eindrücke und Gefühle von früher verloren gingen wie das Hochgefühl, als ich mich an das Fell der Bärin klammerte, während sie durch den Wald rannte, wie ihre mächtigen Muskeln dicht an meinem Körper arbeiteten, die Bäume an mir vorbeiflogen.
Doch ich war auch voller Neugier, beobachtete von meinem Aussichtspunkt auf einem Felsen am Teich, der von den zierlichen Zweigen einer Weide vor der Sonne geschützt wurde, meine neuen Gefährtinnen. Da war Phiale, die in den Sommermonaten, wenn es wenig Wasser gab, der Quelle mehr entlocken konnte, selbst wenn nur noch ein Rinnsal herausfloss. Oder Krokale, die anmutig über die Erde schritt und dort, wo sie entlanggegangen war, Blumen erblühen ließ. Wenn die sengende Sonne den Boden hart und trocken werden ließ, konnte Psekas einen feinen Sprühregen heraufbeschwören, der die durstige Erde nährte. Ich fragte mich, wo sie all das gelernt hatten. »Seid ihr immer hier im Wald gewesen?«, fragte ich sie.
»Nicht immer«, erklärte mir Phiale. »Ein paar von uns sind die Töchter des Titanen Okeanos, jenes gewaltigen Flusses, der die Erde umfließt. Unser Vater hat uns schon als Kinder zu Artemis geschickt, und seitdem leben wir hier.«
Das warf eine weitere Frage auf: Ich wuchs die ganze Zeit und war schon fast so groß wie die Nymphen, wieso schienen sie sich nie zu verändern?
»Wie Artemis sind wir von klein auf zu dieser Gestalt herangewachsen, und so werden wir bleiben«, erklärte mir Phiale. »Während die Göttin nie sterben wird, können wir von wilden Tieren oder auf andere Art verletzt werden.« Sie schwieg kurz. »Nymphen können getötet werden, wie die Geschöpfe, die du im Wald erlegst. Aber die Leiden des Alters können uns nichts anhaben.«
»Und was ist mit mir?«, fragte ich.
Sie umfasste meine Wange mit einer Hand und strich die Haarsträhnen glatt, die sich aus meinem Zopf gelöst hatten. »Du bist eine Sterbliche, Atalanta. Anders als jede andere Sterbliche, die je gelebt hat, aber wie alle Menschen wirst auch du heranwachsen und altern.«
»Mach ihr keine Angst.« Von der anderen Seite des Hains näherte sich Kallisto, die gerade von der Jagd zurückkehrte; ihr Zopf hatte sich gelockert, ihr Gesicht war schmutzig. Sie warf ihren Speer beiseite, der scheppernd auf dem Felsboden landete, und ließ sich neben uns zu Boden sinken.
»Sie macht mir keine Angst«, widersprach ich, streckte die Hand aus und pflückte ein Blatt aus Kallistos wirren Locken.
»Natürlich nicht.« Sie legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen.
»Bist du erschöpft?«, fragte Phiale sie.
Kallisto streckte den Arm aus und nahm meine Hand in ihre. »Ich war mit Artemis auf der Jagd, aber sie ist so schnell vorausgerannt, dass ich nicht mit ihr Schritt halten konnte.« Sie verzog die Lippen zu einem schiefen Lächeln. »Anders als Atalanta, die den ganzen Tag mit ihr durch die Berge laufen kann und erfrischt und zu allem bereit zurückkommt.«
Phiale lachte. »Atalanta ist noch jung, deshalb ist sie so voller Energie.«
»Glaubst du nicht, dass sie noch beeindruckender sein wird, wenn sie erst erwachsen ist? Ich schon.« Kallisto drückte meine Finger, dann sah sie mich an. »Bald wirst du meinen Platz als vertrauteste Gefährtin einnehmen«, sagte sie. Ihr Ton verriet keine Verbitterung, keine Spur von Eifersucht. Sie sagte es schlicht und ehrlich, mit derselben Zuneigung, die sie mir immer entgegenbrachte. Meine Brust schwoll vor Stolz, und ich wandte den Blick ab, unsicher, wie ich reagieren sollte.
Wir spürten es gleichzeitig, ein plötzliches Prickeln in der Luft, als würde der Wald selbst erwartungsvoll aufhorchen. Das konnte nur eins bedeuten. Artemis war gekommen.
Sie betrat die Lichtung, und Nymphen sprangen auf, um sich um sie zu kümmern. Sie überragte alle und hielt einen blutbefleckten Speer in der Hand. Sie glühte förmlich von der Anstrengung und dem Kitzel der Jagd. Sie reichte den Speer, den Bogen und den Köcher zwei bereitstehenden Nymphen, die beides behutsam in einem Winkel der Höhle ablegten. Unterdessen streifte Krokale Artemis die Tunika von den Schultern und hielt ihre Haare hoch, als die Göttin nackt ins Wasser stieg.
Artemis seufzte zufrieden, während die Strahlen der Mittagssonne ihr Gesicht beschienen, die Rundung ihrer Schultern, ihrer Brüste hervorhoben. Es war ein harmonischer, wunderschöner Moment, die Zeit schien stillzustehen.
»Heute Morgen waren auch Männer auf der Jagd«, sagte Kallisto. Ihr Ton klang bedeutungsschwer, als wollte sie Phiale wortlos etwas mitteilen, und sie sahen sich an und schauten dann zu Artemis hinüber, die immer noch ihr Bad genoss.
Ich setzte mich aufrecht hin. »Wie nah sind sie euch gekommen?«
Kallisto lachte. »Nicht sehr nah.«
»Das tun sie nie«, sagte ich. Männer, Hunde und Pferde. Hin und wieder drangen sie in den Wald ein und verscheuchten mit schmetternden Hörnern und ihrem markerschütternden Geschrei die Vögel aus den Bäumen, aber bei all dem Lärm und dem Durcheinander ahnten sie nicht einen Moment, wie nah sie mir, einer Nymphe oder der Göttin selbst kamen.
Phiales Gesicht war ungewöhnlich streng. »Sei dir da nicht zu sicher«, sagte sie. »Sie sind schon einmal tief in den Wald gelangt.«
Ich zuckte die Schultern. »Sie sind nicht schnell genug, um mehr als einen flüchtigen Blick auf uns zu erhaschen.«
»Du darfst ihnen nicht einmal einen flüchtigen Blick auf dich gönnen.« Phiale schüttelte den Kopf, und ich verspürte angesichts ihrer übertriebenen Vorsicht einen Anflug von Gereiztheit.
»Nein, wahrlich nicht.« Kallisto stand auf, holte einen breitrandigen Becher aus der Höhle und hielt ihn unter die Quelle, die den Teich speiste.
»Einmal hat ein Jäger den Weg in den heiligen Hain gefunden«, sagte Phiale. Kallisto stand halb im Schatten der Höhle, weshalb ich ihr Gesicht nicht sehen konnte, aber Phiales Blick war eindringlich auf mich gerichtet, als sie weitersprach. »Er hatte seine Gefährten aus den Augen verloren und war auf der Suche nach ihnen hierhergelangt.«
»Wirklich?« Ich wusste nicht genau, ob ich ihr glauben sollte. Vielleicht war es ein Scherz, oder sie erzählte mir die Geschichte nur, um zu sehen, wie gutgläubig ich war.
»Artemis nahm gerade ein Bad, genau wie heute«, fuhr Phiale fort. Das Gelächter und Geplätscher der Nymphen, die Artemis im Teich Gesellschaft leisteten, sorgte dafür, dass niemand ihre Geschichte hörte, trotzdem sprach sie so leise, dass ich mich anstrengen musste, um sie zu verstehen. »Die Nymphen warfen sich ins Wasser, scharten sich um die Göttin, um sie vor seinen Blicken zu schützen, aber er war wie gebannt, starrte sie unverwandt an.«
Unbehagen überkam mich. »Was hat sie getan?«
»Er hatte zwei Hunde bei sich«, sagte Kallisto. »Artemis war außer sich, zorniger, als ich sie je erlebt habe. Ich erinnere mich noch an ihr Gesicht, wie sie die Hunde ansah, dann wieder den Mann. Es war still, niemand rührte sich, dann plötzlich schlug Artemis auf die Wasseroberfläche, sodass die Tropfen ihm ins Gesicht spritzten. Ihre Stimme – sie klang gar nicht mehr wie Artemis’ Stimme, sondern tiefer, schrecklich. Sie sagte ihm, er solle zu seinen Gefährten gehen und ihnen erzählen, dass er eine Göttin nackt gesehen habe.« Nach einer dramatischen Pause erzählte Phiale weiter. »Er wollte davonlaufen, eilte zurück in Richtung Wald, aber ich konnte sehen, dass sich unter seinen tropfenden Haaren etwas bewegte, dass auf seinem Kopf etwas wuchs, etwas Ungeheuerliches. Ich konnte nicht glauben, was ich sah, aber als er anfing zu schreien, sah ich, was da Gestalt annahm – ein Geweih spross aus seinem Schädel.«
»Ein Geweih?« Ich schnappte nach Luft. »Aber wie …?«
»Er stürzte, und auf einmal war sein ganzer Körper von Fell bedeckt. Er zuckte, wieder und wieder, seine Schreie gellten zum Himmel empor, dann wälzte er sich herum, stand auf vier Läufen – kein Mensch mehr, sondern ein Hirsch.«
»Die Hunde …«, sagte Kallisto und schluckte.
»Er versuchte zu fliehen, stolperte jedoch über seine eigenen Läufe. Die Hunde stürzten sich auf ihn, und ihr Gebell hallte im ganzen Wald wider.«
»Ich konnte nicht hinsehen«, sagte Kallisto.
Ich war fasziniert und abgestoßen zugleich. »Aber ist das den Männern nicht eine Warnung, sich fernzuhalten? Wieso soll ich ihnen dann aus dem Weg gehen? Wenn sie uns hierherfolgen, trifft sie die gleiche Strafe.«
»Stell dir vor, Artemis wäre an jenem Tag nicht hier gewesen.« Phiale strich sich ungeduldig die Haare aus dem Gesicht. »Stell dir vor, ein Mann hätte uns hier ohne sie vorgefunden, hätte eine Nymphe allein beim Bad angetroffen, ohne Kleidung, verwundbar? Wenn sie wüssten, dass wir hier sind, was glaubst du, würden sie tun?«
»Ich weiß es nicht.« An ihrem Tonfall erkannte ich, dass es etwas Schreckliches sein musste.
Kallisto trat nah an mich heran. »Natürlich weißt du es nicht, aber nur, weil wir so leben, wie wir es tun, nur wir Frauen und Artemis.«
»Artemis sorgt dafür, dass wir in Sicherheit sind«, sagte Phiale. »Im Gegenzug haben wir alle denselben Eid geschworen: dass wir uns nicht mit Männern abgeben.«
»Seine Hunde heulten den ganzen Abend und suchten nach ihrem Herrn«, sagte Kallisto. »Sie wollten dafür gelobt werden, dass sie Beute erlegt hatten. Wir hörten, wie seine Freunde in der Ferne seinen Namen, Aktäon, riefen, wieder und wieder. Erst nach Stunden gaben sie auf.«
Ich ließ mir alles durch den Kopf gehen. »Er ist hierhergekommen, um zu jagen. Und er hat etwas gefunden, was stärker war als er.« So war das Leben im Wald. Das hatte Artemis mir beigebracht, als wir mit dem Bogen in der Hand auf Beute gelauert hatten. Wir mussten es mit allem aufnehmen können, was uns über den Weg lief, stark genug sein, um aus allen Begegnungen siegreich hervorzugehen.
»Das stimmt«, sagte Phiale. »Aber Artemis ist nicht immer hier, und wir sind nicht alle so schnell wie du, Atalanta.« Ihre Stimmung hatte sich aufgehellt, sie sagte es lachend.
»Und wir haben auch nicht dein Talent im Bogenschießen«, sagte Kallisto und küsste mich auf die Stirn.
Aber ich würde hier sein, auch wenn Artemis es nicht war. Ich hatte die Jäger nur als Ärgernis betrachtet, jetzt fasste ich den Entschluss, dass ich, wenn einer uns so nahe kam wie Aktäon, dafür sorgen würde, dass es ihm ebenso schlecht erging. Manchmal war ich versucht, ihnen schnell über den Weg zu laufen, um zu sehen, ob sie einen flüchtigen Blick auf mich erhaschen konnten. Wenn sie von nun an mit ihren Pferden und Hunden durch den Wald donnerten, wandte ich mich von den lärmenden Eindringlingen ab und begab mich tiefer ins Herz des Waldes, wohin sie mir nicht folgen konnten.
Ich war fest entschlossen, stärker und schneller zu werden. Strengte mich noch mehr an, übte mich jeden Tag im Bogenschießen, um meine Zielsicherheit zu vervollkommnen. Wenn Artemis zu uns kam, prahlte ich mit meinem Können, erlegte Hirsche und Berglöwen. Ich lief mit ihr um die Wette durch das Gebirge mit fliegenden Beinen, sog scharf und hastig die Luft ein, immer ein winziges Stück hinter ihr. Ich war noch jung genug, um zu glauben, dass ich sie eines Tages einholen würde, dass ich schneller als eine Göttin sein könnte. Sie sollte darauf vertrauen können, dass ich uns alle beschützen würde, so wie sie: ich, die ich das wilde Leben der Bären geteilt hatte und mit Pfeil und Bogen durch die Wälder streifte. Sie war meine Schwester, Mutter, mein Vorbild und meine Lehrmeisterin in einer Person, und ich wünschte mir, nichts zu fürchten, genau wie sie.
2
Wir erreichten eine Wiese voller Blumen, deren zarte rote Blüten im üppigen Gras nickten. Ein schöner Ort, um zu rasten, wie ich fand, doch Artemis runzelte die Stirn, und das Missfallen in ihrem Gesicht wurde noch ausgeprägter, als der Wind einen süßlichen Geruch zu uns trug und wir eine Girlande inmitten des Grases sahen. Es war ein Kranz aus miteinander verflochtenen rosafarbenen Rosen, der zwischen die anderen Blumen gelegt worden war. Verwirrt sah ich, wie Artemis voller Abneigung das Gesicht verzog.
»Was ist das?«, fragte ich. »Wer hat das hier hinterlassen?« Ich verstand nicht, was sie so erzürnte. Bauschige weiße Wolken zogen über den Himmel, die Sonne schien mild und golden auf das wogende, von leuchtenden Blumen übersäte Gras, und die Zweige einer Pappel boten Schatten.
»Rosen«, sagte Artemis und stieß die Girlande mit dem Fuß an, sodass ihr schwerer Duft aufstieg. Dabei lösten sich ein paar Blütenblätter. »Irgendein närrischer Sterblicher muss sie hierhergelegt haben, vielleicht ein verliebter Jäger, als Opfergabe für Aphrodite, in der vergeblichen Hoffnung, dass sie die Stirn hat, je hierher zurückzukehren.«
Ich hielt den Atem an, wagte nicht, sie zu unterbrechen. Artemis sprach selten über die anderen Götter oder Göttinnen. Bisher hatte sie mit keinem Wort erwähnt, dass einer von ihnen je einen Fuß in unseren Wald gesetzt hatte, in ihr Reich, in dem ihre Macht nie infrage gestellt wurde. Es waren die Nymphen gewesen, die mir beigebracht hatten, wie man die anderen Götter ehrte, damit ich sie nicht aus Versehen vernachlässigte oder erzürnte. Ich wusste von Dionysos, der die Sterblichen gelehrt hatte, wie man aus Trauben Wein kelterte; von Zeus, der Blitze schleuderte und den Himmel mit seinem stürmischen Zorn spalten konnte; Demeter, die die Erde segnete, damit sie Früchte trug und uns ernährte; Poseidon, der über Meere herrschte, die ich noch nie gesehen hatte. Gottheiten des Krieges, der Musik und Dichtkunst, der Strategie, der Weisheit, der Ehe, aller möglichen Dinge, von denen manche mein Leben berührten und andere nicht einmal annähernd. Aphrodite gehörte eindeutig in die letzte Kategorie.
Artemis wandte den Blick von dem Kranz ab und sah mich an. Sie lächelte, und ihr Ärger schien verflogen. »Es ist jetzt zehn Jahre her, dass ich dich im Wald umherirrend fand«, sagte sie. »Und schon jetzt bist du größer als alle Nymphen, obwohl du noch nicht einmal erwachsen bist. Du bist tapfer genug, um sie beschützen zu wollen, obwohl du nicht immer genau weißt, vor welcher Bedrohung.«
Ihr Blick huschte zurück zu den Rosen am Boden; sie schürzte die Lippen und schien zu einer Entscheidung zu kommen. »Dieser Wald stand früher unter der Herrschaft von Kybele, der Muttergöttin. Sie herrschte vor allen anderen, sie gebar die Götter und auch die Berge. Löwen schliefen bei ihrem Thron; sie zogen ihren Triumphwagen, wenn sie durch den Wald fuhr, und sie konnte selbst die stärksten, wildesten Bestien zähmen. Sie überließ diesen Wald mir, und kein anderer Olympier wagt es, in mein Herrschaftsgebiet einzudringen.«
Um uns herum zwitscherten die Vögel fröhlich in den Baumwipfeln. Der Duft der Rosen hing noch in der Luft, jetzt noch süßlicher und aufdringlicher.
»Aphrodite kam natürlich wegen ihres Liebhabers hierher. Ein Sterblicher namens Adonis, der die Jagd liebte. Eine Weile vertrieb sie sich ebenfalls die Zeit damit, stellte Hasen und Vögeln nach und hielt sich für mutig. Sie bat ihn, sich von Bären, Wölfen und Löwen fernzuhalten, flehte ihn an, nie einen wilden Eber zu verfolgen, um auch nicht den kleinsten Kratzer auf seinem gut aussehenden Gesicht zu riskieren.« Sie verzog den Mund. »Hier auf dieser Wiese haben sie beieinandergelegen.«
Ich machte große Augen.
»In meinem Hain, Atalanta, dem Ort, an den ich meine Nymphen brachte, um in Frieden zu leben.« Sie schüttelte den Kopf. »Und hierher kam er auch, als er tödlich verwundet wurde, nachdem er ein wildes Tier im Wald aufgeschreckt hatte – ein Geschöpf, das stärker war als er, die Art, vor der sie ihn gewarnt hatte. Er starb in ihren Armen, und sein Blut tropfte auf den Boden, wo es sich mit ihren Tränen mischte.«
Artemis trat vor und zertrat einige rote Blumen unter den Sohlen ihrer Sandale. »Sie sind an der Stelle gewachsen, an der er gestorben ist«, sagte sie. Als sie den Fuß hob, sah ich die geknickten Stiele und die verstreuten Blütenblätter. »Sie ist nie zurückgekehrt.«
Ich nickte, als wäre ich vollkommen im Bilde. Zwar war ich immer begierig darauf, mehr zu erfahren, aber wenn eine Unterhaltung Artemis langweilte oder sie das Gefühl hatte, genug gesagt zu haben, wurde ihr Gesichtsausdruck so abweisend, dass ich es nicht wagte, Fragen zu stellen. Erst später dachte ich über das nach, was sie mir erzählt hatte, und versuchte einen Sinn darin zu finden, der mir anfangs womöglich entgangen war.
Sie war stets unvorhersehbar, unberechenbar, im Handumdrehen verschwunden, nur um ohne Vorwarnung zurückzukehren. An jenem Abend, als sie wieder fort war, gesellte ich mich zu den Nymphen, die um ein Feuer herumsaßen; dünne Rauchkringel stiegen zum Sternenhimmel auf, und ihr Lachen und Geplauder mischte sich harmonisch in der Stille der Dämmerung. Psekas drehte einen Krug in den Händen, sodass die dunkle Flüssigkeit darin gluckerte. Der berauschende, süße Geruch des Weins erinnerte mich an die Rosen. Lächelnd nahm sie einen Krug Wasser und schüttete etwas davon in den anderen, vermischte den Inhalt damit. Als sie ihn herumreichte, war ich selbst überrascht, als ich danach griff.
Normalerweise trank ich lieber frisches Wasser aus den Quellen. Doch heute war ich fasziniert vom Duft des Weines. Ich atmete ihn ein, betrachtete seine tiefrote Färbung und probierte einen Schluck. Er schmeckte scharf nach Früchten und Gewürzen, sodass ich anfangs die Nase rümpfte. Aber dann spürte ich, wie er mich innerlich wärmte, trank einen weiteren Schluck, und die Wärme breitete sich in meinen ganzen Körper aus.
Krokale lehnte sich an einen knorrigen Eichenbaum, dessen Zweige sich über uns erstreckten. Sie strich müßig über die winzigen weißen Blumen, die um sie herum wuchsen. Der Abend hatte etwas Verträumtes, Entspanntes. Es war zwar nicht schöner, wenn Artemis nicht da war, aber anders. In ihrer Anwesenheit fühlte sich alles lebendiger, pulsierender an. Ich saß aufrechter, lauschte eindringlicher. Nun, da sie fort war, ließ ich die Unterhaltungen an mir vorbeirauschen, bis mir die Wiese wieder einfiel, auf die wir am Nachmittag gestoßen waren, und ich unterbrach das Gespräch mit einer Frage, die mir plötzlich überaus dringlich vorkam.
»Wie lange ist es her, seit Aphrodite hier im Wald war?«
Psekas sah mich misstrauisch an. »Was meinst du?«
»Artemis hat mir heute die Wiese gezeigt, wo ihre Blumen wachsen. Ich habe mich nur gefragt, wann das war.«
Psekas zuckte die Schultern. »Das weiß ich nicht.« Sie sah sich rasch im Kreis um und trank einen großen Schluck Wein. »Sie kam zum Schäferstündchen mit ihrem Liebhaber hierher. Artemis konnte es nicht leiden, wenn sie hier war, aber wir hätten nie davon erfahren, wenn sie es uns nicht selbst erzählt hätte – sie war natürlich wütend. Ich glaube, Aphrodite hat nach einem Versteck gesucht, einem Ort, der vor den Augen der Welt verborgen war.«
»Aber der Wald gehört Artemis«, warf Kallisto ein. Sie nahm den Krug und schüttete noch etwas Wasser in den Wein.
Krokale beugte sich vor und hielt ihr den Becher hin. »Das hat Aphrodite deutlich zu spüren bekommen, glaube ich.«
»Artemis hat gesagt, ein Tier habe Adonis getötet«, sagte ich. »Ein Jagdunfall.«
Krokale nickte, aber ich sah, wie sie einen flüchtigen Blick mit Psekas wechselte. »Artemis hatte Aphrodite nicht verziehen, dass sie Ränke gegen eine ihrer Favoritinnen geschmiedet hat. Sie konnte ihre Anwesenheit hier nicht ertragen. Ihr Zorn überschattete jeden Tag.«
»Zweifellos wollte sie uns alle auch beschützen«, sagte Kallisto. Ihr Tonfall war sanft, aber ich glaubte einen warnenden Unterton in ihren Worten zu hören.
»Warum, was ist denn mit ihrem Schützling passiert? War es eine Nymphe?«, fragte ich.
Krokale seufzte. »Ein Mädchen, dem Artemis ganz und gar ergeben war. Sie war ihre liebste Freundin. Ihr Name war Persephone.«
»Persephone, die Königin der Unterwelt?«, fragte ich.
Krokale nickte. »Sie verbrachten ihre Kindheit zusammen auf der Insel Sizilien, ihrem Lieblingsort, wo sie auf den Wiesen spielten und Veilchen pflückten. Sie hatten sich beide einem Leben ohne Männer verpflichtet, wie wir es ebenfalls getan haben.«
»Aber Aphrodite hatte andere Pläne.« Das Mondlicht spiegelte sich schimmernd in dem Wein in Kallistos Becher, als sie ihn schwenkte, und ihre Augen blickten traurig, als sie weitersprach. »Sie wollte ihre Macht beweisen, zeigen, dass es keine Winkel und keine Höhle auf der Welt gab, in die ihr Einfluss sich nicht erstreckte. Einschließlich der Unterwelt.«
»Sie schickte ihren Sohn Eros zu Hades«, sagte Krokale. »Sie wollte, dass der eisige König der Toten vor Sehnsucht brannte. Und so schoss Eros seinen Pfeil ab, und Hades wurde von einem unwiderstehlichen Verlangen nach Persephone überwältigt.«
»Und so wurde Persephone mit Hades vermählt?«, fragte ich.
»Und Artemis verlor ihre geliebte Freundin«, beendete Kallisto die Geschichte.
»Es machte den Affront, dass Aphrodite Adonis hierherbrachte, noch schlimmer«, sagte Psekas. »Das war unerträglich für Artemis.«
Ich dachte daran, wie Artemis die Blumen zertreten hatte. »Verständlich.«
Krokale streckte die Arme und ließ sie mit einem leichten Schauder wieder sinken. »Aber so, wie Artemis nicht verzeihen konnte, was mit Persephone passiert ist, hat Aphrodite den Verlust von Adonis sicher auch nicht verwunden.«
»Woher weißt du das?«, fragte ich.
»Es gibt eine Welt außerhalb des Waldes«, sagte Krokale. »Wir sind mit Artemis hierhergekommen.« Wieder warf sie Psekas einen Blick zu. »Unsere Schwester Peitho dagegen hat sich in den Dienst von Aphrodite begeben.«
»Es gibt viele Nymphen auf Erden«, ergänzte Psekas. »Einige leben wie wir, manche auf völlig andere Art.«
Ich runzelte die Stirn und trank meinen Wein aus. »Hatte eure Schwester eine Wahl?«
Psekas lachte. »Ja, hatte sie.«
»Und jetzt ist sie eure Feindin wie Aphrodite die von Artemis?«
»Ganz und gar nicht. Sie ist und bleibt unsere Schwester; wir lieben sie genauso wie vorher.«
Ich öffnete den Mund, aber Kallisto erhob sich. »Ich glaube, es ist an der Zeit, schlafen zu gehen«, sagte sie.
Ich war müde, und eine angenehme Schwere hatte sich meines Körpers bemächtigt. Der leise Schrei einer Eule ertönte aus einem Baum, und die dunklen Schemen der Berge erhoben sich hinter den Bäumen wie vertraute Freunde. Wie unbegreiflich, dachte ich bei mir, als ich mich schlafen legte, dass jemand sich ein anderes Zuhause als diesen Ort, eine andere Beschützerin als Artemis aussucht.
Im Laufe der Jahre kamen noch andere Nymphen zu uns, von unsterblichen Vätern hierhergesandt, die ein Zuhause für ihre zahlreichen Töchter suchten. Nicht lange nach jenem Tag traf Arethusa bei uns ein. Ihr Vater war Nereus, ein Meeresgott aus alter Zeit; ich hörte, wie sie es den anderen erzählte, als ich mich mit Pfeil und Bogen aufmachte, um auf die Jagd zu gehen. Leichtfüßig und geräuschlos streifte ich durch den Wald, bis Helios’ Bahn sich abwärtsneigte und die Sonne unterging. Ich erreichte ein Flussufer. Dankbar legte ich die Tunika ab und tauchte ins Wasser, wusch mir den Staub und den Schmutz vom Körper. Ich kam wieder an die Oberfläche, ließ mich dahintreiben, und die sanfte Strömung trug meine Müdigkeit davon und linderte den Schmerz in meinen Muskeln. Ich war nicht die Einzige hier; der Wind wehte das Geplauder einer kleinen Gruppe von Nymphen am Ufer zu mir, und ich hob die Hand, um sie zu grüßen. Kallisto stand auf, zog ebenfalls ihre Tunika aus und ließ sich in den Fluss gleiten. Wir schwammen oft zusammen und erzählten uns Geschichten von der Jagd des jeweiligen Tages. Während ich darauf wartete, dass sie mich erreichte, schloss ich in seliger Zufriedenheit die Augen, und meine Haare breiteten sich um mich herum aus. Doch noch während ich in Erinnerungen an den Tag schwelgte, spürte ich ein Ziehen am Kopf. Ich riss die Augen auf, und meine Kopfhaut prickelte, als ich die unverkennbare Berührung von Fingern spürte, die durch mein Haar glitten.
Als ich mich umdrehte, sah ich, dass Kallisto noch weit von mir entfernt war. Das, was mich gepackt hatte, war keine Nymphe. Es befand sich noch etwas anderes im Fluss.
Ich wand mich, befreite mich mit einem Ruck und strampelte panisch, um ins flache Wasser zu gelangen, packte das lange Gras, um mich an Land zu ziehen, zerrte mir hastig die Tunika über den Kopf und griff nach meinem Bogen. Keuchend stand ich am Ufer und suchte den Fluss nach dem ab, was mich festgehalten hatte. Auf der anderen Seite des Flusses war auch Kallisto aus dem Wasser gesprungen, nachdem sie meine panische Flucht bemerkt hatte, und unsere Blicke trafen sich. Die Nymphen am anderen Ufer setzten sich argwöhnisch auf, und der Friede der langsam fallenden Dämmerung war dahin.
Dann schrie Arethusa. Sie hatte sich zu weit über den Fluss gebeugt und schien plötzlich von einem Dutzend wässriger Hände bedeckt zu sein, die über ihr Fleisch krochen. Sie wand sich, schaffte es, sich zu befreien, floh vom schlammigen Ufer und schrie erneut, als wir eine Stimme aus der Tiefe gurgeln hörten; rauschendes Wasser, das die Worte sprach: »Ich bin Alpheios, Gott dieses Flusses.« Ein Schauer lief mir über den Rücken. Artemis mochte die Göttin unseres Waldes sein, aber aus jedem Gewässer, jeder Quelle entsprangen niedere Gottheiten. Die meisten wagten es allerdings nicht, Artemis’ Zorn zu erregen, doch manche waren dreister, kühner.
Arethusa rannte davon, aber ich sah, wie Blasen an die Wasseroberfläche stiegen und eine schimmernde, tropfnasse Gestalt sich daraus erhob. Ohne nachzudenken, sprang ich zurück ins Wasser, schwamm ans andere Ufer, kletterte den schlammigen Abhang hinauf und rannte hinter Arethusa her. Doch er folgte ihr ebenfalls mit schmatzenden Schritten. Hätte ich Pfeile auf ihn abgeschossen, hätten sie seinen wässrigen Körper durchdrungen und Arethusa getroffen. Mein Atem ging stoßweise, aber ich rief Artemis an, als er sich über Arethusa aufbäumte wie eine Welle mit glitzerndem Wellenkamm.
Meine Fersen schlitterten über die Erde, als ich abrupt stehen blieb. Ich spürte, wie Artemis’ Zorn in der Stille pulsierte. Sie musste nah genug sein, um meinen verzweifelten Schrei gehört zu haben, oder sie hatte die Anwesenheit von Alpheios selbst gespürt. Ehe Alpheios Arethusa erreichen konnte, verschwand die erschöpfte Nymphe, und an ihrer Stelle erhob sich eine Nebelwolke. Alpheios drehte das große Haupt, sah sich nach ihr um. Ein unaufhörliches Plätschern ertönte aus dem Zentrum des feuchten Dunsts, wo Arethusa zuvor gewesen war. Dann klaffte im Boden plötzlich ein Spalt auf, die Nebelwolke fiel in sich zusammen, und ein Schwall Wasser ergoss sich in die Erde.
Alpheios brüllte vor Enttäuschung, Schaum blubberte auf der Erde, als er ihr nachstürzte, aber ich hörte Artemis leise hinter mir lachen und fuhr herum. »Wird er sie einholen?«
Die Göttin schüttelte den Kopf. »Er wird es versuchen. Wird sie verfolgen, solange er kann, aber sie ist jetzt ein Strom, fließt den ganzen Weg unter der Erde bis tief in die Unterwelt. Dorthin kann er ihr nicht folgen, er muss in sein eigenes Gewässer zurückkehren.«
»Die Unterwelt?«, fragte ich. »Dann ist sie also tot?« Noch vor wenigen Augenblicken hatte sie am Ufer gelacht.
Hinter Artemis erblickte ich Kallisto mit tropfnassen Haaren und schreckgeweiteten Augen, die noch feuchte Tunika klebte ihr am Körper. Sie musste uns nachgeeilt sein und gesehen haben, was passiert war.
»Keineswegs«, sagte Artemis. »Sie wird auf einer Insel weit weg von hier wieder an die Oberfläche kommen. Als eine heilige Quelle, gesegnet von mir.«
Das Blitzen in ihren Augen hielt mich davon ab, weitere Fragen zu stellen. Als ich einen Blick zurückwarf, hatten sich noch andere Nymphen zu Kallisto gesellt. Ich sah, wie Kallisto die Arme hob, die Form der Wolke nachfuhr, die zuvor ein Mädchen gewesen war; sah die heraufdämmernde Erkenntnis in ihren Gesichtern, während sie zuhörten. Doch ich ging nicht zu ihnen, sondern folgte stattdessen Artemis, und mein rasender Herzschlag beruhigte sich allmählich. Anmutig schritt sie zwischen den Bäumen hindurch, trittsicher und selbstbewusst. Die Haare trug sie wie immer zu festen Zöpfen an ihrem Hinterkopf geflochten, die Beine unter der knielangen Tunika waren nackt, der Bogen auf ihrem Rücken glänzend und golden. Wir kamen an dem Fluss vorbei, aus dem ich geflüchtet war, und sein Wasser war jetzt so dunkel wie der Himmel. Das leise Rauschen des pechschwarzen Stromes klang friedlich. Die anderen Nymphen waren nicht zurückgekehrt. Vielleicht schmollte Alpheios irgendwo dort in der Tiefe, wagte jedoch nicht, Artemis herauszufordern. Erneut breitete sich Ruhe im Wald aus. Artemis blieb stehen, kniete auf einem Felsen nieder, um ihre Sandale zu schnüren, und ihr markanter Kiefer und ihre Wangenknochen glänzten silbern im Mondlicht.
Ich konnte es nicht auf sich beruhen lassen, hatte zu viele Fragen, und sosehr ich vor ihrem Zorn auf der Hut war, ich musste mehr erfahren. Um einen gleichmütigen Ton bemüht, sagte ich: »Arethusa ist also fort.«
Artemis wandte das Gesicht gen Himmel. »Ortygia ist eine wunderschöne Insel«, sagte sie.
»Es kann dort nicht so schön sein wie hier.«
»Nun ja, wenn sie bleiben wollte, hätte sie schneller laufen sollen.« Ihr Tonfall war sanft, trotz der kalten Endgültigkeit ihrer Worte. »Es war eine Gnade für sie, dass ich Alpheios nicht zu Ende bringen ließ, was er tun wollte.«
Ich konnte immer noch seine Finger in meinen Haaren spüren. Ein Schauder lief mir über den Rücken.
»Du warst heute auf der Jagd«, sagte Artemis. »Ich habe dir beigebracht, vorsichtig zu sein, habe dich vor den Berglöwen und den Wölfen gewarnt, die dich in Stücke reißen und bei lebendigem Leib auffressen würden. Aber wenn einer dieser Flussgötter dich in die Hände bekommt … ist das etwas anderes.«
»Also ist sie nun besser dran, als wenn er sie eingeholt hätte?«
Artemis seufzte. »Sie ist jetzt für immer von Männern befreit. Also geht es ihr besser als den meisten.« Sie stützte das Kinn auf die Hände und sah mir direkt in die Augen. Sie hätte irgendeine junge Frau sein können, einfach gekleidet, weder mit Edelmetallen noch mit übertriebenem Zierrat behängt. Doch ihre Furchtlosigkeit, die beständige Entschlossenheit ihres Blicks, ihre Unbekümmertheit und ihr unerschütterliches Selbstvertrauen hoben sie aus der Masse heraus. »Du weißt, dass ich den Hain nur aus einem Grund verlasse und mich in die Stadt begebe«, sagte sie.
Ich nickte. »Um die Gebete der Frauen dort zu erhören.«