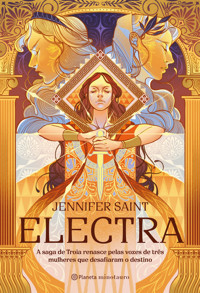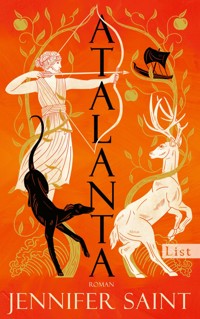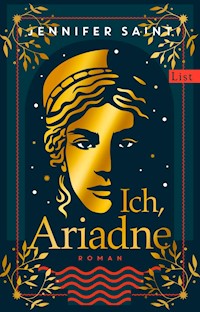15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jennifer Saints mitreißende Heldinnen-Sagas in einem E-Bundle zum attraktiven Sonderpreis. ***Ariadne und Elektra finden ihre eigene Stimme, erzählen ihre schicksalhafte Geschichte. Eine Einladung in die griechische Mythologie.*** Ich, Ariadne Ariadne, Tochter von König Minos, ist so ganz anders als ihre Geschwister. Sie schwört, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und es nicht den Göttern zu überlassen. Jedes Jahr beobachtet sie, wie 14 junge Athener dem gefräßigen Minotaurus geopfert werden. Sie lehnt sich vergeblich gegen diese Grausamkeit auf. Bis sie sich in einen der Todgeweihten verliebt. Theseus verspricht ihr ewige Liebe, wenn sie ihm hilft, das Ungeheuer zu töten. Alles kommt anders. Elektra, die hell Leuchtende Sehnsüchtig wartet Elektra, Prinzessin von Mykene, auf die Rückkehr ihres Vaters Agamemnon. Bei seiner Rückkehr bringt er als Beute die Priesterin Kassandra mit. Sie kann die Zukunft vorhersehen, aber niemand glaubt ihr. Die Schicksale von Elektra, ihrer Mutter Klytaimnestra und Kassandra sind durch die Untaten der Männer unentrinnbar verbunden. Elektra jedoch beginnt, sich aufzulehnen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. »Ebenbürtig mit Madeline Millers Romanen.« Waterstones.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zwei griechische Rebellinen erzählen ihre Geschichte
Die Autorin
JENNIFER SAINT begeisterte sich schon als Kind für die griechische Mythologie. Während ihres Studiums der Altphilologie am King's College in London hat sie ihre Liebe zu den antiken Sagen vertieft. Als Englischlehrerin versucht sie die Faszination für Geschichten aller Art und die reiche Erzähltradition seit Homer zu vermitteln. Jeder Erzähler hat die antiken Stoffe für sich neu interpretiert. Jennifer Saint stellt die weibliche Heldin in den Mittelpunkt.
Das Buch
Jennifer Saints mitreißende Heldinnen-Sagas in einem E-Bundle
Ich, Ariadne
Ariadne, Tochter von König Minos, ist so ganz anders als ihre Geschwister. Sie schwört, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und es nicht den Göttern zu überlassen. Jedes Jahr beobachtet sie, wie 14 junge Athener dem gefräßigen Minotaurus geopfert werden. Sie lehnt sich vergeblich gegen diese Grausamkeit auf. Bis sie sich in einen der Todgeweihten verliebt. Theseus verspricht ihr ewige Liebe, wenn sie ihm hilft, das Ungeheuer zu töten. Alles kommt anders.
Elektra, die hell Leuchtende
Sehnsüchtig wartet Elektra, Prinzessin von Mykene, auf die Rückkehr ihres Vaters Agamemnon. Bei seiner Rückkehr bringt er als Beute die Priesterin Kassandra mit. Sie kann die Zukunft vorhersehen, aber niemand glaubt ihr. Die Schicksale von Elektra, ihrer Mutter Klytaimnestra und Kassandra sind durch die Untaten der Männer unentrinnbar verbunden. Elektra jedoch beginnt, sich aufzulehnen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Jennifer Saint
Zwei griechische Rebellinen erzählen ihre Geschichte
2 in 1: Antike Mythologien-Bundle
Aus dem Englischen von Simone Jakob
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Sonderausgabe im Ullstein TaschenbuchFebruar 2023
Aus dem Englischen von Simone Jakob© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023
Ich, Ariadne© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021 / List Verlag(c) 2021 by Jennifer SaintTitel der englischen Originalausgabe: AriadneErschienen bei Wildfire, Headline Publishing Group Ltd., LondonUmschlaggestaltung: Favoritbüro, MünchenTitelabbildung: (c) Anastasiia Veretennikova / Shutterstock.com, (c) Dalhazz / Shutterstock.com, Favoritbüro, München
Elektra, die hell Leuchtende© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022 / List Verlag(c) by Jennifer SaintTitel der englischen Originalausgabe: ElektraErschienen bei Wildfire, Headline Publishing Group Ltd., LondonUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: Design und Illustration: Micaela Alcaino for Headline Publishing Group
Autorenfoto: © Katie ByramISBN 978-3-8437-2983-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Ich, Ariadne
Prolog
TEIL I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TEIL II
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TEIL III
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEIL IV
37
38
39
40
Epilog
Dank
Elektra, die hell Leuchtende
Prolog
Teil 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teil 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Teil 3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Teil 4
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Epilog
Danksagung
Anhang
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Ich, Ariadne
Ich, Ariadne
RomanAus dem Englischen von Simone Jakob
Motto
»Wenn du vor der Menge stehst und den ruhmreichen Tod des Stiermenschen in jenen verschlungenen, steinernen Gängen schilderst, so vergiss nicht, auch von mir zu erzählen.«
Ariadnes Brief an Theseus, Ovids Heroides
Prolog
Lasst mich die Geschichte eines rechtschaffenen Mannes erzählen.
Der rechtschaffene Mann hieß König Minos von Kreta und zog aus, um Krieg gegen Athen zu führen, denn er wollte seinen Sohn Androgeos rächen. Der unbezwingbare Athlet hatte bei den Panathenäen bei allen Wettkämpfen gesiegt, nur um kurz darauf auf einem einsamen athenischen Hügel von einem rasenden Stier zerrissen zu werden. Minos machte Athen für den Tod seines Sohnes verantwortlich, und es dürstete ihn nach blutiger Vergeltung.
Auf dem Weg nach Athen besuchte Minos Megara, um seine Macht zu demonstrieren und das Königreich zu erobern. Nisos, der König von Megara, war weithin für seine Unbesiegbarkeit bekannt, doch trotz seines legendären Rufs war er Minos in keiner Hinsicht gewachsen. Indem er Nisos der purpurnen Locke beraubte, der dieser seine unsterbliche Macht verdankte, gelang es Minos, ihn zu besiegen und den Unglückseligen zu erschlagen.
Doch woher wusste Minos um die Quelle von Nisos’ Macht? Minos erklärte mir unbekümmert, die Tochter des Königs, die schöne Prinzessin Skylla, habe sich rettungslos in ihn verliebt. Als sie ihm ihre süßen Versprechungen ins Ohr hauchte, bereitwillig für seine Liebe ihre Heimat und ihre Familie aufzugeben, verriet sie ihm auch den Schlüssel zum Verderben ihres Vaters.
Minos war natürlich zu Recht entsetzt über ihren Mangel an töchterlicher Ergebenheit, und sobald Megara gefallen war, ließ er das verliebte Mädchen am Heck seines Schiffs anbinden und zu Tode schleifen, während sie schreiend und weinend ihr blindes Vertrauen in seine Liebe beklagte.
Sie habe nun einmal ihren Vater und ihr Land verraten, erklärte er mir, als er nach der Einnahme Athens im Siegestaumel nach Knossos zurückkehrte. Und was sollte mein Vater, König Minos von Kreta, mit einer verräterischen Tochter anfangen?
TEIL I
1
Ich bin Ariadne, Prinzessin von Kreta, obwohl meine eigene Geschichte mich weit von der felsigen Küste meiner Heimat fortführen wird. Mein Vater Minos erzählte mir gern und oft davon, wie seine untadelige Moral ihm zum Sieg über Megara, zur Herrschaft über Athen und zu der Gelegenheit verhalf, mit seinem unfehlbaren Urteilsvermögen ein leuchtendes Vorbild zu geben.
In manchen Versionen ihrer Geschichte heißt es, Skylla sei im Augenblick ihres Todes in einen Seevogel verwandelt worden. Doch statt dadurch ihrem grausamen Schicksal zu entkommen, musste sie sofort vor einem Adler mit einem purpurnen Streifen fliehen, der sie bis in alle Ewigkeit verfolgt. Ich bin durchaus geneigt, das zu glauben, denn die Götter haben bekanntlich ihre Freude an Spektakeln von unendlich in die Länge gezogenen Qualen.
Aber wenn ich mir Skylla vorstellte, dann als törichtes, allzu menschliches Mädchen, das inmitten der schäumenden Wellen im Kielwasser des Schiffs meines Vaters nach Luft rang. Ich sah sie vor mir, wie sie im tosenden Wasser nicht nur von den schweren eisernen Ketten, mit denen man sie gefesselt hatte, in die Tiefe gezogen wurde, sondern auch von der Last der Wahrheit, dass sie alles, was sie gekannt hatte, für eine Liebe geopfert hatte, die so trügerisch war wie die in der Gischt schimmernden Regenbögen.
Nach Skylla und Nisos war das blutige Werk meines Vaters jedoch noch nicht vollbracht. Von Athen verlangte er einen schrecklichen Preis für den Frieden. Zeus, der allmächtige Herrscher der Götter, schätzte Macht bei Sterblichen über alles, und so gewährte er seinem Favoriten Minos die Gnade einer schrecklichen Seuche, die er wie eine Sturmflut aus Krankheit, Leid und Tod über Athen hereinbrechen ließ. Ein großes Geschrei erhob sich in der Stadt, als Mütter mit ansehen mussten, wie ihre Kinder vor ihren Augen dahinsiechten und starben, als Soldaten auf dem Schlachtfeld zusammenbrachen und als die stolze Stadt – die erkennen musste, dass sie wie alle Städte nur aus schwachem, menschlichem Fleisch bestand – unter der Last der Leichenberge zu ersticken drohte und kapitulieren musste. Athen blieb keine andere Wahl, als all seine Forderungen zu erfüllen.
Mein Vater verlangte jedoch weder Macht noch Reichtum von Athen, sondern einen Tribut – sieben athenische Jünglinge und sieben athenische Jungfrauen mussten jedes Jahr auf einem Schiff nach Kreta entsandt werden, um den Hunger jenes Ungeheuers zu stillen, an dessen Existenz meine Familie fast zerbrochen wäre, die uns aber in den Status eines Mythos erhob. Jene Kreatur, deren Gebrüll die Gebäude unseres Palastes erzittern ließ, wenn die Zeit ihrer jährlichen Fütterung nahte, und die tief unter der Erde in einem so weitverzweigten, verworrenen Labyrinth hauste, dass niemand, der es betrat, je wieder zurück ans Tageslicht fand.
Ein Labyrinth, zu dem ich allein den Schlüssel besaß.
Ein Labyrinth, das jenes Wesen beherbergte, das Minos’ größte Demütigung und zugleich sein wertvollster Besitz war.
Meinen Bruder, den Minotaurus.
Als Kind übte der verwinkelte Palast von Knossos eine endlose Faszination auf mich aus. Ich streifte durch eine verwirrende Anzahl von Räumen und verwinkelten Gängen, strich über die glatten roten Mauern, fuhr mit den Fingerspitzen die Umrisse der Labrys nach – jener Doppelaxt, die viele Steine des Palastes zierte. Später erfuhr ich, dass die Labrys die Macht des Zeus symbolisiert, der damit den Donner herbeiruft – eine gewaltige Machtdemonstration. Für mich, die ich durch den Irrgarten meines Zuhauses streunte, sahen sie aus wie Schmetterlinge. Und es war auch der Schmetterling, an den ich dachte, wenn ich aus dem düsteren Kokon des Palastinneren in den offenen, lichtdurchfluteten Hof trat, in dessen Mitte ein poliertes rundes Objekt prangte, auf dem ich die glücklichsten Stunden meiner Kindheit verbrachte – eine große Tanzbühne. Oft wirbelte ich in schwindelerregenden Kreisen dahin, wob mit den Füßen ein unsichtbares Muster auf dieses Wunderwerk aus Holz, ein handwerklicher Triumph des legendären Erfinders Dädalus. Obwohl die Tanzbühne natürlich nicht als seine berühmteste Schöpfung in die Geschichte eingehen würde.
Ich hatte zugesehen, wie er sie gebaut hatte; ein übereifriges Mädchen, das sich voller Ungeduld hinter ihm herumdrückte und gespannt darauf wartete, dass sie endlich fertig wurde, ohne zu ahnen, dass es einem Erfinder bei der Arbeit zuschaute, dessen Ruhm sich in ganz Griechenland verbreitete. Vielleicht sogar auf der ganzen Welt, auch wenn ich darüber nicht allzu viel wusste. Genau genommen wusste ich so gut wie nichts über das, was außerhalb der Palastmauern lag. Obwohl seitdem viele Jahre vergangen sind, sehe ich Dädalus in meiner Erinnerung als jungen Mann vor mir, erfüllt von der Energie und dem Feuer seiner Kreativität. Während ich ihm bei der Arbeit zuschaute, erzählte er mir, wie er sein Handwerk erlernt hatte, indem er von Ort zu Ort zog, bis seine außergewöhnlichen Talente die Aufmerksamkeit meines Vaters erregten, der dafür sorgte, dass es sich für ihn lohnte, an einem Ort zu bleiben. Dädalus war, wie mir schien, schon überall auf der Welt gewesen, und ich hing an seinen Lippen, wenn er die sengenden Sandwüsten Ägyptens und scheinbar unendlich weit entfernte Königreiche wie Illyrien oder Nubien beschrieb. Ich sah Schiffe, deren Masten und Segel unter Dädalus’ kundiger Anleitung konstruiert worden waren, in See stechen und malte mir aus, wie es sein würde, in einem davon über das Meer zu fahren, zu spüren, wie die Bretter unter den Füßen knarzten, während die Wellen gegen den Schiffsrumpf brandeten.
Unser Palast war voll von den Kreationen des Dädalus. Die Statuen, die er schuf, wirkten so lebensecht, dass sie mit Ketten an der Wand befestigt wurden, damit sie nicht davonmarschierten. Seine exquisiten langen Goldketten zierten den Hals und die Handgelenke meiner Mutter. Als er meine begehrlichen Blicke bemerkte, schenkte er mir meine eigene Kette mit einem kleinen Anhänger – zwei Bienen, die eine Honigwabe einrahmen. Er bestand ganz aus poliertem Gold und glänzte so prächtig in der Sonne, dass ich glaubte, die winzigen Honigtropfen würden in der Hitze schmelzen.
»Für dich, Ariadne.« Er sprach immer ernst mit mir, was mir gefiel.
In seiner Gegenwart kam ich mir nie vor wie ein lästiges Kind, eine Tochter, die nie eine Flotte befehligen oder ein Königreich erobern würde und deshalb für Minos von wenig Interesse war. Falls Dädalus mich nur bei Laune hielt, merkte ich es nicht, denn ich hatte immer das Gefühl, dass wir uns auf Augenhöhe begegneten.
Ehrfürchtig nahm ich den Anhänger entgegen, drehte ihn in den Händen und bestaunte seine Schönheit. »Warum Bienen?«, fragte ich ihn.
Er zuckte lächelnd die Schultern. »Warum nicht?«, fragte er zurück. »Die Götter lieben Bienen. Als Zeus noch ein Kleinkind war, fütterten ihn Bienen in seinem Höhlenversteck mit Honig, bis er stark genug war, um die mächtigen Titanen zu besiegen. Bienen stellen den Honig her, mit dem Dionysos seinen Wein mischt, damit er süß und unwiderstehlich wird. Es heißt, dass sogar der monströse Zerberus, der die Unterwelt bewacht, mithilfe von Honigkuchen bezähmt werden kann! Wenn du diese Kette um den Hals trägst, kannst du jeden Willen dem deinen sanft unterwerfen.«
Ich brauchte ihn nicht zu fragen, wessen Willen es zu besänftigen galt. Ganz Kreta zitterte vor Minos’ unerbittlichem Urteil. Ich wusste, es würde mehr als ein paar Bienen brauchen, um ihn zu beeinflussen, trotzdem war ich bezaubert von dem Geschenk und legte es nie ab. Ich trug es voller Stolz, als wir der Hochzeitsfeier des Dädalus beiwohnten. Mein Vater, der entzückt war, dass Dädalus sich mit einer Tochter Kretas vermählte, hielt ein üppiges Festmahl für ihn ab. Denn jedes weitere Band, das ihn mit diesem Ort verknüpfte, bedeutete, dass Minos weiterhin mit seinem brillanten Erfinder angeben konnte. Obwohl seine Frau bei der Geburt des gemeinsamen Kindes im Kindbett starb, als sie noch kein Jahr verheiratet waren, tröstete sich Dädalus mit seinem neugeborenen Sohn Ikarus, und ich liebte es, zuzusehen, wie er den Säugling in den Armen wiegte und ihm die Blumen, die Vögel und die vielen Wunder des Palastes zeigte. Meine jüngere Schwester Phädra tappte verzückt hinter ihnen her, und wenn ich es müde wurde, sie vor allen möglichen Gefahren zu beschützen, überließ ich sie der Obhut des Dädalus und schlich zurück zu meiner Tanzbühne.
Früher hatte auch meine Mutter Pasiphaë gern getanzt, und sie hatte es mir beigebracht. Sie hielt nichts von formellen Schrittfolgen, stattdessen vermachte sie mir ihre Gabe, freie Bewegungsabfolgen in fließende, geschmeidige Formen zu bringen. Ich sah zu, wie sie sich der Musik hingab, in eine Art anmutige Raserei verfiel, und folgte ihrem Vorbild. Sie machte für mich ein Spiel daraus, rief mir die Namen von Sternbildern zu, die ich mit den Füßen auf dem Boden nachzeichnen sollte; Konstellationen, aus denen sie sowohl Tänze als auch Geschichten spann. »Orion!«, sagte sie, und ich hüpfte eifrig von einer Stelle zur nächsten, um die Lichtpunkte anzudeuten, die den todgeweihten Jäger am Himmel abbildeten. »Artemis hat ihn dorthin versetzt, damit sie ihn jede Nacht anschauen kann«, vertraute sie mir an, als wir uns danach auf den Boden sinken ließen, um zu verschnaufen.
»Artemis ist eine jungfräuliche Göttin, die ihre Keuschheit erbittert verteidigt«, hatte sie mir erklärt. »Doch Orion, ein sterblicher Mann, war ihr Lieblingsjagdgefährte, denn er war ihr an Geschicklichkeit fast ebenbürtig.« Eine heikle Situation für einen Sterblichen. Götter mochten die Talente der Menschen für die Jagd, die Musik oder die Webkunst schätzen, hielten dabei jedoch immer nach Hybris Ausschau – und wehe dem Menschen, der die Götter zu überflügeln drohte. Unsterbliche konnten es nicht ertragen, von irgendjemandem übertroffen zu werden.
»Getrieben vom Ehrgeiz, mit Artemis’ verblüffendem Jagdgeschick mitzuhalten, versuchte Orion verzweifelt, sie zu beeindrucken«, fuhr meine Mutter fort. Sie sah zu Phädra und Ikarus hinüber, die am Rande der Holzbühne spielten. Sie waren unzertrennlich. Phädra war begeistert, die Ältere von beiden zu sein und endlich jemanden zu haben, dem sie Befehle erteilen konnte. Nachdem Pasiphaë sich vergewissert hatte, dass sie ganz in ihr Spiel vertieft waren und uns nicht belauschten, erzählte sie weiter. »Vielleicht hoffte er auch, sie trotz ihres Keuschheitsgelübdes für sich zu gewinnen, wenn er genug Tiere erlegte, um ihre Bewunderung zu erlangen. Und so kamen die beiden hierher nach Kreta, um eine große Jagd zu veranstalten. Tag für Tag schlachteten sie die Tiere der Insel ab, bis ihre Beute sich als Zeugnis für ihr Jagdglück bis zum Himmel auftürmte. Doch als ihr Blut die Erde tränkte, erwachte Gaia, die Mutter aller lebenden Wesen, aus friedlichen Träumen. Sie war entsetzt über das Massaker, das Orion Seite an Seite mit der angebeteten Göttin anrichtete. Gaia fürchtete, er werde alles Leben auslöschen, wie er sich in seinem Blutrausch vor Artemis brüstete. Und so rief sie eine ihrer Kreaturen zu sich, die in einer unterirdischen Höhle hauste: einen gigantischen Skorpion, den sie dem Prahlsüchtigen auf den Hals hetzte. Ein solches Ungetüm hatte die Welt noch nicht gesehen. Sein Panzer glänzte wie polierter Obsidian. Seine riesigen Zangen waren so groß wie zwei ausgewachsene Männer, sein schrecklicher stachelbewehrter Schwanz ragte bis in den wolkenlosen Himmel auf, verdunkelte selbst das Licht des Helios und warf einen gewaltigen Schatten.«
Bei dieser Beschreibung der legendären Bestie lief es mir kalt den Rücken hinunter, und ich kniff die Augen zu, als würde sie gleich vor mir auftauchen, unvorstellbar scheußlich und grausam.
»Doch Orion hatte keine Angst«, fuhr Pasiphaë fort. »Oder zumindest zeigte er sie nicht. Aber er war dem Skorpion in keiner Hinsicht gewachsen, und Artemis mischte sich nicht ein, um ihn den mächtigen Zangen der Kreatur zu entreißen …« An dieser Stelle legte sie eine Kunstpause ein, die eine beredtere Beschreibung von Orions mitleiderregendem Kampf lieferte, als ihre Worte es vermocht hätten. Nachdem ich mir ausgemalt hatte, wie das Leben aus ihm wich, seine menschliche Schwäche enthüllt wurde und er schließlich seinen Verletzungen erlag, erschöpft von dem Versuch, es in seiner sterblichen Hülle den Göttern gleichtun zu wollen, fuhr sie fort: »Und Artemis trauerte um ihren Jagdgefährten, sammelte seine sterblichen Überreste ein, die über ganz Kreta verstreut lagen, und versetzte sie an den Himmel, wo sie noch heute in der Dunkelheit leuchten und sie ihn jede Nacht betrachten kann, wenn sie mit ihrem silbernen Bogen zur Jagd aufbricht, allein und unangefochten in ihrer Überlegenheit und Keuschheit.«
Es gab unzählige solcher Geschichten. Es schien, als wäre der Nachthimmel mit Sterblichen gespickt, die den Göttern begegnet waren und nun als leuchtendes Exempel für die Welt dienten, wozu Unsterbliche fähig waren. Damals stürzte meine Mutter sich noch mit ebenso selbstvergessener Hingabe in ihre Geschichten wie in ihren Tanz, bevor ihre unschuldigen Vergnügungen als Beweis für ihre Zügellosigkeit gegen sie verwendet wurden. Zu dieser Zeit versuchte allerdings noch niemand, sie als unweiblich zu brandmarken oder ihr lüsterne, unnatürliche Gefühle zu unterstellen, darum tanzte sie völlig ungezwungen mit mir, während Phädra mit Ikarus spielte. Das einzige Urteil, das wir damals zu fürchten hatten, war das meines gefühllosen Vaters. Doch gemeinsam konnten wir uns im Tanz von unseren Ängsten befreien.
Als junge Frau jedoch tanzte ich allein. Das Geräusch meiner Schritte auf dem glänzenden Holzboden bildete den wirbelnden Trommelrhythmus, in dem ich mich verlieren konnte, der mich ganz in seinen Bann riss. Selbst ohne Musik konnte er das ferne Klappern der Hufe tief unter der Erde dämpfen, im Herzen jener Konstruktion, die Dädalus endgültig zu unsterblichem Ruhm verhalf. Und ich reckte die Arme zum Himmel empor und vergaß für die Dauer des Tanzes das Grauen, das unter uns wohnte.
Das führt mich zu einer weiteren Geschichte, die Minos allerdings nur ungern erzählte. Als junger Mann versuchte er verzweifelt, sich unter seinen drei rivalisierenden Brüdern im Kampf um die Königswürde hervorzutun. Und so betete er zu Poseidon, ihm als Zeichen seiner göttlichen Gnade einen prächtigen Stier zu senden, und schwor, er werde das Tier zu Ehren Poseidons opfern, wodurch er in einem Zug Poseidons Gunst und die Königswürde zu erlangen hoffte.
Poseidon schickte ihm den Stier als Bestätigung seines Anrechts, über Kreta zu herrschen, doch das Tier war von so vollkommener Schönheit, dass mein Vater glaubte, er könne den Gott überlisten, indem er ein anderes, minderwertiges Tier opferte und den kretischen Stier für sich behielt. Erzürnt über seinen Ungehorsam, sann der Gott des Meeres auf Rache.
Meine Mutter Pasiphaë ist die Tochter des Sonnengottes Helios. Anders als mein Großvater, der wie eine gleißend helle Flamme leuchtet, umgab sie nur ein leichter goldener Schimmer. Ich erinnere mich an das weiche Strahlen ihrer bronzefarbenen Augen, die Sommerwärme ihrer Umarmung und den Sonnenschein ihres Lächelns. Das war in meiner Kindheit, als sie mich noch ansah und nicht durch mich hindurch. Bevor sie den Preis für den Verrat ihres Mannes bezahlte.
Von Salz und Seepocken übersät, erhob sich Poseidon aus den Tiefen des Meeres in einer Woge aus Gischt und Zorn. Seine Rache richtete sich nicht direkt gegen Minos, jenen Mann, der ihn verraten hatte, sondern gegen meine Mutter, die Königin von Kreta, die er in wahnsinniger Leidenschaft zu dem Stier entbrennen ließ. Von animalischer Lust getrieben, machte ihre Begierde sie hinterhältig und gerissen, und so überredete sie den nichtsahnenden Dädalus, eine Kuh aus Holz zu fertigen, die so lebensecht wirkte, dass der Stier sich täuschen ließ und mit ihr auch die verrückte Königin bestieg, die sich darin verbarg.
Diese Vereinigung war ein verbotenes Thema des Klatsches auf Kreta, doch Gerüchte darüber verbreiteten sich überall wie ein bösartiger Pesthauch und erreichten auch mein Ohr. Ein gefundenes Fressen für missgünstige Adelige, schadenfrohe Händler, verdrießliche Diener, boshafte Frauen, die sich fasziniert ihrem morbiden Entsetzen hingaben, oder lüsterne junge Männer, die sich an dem schlüpfrigen Irrsinn ergötzten – ihr Flüstern und Wispern, ihr abfälliges Zischen und ihr höhnisches Kichern drang bis in alle Winkel des Palastes vor. Poseidon hatte sein Ziel mit tödlicher Präzision getroffen. Minos zu verschonen und stattdessen seine Frau auf eine so groteske Weise zu erniedrigen, demütigte auch ihren Mann – gehörnt von einem primitiven Tier, verheiratet mit einer Frau, die von unnatürlichem Verlangen in den Wahnsinn getrieben wurde.
Pasiphaë war wunderschön, und ihre göttliche Herkunft machte sie zu einer glorreichen Trophäe, die Minos mit der Hochzeit erwarb. Ihr zartes, kultiviertes, liebliches Wesen war sein ganzer Stolz, was ihre Schande für Poseidon umso köstlicher machte. Wenn man etwas hat, auf das man sehr stolz ist und das einen über all seine Mitmenschen erhebt, bereitet es den Göttern anscheinend besonders viel Freude, es zu zerstören, dachte ich eines Morgens, nicht lange nach Pasiphaës Frevel. Als ich das seidige blonde Haar meiner kleinen Schwester kämmte, das wir beide von unserer Mutter geerbt hatten, brach ich in Tränen aus, denn ihre goldenen Strähnen kamen mir in jenem Moment vor wie eine einzige gefährliche Verlockung für jene göttlichen Kolosse, die im Himmel lebten und unsere armseligen Schätze und Triumphe mit einem Schnippen ihrer unsterblichen Finger zu Staub zerfallen lassen konnten.
Meine Dienerin Eirene fand mich schluchzend über das Haar der bestürzten Phädra gebeugt. »Ariadne«, sagte sie. »Was ist los?«
Sie dachte zweifellos, ich würde über die Schande meiner Mutter weinen, aber mit kindlicher Selbstbezogenheit war ich eher um mich selbst besorgt. »Was, wenn die Götter …«, stammelte ich unter Tränen. »Was, wenn sie mir meine Haare nehmen und ich nur noch ein hässlicher Kahlkopf bin?«
Wenn Eirene ein Lächeln unterdrücken musste, ließ sie es mich nicht merken. Sie schob mich sanft beiseite und nahm selbst den Kamm in die Hand. »Und warum sollten sie so etwas tun?«
»Weil Vater sie wieder wütend macht!«, rief ich. »Vielleicht nehmen sie mir die Haare, um mit einer hässlichen Tochter Schande über ihn zu bringen.«
Phädra rümpfte die Nase. »Prinzessinnen haben keine Glatzen«, sagte sie bestimmt.
Und eine kahlköpfige Prinzessin wäre nutzlos. Minos hatte immer von der Ehe gesprochen, die ich eines Tages eingehen würde; eine ruhmreiche Vereinigung, die Kreta große Ehre einbringen würde. Er hätte nicht so laut damit angeben sollen. Die schleichende Erkenntnis überlief mich wie ein eisiger Schauer. Wie sollte ich mich gegen seine Verfehlungen wappnen? Wenn er die Götter erzürnte und sie seine Frau bestraften, warum nicht auch seine Tochter?
Damals wusste ich noch nicht, dass ich auf eine grundlegende Wahrheit des Frauseins gestoßen war: Ganz gleich, wie tadellos unser Leben war, die Leidenschaften und Begierden der Männer konnten uns jederzeit in den Ruin stürzen, ohne dass wir etwas dagegen zu unternehmen vermochten.
Das konnte auch Eirene nicht leugnen. Und so erzählte sie uns eine Geschichte: Perseus, ein tapferer Held, den Zeus in Form eines Goldregens mit der wunderschönen Danaë gezeugt hatte, wuchs zu einem würdigen Sohn seines mächtigen Vaters heran, und wie alle Helden besiegte auch er ein schreckliches Ungeheuer und befreite die Welt von seiner Grausamkeit. Wir kannten die Geschichte, wie er der Gorgone Medusa den Kopf abgeschlagen hatte, und hatten gebannt der Schilderung gelauscht, wie die Schlangen auf ihrem Kopf sich wanden, zischten und nach ihm schnappten, als er sein magisches Schwert schwang. Die Nachricht dieser Heldentat hatte erst vor Kurzem unseren Hof erreicht, und wir hatten alle über seinen Mut gestaunt und uns schaudernd seinen Schild vorgestellt, auf dem jetzt das schreckliche Haupt der Gorgone prangte, das jeden, der es ansah, sofort zu Stein erstarren ließ.
Doch heute erzählte uns Eirene nicht von Perseus, sondern von Medusa und wie sie zu ihrer Schlangenkrone gekommen war. Es war eine Geschichte, wie ich sie letzthin erwartete. Meine Welt war nicht länger eine der tapferen Helden; nach und nach erfuhr ich vom Schmerz der Frauen, der die Geschichten über ihre Großtaten unausgesprochen überlagerte.
»Medusa war einst wunderschön«, erzählte uns Eirene. Sie hatte den Kamm beiseitegelegt, und Phädra war auf ihren Schoß geklettert. »Meine Mutter hat sie einmal gesehen, bei einem großen Fest zu Ehren der Athene, zwar nur aus der Ferne, aber sie hat Medusa an ihrem herrlichen Haar erkannt. Es glänzte in der Sonne wie ein Fluss. Sie wuchs zu einer atemberaubend schönen jungen Frau heran, schwor jedoch, keusch zu bleiben, und lachte die Freier aus, die sie um ihre Hand baten …« Eirene schwieg, als würde sie ihre Worte sorgfältig abwägen. Aus gutem Grund, denn sie wusste, dass das keine geeignete Geschichte für kleine Prinzessinnen war. Trotzdem erzählte sie weiter. »Im Tempel der Athene traf sie auf einen Freier, den sie nicht verspotten oder abweisen konnte. Der mächtige Poseidon wollte das schöne Mädchen für sich und ließ sich von ihrem Flehen und ihren Schreien nicht davon abhalten, den heiligen Ort zu entweihen, in dem sie sich befanden.« Sie holte tief Luft.
Meine Tränen waren versiegt, und ich hörte gebannt zu. Ich kannte Medusa nur als Ungeheuer. Nie hätte ich gedacht, dass sie noch etwas anderes sein könnte. In den Erzählungen über Perseus gab es keinen Platz für eine Medusa mit einer eigenen Geschichte.
»Athene war erzürnt«, fuhr Eirene fort. »Als jungfräuliche Göttin konnte sie ein so dreistes Verbrechen in ihrem Tempel nicht dulden. Sie musste das Mädchen bestrafen, das schamlos genug war, sich von Poseidon überwältigen zu lassen und Athene mit dem Anblick ihres Verderbens grob zu beleidigen.«
Und so musste Medusa für Poseidons Tat büßen. Das ergab keinen Sinn; ich legte den Kopf schief und versuchte es mit den Augen der Götter zu sehen. Die verschiedenen Teile des Bildes glitten an ihren Platz: ein schrecklicher Anblick aus der Sicht eines Sterblichen, wie die Schönheit des Spinnennetzes, das der Fliege grässlich erscheinen muss.
»Athene berührte Medusas Haar und ersetzte es durch lebendige Schlangen. Sie nahm ihr ihre Schönheit und machte ihr Gesicht so hässlich, dass es jeden, der sie ansah, in Stein verwandelte. Und so wütete Medusa, wohin sie auch ging, und hinterließ Steinstatuen, deren Gesichter für immer in Grimassen des Schreckens erstarrt waren. So leidenschaftlich Männer sie früher umworben hatten, so sehr fürchteten sie sie jetzt und flohen vor ihr. Sie rächte sich hundertfach, ehe Perseus sie enthauptete.«
Ich brach mein entsetztes Schweigen. »Warum erzählst du uns diese Geschichte, Eirene?«
Sie strich mir über die Haare, ihr Blick war in die Ferne gerichtet. »Ich finde, es ist an der Zeit, dass ihr andere Dinge erfahrt«, erwiderte sie.
In den folgenden Tagen stießen mich meine Gedanken immer wieder auf diese Geschichte. Wie wenn bei einem Biss in einen weichen Pfirsich die Zunge den Stein berührt: der plötzliche, unerwartete harte Kern in der Mitte von allem. Ich kam nicht umhin, die Parallelen zwischen Medusa und Pasiphaë zu bemerken. Beide mussten den Preis für die Vergehen anderer bezahlen. Aber Pasiphaë schrumpfte mit jedem Tag, während ihr Leib immer mehr anschwoll, unnatürlich geformt wie das Kind darin. Sie sah nicht mehr auf, sprach nicht mehr. Sie war keine Medusa, trug ihr Leid nicht wie eine Krone aus Schlangen auf dem Kopf, die sich zischend und wütend aufbäumten, sondern zog sich in sich zurück. Meine Mutter war nicht mehr als eine dünne durchscheinende Muschelschale am Strand, die von der Brandung zu Sand zermalmt wurde.
Wenn es so weit war, würde ich wie Medusa sein, beschloss ich. Sollten die Götter mich eines Tages für die Taten eines Mannes zur Verantwortung ziehen, würde ich mich nicht verstecken wie Pasiphaë. Ich würde die Schlangenkrone tragen, und die Welt würde vor mir fliehen.
2
Asterion, mein schrecklicher Bruder, kam in meinem zehnten Lebensjahr auf die Welt, kurz nachdem Eirene mir die Geschichte von Medusa erzählt hatte. Nach der Geburt meines Bruders Deukalion und meiner Schwester Phädra hatte ich geholfen, mich um meine Mutter zu kümmern, und so glaubte ich auch diesmal zu wissen, was mich erwartete. Doch bei Asterion war alles anders. Pasiphaës ganzer Körper war von der Tortur gezeichnet. Das göttliche Blut des Helios erhielt sie während der Geburt am Leben, doch es bewahrte sie nicht vor dem Schmerz. Ein Schmerz, dessen Ausmaß ich mir nicht vorzustellen wagte, obwohl ich nachts nicht verhindern konnte, dass meine Erinnerungen sich dorthin verirrten. Die scharfkantigen Hufe, die knospenden Hörner auf seinem missgebildeten Kopf, seine strampelnden Gliedmaßen – ich schauderte, wenn ich daran dachte, wie er sich einen Weg aus meiner Mutter, diesem fragilen Sonnenstrahl, gebahnt hatte. Die Feuerprobe des Schmerzes zerriss die sanfte Pasiphaë, und meine schon damals abwesende Mutter kehrte nie wieder ganz zurück.
Ich erwartete, es zu hassen und zu fürchten, dieses Monstrum, dessen Existenz eine Verirrung der Natur war. Ich schlich in den Raum, aus dem mir erschütterte Geburtshelferinnen entgegentaumelten, atmete den Geruch von frisch geschlachtetem Fleisch ein, und mich überkam ein solches Grauen, dass ich fast umgekehrt wäre.
Doch meine Mutter saß, wie nach den beiden anderen Geburten, am Fenster, vom leichten Schimmer der Erschöpfung umgeben. Und obwohl ihre Augen glasig blickten und ihr Gesicht von den Verheerungen der Geburt gezeichnet war, wiegte sie ein eingewickeltes Bündel in den Armen, die Nase sanft auf den Kopf des Neugeborenen gedrückt. Es schniefte, und als ich langsam näher trat, öffnete es eins seiner dunklen Augen und sah mich an. Mir fiel auf, dass es von einem dunklen Wimpernkranz umgeben war. Ein pummeliger Finger zuckte gegen die Brust meiner Mutter; fünf winzige, vollkommene, rosige Fingernägel an jedem Finger. Noch konnte ich nicht sehen, was sich unter der Decke verbarg: weiche rosige Babybeine, die an den Knöcheln in dunkles Fell und steinharte Hufe übergingen.
Das Baby war ein Ungeheuer, die Mutter nur noch ein Schatten ihrer selbst, doch ich war ein Kind und fühlte mich von den flüchtigen Funken der Zärtlichkeit im Raum angezogen. Zaghaft bat ich, einen Finger ausgestreckt, stumm um Erlaubnis und suchte im Blick meiner Mutter nach einem Zeichen des Wiedererkennens. Sie nickte zustimmend.
Ich trat noch einen Schritt vor. Der Atem stockte mir. Das dunkle, runde Auge blickte mich immer noch unverwandt an.
Ich erwiderte seinen Blick und strich mit dem Finger über das glatte Fell auf seiner Stirn, unter der Wulst der steinharten Hörner an seinen Schläfen. Ich ließ ihn sanft über die weiche Stelle zwischen seinen Augen gleiten. Mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung öffnete es den Mund, und sein warmer Atem streifte mein Gesicht. Ich sah zu meiner Mutter auf, doch ihr Blick, der auf uns ruhte, war leer.
Als meine Mutter das Schweigen brach, zuckte ich zusammen. Ihre krächzende Stimme klang wie die einer Fremden. »Er heißt Asterion«, sagte sie zu mir. »Das bedeutet Stern.«
Asterion. Ein weit entferntes Licht in unendlicher Dunkelheit. Ein zerstörerisches Feuer, wenn man ihm zu nahe kam. Ein Leitstern, der meine Familie auf den Weg der Unsterblichkeit führen sollte. Eine göttliche Rache an uns allen. Ich wusste noch nicht, was aus ihm werden würde. Aber meine Mutter wiegte ihn, stillte ihn, gab ihm einen Namen, und er erkannte uns. Er war noch nicht der Minotaurus. Er war nur ein kleines Kind. Und er war mein Bruder.
Phädra wollte nichts von ihm wissen. Sie steckte sich die Finger in die Ohren, wenn ich ihr von ihm erzählte: wie schnell er wuchs, wie kurz nach der Geburt er zu laufen versuchte, wie seine Hufe unter ihm wegrutschten, wie die Unwucht seines schweren Kopfes ihn nach vorn zog, sodass er immer wieder hinfiel, es jedoch entschlossen weiter probierte. Ganz besonders wollte sie nichts davon hören, wie wir ihn fütterten, seit er sich nur wenige Wochen nach der Geburt von der Mutterbrust abgewandt und geweigert hatte, Milch zu trinken, und wie Pasiphaë, immer noch grimmig und stumm, ihm blutiges Fleisch hinlegte, er es gierig verschlang und danach seinen glatten Kopf an uns rieb. Diese Details ersparte ich Phädra.
Deukalion wollte ihn ebenfalls sehen, aber ich merkte, dass, obwohl er das Kinn in Nachahmung der männlichen Entschlossenheit unseres Vaters vorstreckte und ein paar kühle Worte des Interesses hinwarf, er bis ins Innerste erschüttert war.
Minos kam nicht einmal in seine Nähe.
Also war ich außer Pasiphaë die Einzige, die sich um Asterion kümmerte. Ich verschwendete keinen Gedanken an die Zukunft, worauf sollten wir ihn auch vorbereiten? Ich hoffte und glaube, den Menschen in ihm zu stärken. Womöglich ging meine Mutter nicht einmal so weit, vielleicht wurde sie damals einfach nur vom Mutterinstinkt angetrieben. Ich konzentrierte mich ganz auf das Hier und Jetzt: ihm das Aufrechtgehen beizubringen, ein paar grundlegende Tischmanieren, wie man sanft auf gesprochene Worte und Berührungen reagierte. Und zu welchem Zweck? Glaubte ich wirklich, er würde eines Tages halbwegs zivilisiert sein, steif über den Hof staksen und zur Begrüßung der versammelten Adeligen den großen Stierkopf neigen? Ein kretischer Prinz, geachtet und respektiert? Sicher war ich nicht so dumm, davon zu träumen. Vielleicht hoffte ich auch, unsere Bemühungen würden Poseidon so sehr beeindrucken, dass er seine göttliche Schöpfung bewunderte und ihr seine Gunst schenkte.
Aber vielleicht ist genau das passiert. Denn ich hatte nicht bedacht, was die Götter wirklich schätzen. Poseidon hätte kein Interesse an einem stolpernden Stiermenschen, einer taumelnden Fassade von Menschlichkeit und Würde gehabt. Die Götter liebten Grausamkeit, Gewalt und Angst. Immer Angst, die scharfe, nackte Angst im Rauch, der von den Altären aufstieg, im schrillen Unterton der Gebete und Lobgesänge, die wir himmelwärts sandten, ihr beißender, urtümlicher Geruch, wenn wir das Messer über dem Hals des Opfertiers hoben.
Unsere Angst. Sie machte die Götter groß. Und gegen Ende seines ersten Lebensjahres wurde mein Bruder rasch zum Inbegriff des Schreckens. Die Sklaven wagten sich nicht einmal unter Androhung des Todes in seine Nähe. Wenn ich seine gierigen Schreie bei der Fütterung hörte, liefen mir Schauer über den Rücken. Er gab sich nicht länger mit rohen Fleischstücken zufrieden – darauf reagierte er mit einem tiefen Grollen, bei dem mir das Blut in den Adern gefror. Pasiphaë brachte ihm die Ratten, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn sie sich kreischend in ihrem Griff wanden, bevor sie sie ihrem Sohn zum Fraß vorwarf. Er war entzückt über ihr panisches Hin-und-her-Flitzen im Stall, wo wir ihn mittlerweile hielten, stürzte sich begierig auf sie und riss sie bei lebendigem Leib in Stücke.
Er wuchs wesentlich schneller als ein menschliches Kind, und mir fielen die Muskeln auf, die sich schon jetzt an seinem Torso abzeichneten, wenn er die Ratten jagte. Seine Oberschenkel glänzten rosig unter dem dunklen Haar, seine Brust sah aus wie gemeißelt, wie die der Marmorstatuen, die die Palasthöfe säumten; der angespannte Bizeps, der schwere gehörnte Kopf und die blutverschmierte Schnauze.
Ich wäre eine Närrin gewesen, ihn nicht zu fürchten. Oder verrückt, wie Pasiphaë. Aber Furcht war nicht das Einzige, was ich ihm gegenüber empfand. Abscheu, sicher, und auch Ekel, wenn ich sah, wie er vor lauter Vorfreude über sein sich windendes Festmahl schnaubte, prustete und mit den Hufen scharrte, aber auch Mitleid, sodass mir manchmal der Atem stockte und die Tränen kamen, wenn er nach mehr Blut verlangte. Es ist nicht seine Schuld, dachte ich erbittert, er hat es sich nicht ausgesucht, so zu sein. Er war Poseidons grausame Rache, um einen Mann zu demütigen, der noch nicht einmal einen Blick auf ihn warf. Und so war es an Pasiphaë und mir, für ihn zu sorgen. Aber ganz gleich, wie groß mein Entsetzen war, es blieb immer mit Mitgefühl verquickt, sodass ich es nicht über mich brachte, es zu beenden, als es noch in meiner Hand lag. Ihn mit einem Ziegelstein zu erschlagen, während er fraß, ihm einen Speer in das verletzliche Fleisch seiner Flanke zu rammen – ich hätte es selbst als Mädchen tun können, als er noch klein war. Aber ich brachte es nicht über mich, und als ich schließlich erkannt hatte, was er war und wozu Minos ihn benutzen würde, überstieg es meine Kräfte.
Asterion wuchs und wuchs, und es wurde immer schwieriger, ihn im Zaum zu halten. Nach einigen Monaten konnte nur noch Pasiphaë den Stall betreten, der mit schweren Eisenstäben gesichert war. Obwohl ich nicht mehr hineinging, lungerte ich ängstlich in der Nähe herum, wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich hatte seit dem Tag seiner Geburt nicht mehr getanzt. Mit einem ängstlichen Knoten im Magen ging ich unablässig auf und ab; es gab keinen Teil meines Körpers, der nicht angespannt war. Ich wartete, sagte mir, ich wisse nicht, worauf. Dabei wusste ich es sehr wohl.
Eirene hätte sich nie von sich aus in die Nähe der Stallungen gewagt. Ich werde nie erfahren, warum sie ausgerechnet in jener Nacht diesen Weg zu ihrem Quartier einschlug, in der er wieder einmal den Kopf mit den imposanten Hörnern gegen die verschlossene Tür rammte, wie er es schon so viele Male getan hatte, ohne dass das Holz gesplittert war. Alle, die das Krachen hörten, zuckten zusammen und eilten weiter, doch wir hatten geglaubt, er sei sicher eingesperrt. Ich gestattete mir nicht, mir den Moment auszumalen, in dem er sich befreite; wie Eirene gerannt sein muss, obwohl sie keine Chance hatte. Mein Gesicht fühlte sich taub an, die Tränen blieben mir im Hals stecken, als ich die zerrissenen Stofffetzen aufsammelte, die – von einem rastlosen Wind getragen – auf dem Hof herumflatterten, als wir bei der zersplitterten Stalltür ankamen, die von den unglücklichen Stallburschen, die das Blutbad früh entdeckt hatten, hastig wieder verbarrikadiert worden war.
Phädra verbarg das Gesicht in meinen Röcken, und ich strich ihr übers Haar. »Schau nicht hin«, murmelte ich wie betäubt.
Ich erinnere mich an die aufgebrachten Blicke, die vorwurfsvoll auf uns ruhten, als wir uns umdrehten und die versammelte Dienerschaft sahen, die Zeuge der Szene war. Ich erinnere mich an die Lähmung, die mich inmitten dieses Halbkreises aus Anklägern überkam, und an das monotone Rumms, rumms, rumms der mörderischen Hörner meines Bruders gegen die notdürftig verstärkte Tür hinter uns.
Wie lange es andauerte, kann ich nicht sagen, aber das ohrenbetäubende Schweigen endete abrupt mit Minos’ Ankunft. Sein Seidenmantel raschelte, als er durch die Menge schritt, die sich in seinem Kielwasser zerstreute wie ein Fischschwarm vor einem Hai.
Neben mir verzog meine Mutter das Gesicht.
Doch es folgten keine Schläge, keine scharfen Worte. Als ich den Blick zu heben wagte, sah ich, dass sein Gesichtsausdruck friedlich war, keine dunklen Wolken, die auf einen Sturm am Horizont hindeuteten. Der Saum seines Gewandes wogte leicht im Wind, als sich ein Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete. »Geliebte Ehefrau!«, rief er.
Ich spürte, wie sie zusammenzuckte, obwohl ihr Blick leer und trüb war wie Rauchglas.
Jovial fuhr er fort: »Jeden Tag höre ich neue Berichte über die außergewöhnliche Kraft unseres Sohnes. Trotz seiner Jugend ist er bereits zu einem Prachtexemplar herangewachsen, und Geschichten über seine Stärke erfüllen die Herzen der Menschen aus nah und fern mit Ehrfurcht und Respekt.« Er deutete mit dem Kopf anerkennend auf die blutbefleckten Kleiderfetzen und den Verschlag, aus dem immer noch das Wummern zu hören war.
Unser Sohn? Seine Worte verblüfften mich. Ungläubig erkannte ich, dass er vor Stolz auf das Monstrum strahlte. Stolz auf den Ruf, den es ihm verschafft hatte. Statt dem gehörnten Ehemann nichts als Spott einzubringen, hatte Poseidon Minos eine furchterregende Waffe geliefert, einen göttlichen Unhold, der, wie Minos erkannt hatte, seinen Status noch weiter festigen würde.
»Er braucht einen Namen«, verkündete Minos. Ich öffnete nicht den Mund, um ihm zu sagen, dass er Asterion hieß. Was kümmerte es Minos, wie Pasiphaë und ich ihn genannt hatten?
Minos näherte sich dem Verschlag, und beim Geräusch seiner Schritte wurde das Rumpeln darin noch lauter, noch hektischer, als ob die Erregung meinen Bruder zu überwältigen drohte. Minos legte die Hand auf die Tür, die unter seiner Hand erzitterte, und sein Lächeln wurde noch breiter. »Er soll Minotaurus heißen«, verkündete er und nahm meinen Bruder dadurch in Besitz. »Ein Name, wie er sich für eine solche Bestie geziemt.«
Und so wurde Asterion zum Minotaurus – von der ganz privaten Sternenkonstellation der Scham meiner Mutter zu einer Machtdemonstration meines Vaters für alle Welt. Ich begriff, warum er ihn Minotaurus genannt hatte; er gab diesem göttlichen Monster seinen eigenen Namen, verschaffte ihm einen legendären Status, den er für sich vereinnahmen konnte. Als immer deutlicher wurde, dass bald kein Stall der Welt den Minotaurus mehr würde zurückhalten können, zwang Minos Dädalus, sein bis dato beeindruckendstes und ehrgeizigstes Werk zu schaffen: ein gewaltiges Labyrinth unter der Palastanlage, ein Albtraum aus gewundenen Gängen, Sackgassen und spiralförmigen Abzweigungen, die alle unweigerlich wieder zurück ins dunkle Herz des Irrgartens führten. Dorthin, wo der Minotaurus lauerte.
Nun, da ihr Kind in ein dunkles, stinkendes Gewirr aus Tunneln verbannt worden war, in dem ihm nur das einsame Echo seines Gebrülls und die verrottenden Gebeine unter seinen Hufen Gesellschaft leisteten, entdeckte ich wieder Gefühle in Pasiphaës Gesicht. Ihr Antlitz, das früher vor Freude, Liebe und Lachen gestrahlt hatte, war jetzt von Bitterkeit und einem unterschwelligen, schwelenden Zorn überschattet.
Ich hatte meine Mutter an jenem Tag verloren, als Poseidons Fluch sie auf die Weide hinaustrieb, wo sein heiliges Biest sie erwartete, doch ich ertappte mich dabei, dass ich sie immer noch ins Leben zurückzuholen versuchte, obwohl mir klar war, wie sinnlos das war. Ich bemühte mich, sie aus ihrem Gemach zu holen und wieder in die Welt hinauszuzerren, ganz gleich, wie oft sie mich abwies. Meist fand ich ihre Tür verriegelt vor, und obwohl ich wusste, dass meine Mutter nur wenige Fingerbreit von mir entfernt war, erhielt ich kein Anzeichen dafür, dass sie mein Klopfen hörte. Eines Tages jedoch gab die Tür unerwartet nach und öffnete sich so geräuschlos, wie es für die Werke des Dädalus typisch war.
Sie hörte mich nicht eintreten. Es war dunkel im Raum; das warme goldene Licht, von dem es hätte erfüllt sein müssen, wurde von schweren Vorhängen ausgesperrt. Ein scharfer Kräutergeruch brannte mir in den Augen. Desorientiert sah ich mich in der Finsternis nach meiner Mutter um.
Sie saß, reglos und stumm, auf dem Boden, wirkte lebloser als eine der Statuen des Dädalus. Durch die Haarsträhnen, die ihr wirr ins Gesicht fielen, konnte ich das Weiß ihrer Augen ausmachen.
»Mutter?«, flüsterte ich.
Sie verriet mit keiner Regung, dass sie mich gehört hatte. Die stickige Luft im Raum nahm mir den Atem, und ich taumelte zurück und tastete nach der Tür. Ich konnte das klaustrophobische Grauen, das mich überkam, nicht erklären, wusste nicht, was genau sich an dieser Szene so falsch anfühlte und warum sie mir trotz der drückenden Hitze das Blut in den Adern gefrieren ließ. Alles, was ich wusste, war, dass ich hier rausmusste, zurück an die frische Luft, zurück zum Geruch von Lavendel, den summenden Bienen, zurück zu allem, was natürlich, rein und frisch war.
Als ich mich gerade abwenden wollte, bemerkte ich eine kleine Figur vor ihr auf dem Boden, die aus Wachs, vielleicht auch aus Lehm bestand, das ließ sich in der Dunkelheit nicht genau sagen. Ich war mir nicht einmal ganz sicher, dass sie menschlich war, so verstümmelt und verdreht waren ihre Gliedmaßen. Die Hand meiner Mutter verharrte schlaff ein paar Fingerbreit darüber, ein unbekanntes Schmuckstück baumelte von ihrem blassen Handgelenk – vermutlich ein beinernes Amulett, etwas, das ich sie noch nie hatte tragen sehen.
Ich hatte genug Schreckliches durchgemacht; nach der Geburt meines Bruders war mein Bedarf an Monströsem gedeckt, und ich hatte nicht den Wunsch, noch länger zu bleiben. Vielleicht waren es nur eine Puppe und ein Armband, nichts weiter. Ich drehte mich auf dem Absatz, und ging und fragte sie auch nie danach. Ich tat mein Bestes, den Vorfall zu vergessen, aber auf die Gedanken und Worte anderer Menschen hatte ich keinen Einfluss.
Eine Springflut der Gerüchte überschwemmte ganz Knossos. Eine göttliche Hexe, die Rache an ihrem Ehemann nahm, flüsterte man sich unter der Hand zu. Die Waschfrauen, die am Fluss schmutziges Leinen wuschen, die Händler, die sich auf dem Markt trafen, die kichernden Mägde im Palast und selbst die feixenden Adeligen, die in unserer großen Halle Wein aus Bronzeschalen tranken, amüsierten sich alle köstlich über die Geschichten, die man sich über die Mädchen erzählte, die Minos in sein Bett holte. Im Moment seines größten Vergnügens begannen sie sich vor unerträglichen Schmerzen zu winden und starben schreiend vor Qual einen grausamen Tod. Als ein Heiler, dessen Rat Minos gesucht hatte, eine ihrer Leichen aufschnitt, kroch ein Schwarm Skorpione aus ihrem Körper. Es hieß, Pasiphaë habe ihn verflucht, und niemand zweifelte daran, dass sie dazu fähig wäre. Ich konnte dem schlangengleichen Zischen, das überall in der Luft lag, nicht entkommen: Sie wollte ihn, den Stier, das Tier, ich wette, sie hat vor Wonne geschrien, und der Bastard, den sie gezeugt hat, ist genau so eine Missgeburt wie seine Mutter …
Die schrecklichen Worte quollen aus allen Ecken. Der Odem des verspritzten Giftes hing über unserer Familie, besudelte den polierten Marmor und das Gold des Palastes, beschmutzte die opulenten Wandteppiche, ließ die Milch sauer werden, verlieh dem Honig ein bitteres Aroma, verdarb, vergiftete und ruinierte alles, was wir anfassten. Deukalion, der Glückliche, wurde nach Lykien zu unserem Onkel geschickt, sodass er in der Obhut von Minos’ Bruder unter einem freundlicheren männlichen Einfluss aufwuchs. Phädra und ich waren als Töchter dazu verdammt, zu bleiben. Falls Dädalus sich danach sehnte, uns zu entfliehen, ließ mein Vater ihm keine Wahl mehr. Minos sperrte ihn und Ikarus in einem Turm ein, den sie nur unter der Aufsicht von Wachposten verlassen durften. Minos konnte es nicht riskieren, dass er die Geheimnisse seines Labyrinths anderen Königen enthüllte und ihnen Macht über ihn verlieh.
Ganz Kreta verabscheute uns. Die Menschen buhlten um unsere Gunst, während sie sich gleichzeitig über unsere widernatürlichen Perversionen das Maul zerrissen. Bei Hofe katzbuckelten sie vor Minos, doch obwohl sie unterwürfig die Köpfe senkten, warfen sie ihm verstohlen angewiderte Blicke zu. Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Sie wussten, wohin die Gefangenen von Kreta nun gebracht wurden; jeder, der sich etwas zuschulden kommen ließ, büßte für seine Vergehen in jenem gefürchteten Labyrinth, das unter dem Palast von Knossos ins Felsgestein gehauen worden war. Minos wusste um ihre Verachtung, doch er schwelgte in ihrer Angst, die ihm die Königswürde sicherte. Er trug ihren Hass wie eine Rüstung.
Ich dagegen tanzte, wob ein kompliziertes Muster auf dem Rund der Tanzbühne, trommelte mit den Füßen einen wilden, rasenden Rhythmus auf die polierten Dielen; die langen roten Bänder, die ich mir um die Handgelenke gebunden hatte, sausten zischend durch die Luft, verflochten sich ineinander, hoben und senkten sich im Takt meiner Schritte. Mein Tanz wurde schneller und schneller, das Trommeln meiner Füße lauter und lauter, bis es das hämische Lachen, das ich ständig hinter meinem Rücken zu vernehmen glaubte, das Schnauben der Kreatur und die flehentlichen Schreie jener Unglücklichen übertönte, die man gezwungen hatte, durch das eisenbeschlagene Tor zu treten, über dem die Labrys prangte. Ich tanzte und tanzte, und der glühende Zorn in meinem Blut steigerte sich zur Raserei, trieb mich an, bis ich – keuchend und hoffnungslos in scharlachrote Bänder verwickelt – im Zentrum des Tanzbodens zusammenbrach.
Zeit verging. Mein ältester Bruder Androgeos, der viele Jahre fort gewesen war, um seine athletischen Fähigkeiten zu vervollkommnen, stattete uns einen kurzen Besuch ab. Zweifellos entsetzt über das, was er zu Hause sah, flüchtete er zu den Panathenäen, wo er alle Wettbewerbe gewann und dafür mit einem einsamen Tod auf einem athenischen Hügel belohnt wurde. Mein Vater segelte ohne echte Trauer im Herzen los, um Athen den Krieg zu erklären, alles in Schutt und Asche zu legen und Tod und Verzweiflung zurückzulassen. Unter den zahllosen Toten befand sich auch jenes Mädchen, das ihn geliebt hatte und dem er zum Dank dafür ein wässriges Grab beschert hatte.
Nichtsdestotrotz brachte er gute Neuigkeiten für die Einwohner Kretas mit nach Hause: Von nun an würden die Missetäter unter ihnen nicht mehr dem Hunger des Minotaurus zum Opfer fallen, denn Minos hatte sich Athen untertan gemacht und zwang die Stadt, ihm jedes Jahr vierzehn ihrer Kinder zu überlassen, die als Sühne für das Leben meines ältesten Bruders meinem jüngsten Bruder zum Fraß vorgeworfen wurden.
Ich wagte nicht, an die sieben Jünglinge und sieben jungen Frauen zu denken, die gefesselt auf einem Schiff mit schwarzen Segeln über das Meer fuhren. Ich mochte mir die Schrecken des Labyrinths nicht ausmalen; die stickige, nach Tod und Verzweiflung stinkende Luft, das Geräusch von menschlichem Fleisch, das von scharfen Zähnen in Stücke gerissen wird. Eine Opferung kam, dann noch eine; ich suchte den dunklen Himmel nach den Konstellationen ab, die die Formen der Sterblichen hatten, mit denen die Götter gespielt und die sie danach in hübschen Lichtern verewigt hatten.
Ich weigerte mich zu denken. Stattdessen tanzte ich.
3
Damals war ich achtzehn, ein junges Mädchen. Ich hatte ein behütetes Leben geführt, verborgen hinter Schleiern und hohen Mauern. Ich hatte Glück, dass mein Vater mich behielt wie einen Preis, der noch zu vergeben war, und dass er mich noch nicht gegen eine Allianz mit einem fremden Land eingetauscht und auf ein Schiff verfrachtet hatte, das mich in ferne Gefilde brachte, um seinen Einfluss zu vergrößern, verschachert wie ein Stück Vieh auf dem Markt. Doch all das sollte sich bald ändern.
Minos war für sein kaltblütiges Urteil bekannt. Ich hatte ihn nie toben sehen, nie erlebt, dass er von seinen Leidenschaften überwältigt wurde. Ebenso konnte ich mich nicht daran erinnern, ihn je lachen gehört zu haben. Es bestand keine Gefahr, dass Liebe oder Freundlichkeit seine Sicht trübten, wenn es darum ging, einen Mann für mich auszusuchen. Sein Vorteil allein würde den Ausschlag geben.
»Hoffentlich ist er nicht zu alt«, sagte Phädra eines Tages, als wir bei den Felsen aufs Meer hinausblickten. »So wie Rhadamanthys.« Sie rümpfte die Nase. Sie war damals dreizehn, glaubte jedoch, eine Expertin für alles und jeden zu sein; über die meisten machte sie sich lustig.
Gegen meinen Willen musste ich lachen. Rhadamanthys war einer der Ältesten von Kreta. Minos nahm von niemandem Ratschläge an, aber er erlaubte ehrwürdigen betagten Adeligen, bei kleineren Konflikten an seinem Hof Recht zu sprechen. Die Augen des Rhadamanthys waren immer noch scharf genug, und obwohl seine Hände mit der pergamentdünnen Haut zitterten, wenn er mit dem Finger auf die Missetäter zeigte, verstummten selbst die aufgebrachtesten Angeklagten aus Angst vor seinem Richterspruch.
Ich musste an seine schütteren Haare denken, seine wässrigen Augen und die knittrigen Hautfalten. Doch ich erinnerte mich auch, wie Amaltheia, die Frau des Bauern Yorgos, Rhadamanthys vor Gericht einmal darum gebeten hatte, ihren Mann wegen Grausamkeit zu verurteilen. Yorgos war polternd herumstolziert und hatte auf sein Recht gepocht, die Mitglieder seines Haushalts zu züchtigen, wie es ihm beliebte, während alle Zuschauer, empört über Amaltheias Anmaßung, beifällig nickten. Doch Rhadamanthys sah den aufgeblasenen Mann mit den beachtlichen Armmuskeln, der beim Reden die mächtigen Fäuste schwang, lange mit schmalen Augen an. Dann schaute er zu der zerbrechlichen, weinenden Frau hinüber, die die Arme um sich geschlungen hatte und auf deren Hals blaue Flecken erblühten wie Schatten von Blumen.
Schließlich sagte er: »Yorgos, wenn du einen Esel schlägst, wird er dadurch nicht stärker. Er wird keine schwereren Lasten tragen können, genau genommen wird er sogar schwächer. Und wenn du ihn füttern willst, weicht er ängstlich vor dir zurück und wird immer dünner. Wenn du ihm deine Waren aufladen willst, um sie zum Markt zu bringen, bricht er unter der Last zusammen, die er früher mit Leichtigkeit getragen hat. Er wird für dich nutzlos.«
Alle sahen, dass Yorgos genau zuhörte. Keiner der Appelle seiner Gattin an sein Mitgefühl und sein Erbarmen hatte ihn erweichen können, aber den Worten des Rhadamanthys lauschte er aufmerksam.
Rhadamanthys lehnte sich auf seinem hohen Stuhl zurück. »Diese Frau könnte dir Söhne gebären, die dir im Alter die Pflichten und die harte Arbeit auf dem Hof abnehmen können. Aber einen starken Sohn auszutragen, ist eine schwere Last für eine Frau, und wenn du sie weiter so behandelst, wird sie schwächer und schwächer werden und dir ein solches Geschenk nicht mehr machen können.«
Viele Frauen würde es nicht unbedingt mit Zuversicht erfüllen, wenn man sie mit einem Esel verglich, aber ich sah einen schwachen Hoffnungsschimmer in Amaltheias Augen aufglimmen. Yorgos druckste herum, während er über Rhadamanthys’ Worte nachdachte. »Ich versteh, was Ihr meint, Herr«, sagte er schließlich. »Ich werde über Eure Worte nachdenken.« Als er sich danach seiner Frau zuwandte, zerrte er sie nicht barsch mit sich, sondern hielt ihr den Arm hin, ein unbeholfener Versuch der Beflissenheit.
Ein enttäuschtes Murren erhob sich unter den Männern, die sich in der Hoffnung versammelt hatten, etwas Spektakuläres zu Gesicht zu bekommen. »Vielleicht gibt es Schlimmere als Rhadamanthys, obwohl er uralt ist«, sagte ich zu Phädra.
»Igitt!«, erwiderte sie und gab eine Reihe von angewiderten Geräuschen von sich.
»Wen erhoffst du dir denn?«, fragte ich lachend.
Sie seufzte und betrachtete die Adeligen, die unseren Hof besuchten. Sie legte die Ellbogen auf die niedrige Mauer vor uns, stützte das Kinn in die Hände und schaute über die Felsen. »Niemanden aus Kreta.«
Während sie aufs Meer hinausblickte, fragte ich mich, welches Schiff sie dort ins Auge fasste. Knossos hatte einen geschäftigen Hafen, Händler aus Mykene, Ägypten, Phönizien und von jenseits der Grenzen unserer Vorstellungskraft fuhren dort ein und aus. Neben den wettergegerbten Kapitänen und sonnenverbrannten Händlern, die in der grellen Mittagssonne blinzelten, kamen auch schmeichlerische Prinzen und glattzüngige Adelige, die in Seide gekleidet waren und auffällige Juwelen trugen. Man sah Ballen feinster Stoffe, Berge von glänzenden Oliven, Amphoren mit dem reichhaltigen Öl, das daraus gepresst wurde, überquellende Kornsäcke und scheuende Tiere, die von Deck geführt wurden, und wer wusste schon, ob einer der Reisenden nicht vorhatte, seine Reichtümer gegen eine Tochter von König Minos – und das Prestige einer ehrenwerten Blutlinie, gewürzt mit dem aufregenden Kitzel unserer Familienskandale – einzutauschen? Furcht und Faszination sowie die Aussicht, ein Stück von dieser Mischung aus Ruhm und Schrecken mit nach Hause zu nehmen und sich mit der dahinterstehenden Macht zu verbünden, lockten sie an Minos’ Hof. Aber falls irgendjemand trotz Phädras Jugend um ihre Hand angehalten hatte, musste Minos abgelehnt haben. Er konnte es sich erlauben, sich Zeit zu lassen und genau abzuwägen, welche Partie für ihn am vorteilhaftesten wäre.
»Stell dir das nur vor, Ariadne«, sagte sie und wandte mir das Gesicht zu. »Ein Schiff zu besteigen und einfach davonzusegeln. In einem Marmorpalast am anderen Ende der Welt zu leben, umgeben von Pracht und Reichtum.«
»Wir sind jetzt schon von Pracht und Reichtum umgeben«, wandte ich ein. »Welchen Luxus kannst du dir vorstellen, den wir nicht bereits besitzen?«
Sie senkte kurz den Blick. Aber ich wusste, was sie meinte. Den Luxus, in einem Palast zu leben, unter dem es nur Kornspeicher und Weinkeller gab. Den Luxus, ruhig einzuschlafen, ohne vom Echo eines hungrigen Brüllens tief unter der Erde aus dem Schlaf gerissen zu werden. Den Luxus eines Ortes, an dem der Boden nie unter dem Zorn einer eingesperrten Bestie erzitterte.
»Ich will nur fort von all den neugierigen Blicken«, sagte sie ungeduldig. »Fort von dem geschmacklosen Klatsch und den geschwätzigen Narren. Ich möchte eine Königin sein, die von ihren Untertanen respektiert wird, und mir nicht ständig Sorgen machen müssen, dass sich die Leute hinter meinem Rücken das Maul zerreißen, wenn ich einen Raum verlasse.« Ihr Gesichtsausdruck war hart, ihr Kinn trotzig vorgeschoben. Dann senkte sie wieder den Blick.
Als Säugling hatte sie sich beim kleinsten Anlass empört die Seele aus dem Leib gebrüllt. Sie hatte nie still sitzen können, war immer entschlossen gewesen, mir zu folgen, sobald sie unbeholfen über den Boden krabbeln konnte. Kaum dass sie sprechen konnte, schallte ihre hohe Stimme gebieterisch über die Flure. Pasiphaë lachte gutmütig über ihre forsche Jüngste, doch als Phädra fünf war und Poseidon seinen Stier schickte, starb ihre Kindheit einen plötzlichen Tod.
Jetzt legte ich den Arm um sie und spürte ihre dünnen Schulterknochen, zierlich wie die eines Vogels. Ich spürte, wie sie unter meiner Berührung erstarrte; dann entspannte sie sich. »Ich hoffe nur, dass es so weit weg ist wie möglich und dass wir zusammen gehen können.« Sie verschränkte die dünnen Finger mit meinen, die auf ihrem Arm lagen. »Gar nicht auszudenken, wenn du mich hier zurücklässt.«
Doch unsere Hoffnungen spielten keine Rolle. Als Minos mich an einem bewölkten Nachmittag zu sich rufen ließ, hatte ich den Verdacht, dass er eine vorteilhafte Partie für mich gefunden hatte. Und so war ich nicht völlig überrascht, als ich die große Halle betrat und einen unbekannten Mann vor dem karmesinroten Thron des Minos stehen sah.
An jenem Tag fiel trübes, graues Licht durch die Säulen des benachbarten Hofs, und der Mann stand im Schatten. Zögernd verharrte ich am Eingang, bemüht, durch den Schleier, der vor meinem Gesicht flatterte, etwas zu erkennen.
»Meine Tochter, Ariadne.« Minos’ Stimme klang blutleer.
Ich starrte auf den Boden. Auf den Fliesen zu meinen Füßen prangte die Abbildung eines galoppierenden Stiers, der mit wütenden schwarzen Augen einen springenden Mann fixierte, der sich vor ihm in der Luft drehte.
»Auf der Seite ihrer Mutter fließt das Blut des Sonnengottes durch ihre Adern, auf meiner das Blut des Zeus.«
»Höchst eindrucksvoll«, erwiderte der Mann. Er sprach anders als die Leute in Kreta, doch mein ungeübtes Ohr konnte seinen Akzent nicht einordnen. »Aber es ist nicht ihr Blut, das mich interessiert.« Er schritt über die Fliesen auf mich zu. »Darf ich Euer Gesicht sehen, Prinzessin?«
Ich hob den Blick und sah Minos an. Der neigte den Kopf. Mein Herz klopfte. Unbeholfen wollte ich den Schleier lösen, aber der Mann, der nicht an Blut interessiert war, kam mir zuvor und nahm ihn selbst ab. Abrupt zuckte ich zurück, als seine Hände meine Schläfe streiften, und ich erwartete halb, dass mein Vater ihn dafür zurechtweisen würde. Doch Minos lächelte nur.
»Ariadne, das ist Kinyras von Zypern«, sagte er.
Kinyras von Zypern war so nah an mich herangetreten, dass ich seinen Atem auf dem Gesicht spürte. Entschlossen hielt ich den Blick abgewendet, doch er hob mein Kinn an. Seine schwarzen Augen funkelten im trüben Licht. Dunkle Locken umrahmten sein Gesicht, und seine feucht glänzenden Lippen waren nur wenige Fingerbreit von meinen entfernt.
»Hocherfreut, Eure Bekanntschaft zu machen«, murmelte er.
Ich kämpfte gegen den Drang an, vor seinem übel riechenden Atem zurückzuweichen, meine Röcke anzuheben und davonzulaufen. Doch da Minos wohlwollend lächelte, blieb ich wie angewurzelt stehen und blickte nach vorn. Zu meiner Erleichterung trat Kinyras gleich darauf ein paar Schritte zurück.
»Sie ist genauso liebreizend, wie Ihr gesagt habt«, bemerkte er.
Ich hörte seine öligen Worte, spürte, wie sein Blick über meinen Körper wanderte, vernahm das feuchte Schmatzen, als er schluckte. Übelkeit stieg in mir auf.
»Natürlich«, sagte Minos knapp. »Du darfst jetzt gehen, Ariadne.«
Ich versuchte, keine unziemliche Eile an den Tag zu legen, doch ich sehnte mich so unbändig nach der salzigen frischen Seeluft draußen, dass ich an der Schwelle stolperte. Als ich die wohltuende Kühle des Hofs erreichte, hörte ich das schallende Lachen der beiden Männer in der Halle.