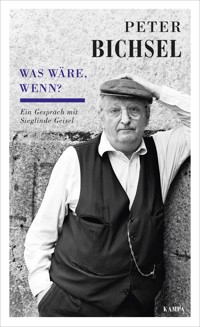15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die erste der in vier Jahrzehnten zu einer Institution sui generis gewordenen P.S.-Kolumnen Peter Bichsels erschien 1975 im Zürcher Tages-Anzeiger. Doch bereits in den 1960er Jahren schrieb der Autor eine Fülle journalistischer Beiträge und Kolumnen zu Fragen der Zeit, die seine frühen Erfolge als literarischer Erzähler begleiteten. Beat Mazenauer hat sie in diesem Band versammelt – und einige erzählerische Erkundungen aus dieser Zeit dazugestellt.
Peter Bichsel hat über die Jahre seine eigene Dialektik des Erkennens entwickelt. Sie gibt dem Widersprüchlichen Raum, und in der fortlaufenden Bewegung der Gedanken behält sie stets auch deren Scheitern im Auge. Bichsel, der fragt und infragestellt, ist, sagt Beat Mazenauer, ein Meister des Verzögerns »endgültiger« Antworten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Peter Bichsel
Auch der Esel hat eine Seele
Frühe Texte und Kolumnen 1963-1971
Mit einem Vorwort des Autors
Herausgegeben von Beat Mazenauer
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort – das letzte
1 Eine Kolumne aus »Die Tat« 1963
In seinem Gedächtnis
2 Texte und Kolumnen in der »Weltwoche« 1965-1968
Vom Fahnenstangenfallenlassen
Kino
Vier Autoren über einen Autor
Diskussion um Rezepte
Bundesfeieransprache
Die Wahrheit oder »Entdämonisieren wir weiter«
Von einem Mädchen und von der Übereinstimmung
Unverbindlichkeiten
[»End of War Now«]
Geistige Entwicklungshilfe
Gedichte und Gegengedichte
Filmzentrum
Tour de Suisse
Marx im Sand
Absolute Prosa
Sichtbar machen
Das private Staatsradio
Das Gutachten Huber
Verstaatlichen?
Relativierungen
Gespräche mit Neckermann
Die Geschichte soll auf dem Papier geschehen
Scharfe Munition im Jura
Eine Stadt wie …
»Häbet Sorg zum Jura«
Verzweiflung und Vermessenheit
Wir empfehlen
Betroffenheit
Abschied von den Waldläufern
Emotionskonventionen
»Geistige Landesverteidigung«
Abschied von 1939
»Altes Brot ist nicht hart ...«
Gefährdete Schweiz
Präsenz durch Leistungen
3 Texte und Kolumnen im Sonntags-Journal / Zürcher Woche 1966-1970
Äpfel sind nämlich meistens grün oder gelb
Notizen zum Tage
Endlich ein Gammler verurteilt
Jenseits von Steinbeck
Der große Untalentierte
Die Schweiz 1938
Von Menschen geformte Dinge
Neuester Fall von deutscher Innerlichkeit
Der Landesverteidigungsstaat
Die SEP
Nun liegt sie auf dem Mond
Das Lampion mit dem Mondgesicht
Mein Hauptmann Defregger
Anstand oder Widerstand
Außerhalb der Weltgeschichte
Die drei Niederlagen des Denkers
Parteiprogramme
15 Fragen an einen schweizerischen Telefonabhörer
In einem ruhigen Land
Grenzen?
Die dezenten Töne
Freiheiten sind nur schädlich
Der kalte Bürgerkrieg
Gegenwärtig wird …
Mer hei e kei Angscht
Wer nicht 50 ist, schadet der Heimat
Wer freut sich über den Einmarsch der Russen?
Ein weiteres Zitat
Die Langhaarigen
Schriftsteller zu ihrem Austritt
Wie soll das weitergehen?
4 Verstreute Texte 1963-1971
Sonnenaufgang
Zwei Briefe eines Teilnehmers am Literarischen Colloquium, Berlin
Prosaschreiben
Jemand entfernt sich in starker Beleuchtung
Stadtrundfahrt für Alte und Einsame
Der Doktorfisch
Variationen über ein Kapitel aus Gottfried Kellers »Der grüne Heinrich«
Wie es war
Abfahrt und mehrmalige Ankunft des Kellners Otto Büttiker, der kommt, geht, ohne zu einer Geschichte zu kommen.
Daisy Ashford: Junge Gäste oder Mr. Salteenas Plan
Der Linksaußen
Schreiben
H. C. Artmann: Verbarium
Ein Schriftsteller möchte antastbar sein ...
Was erwarte ich von einem Roman?
Jan Erik Vold: Von Zimmer zu Zimmer
[Selbstportrait]
Zum Beispiel auch Berlin
Aus einem schönen alten Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
[Rede zur Tschechoslowakei 1968]
Wie ein stiller Anarchist
Der Zeichner des Möglichen
Viel eher als an Regentagen, oder Das Verhalten von Frau Leuenberger
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Hans Schuppisser
Wo ich zu Hause bin
Ansprache zur Eröffnung der gemeinsamen Geschäftsräume
Von der Buchmesse zurück
Und sie dürfen sagen, was sie wollen
»Macht euren Dreck allein!«
Warum mir die Geschichte mißlungen ist – auch der Esel hat eine Seele
Mit Tell leben
Nachwort des Herausgebers
Nachweise und Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Vorwort – das letzte
Eine meiner ersten Lesungen nach dem Erscheinen der Milchmanngeschichten war im Realgymnasium in Basel. Walter Widmer, der Vater des Schriftstellers Urs Widmer, veranstaltete sie, und er hatte mit seinen leidenschaftlichen Einführungen ein großes und großartiges Publikum herangezogen, das sich im Literaturbetrieb einen Namen gemacht hatte; Autoren rissen sich darum, dort lesen zu dürfen. Selbstverständlich war ich stolz darauf. An seine Einführung erinnere ich mich nicht mehr, ich war zu aufgeregt. Aber er lobte mich – unter anderem auch damit, daß er sagte: »Er hat noch nie ein Vorwort oder Nachwort geschrieben«, und er schimpfte über die gängige Unkultur der Vor- und Nachwörter. Ich nahm mir damals vor, nie eines zu schreiben.
Inzwischen sind es unzählige geworden. Alle unwillig geschrieben, alle so etwas wie ein Verrat an meinem väterlichen Freund Walter Widmer. An ein solches Vor- oder Nachwort erinnere ich mich mit Schrecken und Scham. Ein Verleger fragte mich an, ob ich bereit wäre ein Nachwort für einen seiner Autoren zu schreiben – es eilte und ich kannte diesen Autor, hatte alles von ihm gelesen und war davon begeistert. Sein neues Buch brauchte ich vorerst nicht zu lesen, und ich schrieb ein begeistertes Nachwort, glücklicherweise ohne ein Werk von ihm zu erwähnen, vielmehr von seiner Art zu leben und seiner Art zu schreiben. Erst als mir der Verleger das Buch mit einem Brief und einem Brief des Autors zusandte, schreckte ich zusammen. Ich hatte, weiß der Teufel weshalb, über einen ganz anderen Autor geschrieben, aber ich wurde nun gelobt dafür, daß ich diesen einen und falschen – auch ihn kannte ich, und sein Name im Text war der richtige – so exakt getroffen und sein Schreiben so einfühlsam beschrieben hätte. Ich hatte mit seinem Namen einen wirklich ganz anderen beschrieben. Der Schrecken sitzt mir heute noch in den Knochen, aber auch die tröstliche Einsicht, daß Vor- und Nachwörter austauschbar sind.
Das gilt auch für dieses Vorwort. Schreibe ich über mich oder über einen anderen?
Sollte ich über mich schreiben, dann über einen alten ehemaligen Schriftsteller, der das Schreiben mehr oder weniger hinter sich gelassen hat; schreibe ich aber über den anderen, dann über einen, der sich nach und nach herantastet an das Schreiben, auch wenn er das schon als kleines Kind getan hat. Die Entdeckung der Buchstaben war das größte Abenteuer seines Lebens, und sein Schreiben hatte mit nichts anderem zu tun als mit der Begeisterung für diese Buchstaben, damit zum Beispiel, daß man mit den Buchstaben a, h, s und u ein richtiges Haus, oder gar mehr, nämlich das Haus aller Häuser bauen kann. Und selbstverständlich wurde er auch zum Leser. Erst mal zum Leser der wenigen Bücher, die er zu Hause fand: Die Bibel. Kochs Großes Malerhandbuch, siebzehn Bände von Meyers Konversationslexikon, schön von vorn bis hinten gelesen; erster Band von A bis Aslang, zweiter Band von Asmanit bis Biostatik, so stand es auf den Rücken der Bände, bis zum letzten Band von Turkos bis Zz. Und er entdeckte erst viel später, daß dies nur mit dem Alphabet zu tun hat. Er hielt diese Wörter lange Zeit für so etwas wie die geheimen geografischen Eckpfeiler des Wissens, die Magie der Buchstaben. Hätten seine Eltern viele Bücher gehabt und »richtige« Bücher, er wäre wohl nie zum Leser geworden.
Dann sammelte ich im ganzen Quartier alte Zeitungen und Heftchen ein, und las alles unter dem Strich, also das, was man damals Feuilleton nannte, entdeckte die Stadtbibliothek, las nur noch Gesamtwerke, und zwar so wie meine Kollegen ihren Karl May – Band 1, Band 2, Band 3… Und dann, etwas später, entdeckte ich durch Zufall die Dadaisten, die Konkreten, Heißenbüttel, und mein Schreiben – Gedichte – bekam eine Grammatik und Struktur – »Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen«: für mich konkrete Dichtung, für meine Leser und Kritiker etwas ganz anderes – aber ich war jetzt ein Schriftsteller geworden, wie auch immer, aber eigentlich durch ein Mißverständnis. Es klärte sich drei Jahre später glücklicherweise auf bei meinem zweiten Buch »Die Jahreszeiten«, das nur noch wenigen, mir zum Beispiel, gefallen wollte und den Kritikern schon gar nicht.
Die Texte in diesem Buch habe ich recht flüchtig durchgelesen, weil ich mich irgendwie vor ihnen fürchte. Ich fürchte mich vor Biographie, vor der Biographie eines alten Mannes. Trotzdem bin ich Beat Mazenauer sehr dankbar für sein liebevolles Suchen und Sammeln, ohne ihn wären sie verloren. Als gedrucktes Buch, das Sie, liebe Leserin, jetzt in den Händen halten, werde ich die Texte sicher auch gründlich lesen.
1963/64 war ich im Literarischen Colloquium in Berlin als kleiner Provinzler in der großen Stadt, über alles staunend, auch über diese Dichterschule, über unsere Lehrer, Höllerer, Peter Weiss, Rühmkorf, Hans Werner Richter, Günter Grass. Ich habe dort das Dazugehören gelernt und auch, daß Schreiben durchaus etwas Gemeinsames sein kann. In Sigtuna/Schweden las ich vor der Gruppe 47, und kurz darauf erschien mein kleines Buch »Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen«. Ein Jahr darauf las ich bei der Tagung der Gruppe 47 in Berlin. Ich gehörte jetzt zu meiner eigenen Überraschung dazu. Ich kriegte den Preis, und das kam so:
Am Samstagabend wurde recht viel getrunken, und ich hielt da tapfer mit. Da kam Hans Werner Richter zu mir und sagte: »Das ist gescheit von dir, daß du nicht liest, es hatte noch nie einer zweimal hintereinander Erfolg.« Und die beiden Wörter »gescheit« und »Erfolg« weckten meinen Trotz, damit wollte ich nichts zu tun haben und ich sagte: »Doch, ich lese morgen.« Nun versuchten mich alle davon abzuhalten, als erster Reich-Ranicki. Ihm sagte ich: »Doch – wunderbare Texte. Ich habe nur die Noten zu Hause vergessen.« »Was für Noten?« »Ich werde singen.« Ranicki ging zu meinem Verleger Otto F. Walter. Und nun versuchten mich alle abzuhalten und machten mich zu Recht auf meine Betrunkenheit aufmerksam. Und ich wußte, ich werde mit meinen Texten aus den »Jahreszeiten« durchfallen, und ich freute mich diebisch darauf. Ich fiel nicht durch, und gesungen habe ich selbstverständlich auch nicht.
Aber gleich nach meiner Lesung mußte ich gehen, ich war Lehrer und mußte am Montag in der Schule sein. Jetzt wollten mich alle zurückhalten und sagten: »Du kriegst den Preis, du mußt bleiben.« Ich ging. Und als ich nach einer umständlichen Reise in Solothurn ankam, stand am Bahnhof meine Frau Therese mit einem Telegramm: »Gratuliere zum Preis der Gruppe 47 – Hans Werner Richter.«
Und das gehört nun wirklich nicht in ein Vorwort und der Schluß der Geschichte auch nicht: Wir gingen nach Hause und ich telefonierte nach Berlin. Der Portier in der Loge am Wannsee nahm ab, und ich fragte nach Hans Werner Richter. »Ich kann ihn nicht ans Telefon holen, der Herr Regierende Bürgermeister ist im Saal.« »Hält er eine Rede?« »Nein, die Herren unterhalten sich.« Ich erklärte ihm von meinem Preis, und er gratulierte mir herzlich, ließ sich aber nicht bewegen in den Saal mit Regierendem Bürgermeister – Willy Brandt – zu gehen. »Sagen sie mal, ich kenne mich nicht aus in deutschen Gebräuchen, aber müssen die Deutschen auch aufs Klo, wenn der Regierende Bürgermeister usw. Das Klo ist doch gleich neben ihrer Loge. Sollte also einer trotz Bürgermeister« – ach Quatsch, was soll das. Aber es ist nun mal erzählt. Und damit habe ich den Faden verloren.
Wo sind wir stehengeblieben?
Ich fürchte mich vor Biographie, vor der Buchhaltung des Lebens. Ich erinnere mich nicht gern an mich. Ja, ich werde diese Texte lesen – sozusagen gleichzeitig mit meinen Leserinnen und Lesern –, und sie werden mich erinnern – nicht eigentlich an mich, vielmehr an die vielen, die mein Schreiben begleitet haben. Jörg Steiner, der erste richtige Schriftsteller, den ich persönlich getroffen habe und der mir, als ich mich von ihm verabschiedete, um in dieses Colloquium nach Berlin zu gehen, noch nachrief: »Vergiß nicht, schreiben kannst du, laß dich zu nichts überreden.« An Hugo Leber und Bruno Schärer, die mich 1968 für ein Jahr an die »Weltwoche« holten. Vielleicht wäre ich ohne sie nie zum Kolumnenschreiber geworden. Ich war ihr Lehrling. Ja, Texte eines Lehrlings, Einübungen und dazugehören. Und die Texte Woche für Woche in der Druckerei kontrollieren, in Blei lesen: Buchstaben, Buchstaben, da waren sie wieder.
Aber dazugekommen war so etwas wie Ernst, eine gewisse Direktheit, Engagement. Auch das hat mir gefallen und erinnert mich an jene Zeit – 68 –, die mich entscheidend geprägt hat, nicht einfach so und direkt, ich war schon etwas älter als die 68er, und ich hatte zu lernen, mühsam zu lernen. Auch daran erinnern mich meine Texte aus jener Zeit – einer Zeit, die jung war.
Inzwischen – so scheint mir – bin nicht nur ich alt geworden, sondern auch die Zeit. Geblieben ist mir das Lesen, fast nur noch Bücher, die ich bereits gelesen habe, die ich noch einmal und noch einmal lesen möchte. Diese Bücher erinnern mich mehr an mich als meine eigenen Texte. Ich erinnere mich beim Lesen von Joseph Conrad sozusagen Zeile für Zeile an jenen Jüngling, der es damals zum ersten Mal gelesen hat.
Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, auf Wiederlesen.
Bellach/Solothurn, September 2019
Peter Bichsel
1
Eine Kolumne aus »Die Tat« 1963
In seinem Gedächtnis
Einer war in der Stadt, und es liegt mir fern, ihn hier ausführlich zu beschreiben, der kannte die Geburtsdaten der Leute. Er hatte ein riesengroßes Gedächtnis, in ihm stapelte er Geburtsdaten auf. Er fragte die Leute nicht nach ihrem Namen, er fragte sie nach dem Geburtsdatum. Er rempelte sie später, vielleicht Jahre später auf der Straße an und preßte mit seiner schweren Zunge hervor: »Du hast gestern Geburtstag gehabt« oder er sah jemanden in der Wirtschaft und sagte: »12. April.« Er täuschte sich nie. Er konnte Zwillinge auseinanderhalten, wußte, welcher der Erstgeborene war und verstand die kompliziertesten Familienverhältnisse in seinem Kopfe zu ordnen. Dabei, das muß hier gesagt sein, gab er sich nicht mit Astrologie ab, nur mit Geburtsdaten und er suchte nichts in ihren Zufälligkeiten und Unzufälligkeiten.
Es hat einen Grund, daß ich das aufschreibe.
Er war ein Trottel. Man weiß, daß Idioten oft ein überraschendes Gedächtnis haben. Ich kannte einen anderen und verehrte ihn damals, der lernte den Fahrplan und zwar den großen, internationalen – auswendig.
Dieser nun also merkte sich Geburtsdaten, doch er gratulierte niemandem zum Geburtstag. Seine Fähigkeit machte ihm Freude. Seine Fähigkeit ließ sich auch kontrollieren und die Leute sagten etwa ›großartig‹, wenn seine Behauptung zutraf und das tat sie immer. Er wußte auch auf den Tag genau, wie das Wetter in den vergangenen Jahren war, das konnte man nicht kontrollieren und man glaubte es auch nicht, trotzdem es einen gefreut hätte, wenn es zugetroffen hätte. Er war ein glücklicher Mensch, ich hörte oft sagen: »Er ist doch ein glücklicher Mensch.« Er war weder böse noch gefährlich, alle mochten ihn gut. Wenige kannten seinen Namen und vielleicht niemand sein Geburtsdatum. Vielleicht hatte er selbst keines. Ja, bestimmt, hatte er keines. Ich glaube, er hatte keinen Spitznamen, jetzt fällt mir das plötzlich auf. Es gab bestimmt Leute, die ihm hie und da etwas schenkten. Er verrichtete auch kleine Arbeiten und war zuverlässig. Er sah immer gleich alt aus.
Es hat einen Grund, daß ich das aufschreibe.
Sicher hatte er Gewohnheiten und er fürchtete sich nicht vor ihnen und er hatte einen Sprachfehler und er hatte einen Tick. Er hatte tiefe braune Augen, die direkt ins Gedächtnis führten. In sein großes Gedächtnis, in dem die Leute in 365, oder sogar in 366 Gruppen geordnet waren. Soviel ich weiß, kannte er die Jahrgänge der Leute nicht, um eine Ordnung aufzustellen genügt das Geburtsdatum. Mehr wußte er nicht, mehr sagte er selten, mehr schien ihm nicht Freude zu machen.
Ihm war eine Ordnung gelungen und niemand hatte etwas dagegen.
Ich versuchte oft, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Mein Geburtsdatum kannte er nicht. Er fragte mich nie danach und ich hätte nicht gewagt, es ihm aufzudrängen.
Mein Geburtsdatum ist verzeichnet in den Kartotheken des Staates, in Verzeichnissen von Vereinen, in den Bestandeslisten der Armee und wohl noch vielerorts. Oft bedrückt mich das. Aber in seinem Gedächtnis wäre ich gern gewesen.
Ich wäre gern in seinem Gedächtnis gewesen.
2
Texte und Kolumnen in der »Weltwoche« 1965-1968
Vom Fahnenstangenfallenlassen
Bevor man über etwas schreibt, orientiert man sich. Das ist ein guter Brauch. Wenn man sich orientiert, wird die Sache komplex; das ist die Regel. Eine ungebrochene Meinung zum Schwarzenproblem – habe ich mir sagen lassen – ist nur Leuten möglich, die die Verhältnisse nicht kennen. Die Einheit der Kirche ist für Leute, die keiner Kirche angehören, kein Problem.
Beispiel: ich werde – weil ich mich am Biertisch leidenschaftlich für den selbständigen Jura eingesetzt habe – aufgefordert, etwas darüber zu schreiben. Am Biertisch ist man schnell Fachmann. Man sagt etwas vom alten Bistum Basel, nennt eine Jahrzahl, beispielsweise 1431, läßt sich korrigieren, sagt »ach ja«, greift sich an die Stirn und lächelt. Am Biertisch spielt es im weitern keine Rolle, ob man Begelin oder Béguelin schreibt oder ob er überhaupt so heißt. Zudem kann ich nur spärlich Französisch, ich bin also nicht nur der Geburt nach Deutschschweizer, sondern auch sehr gezwungenermaßen. Ich bin darauf angewiesen, daß die Welschen die Deutschschweizer so sehr lieben, daß es ihnen ein Bedürfnis wird, Deutsch zu lernen, es im Kopf zu behalten und anzuwenden. Ich weiß nicht, ob beispielsweise Herr B. das gern tun würde. Ich könnte also aus diesem Grund gegen ihn sein. Ich bin es nicht.
Ich bin gegen die Anwendung von Gewalt. Wiederum ohne Dokumentation, das fällt mir auf, wenn ich mit Unteroffizieren spreche. Ich habe mich aber nun einmal entschieden, dagegen zu sein und mich durch nichts aus dem Konzept bringen zu lassen. Ich bin gegen die Gewalt, und solche wurde im Jura angewendet. Ich müßte also aus diesem Grund gegen die Sache sein. Ich bin es nicht.
Ich bin nicht fähig, über das Juraproblem zu schreiben. Ich tue es deshalb nicht und werde mir, wenn nötig, mündlich Luft machen.
Zu untersuchen ist also nur der Grund meiner fast zufälligen Sympathie.
Ich bin stolz auf die Schweiz. Ich lebe in einem Land, in dem es möglich ist, daß Fahnenstangen auf Köpfe von Bundesräten fallen. Es wird nichts Vorsorgliches dagegen unternommen. Das spricht nicht für den Fahnenstangenfallenlasser oder -schläger, im Gegenteil; denn es ist so, daß keine Vorsorge nötig ist, weil es nie geschieht. Die Leute tun es nicht, und die Bundesräte tun deshalb nichts dagegen, und deshalb könnte man es tun, aber man tut es nicht – da capo.
Wiederum kein Argument für den Jura.
Aber die Jurassier haben die Probe aufs Exempel geliefert, das ist ihr Verdienst.
Sind Leute, die Fahnenstangen fallen lassen, fähig, sich selbst zu regieren?
Das Argument, die Jurassier seien unfähig, ist leider äußerst glaubhaft, weil es Berner sind, die es aussprechen.
Die Belgier hatten behauptet, der Kongo werde sich nicht selbst regieren können, und sie hatten recht, denn sie mußten es ja wissen. Die Briten sagten, die Inder könnten es, denn sie wußten es und behielten auch recht. Die Berner müssen wissen, wieviel Gelegenheit die Jurassier hatten, sich politisch zu schulen und zu betätigen. Ich bin überzeugt, daß die Jurassier so viel Gelegenheit hatten wie alle Schweizer. Aber die Jurassier behaupten das Gegenteil und die Berner indirekt auch. Wenn zwei Feinde die gleiche Meinung haben, scheint mir diese glaubwürdig.
Ein Reformierter sagte mir: »Die Katholiken wollen einen neuen Kanton.« Ein Antikommunist sagte: »Die Kommunisten wollen einen Kanton.« Der Unteroffizier sagte: »Die Pazifisten wollen einen Kanton.« »Die Intellektuellen, die Halbstarken ...« Für jeden sind es einfach seine Gehaßten, die den Kanton wollen. Das heißt, daß man einfach dagegen ist, einfach so. Besonders daß Halbstarke, gegen jede Regel, politisches Interesse zeigen, freut mich. Sollte es zudem noch so sein, daß diese Halbstarken (wie so oft) sich als nichts anderes als junge Leute entpuppen, wäre die Freude noch größer.
Gefährlich scheint mir, die Bewegung zum vornherein als unschweizerisch zu bezeichnen. Man könnte den Leuten die Bezeichnung derart aufzwängen, daß sie plötzlich keine andere Wahl mehr hätten.
Daß ein Problem, das die Presse seit Jahren beschäftigt, offiziell noch keines ist, bewies die Expo. Das Problem dort darzustellen, wäre allerdings ein Problem gewesen. Es gibt noch keine schweizerische Problembegutachtungsstelle. Warum eigentlich nicht? Sie könnte die Aufgabe haben, für eine künftige Darstellung der Schweiz abzuklären, welche Probleme das PBG-Zeichen (Zeichen der Problembegutachtungsstelle) tragen dürfen.
Man kann auch Probleme als unanständig bezeichnen. Mit der Jurafrage hat man das weitgehend getan.
Es ist ruhiger geworden. Man hört im Augenblick wenig von der Sache.
Es ist so, daß Bomben platzen und Fahnenstangen fallen müssen, damit man davon spricht. Es ist so, daß die ruhige Zeit dazwischen eben eine ruhige Zeit ist und daß man die Ruhe genießt.
Aber ich bin gegen Bomben und finde es nötig, daß man auch in ruhigen Zeiten davon spricht, sei es auch nur, um Bomben unnötig zu machen. Erst wenn Bomben fallen, sprechen die Unkompetenten und Unorientierten; in ruhigen Zeiten nur Fachleute. Ich plädiere dafür, daß auch in ruhigen Zeiten die Unorientierten sprechen.
Ich bin überzeugt , daß der Einfluß der »Unkompetenten« zum Wesen unseres Staates gehört. Ich habe mich schon oft darüber geärgert, ich glaube trotzdem, daß es so sein muß.
Wohl in keinem andern Land besteht die Möglichkeit, daß schlechte Rechner in der Finanzkommission einer Gemeinde sitzen und ein sehr brauchbares Budget aufstellen. Ich habe keine namentlichen Beispiele, aber ich bin voll und ganz überzeugt, daß es das gibt und daß es nicht schlecht ist.
Auch deshalb kann man doch nicht einfach behaupten, die Jurassier könnten sich nicht regieren. Oder hat man den Verdacht, sie wären zu intelligent dazu? Das wäre für mich – und ich sage das ohne Zynismus – eher ein Grund, dagegen zu sein.
Für viele ist die Schweiz etwas völlig Unveränderbares. Oft sieht es sogar so aus, wie wenn man den Flüssen und Seen böse wäre, weil sie trotz allen Regeln keine blauen Schweizer Seen mehr sind. Nur mühsam gewöhnt man sich daran. Später ist man bereit, etwas zu tun – immerhin aber noch mit Kopfschütteln daran denkend, daß sie vorher sauber waren, ohne daß man etwas getan hat.
Übersetzt auf das Juraproblem heißt das: wäre es den Jurassiern nicht eingefallen, selbständig sein zu wollen, hätte man die ganze komplizierte Sache nicht.
Sie sind offensichtlich die Schuldigen.
Nicht alle Jurassier sind für einen Kanton Jura. Viele sind entschieden dagegen. Das heißt dann für die Gegner, die Jurassier wollen gar nicht. Die gleiche Situation heißt für die Befürworter, die Jurassier wollen.
Das ist so oder so ein völlig illegales Argument. Das müssen die Jurassier selbst entscheiden. Eine Minderheit wird unterliegen, und der Mehrheit wird die Geschichte so oder so recht geben. Die Geschichte erbringt immer den Beweis, daß es kommen mußte, wie es kam.
Der Jura gehört zum Kanton Bern; ein großer Kanton, in dem Leute aus den Alpen, dem Mittelland und dem Jura einträchtig zusammenleben. Leute aus zwei Sprachgebieten, eine Schweiz im kleinen, ein schönes Beispiel.
Es hätte ohne weiteres so bleiben dürfen.
Der Beweis, daß es so richtig ist, war erbracht.
Jetzt versuchen einige, den Beweis zu erbringen, daß es so nicht richtig ist. Und die andern sagen: ihr seid zu spät, der Beweis ist bereits erbracht. Die neuen Beweise verstoßen gegen eine bewiesene Regel.
Gegen eine Regel sogar, die uns lieb ist.
Ich habe in der Schule gelernt, wie sich das Wasser selbst reinigt. Unser Lehrer hat mit Begeisterung aufgezählt, was alles in die Aare fließt, und hat erklärt, wie die Aare das tagtäglich verdaut.
Wir haben in der Aare gebadet. Die Mutter sagte: »Schluck nicht zu viel Wasser« – sie sagte nicht einmal: Schluck kein Wasser. Daß Gewässer sich selbst reinigen, ist erwiesen.
Aber eben, Gewässer und Verhältnisse ändern.
Wie wäre es, wenn die Waadtländer auf den Gedanken kommen sollten, nicht mehr zum Kanton Bern gehören zu wollen? Sie gehören zwar nicht dazu, aber wie wäre es, wenn sie dazugehörten und nicht mehr wollten?
Einfacher – die Waadtländer haben ihr Gutschweizersein bewiesen. Ihr Nichtdazugehören ist Geschichte geworden.
Unsere jüngsten Kantone sind mindestens hundert Jahre alt. Fürchtet man sich etwa davor, daß später einmal ein Kanton seine Zweijahrfeier (statt zwei Jahrhundert) hat, daß es also in unserem Land etwas geben sollte, was nicht bereits Geschichte ist?
Das Juraproblem ist nichts Weltbewegendes. Die Existenz der Jurassier ist nicht bedroht.
Die Reaktionen der Gegner lassen aber auf Bedrohung schließen. Besteht etwa die Furcht, die Schweiz könnte bedroht sein, bedroht durch eine kleine Änderung? Sollte das so sein, wäre ich gegen einen Kanton Jura und nicht mehr stolz auf die Schweiz.
Dabei haben die Deutschschweizer einen ganz tüchtigen Französischtick. Sie behaupten ohne Skrupel, daß Französisch die bessere, exaktere und vor allem schönere Sprache als Deutsch sei. Sie verehren Paris und sind überzeugt, daß Geist, Kunst und Freiheit etwas Französisches sind. Vielleicht sind nun die Bedenken gegenüber einem französischen Jura die Reaktion auf die stille Liebe.
Das Vordringen der Sprachgrenze nach Osten macht mir Sorgen. Ich liebe meine Sprache so sehr wie die Welschen die ihrige, ich werde nie besser Französisch können als Deutsch. Ich weiß nicht, weshalb ich eine andere Sprache mehr lieben sollte als meine eigene.
Enthusiastische Verehrung ist auch keine gute Grundlage zum Zusammenleben; wie schnell nimmt man dem Verehrten die Verehrung übel. Man sucht dann eigene Qualitäten, die der andere nicht zu haben scheint. Für den Deutschschweizer heißt dann diese Qualität »Guter Schweizer sein«. Die alte Eidgenossenschaft (wieder die Geschichte) war eine alemannische Angelegenheit, das sitzt uns doch ganz tief in den Knochen. Wir haben die Garantie, daß die Jurassier mit den Bernern zusammen gute Schweizer sind. Wir sind nicht ganz überzeugt, ob sie’s allein noch wären.
Das macht mich traurig.
Hat man denn nur zur Geschichte der Schweiz Vertrauen und zu ihrer Idee überhaupt nicht?
Ich bin nicht orientiert über die Separatistenfrage. Ich habe in Wirtschaften davon gehört, in Zeitungen Kommentare gelesen. Die Kommentare sprachen gegen die Sache. Das reizte mich zur Opposition.
Veränderung der Veränderung zuliebe?
Auch ich bin der Meinung, daß es nicht immer schlecht ist, die Sachen beim alten zu lassen.
Aber Veränderung der Veränderung zuliebe ist immerhin ein Beweis, daß Veränderungen noch möglich sind. Das ist sehr viel und nimmt mich für das Juraproblem ein.
Es gibt noch Schweizer, die an Veränderung glauben, denen die Idee »Schweiz« mehr wert ist als ihre pompöse Geschichte. Die Leute lassen mich an die Schweiz glauben.
Ich habe keine ausreichenden Gründe, um für die Separatisten sein zu können.
Aber ich stehe überzeugt für die Anerkennung des Problems ein.
Ich plädiere für seine Salonfähigkeit.
Kino
Wenn du durch eine Stadt gehst, dann immer auf der Schattenseite und immer die Sonne im Rücken, und warum? Du lebst länger. Das ist Western. Ich habe den Satz dort gelernt, er ist ein Teil meines Wissen geworden. Doch ist anzunehmen, daß ich ihn nie brauchen kann, unnötiger Ballast also. Wenn ich nach dem Western aus dem Kino komme, verspüre ich Lust zu rauchen, und ich fühle mich einsam und kneife die Augen ein wenig zu, fühle mich auch stark, trage die Arme leicht angewinkelt, Hände auf Hüfthöhe, bemerke es nach einigen Minuten und schäme mich. Ich war für kurze Zeit ein Cowboy geworden, ein einsamer Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit.
Und dieser Cowboy wird in irgendeiner Form ganz tief in mir stecken bleiben. Er kommt hoch, wenn ich Whisky bestelle, wenn ich traurig bin oder eine Wut habe, wenn ich bluffe, eine Zigarette anzünde, den Mantel anziehe, durch den Wald gehe und so weiter.
Mit 15 schlich ich mich zum erstenmal ins Kino, glaubte sehr erwachsen auszusehen und sah dann den besten Film meines Lebens, den »Dorfmonarch« mit Joe Stöckel. Als ich dann 16 war und ins Kino durfte, hatte ich das Glück, daß der Film in einer Reprise nochmal gezeigt wurde. Meine Begeisterung war unvermindert. Ich kenne noch die beiden Lieder daraus: »Der Enzian blüht auf sonniger Höh’ und grad so blüht mein Herz in mir« und das zweite »Die Dampfnudeln dampfen«, daran erkenne ich, nachträglich, zu was für einer üblen Sorte der Film gehört.
Es gab schon damals Stimmen, die mir ausreden wollten, daß das ein guter Film sei. Aber daß am Ende des Films die Elfriede von der Alp, die inzwischen das Konservatorium besucht hatte, in Innsbruck Griegs Klavierkonzert spielte, überzeugte mich restlos davon, daß da auch Kunst mit im Spiele gewesen sein muß.
Ähnliches wäre von andern Filmen, die mich damals faszinierten, zu sagen. Dann scheint sich mein Geschmack gebessert zu haben – das gehört aber schon nicht mehr zu meinem Thema, ich möchte nicht vom Film sprechen, sondern vom Kino, und es war nicht Film, sondern Kino, der Raum, die Sitze, die Tatsache, daß sich auf der Leinwand etwas bewegt, was mich damals faszinierte.
Vielleicht hat das sehr wenig mit dieser Tagung zu tun, und sehr wahrscheinlich sind das alles Binsenwahrheiten – vielleicht ist meine Befürchtung, daß es Leute gibt, die aus dem Film nun endgültig eine hochkulturelle, esoterische Angelegenheit machen wollen, völlig unbegründet.
Ich bin überzeugt davon, daß jede Kunst ihre triviale Form nötig hat, als Anregung vielleicht, viel mehr noch als Bestätigung. Die gewissen Sprüche, die an Pissoirwänden zu finden sind, scheinen mir doch eine Bestätigung dafür zu sein, daß die Lyrik, die gehobene Form davon, noch nicht unzeitgemäß geworden ist.
Die Theaterkrise scheint ihre Gründe auch darin zu haben, daß das Theater restlos dem Trivialen entzogen wurde; daß man sich zum Beispiel nicht mehr über den auf der Bühne langwegs hinfallenden Malvolio freut, sondern über die Qualität seiner Darstellung, daß der hinterste Theaterbesucher weiß, daß er nicht vom Irrsinn der Ophelia erschüttert zu sein hat, sondern von der packenden Darstellung der Frau so und so in der geschickten Inszenierung von ...
Es gab zu allen Zeiten, auch im Publikum Shakespeares, Leute, die einen echten Genuß in der kritischen Betrachtungsweise hatten – neu ist nur, daß diese Betrachtungsart inzwischen für alle verbindlich erklärt wurde, daß es im Theater keinen Pöbel mehr gibt.
Im Kino gibt es ihn noch.
Was mich erschreckt, ist, daß auch hier für viele eine Tempelreinigung wünschenswert wäre. Damit wäre das Kino sterilisiert – unter Sterilisation leidet bereits das Theater.
Man sucht immer wieder den guten und schlechten Einfluß des Kinos – insbesondere auf die Jugend – zu ergründen. »Rififi« wurden in dieser Hinsicht belegte Vorwürfe gemacht. Ich finde sie lächerlich. Der Film verdirbt uns so wenig oder so sehr wie das Leben. Er ist zu einem Teil des Lebens geworden.
Was man da sieht, erlebt man. Man kopiert, bekommt eine Vorstellung vom Helden, vom Gentleman, vom Weltmann. Man kann später nicht auseinanderhalten, was wir vom Film, vom Vater oder vom Lehrer mitbekommen haben, was aus eigener Erfahrung.
Auch ein schlechter Film wird zur Bildung. Ich bekomme eine Vorstellung von Amerika, eine falsche vielleicht, aber eine Vorstellung – eine Vorstellung von Paris, von Mädchenhandel und von römischen Gladiatoren.
Ich glaube nicht, daß die Art, wie ich eine Frau anspreche, wie ich mich kämme, wie ich von mir denke (innerer Monolog) nun wirklich original meine eigene ist. Die ganze Umwelt bestimmt in diesen Dingen mit, und aus dieser Umwelt kann der Film nicht ausgeklammert werden.
Ich sitz gern in diesen Klappstühlen, ich liebe das nicht uniformierte Kinopublikum, ich versuche, mich über Zwischenrufe nicht zu ärgern, ich freue mich oft über sie. Hier gibt es noch ein bißchen Galerie à la Daumier, Publikum, wie wir es aus »Les enfants du Paradis« kennen; das überzeugt mich, daß das Kino die zeitgemäße Form des Spektakels ist.
Wir sind aber offensichtlich hier, um über die gehobene Form des Films zu diskutieren. Meine Worte sollen nicht etwa ein Plädoyer gegen den guten Film sein. Ich bin nur überzeugt davon, daß noch nie eine Kunstform ihre Wurzeln so offensichtlich in der trivialen Form hatte wie der Film, und daß sein Vorteil gegenüber andern Künsten ist, daß der Filmmann dadurch noch Freiheiten hat, wie es sie zum Beispiel in der Literatur seit Grimmelshausen nicht mehr gibt, und es berührt mich deshalb eigenartig, daß so viele Filmleute über die Existenz des schlechten Films unglücklich zu sein scheinen.
Ich weiß nicht, wieviel Vergnügen ein Godard, »A bout de souffle« zum Beispiel, einem Betrachter macht, der den trivialen Film (Eddy Constantine) überhaupt nicht kennt. Denn offensichtlich sind hier raffiniert alle Dinge des trivialen Films übernommen und eingebaut und verfremdet und ins Gegenteil verkehrt, offensichtlich ist der Raster des Films, der eines gewöhnlichen Gangsterfilms, mit dem kleinen thematischen Unterschied, daß Held und Gangster eine Personalunion eingegangen sind, mal ganz abgesehen von stilistischen Unterschieden.
Ähnliches könnte man in Resnais’ »Muriel« aufzeigen, Szenen, dies nur kurz angedeutet, die durcheinandergeschnitten sind, brauchen keine weitere Erläuterung; sie sind uns aus gewöhnlichen Filmen bekannt. Resnais setzt zudem die Langeweile als spannungserzeugendes Mittel ein. Kein gewöhnlicher Film ist absichtlich langweilig. Daß uns die Langeweile hier überrascht und deshalb nicht langweilt, liegt wohl vor allem darin, daß wir durch unsere Trivialfilmerfahrungen anderes gewohnt sind.
Ich gebe gern zu, daß mich Trivialfilme selten begeistern. Ich bin aber überzeugt, daß es auch innerhalb des trivialen Films Qualitätsmaßstäbe gibt, die wenig mit den Maßstäben des Kunstfilms zu tun haben. Das fällt dann auf, wenn triviale Filme künstlerisch wirken wollen, als Beispiele »Westside Story« und »Mata Hari« oder die ganze Serie von Western, die nach dem »High Noon«-Erfolg zu psychologisieren begannen, mit einem Seitenblick auf einen Oscar. Als Beispiele auch eine ganze Reihe von Schweizer Filmen, die diese Mischform sogar offensichtlich anstreben. Die Kampagnen gegen den schlechten Film hatten einen halben Erfolg. Der schlechte Film ist halb schlecht geworden, was schlimmer ist.
Zum Schluß: es fällt einerseits auf, daß in der Schweiz noch keine von allem Anfang an als gewöhnliche Kino- oder Kassenfilme gedachten Filme gedreht wurden. Da ist immer ein bißchen Kunst dabei, sei es auch nur der Name Gotthelfs. Es fällt andrerseits auf, daß die Kritik von allem Anfang an Kunst verlangt. Es fällt auf, daß man bei uns vom Staat verlangt, daß er wertvolle Filme unterstützt, daß man also plötzlich diesem Staat, dem man sonst in solchen Dingen nicht viel zutraut, zumutet, er müsse wissen, was wertvoll sei.
Wenn wir wirklich eine Filmindustrie brauchen, dann halt, so unangenehme Seiten es hat, eine ganze – nicht nur eine Kunstfilmindustrie. Meines Wissen haben alle Länder, die wirklich gute, sehenswerte Filme machen, eine äußerst umfangreiche Trivialfilmproduktion.
Diesen Filmen wirft man dann vor, sie seien nur zum Geldverdienen gemacht. Dann sieht es so aus, als ob es in der Schweiz keine guten Leute gäbe, die alles tun, um Geld zu verdienen.
Oder ist es vielleicht doch viel schwerer, einen ganz gewöhnlichen Film zu machen – oder sind wir zu gut dazu, oder zu klein?
Ich hoffe, daß wir nicht auch noch in diesem Bezirk eine Sonderstellung für die Schweiz aushandeln wollen, sozusagen unter dem Motto »relativ gute Filme aus der kleinen Schweiz«. Ich bin gegen den Schweizer Film, bin aber voller Chauvinismus stolz auf jeden guten Film, der aus meiner Region stammt. Daß wirkliche Hoffnungen bestehen, haben die Vorführungen gezeigt.
Ich bin dafür, daß man den Leuten jede mögliche Freiheit gibt, Filme zu machen – einfach Filme, dafür, daß der Staat Filme – einfache Filme – unterstützt, vielleicht im Sinne einer gewissen Defizitgarantie, und daß sich der Staat – wenn er schon kein Qualitätsurteil haben kann – damit abfindet, daß ein großer Teil der Filme mißlingt. Alle können nicht mißlingen.
Ich freue mich über das Abkommen für schweizerisch-deutsche Coproduktion. Kunst ist kaum zu erwarten. Vielleicht aber Filmerfahrung und Geld.
Vier Autoren über einen Autor
Ein sogenannter brillanter Unterhalter kann auf die Dauer langweilen, ein schwerfälliger Erzähler auf die Dauer faszinieren (ich höre lieber einen Bauern ungeschickt über seine Arbeit sprechen als einen Conferencier über irgend etwas). Man hat Dürrenmatt skrupellos den Brillanten zugezählt. Er ist der Autor geworden, bei dem das Publikum zu früh lacht, mit dem es sich voreilig versöhnt.
1956 schrieb er die »Alte Dame«. Sie ist nun auf ewige Zeiten sein »bestes Stück« (so wie Caruso ewig der beste Tenor bleibt), die Auszeichnung wird nur einmal verliehen, ein besserer Dürrenmatt wird nicht mehr akzeptiert. 1956 war der ganze Dürrenmatt durchinterpretiert, man wußte damals bereits, wie man die Stücke der nächsten zehn Jahre zu spielen hat.
Und so spielt man jetzt auch den »Meteor«. Ich freue mich darüber, denn um so mehr fällt auf, daß es einem abgestempelten, eingeordneten, verharmlosten Autor gelungen ist, auszubrechen.
Offensichtlich wollte das Theater wieder einmal ein Stück retten, offensichtlich schützte das Theater wieder einmal seine Abonnenten vor den bösen Absichten eines Autors.
Daß Dürrenmatt schwerfälliger (gewichtiger) geworden ist, daß er auf Brillanz verzichtet, daß die Pointen keine mehr sein wollen, das ignoriert man einfach. Man wollte retten, wo man nur noch zu spielen hat.
Wer mit »dann und dann und dann« aneinanderreiht und auf Schmuck verzichtet, hat bestimmt etwas Wichtiges mitzuteilen. Ihn mit Schmuck zu behängen, ist Verulkung.
Die Aufführung des »Meteors« zeigt, daß nicht nur das Publikum, sondern auch die Schauspieler Dürrenmatt längst als erledigt und harmlos betrachten. Man glaubte, ihm für ewige Zeiten gewachsen zu sein.
Schwitter bricht aus.
Dürrenmatt ist kein Klassiker mehr, das Theater ist ihm nicht mehr gewachsen. Dürrenmatt ist 45, ein junger Autor sozusagen. Man wird mit ihm wieder rechnen müssen, man wird mit ihm wieder Mühe haben.
Diskussion um Rezepte
Es geht in der Diskussion um Schriftstellerei; deshalb vorerst meine Legitimation: ich habe ein kleines Büchlein von 50 Seiten geschrieben, deshalb bin ich ein Schriftsteller (mit knapper Not, 50 Seiten sind etwas wenig). Es geht aber auch um schweizerische Politik, um mich darüber äußern zu dürfen, brauche ich eine andere Legitimation: ich bin Bürger dieses Landes. Ich habe einen Beruf (Lehrer), den ich als politisch betrachte. Ich bemühe mich, keine Abstimmung zu versäumen und bin Mitglied zweier Gemeindekommissionen. Ich bin nicht leidenschaftlich gern Mitglied dieser Kommissionen, aber ich betrachte es als meinen kleinen Beitrag zur Demokratie.
Wenn ich mich über den Jura äußere, dann als Bürger dieses Landes (als Bürger, der schreibt). Ich sehe nicht ein, warum mir der Titel Schriftsteller ein besonderes Recht geben sollte, mich über Politisches zu äußern.
Dieses Recht gibt mir der Titel Bürger, dieses Recht lasse ich mir auch als Schriftsteller nicht nehmen, aber es hat nichts mit dem Schriftsteller zu tun.
Ich gehöre zu den Meckerern, zu den ganz kleinen Wirtshausmeckerern. Ich finde es anderswo immer besser. Nur reise ich erstens nicht gern und spreche zweitens keine Fremdsprachen. Ich liebe meine Mundart. Die Spannung von ihr zum Hochdeutschen fasziniert mich und ist ein wesentlicher Grund, daß ich schreibe.
Ich werde auch weiterhin schreiben.
Ich bin aus diesem Grund restlos an die Schweiz gefesselt.
Sie ist mir Heimat und Gefängnis.
Im Lehrerzimmer ärgerte man sich kürzlich über die Unfähigkeit eines Beamten. Wir diskutierten darüber, was man in der Demokratie (theoretisch) gegen ihn unternehmen könnte. Wir kamen zum Schluß, daß man in der Demokratie sehr viel unternehmen kann, daß man es aber nur selten tut. Wir kamen zum Schluß, daß der Schweizer sehr wenig Zivilcourage hat.
Hätten die Franzosen unser politisches System, würde es bestimmt Initiativen hageln. Hätten es die Deutschen – die Intellektuellen würden sich nicht zweimal bitten lassen. Unsere Rechte funktionieren, weil wir sie nur im Notfall benützen. Eine Flut von Originalität würde unsere Demokratie erdrücken.
Des Schweizers bitterer Mangel, der Mangel an Zivilcourage, ist staatserhaltend. Das ist ärgerlich.
Daß es dumme Nationalräte gibt, das ist auch ärgerlich; aber wir haben eine echte Volksvertretung, die Dummen sind im Nationalrat annähernd prozentual zu den Dummen der Bevölkerung vertreten.
Daß Fachleute im Staat oft nicht zu Worte kommen, das ist auch ärgerlich; aber wir haben eine Laienpolitik, jeder kann mitmachen, wenn der Fachmann schön unten einsteigt, in einer Gemeindekommission, hat er etwas zu sagen. Es ist mir in Berlin aufgefallen, daß sehr wenige Deutsche eine Vorstellung davon haben, wie eine politische Karriere in Deutschland aussieht. Bei uns weiß es sozusagen jeder. Die meisten Bundesräte saßen einmal in einer Gemeindekommission und stiegen dann langsam das Leiterchen hoch. In einer Gemeindekommission diskutiert man zum Beispiel darüber, ob vor das Haus Feldberg 19 eine Straßenlampe gehöre oder nicht. Ich bin überzeugt, daß derartige Entscheide das Staatsgebäude tragen. Das ist in Deutschland nicht so. Ein Mann in Frankfurt wird den Standort einer einzelnen Straßenlampe nicht als Politikum betrachten. Unser Verhältnis zum Staat ist ein grundsätzlich anderes als das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Staat.
Wenn ein Deutscher in einem literarischen Werk historische und gegenwärtige Situationen kritisiert, dann spricht er gegen eine Regierung, gegen Personen, gegen einen Staat, der ihm gegenübersteht. Die Regierung spricht zurück (Pinscher). Welcher Schweizer Autor wurde bis heute von offizieller Seite mit Verunglimpfungen ausgezeichnet? Wenn Frisch ein politischer Autor ist, welche offizielle Stelle hat ihn je erwähnt?
Von Salis schreibt: »... die beiden herben Kritiker unserer bürgerlich moralischen Kleinwelt sind nationale Autoren im vollen Wortsinne geworden.« Ich habe äußerst wenige Dienstkameraden, die irgend etwas assoziieren, wenn sie die Namen Frisch und Dürrenmatt hören. Gut, sozusagen alle meine zivilen Freunde kennen die Namen, aber sind meine Freunde die Nation? (Ich glaube, daß verhältnismäßig mehr Deutsche den Namen Grass kennen als Schweizer den Namen Frisch.)
Ist es nicht eher so, daß Dürrenmatt und Frisch im Gegenteil internationale Autoren sind und als solche für eine gebildete Schicht nationale Renommierstücke (die können sagen, was sie wollen, es ist immer wieder schön). (Dürfte ich übrigens, wenn von Salis schon das Generationenproblem ins Gespräch bringt, den 45jährigen Dürrenmatt für unsere Generation reklamieren, darum bitten, daß man die Grenze auf fünfzig ansetzt, es tut mir sogar weh, den älteren der anderen Seite zu überlassen.)
Daß Walter von Generationenproblem gesprochen hat, ist eine Unterschiebung.
Daß es sich um eine Kontroverse Max Frisch – Otto F. Walter handelt, ist ein Irrtum.
Max Frisch hat Fragen aufgeworfen, die ihn keineswegs in ein Lager zwängen. Von Salis verteidigt Frisch für Aussagen, die er gar nicht gemacht hat. Eine Kontroverse Otto F. Walter – J. R. von Salis hat sich inzwischen ergeben, wobei von Salis (was er selbst Walter vorwirft) sehr von der ursprünglichen Frage abweicht. Von Salis will offensichtlich Äußerungen, Stellungnahmen der Autoren zu politischen Ereignissen.
Max Frisch fragt nur nach der Darstellung der Schweiz in ihrer zeitgenössischen Literatur. Da steht nichts von Aktion, von politischer Wirksamkeit drin, da heißt es ganz einfach: »Hat die Schweiz der letzten Jahrzehnte eine Literatur, in der sie sich erkennen muß?«
Von Salis möchte diese Frage offensichtlich mit »Nein« beantworten; er beantwortet sie offensichtlich und nach meiner Meinung zu Unrecht mit »Ja«: »Unsere Schriftsteller, auch die heutigen, sie mögen es wahrhaben oder nicht, sind unverwechselbar schweizerisch.«
Das ist in meinen Augen eine positive Antwort. Wenn man in einem Buch den Schweizer erkennt, muß man auch um ebensoviel die Schweiz erkennen. Ich wäre stolz darauf. Es ist meine Absicht, als Schweizer zu schreiben.
Ich erkenne die Schweiz in Gottfried Keller und Max Frisch. Ich empfehle, zum Spaß eine Seite »Grüner Heinrich« und eine Seite »Gantenbein« halb zürichdeutsch zu lesen. Daß die beiden nicht weit auseinander wohnen, wird durch diesen Versuch deutlich.
Mir hat man in der Schule erzählt, daß der Schweizer Gottfried Keller ein absolut reines Hochdeutsch geschrieben habe. Das erzählt man wohl noch heute und es ist faustdick gelogen, zum mindesten bis in die Grammatik und die Syntax ist Keller schweizerisch. Daß er thematisch ebenfalls schweizerisch ist (und sein kann), darum beneide ich ihn, um – wie Walter sagt: »... jene Zeit, da die Utopie der Schweiz als Nation, als einer politischen und kulturellen Einheit so stark war, daß sie, getragen vom Pathos der Neugründung von 1848, zum Lebensgefühl zu werden vermochte.« Walter macht im Anschluß daran auf seine Unzulänglichkeit als Historiker aufmerksam. Ich wundere mich, weshalb der Historiker von Salis Keller wiederum zitiert, ohne im geringsten auf das erwähnte Argument von Walter einzugehen.
Aber sind nun wirklich die Bücher jüngerer Schweizer Autoren so sehr schweizerisch, wie von Salis behauptet? Ich glaube, gerade das bezweifelt Frisch. (Ich weiß, daß das Grass sehr bezweifelt.) Ich habe in Berlin nie den Vorwurf gehört, Schweizer Autoren könnten nicht hochdeutsch, aber häufig den Vorwurf, sie schrieben zu hochdeutsch; sie seien zimperlich und auf grammatikalische Exaktheit aus, sie hätten sehr wenig zur deutschen Sprache beigetragen. Wichtige Autoren der deutschen Literatur kamen immer wieder aus den Randgebieten deutscher Sprache, aus Schwaben, aus dem Osten, aus Prag, dann wieder ganz aus dem Norden; sozusagen nie aus Hannover, dem Ort, wo am hochdeutschesten gesprochen wird. Alle brachten ihre sprachlichen Eigenheiten oder zum mindesten ihre besonderen Ausdrücke mit und bereicherten damit die Schriftsprache.
Ich habe bei einzelnen Schweizer Autoren eher den Verdacht, sie stammten aus Hannover als aus Zürich (ich schreibe Zürich, weil es dort am meisten Autoren gibt und daher keiner gemeint sein kann). Auch mir fehlt der Mut. Auch ich bin sehr darauf bedacht, von norddeutschen Lesern bestimmt auch verstanden zu werden.
Dürrenmatt macht mir in dieser Hinsicht Eindruck. Ihm ist es gleichgültig, wie man es genau sagt. Er sagt es so, wie er es sagt. Wobei noch dazukommt, daß er es auf dem heikelsten Gebiet tut, dem Theater. Hier scheint es wirklich wichtig zu sein, wie man zum Beispiel einen Telephonanruf richtig hochdeutsch beantwortet, wie man sich meldet, wenn man auf hochdeutsch jemanden anruft.
Warum berühren Dialoge von Schweizern, die so richtig schön hochdeutsch sind, peinlich, und warum ist bei Dürrenmatt das alles so selbstverständlich? Weil eben ein Hochdeutschizismus (ein schönes Wort von mir) peinlich ist, ein Helvetismus oft wünschenswert.
Bleiben wir bei Dürrenmatt. Er ist bestimmt ein Schweizer. Aber nun möchte ich doch einmal wissen, welches seiner Stücke ein politisch schweizerisches oder schweizerisch politisches ist (von Salis spricht davon). Die These vom politischen Dürrenmatt ist nicht haltbar, wenn er sich auch außerhalb seiner Stücke kräftig politisch äußert. Hingegen stimmt es, daß die eine Seite ein bißchen Angst vor Dürrenmatt hatte und die andere Seite von ihm die Revolution erwartete. – Dürrenmatt hat ein Stück Schweiz dargestellt, in all seinen Werken, im »Romulus«, im »Mississippi« so sehr wie in der »Alten Dame«. Das ist Darstellung, mit Übertreibungen vielleicht, mit kleinen Spitzen, mit Zeigefinger und Holzhammer. Aber tendenziös politisch ist das nicht. Wenn Dürrenmatt die Schweizer wirklich aufschreckte (ich bezweifle es ein wenig), dann liegt für mich der Beweis vor, daß Darstellen seine Wirksamkeit hat, nicht offene Kritik und verpackte Politik.
Ein Beispiel aus Frisch (aus dem Gedächtnis wiedergegeben): die Szene, wo dem Stiller im Zeughaus seine Uniform gezeigt wird, wird oft als hervorragende Kritik an unserer Armee zitiert – sogar von eingeschworenen Pazifisten. Nun ist die Kritik des Schweizers an seiner Uniform doch alles andere als eine Kritik an der Armee im Prinzip. Nur einen Militärfreund interessiert es, wie schön unsere Uniform ist. Ein Gegner der Armee müsste sich über die Uniform freuen. Auch Frisch hat nur dargestellt: einen Schweizer dargestellt, der pflichtgemäß seine Uniform kritisiert; vielleicht ein Schweizer, der wohl ein potentieller Pazifist ist; dem aber im entscheidenden Moment nichts anderes einfällt, als die Uniform zu kritisieren. Immerhin scheint mir Frisch viel mehr als Dürrenmatt politische Absichten zu haben, die Schweiz in seinen Werken kritisch darstellen zu wollen (mir persönlich sind die »Brandstifter« als Beispiel lieber als »Andorra«). Wenn Frisch dabei scheitert, scheitert er als Schriftsteller an seinem Thema – die Sprache trägt ihn weg, die Assoziationen laufen nicht wie geplant, oder die anfängliche Wut verraucht, er versöhnt sich während des Schreibens, steigt in das Denken des Gegners ein und beginnt ihn zu verstehen. Daß, wie Walter sagt, Schriftstellerei vielleicht immer zum Scheitern verurteilt ist, ist keine Tragödie. Mir macht es Spaß.
Übrigens werden Bürger, die eine politische Literatur nötig haben, hellhörig. In Ostdeutschland gibt es eine politische Literatur, die sich hart mit dem Staat auseinandersetzt, die von Blumen, Bäumen und Vögeln spricht und auch Blumen, Bäume und Vögel meint ohne jede Allegorie. Ich habe Lesungen von völlig »unpolitischen« Lyrikern in Ostberlin gehört und ein hellhöriges Publikum gesehen, das erkannt hat, daß Literatur immer politisch ist. Und nicht nur die Leute, auch der Staat hat das dort erkannt, es gibt im Osten Lyriker, die nur über Blumen, Bäume und Vögel geschrieben haben und verfolgt werden. Sie waren für den Staat gefährlich genug. Man traut in Ostdeutschland der Literatur etwas zu. Sie wird von der Gesellschaft ernst genommen. Schriftstellerprozesse im Osten drücken auch das aus.
Noch ist die Frage nach der Darstellung der Schweiz in ihrer Literatur nicht beantwortet. Die Frage ist berechtigt und soll stehenbleiben – ich finde auch nicht allzuviel Schweiz in junger Schweizer Literatur. Ich erlebe im Augenblick, wie mir die Darstellung in meinem zweiten Buch zum zweitenmal mißlingt (sie wird auch im dritten mißlingen). Ist es sehr ketzerisch, zu behaupten, daß der Harry Wind von Diggelmann für mich mehr Schweiz enthält als die »Hinterlassenschaft«? Dies, um den Namen Diggelmann ins Gespräch zu bringen, längst schwebt er ja im Hintergrund des Gesprächs mit. Die Diskussion sieht ein bißchen nach Rezepten aus. Mir scheint, daß die »Hinterlassenschaft« nach einem solchen Rezept gekocht wurde; nach dem Rezept »verpack es in eine Geschichte«. Das Buch bleibt trotzdem so wichtig, daß ich Diggelmann dafür verehre. Auf weitere Beispiele verzichte ich. Ich kann mir vorstellen, daß das Beispiel Diggelmann zu genügend Mißverständnissen führt.
Buchhändler und Verleger bestätigen es: Sachbücher sind gefragter als belletristische, sie verdrängen mehr und mehr das erzählende Buch. Man muß Fakten nicht mehr in Geschichten verpacken, um sie an den Mann zu bringen – im Gegenteil, sie verkaufen sich nackt besser. Sachbücher sind die Bücher der Fachleute, belletristische die der Laien. Über die unbewältigte Vergangenheit Deutschlands gibt es wesentlich mehr Sachbücher als belletristische, und diese Sachbücher halten die Diskussion im Gang.