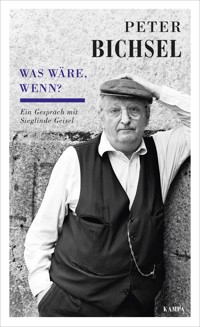9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über das Wetter reden, also über irgendetwas. Verstanden werden, und sei es von einem, der gar nicht meine Sprache spricht. Peter Bichsels Kolumnen kommen mit jedem ins Gespräch, denn seine hohe Kunst des Erzählens beschäftigt sich mit allem Möglichen: Jahreszeit und Wetter, Sport- und politischen Ereignissen – immer aber mit Menschen, mit Geschichten von Fremden und Freunden. Der Erzähler meint und meldet Zweifel an, auch an der eigenen Meinung. Er zielt auf eine Aussage, indem er abkommt vom Weg, hinübergleitet zu einem anderen Gegenstand, abbricht, um in einer Schlussvolte doch wieder anzuknüpfen. Dauernd sind sie in Bewegung, seine Kolumnen, das hält uns wach – wir reagieren angeregt, wir fühlen uns gut unterhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Peter Bichsel
Über das Wetter reden
Kolumnen
2012-2015
Suhrkamp
Informationen zum Buch
Peter Bichsels Kolumnen kommen mit jedem ins Gespräch, denn seine hohe Kunst des Erzählens beschäftigt sich mit allem Möglichen: Jahreszeit und Wetter, Sport- und politischen Ereignissen – immer aber mit Menschen, mit Geschichten von Fremden und Freunden. Der Erzähler meint und meldet Zweifel an, auch an der eigenen Meinung. Er zielt auf eine Aussage, indem er abkommt vom Weg, hinübergleitet zu einem anderen Gegenstand, abbricht, um in einer Schlussvolte doch wieder anzuknüpfen. Dauernd sind sie in Bewegung, seine Kolumnen, das hält uns wach – wir reagieren angeregt, wir fühlen uns gut unterhalten.
Nach sechsundvierzig Jahren, in denen diese Kolumnen Monat für Monat (zuletzt in der Schweizer Illustrierten) erschienen sind, hat Peter Bichsel schließlich für den Januar 2015 die letzte verfasst. Sie bildet den Abschluss dieses Bandes.
Autor
Peter Bichsel, geboren 1935 in Luzern, lebt in Bellach bei Solothurn. Er war Mitglied der Gruppe 47, seit 1985 ist er korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.
Von Peter Bichsel sind zuletzt erschienen: Mit freundlichen Grüßen (it 4345), Über Gott und die Welt. Schriften zur Religion (st 4154) und Das ist schnell gesagt (st 4294).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie
der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung : Hermann Michels und Regine Göllner
eISBN 978-3-518-74009-5
www.suhrkamp.de
Kolumnen 2012-2015
Und was geschieht mit unseren Händen ?
Und die Zählerei beginnt wieder : Zweitausend minus Jahrgang plus zwölf. So alt bin ich also jetzt – Geburtstag. Ich bin jetzt zwölf Jahre älter, als mein Freund Willi geworden ist, und der damals fast zwanzig Jahre älter war als ich, ein älterer Mann also, ein erfahrener Mann, einer, der schon lebte, als ich noch lange nicht lebte. So bin ich dann doch immer noch der Jüngere, auch wenn ich inzwischen wesentlich älter bin, als er geworden ist. Bin ich nun wirklich um zwölf Jahre erfahrener als er ?
Der Begriff Erfahrung hat mich schon immer erschreckt, auch kürzlich, als mich ein junger Freund – fünfundzwanzig Jahre jünger als ich, also schon etwas älter – nach meinen Erfahrungen gefragt hat. Wie hast du die Veränderung der Welt erlebt, fragte er mich. Ich hätte ihm antworten sollen, daß ich sie nicht erlebt habe, nicht erfahren habe, es war immer dieselbe Welt geblieben – nur, daß die Welt, die vorher war, mir hartnäckig das Bild vorgaukelt, eine andere Welt gewesen zu sein, und daß diese Selbsttäuschung wohl seit Jahrtausenden zum Fehlschluß führt, daß diese vordere Welt eine bessere gewesen sein muß. Aber das habe ich ihm nicht gesagt, das ist mir erst auf dem langen Heimweg eingefallen.
Ich habe ihm gesagt : »Ich habe sie genau so wie du erlebt, ich habe wie du den Eindruck, daß sie sich nie so sehr verändert hat wie in den letzten zwanzig Jahren, die Unterhaltungselektronik, das Handy und dann so lächerliche Kleinigkeiten wie die Rauchverbote«, und ich habe ihm von meinem Schmied in Frankfurt erzählt :
Ein alter, stiller und freundlicher Mann in einer kleinen Werkstatt ohne viel Geräte, eine Esse, ein Amboß, ein paar Hämmer. Er schmiedete Stanzformen für die Industrie, für die Textilindustrie, für die Autoindustrie, links von Esse und Amboß hatte er den Plan liegen, und rechts hämmerte er das glühende Eisen, schaute beim Hämmern auf den Plan, maß nichts ab, alles Augenmaß, und arbeitete mit dem Schleifen der Formen auf hundertstel Millimeter genau, und er suchte seit Jahren einen jungen Nachfolger, um ihm sein Können weiterzugeben. Er dürfe nicht aufhören, sagte er, er sei der zweitletzte, der das noch könne. Und wenn er das sagte, schaute er seine Hände an, wie wenn er sie bewundern würde und sie ihm nicht ganz gehören würden. Jedesmal, wenn ich ihn besuchte, hatte er einen jungen Schmied bei sich und versuchte, ihm sein Handwerk zu vermitteln. Er fand keinen mehr, der es konnte. Deshalb mußte er als alter Mann weiterarbeiten. Man könne das nur von Hand herstellen. Nein, er wollte nicht sein Geschäft retten – er wollte eigentlich eine Welt retten, eine Welt, die eben solche Stanzformen braucht. Als ich ihn Jahre später wieder besuchte, war seine kleine Werkstatt aufgeräumt und nicht mehr in Betrieb. Ob er einen gefunden habe, der es jetzt könne, fragte ich ihn. Nein, sagte er, sie machen es jetzt mit Computer und Automaten, und er schaute wieder seine Hände an und sagte, sie sind jetzt für diese Welt nicht mehr zu gebrauchen, nur noch zum Essen und zum Trinken, zum Dinge Herumtragen und zum Geranien Pflanzen.
»Nein«, sagte mein junger Freund, »ich meine etwas anderes, dein Freund Willi war doch Bundesrat. Was hat sich seither verändert ?«
Eben irgendwie habe ich das Gefühl, es sei inzwischen dasselbe verlorengegangen wie beim Schmied. Irgendwie glichen sie sich in ihrer Arbeit, ich hatte auch bei Willi das Gefühl, daß er mit seinen Händen arbeitete, ein Handwerk betrieb, das Handwerk des Lebens, das Handwerk der Politik. Inzwischen brauchen wir unsere Hände selbstverständlich immer noch, aber wir brauchen sie mehr und mehr nur, um eine virtuelle Welt in Bewegung zu setzen.
Ich erinnere mich, wie Willi enttäuscht von den ersten Bundesratssitzungen zurückkam und erzählte, wie dort die Räte wie Rechtsanwälte auftreten und eigentlich nur ihre Verwaltungen vertreten und repräsentieren würden. Die Bundesräte verstanden sich als Repräsentanten einer Verwaltung – der verwaltete Staat. Und offensichtlich waren es gute und kompetente Beamte, die diesen Staat über 150 Jahre alt werden ließen. Das mag nicht sehr spannend sein, aber es hat einigermaßen funktioniert – analog sozusagen.
Inzwischen aber spielt man Regierung, in einem Staat, der als verwalteter und nicht regierter Staat gedacht war und der glücklicherweise und unglücklicherweise durch die direkte Demokratie als Institution unveränderbar bleiben wird – regieren in einer Institution, die nicht dafür gebaut ist.
Auf der Suche nach Henri im Internet
Vor hundert Jahren ist Karl May gestorben. Gelesen hatte ich ihn als Kind und Jugendlicher nie und mußte den Winnetou viel später als Erwachsener nachholen. Aber auch ohne ihn gelesen zu haben, habe ich meine Kindheit wie die anderen in der magischen Welt Karl Mays verbracht, den Legenden konnte sich keiner entziehen, nämlich jenen Legenden, die damals noch – ohne Film und Fernsehen – gemeinsamer Besitz von allen waren, mündlich überliefert wie Sagen und Märchen und der Untergang der Titanic.
Immerhin habe auch ich meinen ersten Zugang zur Literatur Karl May zu verdanken. Auch ich trat den Gang zur Stadtbibliothek in Olten an, um dort Karl May zu holen. Als mich aber der freundliche Bibliothekar, Herr Wölfli, nach meinem Wunsch fragte, war dem kleinen Snob Karl May doch etwas zu billig, und er sagte »Goethe« und trug die ersten beiden Bände der Gesamtausgabe nach Hause, alles Gedichte, und er las sie schön der Reihe nach, eins nach dem anderen, so schnell wie möglich und ohne zu versuchen, sie verstehen zu wollen – ich war jetzt ein Leser, ein Leser von Goethe.
Beim Spielen mit meinen Kollegen aber lebte ich wie sie in der Welt Karl Mays, und auch wenn ich ihn nicht gelesen hatte, konnte auch ich den Namen von »Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah« auswendig, und das kann ich, so stellte ich eben fest, mit meinem schlechten Namengedächtnis zu meiner Überraschung heute noch, und nur zur Sicherheit habe ich die Schreibweise im Internet überprüft.
Kara Ben Nemsi, Winnetou, der Schut und wie sie alle heißen, waren mir geläufig und selbstverständlich auch Old Shatterhand mit seinem Henrystutzen.
Und wieder, wie damals, führt mich Karl May zur Literatur, zum großen Kollegen von Goethe, zu Jean Paul. Er schrieb 1809 von einem Mechaniker Henri, der eine Flinte erfunden hat. Ich ging immer davon aus, daß es sich dabei um jenen Henrystutzen von Shatterhand handeln mußte. Also wieder ins Internet, um es zu überprüfen, und es kann nicht sein, jener amerikanische Henry lebte viel später und erfand sein Gewehr lange nach dem Tod von Jean Paul. Die Suche aber nach dem früheren Henri aus Paris blieb erfolglos.
Hier also, was Jean Paul in seinen »Dämmerungen in Deutschland« 1809 schrieb :
»Der Mechaniker Henri in Paris erfand – approbierte – Flinten, welche nach einer Ladung 14 Schüsse hintereinander geben ; – welche Zeit wird hier dem Morden erspart und dem Leben genommen ! – Und wer bürgt unter den unermeßlichen Entwicklungen der Chemie und Physik dagegen, daß nicht endlich eine Mordmaschine erfunden werde, welche wie eine Mine mit einem Schuß eine Schlacht liefert und schließt, so daß der Feind nur den zweiten tut und so gegen Abend der Feldzug abgetan ist.«
Die Entwicklungen der Physik, Erstschlag und Zweitschlag. Jean Paul sieht hundertfünfzig Jahre vor der Atombombe, daß sie unabwendbar ist, und ich komme eben von einer langen Reise durchs Internet auf der erfolglosen Suche nach diesem Henri aus Paris, einer Reise durch alte Waffensammlungen mit wunderschönen Waffen, las die begeisterten Kommentare der Sammler und Spezialisten und hatte mich dabei fast an die Ästhetik, an die mechanische Schönheit, gewöhnt. Die Schönheit der Technik erinnerte mich an meine Taschenuhren.
Aber auf die Suche nach dem Jean-Paul-Zitat hat mich dieses Mal nicht Karl May geschickt, sondern Günter Grass, der mit seinem Gedicht einen Wirbelsturm ausgelöst hat. Er habe Tabus gebrochen, sagte man unter anderem. Ich habe seinen Text mehrmals gelesen, und ich kann darin nichts von dem erkennen, was ihm nun vorgeworfen wird – aber ein Tabu hat er wohl schon gebrochen, nämlich das Tabu von den guten und den bösen Atombomben oder, um es anders zu sagen, von den ästhetischen und den häßlichen Atombomben. Atombomben, die den Frieden sichern sollten – und die Bomben des jeweils anderen tun das selbstverständlich nicht. Nun ist es ebenso selbstverständlich, daß sich die Menschen vor den Bomben des jeweils anderen fürchten. Macht das die eigenen so absolut zu Friedensgeräten ? Bis heute sind zwei dieser jean-paulischen Bomben abgeworfen worden, beide auf derselben Seite. Waren es nun gute oder böse ?
Oder haben wir mit der berechtigten Angst vor den guten Atomkraftwerken ganz einfach die Angst vor den guten Atombomben, die ein Tabu sind, verdrängt ?
Zwei in einem Märchen
Nach einer Lesung mit meiner Übersetzerin in Lausanne beschlossen wir, anderntags mit dem Schiff zu unserer Veranstaltung nach Genf zu fahren. Aber es gab kein Schiff nach Genf, so nahmen wir halt eines nach Schloß Chillon und zurück nach Lausanne, um von dort mit der Bahn nach Genf zu fahren. Eine schöne, gute und lange Schiffsfahrt an einem warmen Frühlingstag, sozusagen ohne jeden Grund, einfach so – zweimal an Montreux vorbei. Der See sieht von den Hotels aus wohl schöner aus als die Hotels vom See aus. Hotel Palace, dort hat Vladimir Nabokov, der große russische Autor, gewohnt und gearbeitet von 1961 bis zu seinem Tod 1977. Mit ihm war ich – und nicht nur ich, Tausende andere auch – tief befreundet, ohne ihn je gesehen zu haben, ein Autor, der in seinen Büchern körperlich präsent ist, der sich mit seinen Leserinnen und Lesern listig solidarisiert – der Professor Pnin.
Vor Jahren traf ich nach einer Lesung in Deutschland einen Mann mittleren Alters, Gymnasiallehrer, und unterhielt mich mit ihm angeregt, ein Leser, der mit Begeisterung von seinen Leseerlebnissen erzählte, und dann kam plötzlich ein Satz, der so ganz und gar nicht zu ihm passen wollte und mich irritierte : Ja, er kenne die Schweiz, er gehe Jahr für Jahr in den Sommerferien für sechs Wochen nach Montreux. Ich versuchte, den Satz nicht gehört zu haben, und sprach von etwas anderem, aber er kam wieder auf Montreux zurück und zwang mich sozusagen, ihn zu fragen, was er denn dort so mache. Er lebe dort in seinem Zelt auf dem Campingplatz und, er zögerte und sagte, daß er sich lächerlich mache damit. Jetzt begann es mich doch zu interessieren, und er erzählte, daß er dort nichts anderes mache, als sich Tag für Tag mit Zeitungen und Büchern in die Hotelhalle des Palacehotels zu setzen und darauf zu warten, daß er Nabokov vorbeigehen sehe.
»Und – haben Sie ihn gesehen ?«
»Sehr selten«, sagte er, »und das erste Mal erst im dritten Sommer«, und er lächelte und lachte dann und zuckte verlegen mit den Schultern, ein durchaus normaler und gesunder Mensch. Er hat mich mit seiner Geschichte beeindruckt. Und seither frage ich mich nicht mehr, welche Autoren ich gerne persönlich getroffen hätte – Goethe ? Jean Paul ? Joseph Conrad ? Nazim Hikmet ? –, sondern ich frage mich nur noch, welche Autoren ich gern hätte vorbeigehen sehen. Die zweite Frage ist einfacher zu beantworten, denn eigentlich kennengelernt habe ich sie ja schon längst als Leser. Wenn ich Nabokov lese, dann lese ich das Buch sozusagen mit ihm zusammen – wir zwei leben dann zusammen in dieser Geschichte.
Der Mann, der mir dies erzählte, ist auch nach dem Tod Nabokovs Jahr für Jahr nach Montreux gegangen, hat sich in die Hotelhalle gesetzt und gelesen. Es war ihm zur selbstverständlichen Gewohnheit geworden. Eines Tages nun kam der Mann vom Desk zu ihm und fragte ihn, weshalb er seit Jahren immer wieder hier sitze, und der Mann erzählte ihm von seiner großen Verehrung für Nabokov. Der Deskman ging zum Telefon und rief jemanden an. »Kommen Sie mit«, sagte er, und er führte ihn nach oben und stellte ihn der Witwe von Nabokov vor. »Ja«, sagte diese, »mein Mann sagte damals mal, da unten in der Halle sitzt immer ein Leser, das beeindruckt mich – vielleicht waren Sie das.« Jedenfalls wurden die beiden gute Freunde, und wenn sie nicht …, dann leben sie heute noch. Ja, ein wunderschönes Märchen – eigentlich schade, daß es wahr ist.
Etwa so habe ich die Geschichte meiner Übersetzerin auf der Schiffahrt an Montreux vorbei erzählt.
Abends dann unsere Lesung in Genf. Eine junge Buchhändlerin hatte einen sehr schönen Büchertisch eingerichtet. Neben ihr saß ihr Bub, vielleicht achtjährig, schaute mich vor der Lesung ständig an, kam dann und gab mir schüchtern die Hand. Er hatte einen Film gesehen über mich, und die Mutter hatte ihm eine Geschichte von mir erzählt auf französisch, der Kleine konnte kein Wort Deutsch. Während meiner Lesung beobachtete ich ihn aus den Augenwinkeln und sah, wie er mit größter Aufmerksamkeit meinem Deutsch, das er nicht verstehen konnte, zuhörte. Nach der Lesung sagte seine Mutter, daß er sich ein Buch auslesen dürfe, und ich würde es dann signieren. Das tat ich. Und der Bub setzte sich mit dem deutschen Buch in eine Ecke und begann zu lesen – die Buchstaben kannte er, die Sprache nicht –, aber fürs erste waren ihm die Buchstaben Wunder genug. Als ich etwas später an ihm vorbeiging, war er bereits auf Seite 12. Nicht einfach einer, der meine Prominenz mag. Nein, ein Leser – wir zwei in einem Märchen.
Die Bilder vom Fußball in meinem Kopf
Stefan war der erste in unserem Freundeskreis, der sich einen Farbfernseher anschaffte. So hießen jene Fernsehgeräte damals – Farbfernseher im Unterschied zu Fernsehern, und im Programm stand bei einzelnen Sendungen »in Farbe«. Und das ist gar noch nicht so lange her. Man muß nicht sehr alt sein, um den Wechsel von Schwarzweiß auf Farbe mitbekommen zu haben. Stefan besaß also einen Farbfernseher, und so versammelte man sich bei Stefan, um zu sehen und sich zu freuen darüber, wie das nun mit der Farbe funktioniert, und es funktionierte richtig farbig.