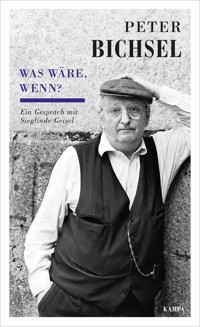11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Herausgeberin, die Peter Bichsel und Peter Bichsels Kolumnen und Geschichten seit vielen Jahren kennt, liebt und verehrt, hat aus des Autors Werk eine Reihe erhellender Geschichten für die dunklere Jahreszeit zusammengestellt: für den Dezember, für Weihnachten und Silvester – und für die Zeit danach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Peter Bichsel
Im Winter muß mit Bananenbäumen etwas geschehen
Geschichten für die kalte Jahreszeit
Herausgegeben von Adrienne Schneider
Insel Verlag
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
November
Das Fest des Dazugehörens
Die heilige Zeit
Die Weihnachtsgeschichten
Erzählen gegen den Tod
Mann mit Hut – ein Nachwort
Weiße Weihnachten
Am Anfang war das Wort
Etwas weihnächtliche Nostalgie
Das Warten auf der Flucht
Im Winter muß mit Bananenbäumen etwas geschehen
Im Schnee von vorgestern
Feiertage
24. Dezember
Dummheit ist Macht
Lesebuchgeschichte
Der Mann mit den goldenen Ohren
Von der Flucht in ein langes Leben
Zum Beispiel das mit den Käfern
Die heilige Zeit der Gewalt
Bescheidenheit und Entschiedenheit
Siegen ist immer einfach
Was willst du werden?
Entfremdete Freizeit
Wahre Geschichten
Ein gutes altes Jahr
Erklärung
Nachweise
Nachbemerkung von Adrienne Schneider
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
November
Er fürchtete sich, und wenn er zu jemandem sagte: »Es ist kälter geworden«, erwartete er Trost.
»Ja, November«, sagte der andere.
»Bald ist Weihnachten«, sagte er.
Er hatte Heizöl eingekauft, er besaß einen Wintermantel, er war versorgt für den Winter, aber er fürchtete sich. Im Winter ist man verloren. Im Winter ist alles Schreckliche möglich, Krieg zum Beispiel. Im Winter kann die Stelle gekündigt werden, im Winter erkältet man sich. Man kann sich schützen gegen die Kälte, Halstuch, Mantelkragen, Handschuhe. Aber es könnte noch kälter werden.
Es nützt nichts, jetzt »Frühling« zu sagen.
Die Schaufenster sind beleuchtet, sie täuschen Wärme vor. Aber die Kirchenglocken klirren. In den Wirtschaften ist es heiß, zu Hause öffnen die Kinder die Fenster und lassen die Wohnungstür offen, im Geschäft vergißt man seinen Hut.
Man bemerkt nicht, wie die Bäume Blätter fallen lassen. Plötzlich haben sie keine mehr. Im April haben sie wieder Blätter, im März vielleicht schon. Man wird sehen, wie sie Blätter bekommen.
Bevor er das Haus verläßt, zählt er sein Geld nach.
Schnee wird es keinen geben, Schnee gibt es nicht mehr.
Frierende Frauen sind schön, Frauen sind schön. »Man muß sich an die Kälte gewöhnen«, sagte er, »man muß tiefer atmen und schneller gehen.« – »Was soll ich den Kindern zu Weihnachten kaufen?« fragte er.
»Man wird sich an die Kälte gewöhnen«, sagte er zum andern. »Ja, es ist kälter geworden, November«, sagte der andere.
Das Fest des Dazugehörens
Weihnachtsgeschichten? Vielleicht ist auch das eine: Der Polizist kommt in den Kindergarten, um Verkehrsunterricht zu erteilen, und er fragt, ob denn jemand wisse, was ein Verkehrsteilnehmer sei. Selbstverständlich weiß es keines der Kinder, also begibt er sich, vermeintlich, auf ihr Niveau und sagt: »Es gibt so Dinger auf der Straße, die haben vier Räder und machen Brumm-brumm, wie sagt man denen?« »Autos«, sagt einer. »Und dann gibt es auch solche mit zwei Rädern, die Brumm-brumm machen, wie sagt man denen?« »Töff, Motorrad«, sagt einer. Und dann das Moped, das Fahrrad. Und jetzt sagt der Polizist: »Es gibt aber noch andere Verkehrsteilnehmer, die haben keine Räder, die stehen auf zwei Beinen und gehen auf ihnen, wie sagt man denen?« Und ein Mädchen antwortet: »Denen sagt man Grüezi, Grüßgott.«
Die Geschichte ist wahr und hat sich vor vielen Jahren in dem Schulhaus zugetragen, in dem ich damals unterrichtete. Ich finde es eine wunderschöne Geschichte, weil hier der kalten Vernunft des Gesetzes menschliche Wärme entgegengesetzt wurde. Der wunderschöne »Irrtum« des Mädchens hatte seine Ursache wohl darin, daß es annahm, daß der Polizist der Hüter des Anstands sei und daß es eben anständig sei, zu grüßen.
Ich grüße gern, und ich genieße es, im kleinen Ort zu wohnen, wo sich die meisten noch grüßen. Es heißt nicht nur, daß ich den anderen wahrgenommen habe, es ist auch ein gegenseitiges Zeichen des Dazugehörens. Gegrüßt werden und grüßen kann ein bißchen Wärme in einen grauen Tag bringen. Autofahrer haben kaum Gelegenheit dazu. Grüßen ist ein Privileg der Fußgänger.
Ein anderes kleines Mädchen, meine spätere Frau, war davon überzeugt, daß man die Polizisten nur freundlich grüßen muß, dann machen sie einem nichts – irgendwie eine Verwechslung mit dem Sankt Nikolaus und dem Schmutzli, und also auch eine Vorstellung von Anstand.
Oder wäre vielleicht das eine Weihnachtsgeschichte: An der Busstation steht ein Mann, durch und durch ein Schweizer. Nun kommen zwei kleine Buben, wahrscheinlich ausländischer Herkunft, auf ihn zu und fragen, ob er ihnen sagen könnte, welchen Bus sie nehmen müßten zum McDonald's. Der Mann geht zum Fahrplan, macht sich kundig und erklärt den beiden, welchen Bus sie nehmen müßten, nämlich den auf der anderen Seite der Straße, und wann er fährt. Die beiden bedanken sich und gehen über die Straße. Da bleibt einer stehen. Dreht sich um und kommt zurück, geht auf den Mann zu und fragt: »Sind Sie Albaner?« Das Dazugehören als Voraussetzung der Freundlichkeit. Weihnachten, das Fest des Dazugehörens.
Im Bus, mit dem ich täglich fahre, grüßt man die Leute, die man immer wieder sieht, die Leute, mit denen man zusammen fährt. Außer morgens früh, wenn die Leute halb verschlafen zur Arbeit fahren. Ich fahre ganz selten so früh, und wohl deshalb fällt mir auf, wie unheimlich still es ist am Morgen im Bus. Auf der nächsten Station steigen zwei Behinderte ein, auch sie fahren zur Arbeit in einer geschützten Werkstatt. Sie steigen ein und sagen laut und deutlich: »Guten Morgen miteinander.« Die Schweigenden im Bus schrecken auf, wie wenn hier ein Überfall angekündigt würde.
Abends spät sitzt ein Mann mit Turban im Bus – er wohnt in meiner Nachbarschaft, schon seit zwei, drei Jahren. Er geht mit Rosen von Restaurant zu Restaurant. Ein schlechter Verkäufer, der kaum etwas sagt, kaum Deutsch kann, kaum lächelt, aber eine leichte Verbeugung andeutet, wenn ihm jemand das Geld für die Rose gibt. Ich habe ihn zwei Jahre lang immer wieder gegrüßt, und er hat meinen Gruß nicht erwidert. Einmal, als wir gemeinsam auf den Bus warteten, habe ich ihn auf englisch angesprochen, wir wechselten ein paar Worte. Seither grüßt er mich freundlich, legt seine Hand aufs Herz und nickt. Ich freue mich jedesmal, wenn er grüßt. Ich habe es damals fast nicht mehr ausgehalten, daß er nicht grüßte. Jetzt fahren wir endlich im selben Bus. Ich kenne ihn eigentlich nicht. Ich kenne weder seinen Namen noch seine Geschichte, und er kennt auch mich nicht. Aber wir nehmen uns nun gegenseitig wahr. Er ist jetzt da und ich auch. Wir haben fast nichts Gemeinsames – eigentlich nur diesen Bus. Aber wir gehören jetzt wirklich dazu, zu diesem Bus. Das ist wenig, sehr wenig. Aber in einer kalten Dezembernacht ist es doch ein kleines Etwas.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest des Dazugehörens.
Die heilige Zeit
Mein treuer Leser Egon teilte mir schon vor zwei Wochen mit, daß meine nächste Kolumne in die Weihnachtswoche falle. Und als ich nicht darauf reagierte, sagte er es ein zweites Mal.
Ich wußte gleich, was er damit meinte. Das war nicht irgendeine zufällige Bemerkung, das war ein Auftrag – oder noch mehr, es war Egons Hoffnung auf eine Geschichte, eine richtige Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte.
Egon ist nicht nur mein bester Leser, er ist auch ein strenger Leser – ein Leser, der weiß, was er will, und er will eine Geschichte.
»Erzähl mir doch was, erzähl mir doch was«, wie Stefan, der ab und zu anruft, seinen Namen sagt und grüßt und dann schweigt und meine Frage, ob er noch da sei, mit einem knappen Ja beantwortet und weiter schweigt.
Es ist mir auch schon gelungen, mitzuschweigen, einfach auch nichts zu sagen – dann verabschiedet er sich nach ein paar Minuten und wünscht einen schönen Abend.
Offensichtlich möchte er einfach, daß mit ihm geredet wird. Aber was soll ich reden? Halt irgend etwas – aber nichts ist schwerer als das Irgendetwas.
Ja, Egon, ich weiß, du wirst dich auf diese Ausgabe der SI stürzen. Du wirst sie aufschlagen und bitter enttäuscht sein.
Ich sitze in der Beiz und suche verzweifelnd nach einem Thema für diese Kolumne. Eben ist ein leicht angetrunkener Weihnachtsmann in seinem Coca-Cola-Kostüm, der lange dasaß, wieder auf die Straße gegangen, um Nüsse zu verteilen. Vielleicht sagt auch er zu den Kindern: »Erzähl mir doch was!«
Nein, lieber Egon, du bist nicht der einzige, der von mir – warum immer von mir? – eine Weihnachtsgeschichte erwartet. Es haben auch dieses Jahr wieder einige Zeitungen angerufen und gefragt, ob ich ihnen eine Weihnachtsgeschichte schreiben könnte.
Noch nie wurde mir eine Ostergeschichte abverlangt, noch nie eine Pfingstgeschichte.
Es gibt nur drei Arten von Geschichten: die Geschichten, die Kindergeschichten und die Weihnachtsgeschichten.
Und von keiner der drei Arten wissen wir so genau, wie sie zu sein haben, wie eben von den Weihnachtsgeschichten. Sie spielen in der Kälte, im Schnee, im Dunkeln – und sie haben mit jenem Ereignis vor 2000 Jahren in Palästina wenig zu tun.
Sehr wahrscheinlich war es der Stern von Bethlehem, der die Nacht nötig machte – und Nächte haben kalt zu sein, und schon sind die Nächte deutsch und verschneit und die Palmen werden zu Fichten.
Ich weiß, Egon, du möchtest nicht so eine Weihnachtsgeschichte von mir, sondern eine andere, eine ganz andere, die aber dann doch eine richtige Weihnachtsgeschichte sein sollte.
Geschichten erzählen ist umgehen mit Zeit. Eine Geschichte hat ihree Zeit, hat einen Anfang und ein Ende, wie das Leben.
Umgehen mit Zeit – die Weihnachtszeit, das klingt so schön: Zeit haben, die Zeit lang werden lassen – die Sehnsucht danach, nur zu sein und Zeit zu haben. Das muß auch mit dem Jahresende zu tun haben, mit dem verlorenen Jahr, mit der verlorenen Zeit: »Erzähl mir doch was, erzähl mir doch was« – eine lange Geschichte, eine Geschichte, die lange Zeit dauert, eine Geschichte über die lange Zeit, di längi Zyt, eine Geschichte über die Sehnsucht, die Sehnsucht, die uns die Zeit lang macht – längi Zyt.
Und solange erzählt wird, wird nicht geredet, wird nicht argumentiert, wird nicht gestritten – erzählen ist friedlich, und der wahre Frieden ist eine große und wunderbare Erzählung, eine Ahnung, eine Sehnsucht, ein Umgehen mit der langen Zeit.
Das ist es wohl, was uns in dieser Weihnachtszeit so streßt – nicht einfach die Einkäufe und die Umstände und das Gedränge im Warenhaus, sondern jetzt – am Ende des Jahres, am Ende eines Zeitabschnittes die Erinnerung daran, daß es eine Zeit gibt, eine Zeit, mit der wir umgehen sollten, die uns gehören sollte – aber wir haben sie verloren –, nun suchen wir sie und hetzen ihr nach. Aber die Zeit ist langsam und erreicht uns nicht mehr.
»Ja, ja – die heilige Zeit«, sagen die Leute und meinen damit nichts Schönes. Sie meinen damit, daß es mehr Betrunkene gibt in der Kneipe, daß die Leute unfreundlich werden, unfriedlich und bösartig – und sie reden und reden und reden.
Erzählen aber ist etwas anderes als reden – erzählen ist eine eigenartige Form von Schweigen, erzählen ist der Weg in die Stille.
Lieber Egon, selbstverständlich hast du ein Recht auf eine Geschichte – aber nicht nur der Zuhörer muß für sie die Stille finden, sondern auch der Erzähler.
Seit zwei Wochen suche ich diesen Weg in die Stille. Aber auch ich habe in dieser Zeit die Zeit verloren. Eine Geschichte wäre jetzt eine Lüge.
Aber erinnerst du dich, es kam schon vor, daß wir uns in der Beiz trafen, uns gegenübersaßen und schwiegen. Das kann wunderschön sein, mit jemandem schweigen zu können.
Das ist wie das Eintauchen in eine große Geschichte. Erzählen ist einüben in das Schweigen, und wir lassen für einmal diese Seite sozusagen eine weiße Seite sein: Weiß wie Schnee und weiß wie eine Weihnachtsgeschichte.
Die Weihnachtsgeschichten
25. Dezember, ob wir Christen sind oder nicht, wir kommen nicht um ihn herum. Wir sitzen da, und vielleicht ist es ein bißchen langweilig, vielleicht auch ein bißchen zu heiß – so viele Leute sind nur an Weihnachten in der Stube, es ist ein bißchen viel –, und dann die Kerzen, und auf die Heizung hätte man verzichten können.
Aber irgend etwas müßte doch jetzt geschehen: Man erinnert sich, man erinnert sich ein bißchen, und man hat fast alles vergessen. Aber dann beginnt Tante Sabine zu erzählen: »Wie hat er nur geheißen, der Schreiner – der hatte so eine Frau –, der war doch immer dabei. Spielt ja keine Rolle, wie er geheißen hat, aber ebenjener Schreiner – nein, nicht der Feierabend, das war ein anderer –, jener Schreiner also, wenn wir als Kinder in der Weihnachtszeit …«
Es ist so schrecklich, Tante Sabine hat ein so schlechtes Gedächtnis. Dabei hätte sie so viel zu erzählen. Und sie erzählt so schön.
Ich kannte einen, der hatte ein gutes Gedächtnis, ein hervorragendes sogar, nämlich ein absolutes. Alles, was er erlebte, prägte sich für immer in sein Gedächtnis, an alles erinnerte er sich so, wie wenn es gerade jetzt – eben in diesem Augenblick – geschehen würde. Jeder Zeitungsartikel, jedes Buch, das er gelesen hatte, war im Original in seinem Kopf gespeichert. Ich war ein Jüngling damals,