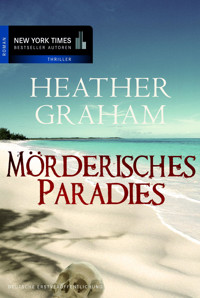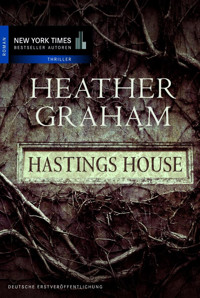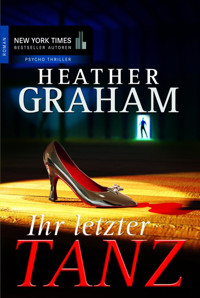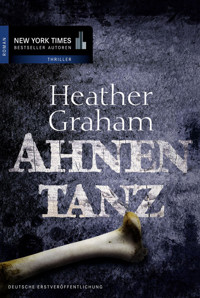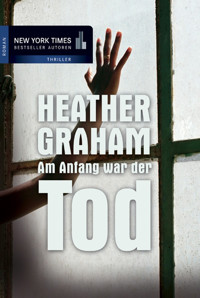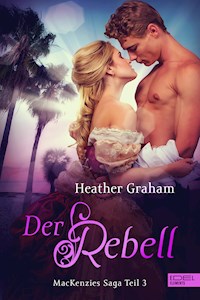Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: MacKenzies Saga
- Sprache: Deutsch
Was hat eine verwöhnte Nordstaaten-Schönheit wie Risa Magee nachts in den Sümpfen Floridas verloren - weit jenseits der feindlichen Linien? Jerome, ein berüchtigter Südstaaten-Rebell, fackelt nicht lange und nimmt sie gefangen. Doch bald erliegt er der Macht des Begehrens...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Was hat eine verwöhnte Nordstaaten-Schönheit wie Risa Magee nachts in den Sümpfen Floridas verloren - weit jenseits der feindlichen Linien? Jerome, ein berüchtigter Südstaaten-Rebell, fackelt nicht lange und nimmt sie gefangen. Doch bald erliegt er der Macht des Begehrens...
Heather Graham
Auf dem Schlachtfeld der Liebe
MacKenzies Saga Teil 4
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2020 by Heather Graham
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur
Covergestaltung: Eden & Höflich, Berlin.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-341-0
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
1
Biscayme Bay, Florida, Mai 1862
Die Nacht wirkte schwarz wie ein ewiger Abgrund und das Meer täuschend ruhig, beängstigend dunkel unter dem Wolkenhimmel. Hin und wieder sandte der Mond dünne Strahlen in die Finsternis. Außer dem Gluckern der Wellen, die gegen das kleine Boot schlugen und dem rhythmischen Geräusch der Ruder war nichts zu hören.
Plötzlich verstummte das Plätschern, und das Boot glitt langsamer zur Küste. »Warum rudern Sie nicht weiter?« fragte Risa Magee. Trotz ihrer Furcht hatte sie entschieden, daß dieser Krieg nicht mehr Menschenleben fordern durfte als unbedingt nötig.
»Für Sie würde ich alles tun, Risa«, seufzte Finn. »Aber das wäre reiner Wahnsinn.«
»Sie können mich doch nicht mitten in der Bucht absetzen!«
»Hier treiben sich Gauner, Diebe und Mörder herum – von feindlichen Rebellen ganz zu schweigen. Wenn St. Augustine auch von der Union besetzt ist, diese Halbinsel gehört den Konföderierten.«
»Machen Sie mir keine Schwierigkeiten, Finn. Sie müssen mich nur zur Insel bringen ...«
»Dafür könnte es zu spät sein«, unterbrach er sie. »In diesen Gewässern war ich schon lange nicht mehr. Aber ich habe gehört, die Blockadebrecher würden oft vorbeikommen. Vernünftige Leute wagen sich nicht mehr hierher, aus Angst vor unfaßbaren Greueltaten.«
»Unsinn!« erwiderte Risa ungeduldig. »Die Rebellen haben kein Schlangenvolk gezüchtet, das sich aus dem Meer erhebt und für sie kämpft.« Es war ein Fehler gewesen, Finn um Hilfe zu bitte. Aber wer hätte sie sonst in dieses Gebiet gebracht? Seit dem Ausbruch des Krieges lebte der rotblonde, sommersprossige junge Yankee in Florida, ein Bergungstaucher aus Boston – ein Opportunist, der keine Partei ergriff, aber immerhin ein anständiger Opportunist. In seiner Freizeit half er im Hospital von St. Augustine aus und machte Risa den Hof. Sein Interesse schmeichelte ihr, doch sie nahm ihn nicht ernst. Schon gar nicht jetzt, in diesen komplizierten Zeiten ...
Nachdem sie beschlossen hatte, Ian McKenzie in seinem Everglades-Domizil aufzusuchen, konnte ihr nur Finn helfen – ein Mann, der sich bestechen ließ und mit ihr die Küste hinabfuhr, ohne nach dem Grund ihrer gefährlichen Aktivitäten zu fragen. Und der General Magee, ihren Vater, nicht informieren würde.
»Wenn jemand wüßte, wohin ich Sie gebracht habe, Risa ...«
»Habe ich Ihnen nicht gesagt, Major McKenzie würde sich in dieser Gegend aufhalten? Deshalb bin ich hier.«
»Aber wenn es Ihrem Vater zu Ohren kommt ... Er stellt mich vors Kriegsgericht.«
»Das kann er nicht, weil Sie kein Soldat sind.«
»Oder er läßt mich erschießen!«
»Finn!« Sollte Papa jemals von dieser Eskapade hören, wäre der Teufel los, dachte sie schuldbewußt. Aber Finn müßte nichts befürchten, denn ihr Vater würde nicht herausfinden, daß sie den armen Kerl umgarnt hatte. Er würde lediglich seine Tochter einsperren und den Schlüssel ihres Gefängnisses wegwerfen. Zum Glück kämpfte der hochgeschätzte, erst vor kurzem beförderte General Magee gerade an General Grants Seite, in weiter Ferne. »Keine Bange, Finn, er wird nichts erfahren. Setzen Sie mich am Ufer der Insel ab, und ich kehre allein nach St. Augustine zurück.«
»Nein, das wäre sträflicher Leichtsinn. Sie müssen mich auf mein Schiff begleiten ...«
»Wenn wir unseren ganzen Mut zusammennehmen«, versuchte sie an seinen Stolz zu appellieren, »werden wir feststellen, warum die Rebellen erfolgreicher sind als die Yankees.«
Verlegen wich er ihrem eindringlichen Blick aus. »Sie sind unfair, Risa, und Sie ahnen nicht einmal, was wir wagen.«
Das wußte sie nur zu gut. Vor einiger Zeit hatte sie den US-Major Ian McKenzie geliebt. Sie waren verlobt gewesen. Doch das Schicksal hatte die Hochzeit verhindert. Er war mit einer anderen verheiratet worden. Und jetzt blieb ihr, einer Yankee, nichts anderes übrig, als allen Gefahren zu trotzen und einen Rebellenspion zu retten, die Mokassinschlange. Und Ians Frau zu schützen. Selbst wenn Risa nie vergessen konnte, wie sehr sie Ian einmal geliebt hatte, durfte sie nicht zulassen, daß seiner Frau ein Leid geschah. In grausamen Zeiten waren sie Freundinnen geworden und hatten ihr Leben füreinander riskiert. Nun mußte sie Alaina finden.
Auf den Kopf der Mokassinschlange war ein Preis ausgesetzt. Tot oder lebendig, vorzugsweise tot.
Und Alaina war irgendwo in der Nähe. Um Risa vor dem Biß eines giftigen Reptils zu bewahren, hatte sie sich dem Ungeheuer selbst ausgeliefert und danach im Fieberwahn erzählt, was sie beabsichtigte. Risa hatte sie nicht davon abhalten können, St. Augustine zu verlassen und ihre Spionage-Mission zu erfüllen. Aber sie wußte wenigstens, wann Alaina zurückkommen und wo sie eintreffen würde. Hier, in dieser Nacht.
Jetzt mußte sie Alaina aufspüren – oder Ian. Wenn sie ihn fand, würde sie ihm erklären, seine Frau sei der Spion, den er suche, und er solle sie in Sicherheit bringen, bevor ihr ein anderer Unionssoldat auf die Schliche kam. Sonst würde sie hängen.
»Sobald sich die Wolken auflösen, kann ich Belamar Isle sehen«, versicherte Risa.
»Bitte, wir müssen zurück ...« Finn unterbrach sich. »Hören Sie das?«
Angespannt lauschte sie. Plätschernde Ruderschläge. Ganz in der Nähe.
»Kehren wir um, Risa, sofort!«
»Das – kann ich nicht.« Direkt vor ihr lag Belamar Isle.
»Schauen Sie, der Meeresarm da drüben! Rudern Sie hin! In dieser stockdunklen Nacht wird uns niemand entdekken.«
Blitzschnell und erstaunlich leise tauchte er die Ruder ins Wasser.
An diesem von Natur aus gefährlichen Küstenstrich konnte man eine Menge Bergegeld verdienen, seit die ersten Spanier in die Neue Welt gesegelt waren. Unter den Wellen verbargen sich tückische Riffe und zerrissen die Schiffe unvorsichtiger Kapitäne. An manchen Stellen erstreckten sich glatte Strände, an anderen bildeten Mangroven ein dichtes Wurzelgeflecht. Subtropische Wälder umgaben unbewohnte Buchten, mannigfaltige Schlangen, Vögel und Insekten bevölkerten brackige Flüsse, die sich landeinwärts zogen.
Plötzlich stieß das Ruderboot gegen eine Wurzel. In einem Mondstrahl sah Risa das bleiche, sommersprossige Gesicht des jungen Yankees. Warnend legte er einen Finger an die Lippen. Sie saß reglos da und schaute sich um, bevor die Wolken den Mond wieder verhüllten. Offensichtlich war Finn ein tüchtiger Führer, denn er hatte sie in eine schmale Bucht gebracht. Die Insekten zirpten fast ohrenbetäubend. Beinahe schrie sie auf, als irgend etwas ihr Gesicht streifte. Doch es war nur ein Mangrovenzweig. In der Finsternis konnte sie die Bäume kaum erkennen.
Wieder wirbelte der unbekannte Ruderer plätscherndes Wasser auf. Dann herrschte eine Zeitlang Stille. Das andere Boot mußte sich ganz in der Nähe befinden, und die Insassen schienen zu lauschen, ebenso wie Risa und Finn. Schließlich wurde das Schweigen gebrochen. »Ah, die scharfen Ohren des Captains hören sogar einen Fisch in der Nacht schwimmen«, meinte ein Mann mit irischem Akzent.
»Er kann sehr gut zwischen einem Fisch und einem Ruderboot unterscheiden«, entgegnete eine andere Stimme.
»Aber der Captain ...«
»... hätte seine eigene Position niemals preisgegeben.«
»Hm ...«
In der nächsten Minute vernahm Risa nur den Insektenchor, bis ein neues Plätschern erklang. Hausten Krokodile in diesen Buchten?
»Wir müssen vorsichtig sein«, mahnte der zweite Mann. »Vor allem, weil die Maid of Salem in diesen Gewässern erwartet wird. Der Captain glaubt, ihre Fracht – für Key West bestimmt – würde ein paar tausend unserer Infanteristen mit Waffen versorgen. Außerdem müßte sie Morphium und Chinin an Bord haben. Seit New Orleans gefallen ist, können wir den Nachschub nur noch langsam durch den Staat transportieren, und der wird auf den Schlachtfeldern im Norden hochwillkommen sein.«
»Aye«, seufzte sein Gefährte mit dem irischen Akzent. »Allzugut sieht’s nicht aus, was, Matt?«
»Kein Krieg ist angenehm.«
»Was immer die Rebs sich auch aneignen, die Yankees sind viel besser dran. Mehr Soldaten, mehr Waffen.«
»Aber wir haben mehr Männer vom Kaliber des Captains – den alten Stonewall Jackson, Stuart und Lee. Den konnten die verdammten Yankees nicht schnappen. Unsere Truppen haben schon viele Siege errungen.«
»Und viele Niederlagen erlitten.«
»Hör zu jammern auf, Michael, das hilft uns nicht weiter.«
»Jedenfalls werden wir hier nichts finden. Kehren wir um.«
Als sich das feindliche Boot entfernte, atmete Risa erleichtert auf. Sie warteten noch eine Weile.
Über dem Wasser wehte eine kühle Brise. Risa fröstelte und spürte kalten Schweiß am Rücken. Würde ihr Plan scheitern? Wie sollte sie in diesen endlosen Sümpfen einen Mann oder eine Frau finden?
»Jetzt fahre ich zum Schoner zurück«, verkündete Finn entschlossen.
»Bitte ...« Abrupt verstummte sie. Ein neues Geräusch, ganz in der Nähe – ein zweites feindliches Boot, in der schmalen Bucht? Wer immer darin saß, hatte in unheimlichem Schweigen ausgeharrt, sich sogar vor den eigenen Landsleuten verborgen, und abgewartet, bis sie sich verraten würden. »Rudern Sie los, Finn!«
»Allmächtiger!« schrie er, als ein harter Schlag die Bootswand traf und Risa auf den feuchten Boden fiel.
»Wer ist da?« rief eine rauhe Stimme. Ein Streichholz flammte auf, Laternenlicht blendete Risa. »Reden Sie, und nehmen Sie sich in acht! Wir verfüttern alle Yankees an die Haie.«
Entsetzt hielt Risa eine Hand über ihre schmerzenden Augen. Ihr Herz schlug wie rasend, und sie brachte kein Wort hervor. Unsicher und stockend gab Finn eine Erklärung ab. »Nein, ich bin kein Yankee – ein Bergungstaucher ...«
»Und was hat ein Bergungstaucher hier zu suchen, mitten in einer dunklen Wolkennacht?« fragte eine andere, tiefere Stimme, die leicht belustigt klang. Ein gestiefelter Fuß stieg ins Boot, und Risa sah ein Entermesser schimmern. Unter der neuen Belastung schwankte der kleine Kahn heftig, aber der hochgewachsene Mann hielt mühelos sein Gleichgewicht.
Als einziges Kind eines Militärs hatte Risa eine Erziehung genossen, die ihr gewisse Vorteile verschaffte. In der Tasche ihres Rocks steckte ein Smith & Wesson-Repetier-revolver, und sie wußte ihn zu benutzen. Rasch zog sie ihn hervor, mit erstaunlich sicherer Hand. »Lassen Sie sich warnen, Sir – wir verfüttern alle Rebs an die Haie«, fauchte sie, von einer Kühnheit beflügelt, die sie selber verwirrte.
Doch das nützte ihr nichts. Ehe sie zielen konnte, wurde ihr die Pistole mit einem wuchtigen Säbelstreich aus der Hand geschlagen. Die Klinge ritzte ihr die Haut auf. In hohem Bogen flog die Waffe durch die Nacht, funkelte sekundenlang im Lampenlicht und fiel ins Wasser. Dann sah Risa wieder das feindliche Entermesser schimmern.
»Captain!« rief der zweite Mann. »Da kommt noch ein Boot, lauter Yankees ...«
Schüsse krachten, und Risa beobachtete ein heftiges Gefecht zwischen dem Boot, das vorhin davongefahren war, und einem anderen.
»In der Tat, es ist soweit. Bringen Sie die Gefangenen in Sicherheit«, befahl der Captain, »dann greifen wir in den Kampf ein.«
»Soll ich sie nicht lieber den Haien zum Fraß vorwerfen?« fragte sein Gefährte.
So viele Yankees ... Risas Gedanken überschlugen sich. War Ian McKenzie in ihrer Nähe? Würde er sie retten? Eine Hand über den Augen, versuchte sie am Lichtkreis der Laterne vorbeizuspähen, sah aber nur das bösartige Glitzern des Entermessers – und die schwarze Silhouette des feindlichen Captains.
Sicher ist es besser, wenn ich mich den Haien in einem Stück präsentiere, dachte sie. Im Boot, in der Gewalt der Rebellen, wäre sie verloren – im Wasser hatte sie vielleicht eine Chance. Als sie aufstand, schwankte der Kahn gefährlich.
»Was, in Gottes Namen ...«, begann der Captain. Im nächsten Moment erriet er ihre Absicht. »Nein, verdammte Närrin, warten Sie ...«
Entschlossen sprang sie über Bord. Er griff nach ihrem Arm, verfehlte ihn, bekam ihren Rock zu fassen und konnte ihn nicht festhalten. Doch er hatte sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert. Es gelang ihr zwar, im Wasser unterzutauchen, aber ihr Kopf schlug gegen das Boot, das Lampenlicht verblaßte, schwarzes Dunkel hüllte sie ein.
Risa erwachte und hörte ein Feuer knistern. Langsam öffnete sie die Augen. Sie erinnerte sich, daß irgend etwas gegen ihren Kopf geprallt war. Inzwischen hatte der Schmerz nachgelassen. Zunächst erschien ihr die Welt nebelhaft, dann erkannte sie ihre Umgebimg etwas klarer. Sie lag auf einem Sofa, in eine warme Decke gewickelt, ein weiches Kissen unter dem Kopf. Obwohl der Flammenschein nur gedämpftes Licht spendete, sah sie blankpolierte Bodenbretter aus Pinienholz und mehrere Teppiche. Vor dem Kamin standen ein paar Ohrensessel, Familienporträts säumten das Sims aus Korallengestein.
Eine Zeitlang fesselten die blaugoldenen Schatten der tanzenden Flammen ihren Blick. Und dann entdeckte sie ihn. Ihr Atem stockte, und sie wagte nicht, an ihr Glück zu glauben. Ian! O Gott, Ian! Sie war ins Meer gestürzt, und er hatte sie wunderbarerweise gefunden und vor dem sicheren Tod gerettet. Nun lehnte er am Kamin in seinem Salon, den Rücken ihr zugewandt, den dunklen Kopf gesenkt.
Offensichtlich war auch er vor kurzem im Wasser gewesen. Er trug nur seine feuchten Breeches, die sich an schmale Hüften und muskulöse Schenkel schmiegten. Auf den bronzebraunen breiten Schultern schimmerte der Widerschein des Feuers.
Zögernd richtete sie sich auf. Ihr Kleid war vermutlich zerrissen worden – zweifellos, als Ian sie aus dem Meer gezogen hatte. Nur die Unterhose, das Korsett und das zerfetzte Hemd bedeckten ihre Blößen. Doch ihre derangierte äußere Erscheinung störte sie nicht. Immerhin lebte sie noch. »Ian!« rief sie. Bevor er sich umdrehen konnte, sprang sie vom Sofa auf und umschlang ihn erleichtert mit beiden Armen, die Wange an seinem kraftvollen Rücken. In diesem Augenblick dachte sie nicht an seine Ehe. Von tiefer Dankbarkeit erfüllt, begrüßte sie einen alten Freund und Verbündeten. »Dem Himmel sei Dank, Ian! Beinahe hätten mich die elenden Rebellen in den Tod getrieben. Sie wollen ein Schiff kapern, das Nachschub nach Key West bringen soll. Darüber kann ich dir alles erzählen. Ich habe sie belauscht. Wahrscheinlich kämpfen sie gerade mit Spähtrupps in mehreren kleinen Booten. Aber deshalb bin ich nicht hier. Ian, du mußt unbedingt die Mokassinschlange fangen, so schnell wie möglich. O Gott, ich dachte schon, ich würde dich nicht rechtzeitig erreichen ...«
Zitternd hielt sie inne, um Atem zu holen. Da wandte er sich zu ihr. Aber sie sah sein Gesicht nicht, denn seine Hand strich über ihren Kopf und zog ihn an seine nackte Brust. Bittersüßer Schmerz erfaßte sie. Bei ihm konnte sie Trost finden. Weil sie jetzt Freunde waren. Früher hatte er sie geliebt – und dann Alaina geheiratet. Kein einziges Mal hatte Risa in seinen Armen gelegen. Dafür war sie zu tugendhaft gewesen. Und so hatte sie nur davon geträumt.
Nun gestattete sie sich – wenigstens für eine kleine Weile –, seine Finger in ihrem Haar zu spüren, seinen Duft einzuatmen, sauberes Salzwasser, Meeresluft, ein Hauch von Brandy ...
»Also planen die Rebellen, ein Yankee-Schiff anzugreifen?«
»Ja. Aber du mußt dich erst mal um Alaina kümmern. Tut mir leid, Ian – sie ist die Mokassinschlange. Während sie Fieber hatte, erzählte sie lauter wirres Zeug. Aber ich reimte mir die ganze Geschichte zusammen. Sie wollte Vorräte von den Inseln holen, irgendwo in dieser Gegend an Land gehen, und ich versuchte, ihr zu folgen. Nun fürchte ich, sie wird von jemandem gefangengenommen, der sogar eine Frau aufknüpfen würde. In diesem Krieg geschehen so gräßliche Dinge ... Bitte, Ian, du mußt sie finden und ihr diesen Unsinn ausreden.«
Sie fühlte, wie sich sein Körper anspannte, und bedauerte ihn zutiefst. Wenn er seine Frau auch der Spionage verdächtigt hatte – er wäre niemals auf den Gedanken gekommen, sie könnte die mysteriöse Mokassinschlange sein. Der Spion, den man mit aller Macht fangen wollte, tot oder lebendig ...
Krampfhaft schluckte sie. »Such Alaina, ich flehe dich an! Und deine Männer sollen die Union Navy vor einem skrupellosen Reb warnen, der die Maid of Salem kapern will, um Waffen und Medikamente zu stehlen. Wie schrecklich das alles ist!« Seine Finger schlangen sich in Risas Haar, und es beglückte sie, seine Nähe zu spüren. Könnte sie doch die grausamen Kämpfe vergessen – und seine Ehefrau, ihre beste Freundin ... »O Ian!«
»Pst, schon gut. Ich kümmere mich um Alaina.«
»Beeil dich ...« Seine Finger glitten über ihre Wange, und sie genoß die Liebkosung, obwohl sie kein Recht dazu hatte. Sie mußte sich losreißen. Aber sie zitterte am ganzen Körper, und die zärtlichen Hände beruhigten sie. »Nicht, Ian ...«, protestierte sie halbherzig. Sie waren nur Freunde. Und er tröstete sie. Noch ein paar Minuten – das würde keine Rolle spielen. Seine Haut, vom Feuer erhitzt, wärmte sie, und seine Arme besaßen die Kraft, die ihr fehlte. Behutsam streichelte er ihre Schultern.
»Nicht«, wiederholte sie mit schwacher Stimme.
»Ein elender Rebell will die Maid of Salem kapern«, murmelte er. »Das hast du gehört?«
»Ja, zwei Männer sprachen darüber. Kurz bevor deine Leute kamen – und der Bastard in mein Boot stieg.«
»Hm ...«
Sie senkte die Lider. Nun mußte sie sich endlich von der Umarmung befreien. Aber sie war so müde, und der Krieg machte ihr das Leben so schwer. An ihrer Wange spürte sie Ians vibrierende Muskeln. Als sein Finger ihr Kinn hob, öffnete sie die Augen nicht, wollte nichts sehen, nur noch ein kleines bißchen von der Vergangenheit träumen. Ians Mund berührte ihren.
So lange war es her. Seine Lippen, sanft und fordernd zugleich, überwältigten sie, seine Zunge begann ihren Mund zu erforschen. Verführerisch wanderte sein Hand über ihre Hüften, ihre Brüste und entzündete ein Feuer, trotz des Hemds und des Korsetts. Schwindelerregend wie Wein, unwiderstehlich ...
Das durfte sie nicht tun. Weil er Alaina geheiratet hatte. Risa versuchte, den Kopf zu schütteln. Doch seine Finger, in ihr Haar geschlungen, verhinderten die Bewegung, und ihre Lippen waren dem leidenschaftlichen Kuß hilflos ausgeliefert. Dann glitt sein Mund an ihrem Hals hinab, zu ihren Brüsten.
»Nein, Ian«
»Was hast du sonst noch gehört?«
Wollte er weitere Informationen sammeln, während sie verzweifelt gegen verbotene Gefühle kämpfte? »Hör auf, Ian!« fauchte sie erbost, stemmte beide Hände gegen seine Brust und öffnete die Augen. »Das ist unmöglich ...«
Entsetzt verstummte sie, immer noch in starken Armen gefangen – in den Armen eines Fremden. Sie hatte seine leise, tiefe Stimme vernommen, fast nur ein Flüstern im düsteren Flammenschein, den bronzebraunen Rücken gesehen. Aber dieser Mann war nicht Ian. Er besaß Ians blaue Augen, den gleichen Körperbau. Doch sie erkannte gewisse Unterschiede ... Höhere, etwas breitete Wangenknochen. Und ein rötlicher Glanz im dichten, glatten dunklen Haar. Eine gerade Nase, eine hohe Stirn ... Völle, sinnliche Lippen, noch feucht von jenem betörenden Kuß, verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. In seinem Gesicht vermischten sich indianische und klassische europäische Züge.
»Oh, mein Gott!« Vergeblich versuchte sie, sich aus der Umklammerung zu befreien. »Lassen Sie mich los! Sie sind nicht Ian – Sie sehen ihm nur ähnlich ...«
»Beruhigen Sie sich«, bat er und hielt sie eisern fest.
»Ich will mich nicht beruhigen!« zeterte Risa. »Wer sind Sie? Oh, Sie müssen mit Ian verwandt sein – ein Rebell, sein Feind ...«
Mit aller Kraft trat sie gegen sein Schienbein. Er unterdrückte einen Schmerzensschrei, hob sie hoch und warf sie aufs Sofa. Einen Augenblick später kniete er rittlings über ihren Hüften und neigte sich herab. Sie wollte ihn schlagen, aber er packte ihre Handgelenke und preßte sie zu beiden Seiten ihres Kopfes ins Kissen. Atemlos starrte sie ihn an. Diese Ähnlichkeit ... Natürlich wußte sie, daß Ian einen Verwandten hatte, in dessen Adern Seminolenblut floß, einen rebellischen Verwandten.
»Lassen Sie mich endlich los! Ich dachte, Sie wären Ian!«
»Tut mir leid. Bedauerlicherweise bin ich der elende Rebell, der die Maid of Salem zu kapern gedenkt. Das müssen meine Männer jetzt ohne mich erledigen. Also haben Sie mich mit Ian verwechselt, Miss Magee? Kein Wunder, ich bin sein Vetter.«
Miss Magee. Wieso kannte er ihren Namen?
»Welcher Vetter?« stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Jerome McKenzie. Was würde wohl geschehen, wenn Sie seinem Bruder Julian begegnet wären? Die beiden gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Vermutlich würden Sie mit ihm ins Bett sinken und Ihren Irrtum erst eine Stunde später bemerken.«
»Oh ...« Heller Zorn verlieh ihr ungeheure Kräfte. Blitzschnell befreite sie eine ihrer Hände und schlug in das bronzebraune Gesicht. Doch er griff sofort wieder nach ihrem Handgelenk und umklammerte es so fest, daß sie leise aufkeuchte.
»Wollten Sie Alaina tatsächlich retten – oder meinen Vetter nur auf die rebellischen Aktivitäten seiner Frau hinweisen?« In seinen dunkelblauen Augen funkelte unverhohlener kalter Spott, der ihr Angst einjagte. Aber warum sollte es sie interessieren, was er dachte – oder was er seinem Vetter erzählen würde? Nach Ians Hochzeit hatte sie nichts mehr mit ihm geteilt, außer der gemeinsamen Sorge um die Kriegsopfer.
»Bastard!« zischte sie. »Was Sie von mir halten, ist mir egal. Verstehen Sie nicht? Wenn Alaina in die Hände der Yankees fällt, wird man sie hängen. Ich bin hierhergekommen, um ihr Leben zu retten. Tun Sie doch was! Verständigen Sie Ihren Vetter! Oder lassen Sie mich gehen, damit ich ihr helfen kann!«
»Ich fürchte, in diesen Sümpfen werden Sie Ian nicht einmal aufstöbern, wenn ich Ihnen einen Spürhund und eine detaillierte Landkarte zur Verfügung stelle.«
»Immerhin habe ich meinen Weg bis hierhergefunden, Sie arroganter Kerl! Lassen Sie mich frei, und ich ...«
»O nein, Miss Magee. Ich werde mich um meinen Vetter und Alaina kümmern, und Sie gehen nirgend wohin.«
»Was? Sie können mich nicht festhalten.«
»Doch.«
Erschrocken schnappte sie nach Luft. »Heißt das – ich bin Ihre Gefangene?«
»Allerdings. Sie gefährden die nationale Sicherheit. Außerdem – wie wollen Sie in den Sümpfen am Leben bleiben?«
»Moment mal, Mr. McKenzie ...«
»Captain McKenzie, bitte. Von der Confederate States Navy.«
»Nun, mein Vater ist ein General – United States of America. Und er wird Sie jagen und vernichten«
»So?«
»O ja. Und ich bin beim Militär aufgewachsen. Ich kann überall am Leben bleiben, unter allen Bedingungen. Sobald ich Ihnen entronnen bin, werde ich die Union Navy über Sie informieren.«
»Das bezweifle ich.« Lächelnd beugte er sich noch tiefer herab, und ihr wurde schmerzlich bewußt, wie unzulänglich sie bekleidet war. O Gott, warum mußte dieser Rebell, dieser wilde Indianer seinem Vetter so ähnlich sehen?
»Sie werden mich gehen lassen«, flüsterte sie beklommen.
Als er den Kopf schüttelte, fiel eine dunkle Haarsträhne in seine Stirn, und Risa spürte den harten Druck seiner Schenkel auf ihren Hüften. »Verzeihen Sie, Miss Magee, aber wir befinden uns im Kriegszustand, und Sie gehören zu unseren Feinden.«
»Sie sind der Feind.«
»Mag sein. Je nachdem, wie man’s betrachtet. Jedenfalls sind Sie jetzt eine Gefangene der Konföderierten.«
»Nein, verdammt noch mal, ich werde fliehen.«
Belustigt erwiderte er ihren wütenden Blick. »Das wird Ihnen nicht gelingen, Miss Magee.«
2
Noch nie in ihrem Leben hatte Risa sich so unbehaglich gefühlt – derangiert, halb nackt, die Gefangene eines Rebellen. Und was sie am schlimmsten fand, er schien zu glauben, sie hätte nichts gegen die Situation einzuwenden, wenn er Ian wäre. Natürlich hatte es keinen Sinn, diesem elenden Schurken zu erklären, sie würde Ian ebensowenig in die Arme sinken. Dem Mann, der sie gewaltsam hier festhielt, brauchte sie überhaupt nichts zu erklären. Unglücklicherweise erhitzte seine Nähe ihr Blut, und sie mußte ihm möglichst schnell entrinnen.
»Wirklich nicht?« antwortete sie verächtlich. »Wollen Sie mich die ganze Nacht auf dieses Sofa pressen?«
Lächelnd hob er die Brauen. »Stellen Sie sich vor, ich wäre Ian. Dann wird’s Ihnen besser gefallen.«
»Oh, Sie unverschämter Kerl! Lassen Sie mich los! Wo bleibt Ihre Südstaatenehre, Sir?«
»Betrachten Sie’s als Gastfreundschaft eines Südstaatlers ...«
»Lassen Sie mich ...« Überrascht verstummte sie, weil er plötzlich aufstand. Sie kam nicht einmal dazu, aus eigener Kraft aufzuspringen, denn er ergriff ihre Hand und zog sie vom Sofa hoch. »Gehen Sie ins Gästezimmer. Dort finden Sie Kleider im Schrank, und dieser Raum ist ein etwas komfortableres Gefängnis. Vor der Tür steht ein Wachtposten, ein zweiter auf der Veranda, falls Sie so dumm wären, aus dem Fenster zu klettern. Zu Ihrer eigenen Sicherheit muß ich Sie warnen – das ist eine gefährliche Gegend, besonders für Leute, die sich hier nicht auskennen. Wenn Sie den Krieg überleben wollen, sollten Sie unsere Gastfreundschaft annehmen.«
»Warten Sie ...«
»Tut mir leid, ich muß mich beeilen, um Ian oder Alaina zu helfen. Sie sind doch hergekommen, um Alaina zu retten. Also halten Sie mich nicht auf.«
»Nur noch eine Frage. Wo ist das Gästezimmer?«
Er öffnete eine Tür, ließ ihr den Vortritt in einen Flur, folgte ihr lautlos und blieb ihr so dicht auf den Fersen, daß sie seinen Atem im Nacken zu spüren glaubte, wie den Hauch eines feuerspeienden Drachen. »Zur Linken«, sagte er kurz angebunden.
Zögernd betrat sie das Zimmer. Eine Lampe brannte auf einem Toilettentisch. Im Kamin mit dem hübschen Sims aus Korallengestein knisterte ein Feuer. Die Wände waren blau tapeziert. Auf dem Vierpfostenbett lag eine schöne Steppdecke. Ein Schrank, eine Truhe und ein Waschtisch hinter einem Paravent vervollständigten die Einrichtung. Als Risa sich in der Mitte des Raums umdrehte, sah sie Jerome auf der Schwelle stehen. Unsicher erwiderte sie seinen rätselhaften Blick.
»Wenn ich Ian und Alaina finde, würden Sie bedenken, daß die beiden verheiratet sind, Miss Magee?«
Mühsam bezwang sie ihren Zorn und schlang die Finger ineinander. »Hoffentlich denken Sie daran, wenn Sie Alaina begegnen, Sir.«
»Keine Bange, ich liebe sie wie eine Schwester.«
»Das freut mich«, bemerkte sie sarkastisch. Als er in den Flur trat und die Tür schließen wollte, erinnerte sie sich plötzlich schuldbewußt an ihren jungen Begleiter. »Einen Augenblick ... Was ist mit Finn geschehen?«
»Finn?«
»Mein Freund – der bei mir im Boot saß.«
»Ah, Finn ...« Betrübt schüttelte er den Kopf. »Wir müssen ihn hängen.«
»Machen Sie sich nicht lächerlich!« rief Risa bestürzt. »Was hat er denn verbrochen?«
»Wie ich bereits erwähnte, befinden wir uns im Kriegszustand. Und obwohl weder Sie noch mein unvernünftiger Vetter das zu berücksichtigen scheinen – dieses Gebiet gehört zu einem der Südstaaten. Ihr Freund Finn ist ein Yankee-Spion aus St. Augustine, nicht wahr?«
»Unsinn! Er ist nicht einmal Soldat – und sicher kein Spion.«
»Irgendwie fällt’s mir schwer, das zu glauben.«
»Verdammt, es ist die reine Wahrheit. Ich riskiere mein Leben, um eine Südstaatenspionin zu retten, und nun bedrohen Sie einen unschuldigen jungen Mann ...«
Seufzend verschränkte er die Arme vor der Brust. »Eine schwierige Situation. Wie ich zugeben muß, will ich ihn nicht hängen. Genausowenig möchte ich Sie gefangenhalten. Leider habe ich keine Wahl. Da Sie meine Männer belauscht haben und brisante Informationen besitzen, kann ich Sie nicht gehen lassen. Andererseits muß ich Ian und Alaina suchen. Aber ich darf Ihnen nicht gestatten, ein Blutvergießen heraufzubeschwören. Und deshalb sollten wir verhandeln.«
»Was? Ich verstehe nicht ...«
»Überlegen Sie mal, Miss Magee. Man hat mir erzählt, Sie seien halbwegs intelligent, obwohl Ihre Aktivitäten in dieser Nacht gewisse Zweifel aufkommen lassen ...«
»Wie können Sie es wagen!«
»Erlauben Sie mir, weiterzusprechen?«
»Nur wenn Sie mir versichern, daß ich nicht um das Leben eines Unschuldigen bangen muß.«
»Ihre verspätete Sorge ist wirklich lobenswert.«
Am liebsten hätte sie ihn geohrfeigt. Aber ihre Schuldgefühle hinderten sie daran, nachdem sie Finn tatsächlich vergessen hatte, trotz der beklagenswerten Umstände. Während Jerome McKenzie sie mit seinen unergründlichen blauen Augen musterte, fragte sie sich, ob er ihre Gedanken zu lesen vermochte.
»Sie wollen Ihren Freund am Leben erhalten«, fuhr Jerome McKenzie fort. »Also treffen wir eine Vereinbarung. Sie bleiben widerstandslos hier und machen meinen Männern und meiner Familie keinen Ärger. Und wenn ich zurückkomme, werden Sie sich nicht in die Arme meines Vetters werfen und ihn anflehen, Ihnen bei irgendwelchen Attacken gegen mich zu helfen. Verstanden?«
Fassungslos starrte sie ihn an. »Sie würden einen Menschen ermorden, falls ich mich weigere, Ihre Bedingungen zu erfüllen!«
»Wie wollen Sie wissen, was ich tun würde und was nicht?« entgegnete Jerome ausdruckslos. »Auf dieser Insel ist der Krieg mit besonderen Problemen verbunden. Nicht nur das Leben Ihres Freundes steht auf dem Spiel. Wenn Sie sich bei Ian beklagen, bringen Sie uns alle in Gefahr. Er ist der einzige Feind, den ich im Kampf fürchte – und ich bin der einzige, dem er niemals auf dem Schlachtfeld begegnen möchte. Tun Sie, was ich sage – dann dürfen Sie hoffen, daß Ian und Alaina den Krieg überleben werden.«
Als er die Tür schließen wollte, rief Risa: »Moment mal ... Lebt Finn noch?«
Jerome nickte.
»Schwören Sie’s?«
»Ja.«
»Wie kann ich Ihnen trauen?«
»Soeben habe ich Ihnen mein Wort gegeben.«
»Was zählt das Wort eines Mannes, der sich für einen anderen ausgibt?«
»O nein, Miss Magee, Sie haben sich gewünscht, ich wäre ein anderer. Zweifeln Sie nie an meinem Wort. Wenn ich etwas schwöre, kann man sich darauf verlassen. Und Sie?«
»Was meinen Sie?«
»Schwören Sie mir, keine Schwierigkeiten zu machen?«
»Das kann ich nicht ...«
»Sicher wäre Ihr Freund Finn tief betrübt, wenn er wüßte, daß Sie zögern, sein Leben zu retten.«
»Zum Teufel mit Ihnen ... Also gut, ich schwöre es!«
»Hoffentlich ist Ihr Wort ebensoviel wert wie meines. Und jetzt muß ich endlich gehen und Ian suchen – oder Alaina.«
»Aber wie soll ich das ertragen, untätig dazusitzen und zu warten – eine Gefangene in diesem Zimmer ...«
»Beten Sie darum, daß ich Ian und seine Frau bald finde. Denn Alaina treibt genauso gefährliche Spiele wie Sie.« Bevor sie ihn erneut zurückhalten konnte, schloß er die Tür.
Im Flur blieb er stehen, streckte seine Hände aus und sah sie zittern. Dieser verdammte Krieg – und die verdammte Rolle, die er darin übernommen hatte!
Zur Hölle mit Alaina, der kleinen Närrin, mit Ian, seinem ›Feind‹, und mit der albernen rothaarigen Schönheit, die er im Gästezimmer von Belamar gefangenhielt. Beinahe wäre sie gestorben. Er hatte befürchtet, nach ihrem unbedachten Sprung ins Meer wäre ihr Schädel beim Zusammenstoß mit dem Boot gebrochen. Und dann hatte sie, ehe er zu Wort gekommen war, seinen Plan erwähnt, die Maid of Salem zu kapern.
Jetzt kannte er Risa, die Frau, die Ian geheiratet hätte, wäre das Schicksal nicht dazwischengetreten. Bildschön und leidenschaftlich – und leichtsinnig. Anscheinend liebte sie seinen Vetter immer noch. Aber nun war sie Jeromes Gefangene und eine Gefahr für alle Beteiligten. Seine gutmütigen Eltern wollten demnächst ihr Heim im Norden verlassen und hierherkommen, um Alainas Anwesen zu hüten – eine Aufgabe, die sie übernehmen würden, während die restliche Familie auf verschiedenen Seiten kämpfte. Wenn Risa Magee seine Mutter oder seine Schwester um Gnade bat, würden ernsthafte Schwierigkeiten entstehen.
Wie auch immer, er mußte sich beeilen und Alaina retten. Doch er zögerte noch. Er hatte zu wenige Männer zur Verfügimg, um seine unvernünftige Gefangene streng bewachen zu lassen. Seine Drohung war nur ein Bluff gewesen. Und er beabsichtigte auch nicht, den armen Finn zu hängen. Aber wenn er Risa Magee belügen mußte, um sie von weiteren Aktivitäten im Dienste der Union abzuhalten, würde das sein Gewissen nicht belasten.
Sie durfte auf keinen Fall fliehen. Vielleicht gab es schmerzlose Maßnahmen, die sie daran hindern würden. Er lief aus dem Haus und erteilte seinen Männern die erforderlichen Befehle.
Eine Stunde lang wanderte sie im Gästezimmer auf und ab – zu rastlos, um sich zu setzen, zu nervös, um einen Fluchtversuch zu wagen.
Während das Kaminfeuer ihre spärliche feuchte Kleidung trocknete, fühlte sie sich immer unbehaglicher. Aus einem Impuls heraus öffnete sie den Schrank. Alaina war klein und zierlich, Risa ziemlich groß. Aber sie mußte ihre zerrissene Unterwäsche bedecken.
Wie sie bald feststellte, gehörten die Sachen im Schrank nicht ihrer Freundin. Sie fand eine Unterhose, ein Hemd und einige Kleider in ihrer Größe.
Auf dem Waschtisch stand ein Krug mit frischem Wasser. Rasch schlüpfte sie aus den schmutzigen Lumpen und wusch sich, dann trocknete sie ihren Körper ab und zog die Kleider an, die sie aus dem Schrank genommen hatte. Von wem stammten sie? Vielleicht hielt sich Ians Vetter eine Geliebte. Sehr gut. Hoffentlich würde die Frau in Wut geraten, wenn sie ihren geplünderten Schrank sah, und dem elenden Rebellen die Hölle heiß machen.
Oder war Jerome McKenzie verheiratet? Würde sich ein Ehemann so benehmen?
Das Blut stieg in Risas Wangen, als sie sich an den leidenschaftlichen Kuß erinnerte. Nein, daran wollte sie nicht denken. Sie mußte Pläne schmieden. Was genau hatte sie geschworen? Sie würde keine Schwierigkeiten machen. Nun, er war nicht mehr hier. Sie trat ans Fenster, öffnete die Vorhänge und schaute in die Nacht.
Inzwischen hatten sich die Wolken aufgelöst, ein heller Mond hing am indigoblauen Himmel. Sollte sie hinausklettern? Sie konnte unmöglich hierbleiben, und Jerome McKenzie würde wohl kaum ernsthaft erwarten, daß sie nicht fliehen würde. Aber während sie sich ihre Chancen ausrechnete, ging draußen jemand vorbei – ein Wachtposten, ein Gewehr an der Schulter. Diese Männer würden sie nicht erschießen – und Finn auch nicht hängen. Oder?
Auf Zehenspitzen schlich sie zur Tür, an die im selben Moment geklopft wurde. Risa zuckte zurück. »Ja?« rief sie unsicher.
»Darf ich reinkommen?« Eine leise weibliche Stimme. Alaina?
Hastig riß Risa die Tür auf. Eine hochgewachsene, schlanke Frau stand ihr gegenüber, eine exotische Schönheit mit rabenschwarzem Haar, goldbraunen Augen und ebenmäßigen Gesichtszügen. Als sie anmutig eintrat, wurde sie von zartem Parfumduft umweht. Auch in ihren Adern floß Indianerblut, was Risa sofort erkannte. Das mochte ihr diesen ungewöhnlichen Reiz verleihen.
Mißtrauisch wich Risa vor ihr zurück. In diesem Haus konnte jeder ihr Feind sein. »Guten Abend, Miss Magee. Ich bin Jennifer, Ians Kusine und Jeromes Halbschwester.«
Jennifer? Diesen Namen kannte Risa. Alainas gute Freundin, deren Mann zu Beginn des Krieges bei Manassas gefallen war. Dieser Verlust hatte sie schmerzlich getroffen.
»Natürlich – Jennifer«, murmelte Risa. »Freut mich ...«
»Jerome hat erklärt, Sie würden uns verlassen, sobald er zurückkommt. Eigentlich dachte ich, Sie würden schon schlafen. Bitte, verzeihen Sie die Störung – ich wollte sehen, ob Sie etwas Passendes zum Anziehen gefunden haben. Er sagte, Sie seien mit Ihrem Boot verunglückt. Tut mir leid. Es war so tapfer von Ihnen, Alaina zuliebe hierherzukommen. Welch eine treue Freundin Sie sind ... Kein Wunder, daß Ian soviel von Ihnen hält! Und Alaina mag Sie auch sehr gern. Anfangs war sie furchtbar eifersüchtig auf Sie. Doch dann schrieb sie uns, wie lieb und gut Sie sind ... O Gott, da stehe ich herum und schwatze. Aber der Krieg verwirrt uns alle ein bißchen. Ich habe ein Dinnertablett für Sie vorbereitet. Und da Sie noch wach sind, will ich’s Ihnen bringen.«
»Danke«, erwiderte Risa. »Bleiben Sie bitte hier – und reden Sie mit mir.« Ein Bootsunfall! Also wirklich!
»Erst mal hole ich das Tablett ...«
»Bemühen Sie sich nicht. Ich kann in der Küche essen – oder im Speisezimmer.«
»Oh, das macht mir keine Mühe.« Jennifer eilte in den Flur, und Risa wollte ihr folgen. Aber da trat ihr einer von Jerome McKenzies jungen Seemännern in den Weg, ein hübscher rotblonder Bursche.
»Entschuldigen Sie, bitte.« Sie versuchte sich an ihm vorbeizuschieben. Doch das ließ er nicht zu.
»Tut mir leid, Ma’am.«
Enttäuscht kehrte sie ins Gästezimmer zurück. Wenig später trat Jennifer mit dem Tablett ein, das verlockende Düfte verströmte, und stellte es schwungvoll aufs Bett. »Frischer Schnappbarsch mit Zitronenscheiben, aufgebackenes Brot, Tomatensalat und eine Key-Limonenpastete, aus den Früchten der speziellen kleinen Limonenbäume von Belamar. Ach ja, und Jerome meinte, Weißwein würde am besten zum Fisch schmecken.«
»Möchten Sie nicht mit mir essen ...« Risa hörte einen schrillen Schrei und unterbrach sich verwirrt.
»Das wird mein kleiner Sohn Anthony leider nicht gestatten«, entgegnete Jennifer lächelnd und ging zur Tür. »Guten Appetit«, fügte sie freundlich hinzu, als wäre Risa ein willkommener Gast.
Hinter ihr blieb die Tür offen, und Risa rannte in den Flur. Aber da stand nach wie vor der junge Seemann.
Wortlos schloß er die Tür, und sie lehnte sich erbost dagegen, von dem unvernünftigen Impuls erfaßt, das Dinnertablett quer durchs Zimmer zu schleudern. Doch dafür war sie viel zu hungrig. Sie setzte sich aufs Bett und begann zu essen. Der Fisch schmeckte köstlich. Durstig griff sie nach dem Weinglas.
Dann jedoch zögerte sie. Jeromes Gastfreundschaft ... Lieber würde sie ihm den Wein ins Gesicht schütten! Sie nippte daran. Ein ausgezeichneter Tropfen. Offenbar war der Rebell ein Weinkenner. Nun, immerhin hieß er McKenzie, wenn er auch einem etwas wilderen Familienzweig entstammte. Sie aß weiter und redete sich ein, sie würde die Mahlzeit aus feindlicher Hand nur akzeptieren, um Kräfte für ihre Flucht zu sammeln.
Danach stellte sie das Tablett auf den Toilettentisch und begann wieder umherzutigern. Für Alaina hatte sie ihr Bestes getan. Nun mußte sie ihre Landsleute erreichen, um sie vor der geplante Attacke auf die Maid of Salem zu warnen.
Plötzlich wurde ihr schwindelig. Sie wankte zum Bett und sank auf die Steppdecke. Ihr wurde schwarz vor Augen. In diesem Zustand konnte sie nicht fliehen. Und genau das hatte man bezweckt.
Eine Droge – im Wein ...
Wie aus weiter Ferne hörte sie das Türschloß rappeln und versuchte, die Augen zu öffnen.
»Ah – sie schläft«, sagte eine sanfte Frauenstimme.
»Offensichtlich«, bestätigte die Stimme eines Mannes. Tief, ein bißchen rauh. Jerome McKenzie war zurückgekommen.
Verzweifelt kämpfte Risa gegen eine neue Ohnmacht an. Sie mußte wissen, was geschehen war. Doch sie konnte ihre Lider nicht heben und brachte kein Wort hervor.
»Sobald sie aufwacht, nehme ich sie mit.«
»Armes Mädchen! Was glaubst du, wie sie sich auf einem Rebellenschiff fühlen wird?«
»Sie versteht die Situation.«
»Mußt du uns schon wieder verlassen?«
Die Tür wurde geschlossen, und Risa hörte nichts mehr. Vergeblich bemühte sie sich, wach zu bleiben. Nach wenigen Sekunden schwanden ihre Sinne.
Geräusche. Stimmen. Irgendwo im Flur. Diesmal gelang es ihr, die Augen zu öffnen. Mühsam hob sie den Kopf, der sich wie Blei anfühlte.
»Anscheinend geht’s ihr gut.«
O nein, dachte sie. Doch dann merkte sie, daß man nicht über sie sprach.
Jennifer redete mit einer älteren Frau, die ihr eine Antwort gab, und Risa erkannte jene sanfte, leise Stimme wieder. Nun mischte sich ein Mann ein, und ihr Herz schlug schneller.
Ian! Endlich!
»Macht euch keine Sorgen«, sagte die ältere Frau. »Die Wunde ist sauber, der Puls schlägt normal. Schau doch, Ian, sie atmet tief und gleichmäßig. Zum Glück wurde sie nicht allzu schwer verletzt.«
Erleichtert seufzte Risa auf, als sie dem Gespräch entnahm, von wem die Rede war. Alaina.
Also hatte Jerome seinen Vetter und dessen Frau gefunden. Jetzt konnte er seine Gefangene nicht länger festhalten. Sie wollte aufstehen. Doch da begann sich der Raum zu drehen.
Wieder Stimmen. Draußen vor der Tür. Jerome McKenzie, der mit dem Wachtposten sprach.
»Schläft Miss Magee?«
»Wie ein Lämmchen, Captain.«
»Bringen Sie das Boot mit dem Nachschub zur Lady Varina. Im Morgengrauen gehe ich an Bord. Was ist mit der Maid of Salem?«
»Die steuert hierher, und ihr Begleitschiff ist in den Untiefen auf Grund gelaufen – so wie Sie’s unseren Männer befohlen haben, Captain. Zum Glück war der Kapitän klug genug, um sofort zu kapitulieren, und er versicherte unseren Leuten, die Beute, die wir suchen, sei unterwegs, mit planmäßigem Kurs.«
»Verluste? Verletzungen?«
»Beim ersten Schußwechsel wurde ein Yankee getötet, und eine Kugel traf Jimmy Meyers ins Bein. Ein glatter Durchschuß. Wenn er morgen in nüchternem Zustand aufwacht, ist er wieder putzmunter.«
»Und die Yankees?«
»Gestrandet, Sir, mit genug Wasser- und Lebensmittelvorräten. O’Hara dachte, Sie würden die Landsleute der armen Schiffbrüchigen verständigen, damit sie abgeholt werden können – nachdem wir die Maid of Salem gekapert haben.«
Dann herrschte wieder Stille. Behutsam richtete Risa sich auf, blinzelte und schüttelte den Kopf. Jede winzige Bewegimg fiel ihr unendlich schwer. Großer Gott, welche Droge hatte man ihr verabreicht? Aber sie mußte aufstehen und verschwinden – oder Ian finden.
Irgendwie schaffte sie es, aus dem Bett zu steigen. Sie wankte zur Tür und öffnete sie. Kein Wachtposten, dem Himmel sei Dank! Während sie sich mit einer Hand an der Wand entlangtastete, folgte sie dem Flur im Schneckentempo und bekämpfte ein heftiges Schwindelgefühl. Plötzlich erstarrte sie. In ihren Augen brannten unerklärliche Tränen, als sie Ians Stimme hörte. Sie blieb im Dunkel stehen und spähte in den Salon, wo die zwei Vettern vor dem Kamin standen.
Nun wußte sie, warum sie Jerome beim Anblick seines Rückens für Ian gehalten hatte. Beide waren gleich groß, breitschultrig und muskulös, abgehärtet vom Krieg, in dem sie seit zwei Jahren kämpften. Aber jetzt sah sie in Jerome McKenzies Gesicht mit den hohen Wangenknochen das indianische Erbe noch deutlicher. Ein faszinierendes Gesicht, im rötlichen Feuerschein ...
»Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll«, seufzte Ian.
Jerome zuckte die Achseln und grinste etwas verlegen. »Manchmal ist Blut dicker als der Krieg.«
»In der Tat. Und ich wünschte, wir könnten den Kampf beenden.«
»Das geht nicht«, erwiderte Jerome leise.
»Nein, natürlich nicht. Tante Teela sagte, Risa würde noch schlafen, und ich möchte sie nicht stören. Richtest du ihr aus, ich wäre ihr von ganzem Herzen dankbar?«
»Das weiß sie ohnehin.«
»Segelt sie mit dir?«
»Das haben wir doch schon besprochen. Ich will sie möglichst bald auf neutralen Boden bringen.«
»Risa – auf einem feindlichen Schiff?«
»Sie versteht, in welcher Position ich mich befinde.«
»Gewiß, Risa versteht alles«, meinte Ian.
O nein, protestierte Risa stumm. Wie traurig seine Stimme klang ... Er liebte seine Frau. Aber er hat auch mich geliebt, dachte sie, und mit mir von der Zukunft geträumt. Vor so langer Zeit ...
Er schüttelte Jeromes Hand. »Nun will ich mich verabschieden. Ich muß meine Männer wissen lassen, daß ich am Leben und unverletzt bin. Kümmert euch inzwischen um Alaina.« Zögernd fügte er hinzu: »Und um Risa. Wahrscheinlich wird sie Höllenqualen ausstehen. Sie ist eine überzeugte Unionsanhängerin. Trotzdem wird sie dich auf dein Schiff begleiten und nicht zulassen, daß wir einander ihretwegen töten.«
Von glühendem Zorn erfaßt, beobachtete Risa die beiden Männer. Offenbar hatte sie nach Luft geschnappt, denn sie wandten sich zur Tür. Jerome sah sie im Schatten stehen und eilte zu ihr. Als sie schwankte, legte er einen Arm um ihre Taille. »Oh, Sie sind erwacht, Miss Magee.«
»Erstaunlich, nicht wahr?«
Seine Augen verengten sich, und sein kraftvoller Körper versperrte ihr die Sicht auf Ian. »Allerdings«, stimmte er zu, so leise, daß Ian nichts hörte. »Wagen Sie bloß nicht, meinen kriegsmüden Vetter um Hilfe zu bitten. Sie haben mir Ihr Wort gegeben, Miss Magee. Halten Sie sich dran, oder ich hänge Sie eigenhändig auf, mit den Füßen nach oben!«
»Drohen Sie mir?«
»Nicht nur das. Keine Sekunde lang würde ich zögern, meine Drohung wahr zu machen.«
»Sie haben mich mit einer Droge betäubt!«
»Leider war’s nötig. Verzeihen Sie mir. Aber die Droge war offensichtlich zu schwach. Benehmen Sie sich vernünfig, ich warne Sie.«
Ehe sie antworten konnte, kam Ian zu ihnen. »Risa, wie gut, daß du erwacht bist!« Mitfühlend betrachtete sie seine eingefallenen Wangen, die glanzlosen Augen. Er war durch die Hölle gegangen.
»Vielen Dank, meine Liebe.« Er befreite sie von Jeromes Arm und zog sie an seine Brust, mit der tiefen Zuneigung eines guten Freundes.
»Alaina ist gerettet – nur das zählt.«
»Aber nun mußt du mit meinem Vetter segeln, diesem schurkischen Rebellen«, sagte er sanft. Sie spürte seine Lippen auf ihrer Stirn, dann wurde sie von ihm weggerissen, und Jerome umschlang wieder ihre Taille. »Wir müssen aufbrechen, Ian.«
Besorgt strich Ian über Risas Wange. »Bist du sicher, daß du ...«
Jetzt könnte sie ihn um Hilfe bitten. Natürlich würde er sich verpflichtet fühlen, sie in seine Obhut zu nehmen. Da sie Jeromes Pläne kannte, durfte er sie nicht freilassen. Und wenn sie ihn verriet, würde womöglich Blut fließen – in diesem Salon. »Alles in Ordnung, Ian.« Beinahe erstickte sie an diesen Worten. Er berührte ihre Schulter, und sie schloß die Augen. Verzweifelt zwang sie sich, nicht daran zu denken, was geschehen wäre, wenn ... Als sie die Lider hob, war er verschwunden. »Wo ...«, flüsterte sie.
»Wann immer wir uns trennen, weiß keiner von uns, wohin der andere geht«, entgegnete Jerome. »Danach fragen wir nicht. Belamar ist uns heilig, für alle McKenzies neutraler Grund und Boden. Jetzt müssen auch wir beide das Haus verlassen, Miss Magee.«
»Warten Sie, ich habe Alaina noch nicht gesehen – und ich bin so schwach ...«
»Immerhin waren Sie stark genug, um durch den Flur hierherzuschleichen. Wollten Sie meinen Vetter bitten, Sie aus der Gefangenschaft zu befreien und sich gegen mich zu stellen?«
»Nein, ich versuchte nur ...«
»Zu fliehen? Obwohl Sie mir Ihr Wort gegeben haben? Erinnern Sie sich? Sie haben geschworen, keinen Ärger zu machen, wenn ich Ihren Freund am Leben lasse.«
»Nein, ich wollte nicht fliehen – ich ging einfach nur den Flur entlang. Aber ich warne Sie – wenn Sie Finn was angetan haben ...«
»Lügen Sie nicht, Miss Magee. Natürlich haben Sie einen Fluchtversuch unternommen. Und danken Sie dem Himmel, daß ich Ihrem Schwur mißtraut und kein Menschenleben riskiert habe.«
»Wie können Sie es wagen, so mit mir zu reden ...«
»Oh, ich wage sehr oft, die Wahrheit auszusprechen.«
»Gewiß – was Sie für Wahrheit halten! Ich begleite Sie nicht. Mir ist schwindlig, und ich ...«
»Tut mir leid, Sie müssen mit mir kommen.«
»Dafür bin sich zu schwach ...«
»Hören Sie zu jammern auf!« unterbrach er sie ungeduldig. Kobaltblaue Augen starrten sie an. »Sobald wir die Maid of Salem gekapert haben, lasse ich Sie frei.«
Dann nahm er sie auf die Arme, obwohl sie vehement protestierte, und trug sie in die Morgendämmerung hinaus.
3
In einem kleinen Boot fuhren sie von Belamar zum tiefen Gewässer der Bucht, und Risa überlegte, ob sie ein zweites Mal hineinspringen sollte. Selbst wenn sie nicht entkam, würde sie dem Captain so viel Ärger machen, daß er sie vielleicht loswerden wollte. Bei diesem Gedanken drehte sie sich zu Jerome McKenzie um, der hinter ihr saß, ruderte und grimmig lächelte.
Entschlossen stellte er einen gestiefelten Fuß auf ihren Sitz und klemmte den Rock ihres Kleids ein. »Verzichten Sie lieber auf ein Bad. Die Zeit drängt.«
»Wo ist Finn?« fragte sie.
»Das werden Sie bald sehen.«
»Sie haben versprochen, er würde am Leben bleiben.«
Für eine Minute hörte er zu rudern auf und beugte sich vor. »Und ich pflege mein Wort zu halten, Miss Magee. Sie sind es, der man nicht trauen darf. Da sind wir. Die Lady Varina, früher die Mercy. Sie wurde umgetauft.«
Im schwachen Morgenlicht tauchte das Schiff aus rosigen Nebelschleiern auf, wie ein Geist. Der Name einer vornehmen Dame wie Varina, mit Präsident Davis von der Konföderation verheiratet, paßte zu dem schönen, eleganten Schoner, der anmutig auf den Wellen schaukelte. Während Jerome näher heranruderte, entdeckte Risa fünf Geschütze an der Steuerbordseite. Zweifellos würden sich fünf weitere an der Backbordseite befinden.
Sie versuchte sich einzureden, kampfstarke Schiffe von der Union Navy könnten diesen kleinen Rebellenschoner mühelos versenken. Aber da sie in militärischen Kreisen aufgewachsen war, kannte sie die Vorteile schneller, wendiger Schiiffe.
Sobald sie die Steuerbordseite erreichten, wurde eine Strickleiter herabgelassen. Risa erhob sich, und das kleine Boot schwankte gefährlich. Von kalter Panik erfaßt, wollte sie sich lieber dem Meer anvertrauen, statt mit dem Captain und seiner Besatzung davonzusegeln. Aber Jerome stand dicht hinter ihr, balancierte den Kahn aus und legte ihre Hände auf eine Sprosse der Strickleiter. So blieb ihr nichts anderes übrig, als hinaufzuklettern.
Der rotblonde Bursche, der sie auf Belamar bewacht hatte, begrüßte sie und half ihr an Deck. Rasch schaute sie sich um und zählte die Besatzungsmitglieder. Fünfzehn Mann. Wahrscheinlich waren noch mehr an Bord und bereiteten die Abfahrt vor. Die Leute trugen keine Uniformen, nur schäbige Hemden und Hosen, und die meisten waren ziemlich jung. Doch sie sah auch ein paar Graubärte. Barfuß standen sie auf den Planken, musterten Risa und erwarteten die Ankunft ihres Captains.
Geschmeidig schwang er sich über die Reling und trat neben seine Gefangene. »Gentlemen, für einige Zeit haben wir einen Gast in unserer Mitte. Wenn die Dame auch alles verabscheut, wofür wir kämpfen, werden wir ihr beweisen, daß die Gastfreundschaft der Südstaatler kein Mythos ist. Kurz gesagt, sie muß bei uns bleiben, trotz ihrer fatalen Neigung, im Meer zu baden. Segeln wir los, Hamlin.«
Ein großer, schlanker Mann mit silbernen Strähnen im dunklen Haar salutierte lächelnd. Respektvoll nickte er Risa zu, dann gab er der Besatzung seine Befehle.
»Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihr Quartier.« Risa spürte Jeromes Hand auf ihrer Schulter. Trotz ihrer mißlichen Lage bewunderte sie das schöne Schiff. Er führte sie an den Männern vorbei, die geschäftig umhereilten, drei Stufen hinab und in die Kapitänskabine.
Im gedämpften Morgenlicht brannte eine hübsche kugelförmige Lampe auf einem Eichenschreibtisch. Zur Linken war eine Koje in die holzgetäfelte Wand eingebaut, von Regalen voller Bücher und Kristallkaraffen umgeben. Seltsamerweise befand sich eine kleine Tür neben der Koje. Davor stand ein wuchtiger lederner Ohrensessel. Auf der anderen Seite der Kabine sah Risa weitere Regale, einen Schrank und eine Bullaugenreihe mit geschlossenen kobaltblauen Vorhängen. Die exquisite, geschmackvolle Einrichtung paßte nicht zu einem Kriegsschiff und erinnerte eher an ein Handelsschiff.
»Nun?« fragte Jerome höflich, und sie wandte sich zu ihm. Seine Arroganz stand ihm gut. In einem weißen Hemd, am Kragen geöffnet, engen Breeches, einem dunkelgrauen Gehrock und blankpolierten Stiefeln war er ganz der Herr seines Schiffs – und seines Schicksals.
Doch sie hatte nicht vor, ihm Komplimente zu machen. »Gehört Ihre zerlumpte Besatzung wirklich der Confederate Navy an?«
Sein leises, rauhes Gelächter beschleunigte ärgerlicherweise ihren Puls. »In der Konföderation müssen wir uns mit dem begnügen, was wir haben, Miss Magee. Bedenken Sie – die Union begann diesen Krieg mit der achtzigjährigen Erfahrung eines geeinten Landes, während wir uns zunächst ohne Regierung, ohne finanzielle Mittel, ohne Army und Navy zurechtfinden mußten. Verzeihen Sie uns den Mangel an schneidigen Uniformen.«
Seine Gelassenheit verwirrte sie, denn sie hätte ihn gern in Wut gebracht. »Und das ist wohl mein Gefängnis? Wenn ja, sehe ich außer der Tür keinen Fluchtweg. Also können Sie mich beruhigt allein lassen und Ihr Schiff kommandieren.«
»Ganz recht, das ist Ihr Gefängnis.« Mehr sagte er nicht, aber nun las sie unverhohlenen Zorn in seinen blauen Augen. Abrupt ging er hinaus, schloß die Tür hinter sich, und sie erkannte verwirrt, daß sie nicht auf sein plötzliches Verschwinden vorbereitet gewesen war. Sie hatte gehofft, ihn zu provozieren, einen Streit herauszufordern. Warum, wußte sie nicht genau. Aber sie empfand eine vage Angst, die sie sich allerdings nicht eingestehen durfte. Sie war immerhin die Tochter eines Generals.
Eine Zeitlang stand sie nachdenklich da, bis sie von einem heftigen Ruck quer durch die Kabine geschleudert wurde und in der Koje landete. In den letzten Monaten war sie lange genug an Bord eines Schiffes gewesen, auf der Fahrt von Washington nach St. Augustine, dann zur Biscayne Bay. Hoffentlich wurde sie jetzt nicht seekrank – das wäre zu peinlich. Reglos blieb sie liegen und spürte, wie das Schiff immer schneller über die Wellen segelte. Sie schloß die Augen. Allmählich gewöhnte sie sich an die rhythmischen Schwankungen und schlief ein.
Als sie erwachte, fühlte sie erneut die sanfte, tröstliche Bewegung. Dann erinnerte sie sich wieder, daß sie gefangen war, an Bord eines feindlichen Schiffs. Hastig setzte sie sich auf – etwas zu schnell, und ihr wurde schwindlig. Doch das Unbehagen ließ bald nach, und sie stieg vorsichtig aus der Koje.
Wie spät machte es sein? Zwischen den Vorhängen drang helles Licht hindurch. Also mußte sie mehrere Stunden geschlafen haben. Sie rieb sich den Nacken.
Neugierig betrachtete sie den Schreibtisch und überlegte, welche Korrespondenz in den Schubladen verwahrt wurde. Jetzt war sie gefangen. Doch das würde sich ändern, und wenn sie entkam ...
Sie setzte sich hinter den massiven Eichenschreibtisch, öffnete das oberste Schubfach und entdeckte einen Stapel Briefe. Sicher würden sie wichtige Informationen enthalten. Eifrig sah sie die Papiere durch. Zu ihrer Enttäuschimg fand sie nur Privatbriefe. Der erste stammte von Ians Schwester Tia, die erklärte, sie würde sich gern nützlich machen und zusammen mit ihrem Bruder in seinem behelfsmäßigen Lazarett am St. Johns arbeiten. Den zweiten Brief hatte Jerome McKenzies Schwester Sydney geschrieben, wohnhaft in Charleston, den dritten sein Bruder Brent, den man wegen eines dringenden medizinischen Problems nach Richmond berufen hatte.
Während Risa die Briefe studierte, entsann sie sich, daß sie militärische Anhaltspunkte suchte, und es war zweifellos ungehörig, in der Privatpost des Captains herumzuschnüffeln. Aber Brents Brief interessierte sie sehr. Trotz ihrer Gewissensbisse las sie weiter.