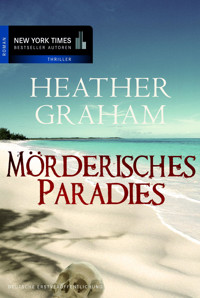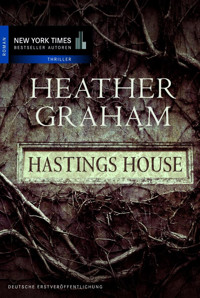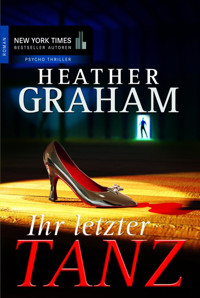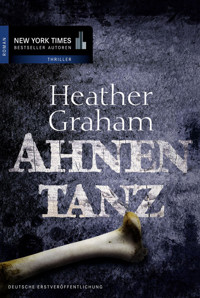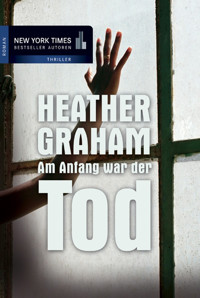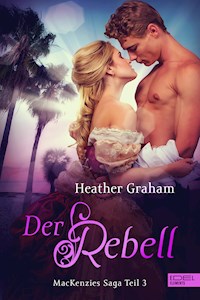Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: MacKenzies Saga
- Sprache: Deutsch
Als die wohlbehütete Teela Warren, eine auffallende Schönheit aus dem Süden, nach Florida kommt, erliegt sie alsbald dem verführerischen, exotischen Flair dieses in blutige Indianerkämpfe verstrickten Grenzlandes. Der Mischling James McKenzie ist der attraktivste Mann, den Teela je gesehen hat. Sie sind Feinde von Geburt an, doch das Schicksal macht sie zu Liebenden. James verbotene Leidenschaft entzündet Teelas heißblütiges Herz, allen Gefahren zum Trotz, in die der verheerende Krieg sie hineinreißt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Als die wohlbehütete Teela Warren, eine auffallende Schönheit aus dem Süden, nach Florida kommt, erliegt sie alsbald dem verführerischen, exotischen Flair dieses in blutige Indianerkämpfe verstrickten Grenzlandes.
Der Mischling James McKenzie ist der attraktivste Mann, den Teela je gesehen hat. Sie sind Feinde von Geburt an, doch das Schicksal macht sie zu Liebenden. James verbotene Leidenschaft entzündet Teelas heißblütiges Herz, allen Gefahren zum Trotz, in die der verheerende Krieg sie hineinreißt.
Heather Graham
Verstrickung des Herzens
MacKenzies Saga Teil 2
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2020 by Heather Graham
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Meller
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-338-0
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Die Geschichte Floridas
PROLOG
GEFANGEN
Florida, Anfang Herbst 1837
Sie war dem Tod so nahe, daß sie das Metall der Klinge fast schmeckte, die ihren Hals bedrohte, den pulsierenden Strom ihres eigenen Blutes beinahe spürte ...
Aber dann ertönte ein durchdringender Ruf, und der Krieger, der sie ermorden wollte, hielt inne. Der Stahl berührte ihre Kehle nicht mehr, und der Befehl ließ das Geschrei der Indianer verstummen. Eben erst hatten sie die Schlacht gewonnen, und sie feierten den Sieg, stahlen ihren Opfern Schmuck und Münzen, ermordeten oder skalpierten sie, gaben grausam verstümmelten Gestalten den Gnadenstoß.
Jetzt erstarrten sie alle, tiefe Stille sank herab. Teela schaute den Krieger an, das tintenschwarze Haar, den nackten, mit Bärenfett beschmierten Körper, die haßerfüllten dunklen Augen.
Sie haßte ihn allerdings genauso. Sie hatte nichts mit dem Trupp der U.S. Army zu tun und sich den Soldaten nur angeschlossen, um diesen gräßlichen Ort zu verlassen. Grauenvoll – und doch so schön im Glanz des Sonnenuntergangs ... Bald würden Mond und Sterne schimmern, eine frische Brise würde die Hitze des Tages mildern.
Und sie würde wahrscheinlich sterben, wenn die Finsternis die wunderbare Wildnis verhüllte.
Vielleicht schwebte sie in dieser furchtbaren Gefahr, weil die meisten Mitglieder der Eskorte – hartgesottene, skrupellose Männer – unter ihrem Stiefvater gedient, diese Sümpfe monatelang durchstreift und gegen Seminolen oder andere Stämme gekämpft hatten. Nur wenige Weiße waren bei den Indianern so verhaßt wie Michael Warren – und offensichtlich auch seine Tochter.
Doch manche Soldaten verhielten sich genauso brutal wie die sogenannten Rothäute. Deshalb durfte sie den Indianern nichts verübeln. Andererseits hatte sie ihnen kein Leid angetan. Einige ihrer Begleiter, unschuldige Grünschnäbel, verdienten einen so grausamen Tod in der Wildnis einfach nicht. Teela ebensowenig.
»Bastard!« fauchte sie den Krieger an, der ihr Haar immer noch festhielt, trat mit aller Kraft in seinen Unterleib und versuchte sich zu befreien, selbst wenn sie nur ein paar Sekunden gewinnen würde, eine kurze Atempause.
Schmerzerfüllt schrie er auf, ließ ihr Haar los und krümmte sich zusammen. Sie wollte davonlaufen. Aber der Indianer packte sie und warf sie zu Boden. Über ihrer Brust zitterte das Messer, an dem bereits das Blut zahlreicher Männer klebte.
Wieder erklang jene kraftvolle, gebieterische Stimme. Während Teela blinzelte und nach Luft rang, wurde der Krieger von ihr weggezerrt, und sie wagte sich nicht zu fragen, warum. Sie sprang auf und ergriff die Flucht. Kampflos wollte sie nicht sterben.
Umgehend krallten sich starke Finger in ihr Haar und rissen sie zurück. Verzweifelt wehrte sie sich und wurde erneut zu Boden geschleudert. So wie zuvor.
Nein. Diesmal war es noch schlimmer. Denn der Mann saß auf ihren Hüften, klemmte sie zwischen seine Schenkel und preßte ihre Unterarme, die er mit einer Hand umklammerte, hinter ihrem Kopf ins Erdreich. Ihr langes kastanienrotes Haar versperrte ihr die Sicht, und beinahe erstickte sie daran, als sie Atem holte.
Da wurden die zerzausten Strähnen von ihren Wangen gestreift. Sie öffnete den Mund, um zu schreien. Aber kein Laut kam über ihre Lippen. Wie gebannt starrte sie in Augen, die sie genauso zu fesseln schienen wie die muskulösen Arme und Beine.
Es waren blaue Augen. Ein Blau, das im Zorn wie Kobalt funkeln und vor Belustigung wie ein Sommerhimmel leuchten konnte. Blaue Augen in einem bronzebraunen Gesicht, die sie schon einmal fasziniert hatten.
Running Bear – Laufender Bär.
Diesen Namen hatte ihm sein Volk in den dunkelgrünen Schatten der Sümpfe gegeben. Der Name paßte zu ihm, seit er seine Kindheit beendet und den schwarzen Trank getrunken hatte, denn er war bärenstark und doch geschmeidig, und er konnte sich blitzschnell bewegen. Weil er ihr Interesse geweckt hatte, wußte sie Bescheid über ihn.
Jetzt war er halbnackt, nur mit einer engen Hose aus Rehleder, Silberketten und Lederstiefeln bekleidet, die Muskelkraft seiner Brust und der breiten Schultern deutlich zu sehen. In seinem ebenholzschwarzen Haar zeugten die Wellen vom Blut der Weißen, das durch seine Adern floß, ebenso wie die blauen Augen. Sein Gesicht zeigte Merkmale beider Rassen, mit hohen, breiten Wangenknochen, einem eigenwilligen Kinn, einer schmalen Nase, einer hohen Stirn und vollen, sinnlichen Lippen.
Um seinem Blick zu entrinnen, senkte Teela die Lider.
Ihr Herz schlug wie rasend. Viel zu gut kannte sie diese Augen. Und sie spürte erneut das blaue Feuer.
Nun nannte er sich Running Bear. Aber er hatte James McKenzie geheißen, an jenem Abend, an dem er ihr zum erstenmal begegnet war, im weißen Rüschenhemd mit roter Weste, in dunklen Breeches und schwarzen Stiefeln. Sie hatte ihn in der Welt des weißen Mannes gesehen, seine Eleganz auf der Tanzfläche beobachtet, seinen Argumenten gelauscht, die er so beredsam vorzubringen wußte. Alle Frauenherzen pochten schneller vor Erregung, denn obwohl er einem zivilisierten Gentleman glich, umgab ihn eine gefahrvolle, hypnotisierende Aura.
Er war jedoch kein zivilisierter Gentleman, er hatte sich nur verkleidet, und er spielte die Spiele der Weißen. Im blauen Feuer seiner Augen glühte eine wilde Bitterkeit. Nicht mit Waffen hatten die Weißen seine Familie getötet. Nach der Flucht seines Stammes vor den amerikanischen Siedlern war eine Fieberseuche im Sumpfgebiet ausgebrochen und hatte zahlreiche Indianer dahingerafft. Um ihres Vaters willen haßte er Teela.
Trotzdem schien er sie zu begehren, was sie entsetzte und zugleich faszinierte. Irgend etwas zwang sie, seine Nähe zu suchen, obwohl sie besser davongelaufen wäre. Er gehörte nicht zu ihrer Welt. Einerseits wollte sie beteuern, sie sei nicht schuld an den Taten ihres Vaters, andererseits grollte sie ihm, weil er sie so rückhaltlos verachtete. Wie auch immer, er hatte sie unwiderstehlich in seinen Bann gezogen.
»Schau mich an!« befahl er. Beinahe hätte sie gelacht. Inmitten dieser halbnackten, mit Federn und Silberketten geschmückten, mit Messern und Äxten und Gewehren bewaffneten Wilden klang sein makelloses Englisch absurd. Genausogut hätte er sie bitten können, ihm eine Tasse Tee einzuschenken.
Sie öffnete die Augen und überlegte, was seine Ankunft bedeuten mochte. Würde sie am Leben bleiben oder einfach nur etwas langsamer sterben?
Nicht einmal er konnte etwas an der Tatsache ändern, daß sie Michael Warrens Stiefkind war, die Tochter des Mannes, der seinem Volk so viel angetan hatte.
Entschlossen biß sie die Zähne zusammen und bekämpfte ihr Zittern. Nein, er würde sie nicht einschüchtern. Von Anfang an war er verbittert gewesen. Er hatte sie nie geliebt, nicht einmal gemocht, sondern gehaßt, vielleicht auch sich selbst, weil es eine Weiße war, zu der er sich hingezogen fühlte. Aber diese seltsamen wilden Flammen loderten zwischen ihnen, ob es ihm gefiel oder nicht. Damals hatte sie ihre Angst verborgen. Auch jetzt wollte sie ihm die Stirn bieten.
»Offensichtlich gehörst du zu diesen roten Kriegern. Worauf wartest du?« forderte sie ihn heraus. »Töte mich! Bringen wir’s hinter uns! Nimm dir doch ein Beispiel an deinen Leuten, die diese Männer skrupellos niedergemetzelt haben!«
»Es war ein fairer Kampf«, entgegnete er, und seine Augen verengten sich.
»Nein, ein Hinterhalt.«
»Der Kommandant deiner Truppe hat die Vernichtung zweier Stämme angeordnet – von Männern, Frauen und Kindern, von Babies im Mutterschoß ... Und da sollten die Krieger Gnade walten lassen?«
»Natürlich, du kennst keine Gnade ...« Teela verstummte zögernd. Was den Captain betraf, hatte James die Wahrheit gesagt. »In dieser ganzen verdammten Hölle gibt es keine Barmherzigkeit. Ich weiß, daß ich sterben muß. Also laß mich nicht länger leiden. Mach ein Ende!«
»Ein Ende?« Spöttisch hob er die Brauen und neigte sich zu ihr hinab. »Aber wir Wilden ziehen es vor, unsere Opfer endlos lange zu martern. Besonders die widerspenstigen ...«
Obwohl ihr das Blut in den Adern zu gefrieren drohte, glaubte sie, ihre Haut müßte verbrennen – überall, wo er sie berührte. Sie hörte die Stimmen der Krieger, die in den Habseligkeiten der Soldaten wühlten. Vor allem suchten sie Lebensmittel. Das wußte Teela. Die weißen Militärs wandten jene besondere Taktik an, die Indianer auszuhungern, um ihre Kapitulation zu erzwingen.
»Warum hast du diese Männer begleitet?«
Inzwischen war nächtliches Dunkel hereingebrochen, verbarg die Leichen und die Krieger, die sorgfältig die Taschen der Toten durchstöberten, auf der Suche nach ein paar Bissen.
Das konnte sie ihnen nicht übelnehmen. Oft genug war sie erschauert, wenn ihr Stiefvater genüßlich seine brutalen Attacken gegen die Indianer geschildert hatte. Nicht alle Soldaten waren so unmenschlich. Viele strebten ein friedliches Zusammenleben mit den Ureinwohnern an. Aber auch sie bekamen die Konsequenzen jener grausigen Manöver zu spüren, die Colonel Warren als militärische Glanzleistungen bezeichnete.
»Nun, warum hast du die Männer begleitet?« wiederholte James ärgerlich.
»Ich wollte weg ...«
»Wohin?«
»Nach Charleston.« Sie hatte keine andere Möglichkeit gesehen und beschlossen, davonzulaufen. Niemals war es ihr gelungen, irgend jemandem klarzumachen, daß sie Warren ebenso abgrundtief verabscheute wie jeder einzelne seiner Feinde. James hatte sie von Anfang an gedrängt, ihren Stiefvater zu verlassen.
Plötzlich sprang er empor, behende wie ein Panther. Teela erwog einen neuen Fluchtversuch. Wenn sie St. Augustine erreichte ... Aber ehe sie sich bewegen konnte, zerrte er sie auf die Beine und preßte sie an seine Brust. »Närrin! Du gehst nirgendwohin!«
»Hast du nicht immer wieder gesagt, daß ich aus diesem Land verschwinden soll?«
»Leider wolltest du nicht auf mich hören.«
»Ich bin doch weggerannt ...«
»Zu spät. Wenn du jetzt fliehst, wirst du’s nicht überleben.«
Ein heftiges Schwindelgefühl erfaßte sie. Ringsum lagen Tote, die sie nicht anzuschauen wagte. Tränen brannten in ihren Augen. Einige dieser Männer hatte sie gehaßt. Aber andere ...
Was mochte James empfinden? Vielleicht hatte er an diesem Abend weiße Freunde verloren. Sein Bruder und sein Neffe waren weiß. Und er stammte von einem weißen Vater ab. Er hatte versucht, sich aus den Kämpfen herauszuhalten. Doch es war unmöglich gewesen.
Als sie einen gellenden Schmerzensschrei hörte, stockte ihr Atem. Vielleicht verspürte ihr Feind ein gewisses Mitleid, wenn er es auch niemals zugeben würde. Er erteilte einen Befehl in der Muskogee-Sprache. Dann umfaßte er Teelas Oberarm und zog sie mit sich. »Schau nicht hinunter – und nicht nach hinten.«
Vergeblich bemühte sie sich, die Spuren des Gemetzels zu ignorieren. Auf der Leiche eines Army Corporals lag ein lebloser Seminole, Federn um den Kopf, den nackten Oberkörper blau bemalt. Im Tod schienen sie sich zu umarmen. Eine gräßliche Kälte durchdrang Teelas Glieder, ihre Zähne klapperten. Bald würde sie zu schluchzen beginnen. Nein, niemals vor den Augen dieses Mannes ...
Er hob sie auf eine schöne braune Stute, schwang sich hinter ihr in den Sattel, und sie verließen den Schauplatz des Hinterhalts.
Welches Ziel sie ansteuerten, wußte Teela nicht. Da James’ Volk ständig auf der Flucht war, gab es kaum noch Dörfer, nur mehr in der abgeschiedenen Tiefe des Sumpfs. Manche Indianerinnen rächten sich noch grausamer als die Männer an den Weißen, und so hoffte sie, er würde sie nicht in ein Lager bringen, wo Frauen wohnten. Zu den Folterwerkzeugen der Seminolen gehörten Nadeln, mit denen sie die Haut ihrer Opfer zerkratzten, oder sie schnitten ihnen Ohren und Nasen ab ...
Während sie dahinritten, fühlte sie sich elend. Die Erinnerung an den gnadenlosen Angriff lastete bleischwer auf ihrer Seele. Hatten einige weiße Soldaten den Überfall überlebt? Wurden sie jetzt gemartert?
Zunächst glaubte sie, James hätte das Pferd am Fluß nur gezügelt, damit sie trinken konnten. Aber dann sah sie das kleine, hastig errichtete Quartier zwischen den Bäumen. Kohlpalmenblätter bildeten das Dach, am Boden lagen mehrere Pelzdecken.
Weit und breit ließ sich keine Menschenseele blicken, und dafür war Teela dankbar, obwohl er sie ziemlich unsanft auf die Füße stellte. Sie mochte den Mitgliedern seines Stammes nicht begegnen.
Als sie zum Ufer ging, folgte er ihr. »Wolltest du aus Florida abreisen, um in die eleganten Salons zurückzukehren, in die Welt der vornehmen Gesellschaft, wo junge Damen von deiner Sorte hingehören?«
Ärgerlich straffte sie die Schultern. »Ich wollte nirgend-wohin zurückkehren!«
»Also hast du nur versucht, dieser schrecklichen Wildnis zu entrinnen.«
»Ja«, flüsterte sie mit bebenden Lippen und drehte sich zu ihm um, »und den Kämpfen und dem Grauen und dem Tod. Dein Freund war drauf und dran, mir die Kehle aufzuschlitzen.«
Lässig verschränkte er die Arme vor der nackten Brust. Rabenschwarzes Haar fiel auf seine Schultern, ein schlichtes Band ohne Federschmuck umwand seinen Kopf. »Wenn das geschehen wäre, hätte ich ihn getötet, ganz langsam.«
»Wie tröstlich! Dann hätte ich mich im Himmel über deine Rache freuen können.«
»Oder in der Hölle«, bemerkte er trocken. »Warum hast du das Haus meines Bruders verlassen?«
»Weil mir nichts anderes übrigblieb.«
»Jarrett hätte dich niemals hinausgeworfen.«
»Trotzdem – ich hatte keine Wahl.« Er ging zu ihr, und sie wollte zurückweichen. Aber hinter ihr plätscherte der Fluß. James ergriff ihre Hand und preßte sie an seine Brust. »Bist du vor dem Krieg davongelaufen? Oder davor? Vor bronzebrauner Haut?«
Mit aller Kraft riß sie sich los. »Ich fürchte mich nicht vor dir ...«
»Schon vor langer Zeit hättest du dich fürchten und in dein zivilisiertes Charleston zurückkehren müssen.
Sobald du einen Fuß in dieses Gebiet hier gesetzt hattest!«
»Geh doch zum Teufel!« zischte sie.
»Sicher werde ich bald im ewigen Höllenfeuer landen.« Er packte ihre Schultern, drückte sie an einen knorrigen Zypressenstamm, und sein warmer Atem streifte ihr Gesicht. »Wurdest du nicht vor diesem Krieg gewarnt? Wußtest du nicht, daß wir die Weißen ausrauben, vergewaltigen, martern und ermorden? Daß die Rothäute frei in der Wildnis herumlaufen?« Ohne seine Stimme zu erheben, verlieh er ihr einen eindringlichen Klang. »Oder war’s dir egal? Hat’s dich amüsiert, mit einem Indianerjungen zu spielen und dann den Rückzug anzutreten, ehe du dich verbrennen konntest?«
»Jeder, der dich anrührt, wird von deinem Haß verbrannt, von deiner Leidenschaft und Verbitterung ...«
Erschrocken verstummte sie, als er das Oberteil ihres Kleids und das Hemd zerriß. »Dann spür dieses Feuer!«
Ein fordernder Kuß zwang sie, die Lippen zu öffnen. Begierig erforschte seine Zunge ihren Mund. Sie wollte schreien und ihn hassen, die betörenden Flammen nicht fühlen, die er in ihr entfachte. Wie eine Tigerin wehrte sie sich, trommelte mit beiden Fäusten gegen seine Brust. Aber er warf sie zu Boden, auf einen weichen Teppich aus Zypressennadeln und Moos. Der Duft der Erde verstärkte die sinnliche Atmosphäre.
Während er rittlings auf Teelas Hüften saß, umklammerte er ihre Handgelenke. Sie bekämpfte ihn nicht mehr, starrte ihn nur an, zornig und anklagend. Plötzlich ließ er sie los. Sie rührte sich noch immer nicht.
»O Gott, was soll ich nur mit dir machen?« seufzte er leise, strich über ihren Hals, zog das zerfetzte Kleid und das Hemd auseinander.
Seine Hand liebkoste eine erhärtete Brustwarze, und Teela wußte genau, was er mit ihr machen, wie er sie küssen würde, hungrig und trotzdem zärtlich und so verführerisch. Ja, sie spürte das Feuer. Es brannte in ihrem Herzen und in ihrer Seele, versengte ihr Fleisch. »Bastard«, hauchte sie atemlos.
»Vielleicht bin ich das. Schick mich doch weg. Befiehl mir zu gehen. Aber du mußt es ernst meinen.«
Selbst wenn die ganze Welt zusammenbrechen würde – sie wollte nicht, daß er sie verließ. »Bastard ...«
»Das hast du bereits gesagt«, stöhnte er und schlang die Finger in ihr Haar. Dann spürte sie seinen Mund an ihrem Hals, auf ihren Brüsten. Seine Zunge spielte mit einer Knospe und sandte heiße Ströme durch ihren ganzen Körper.
Ungeduldig riß er das Kleid und die Unterwäsche noch weiter nach unten, seine Hände glitten über ihre Hüften und Schenkel, gefolgt von seinen aufreizenden Lippen.
Sie stieß einen halb erstickten Schrei hervor, versuchte ihr Verlangen zu bezähmen und kämpfte auf verlorenem Posten. Denn das Feuer brannte immer heller, vom Wind der Wildnis geschürt, und trug sie auf süßen Wellen himmelwärts. Sie schloß die Augen und schlug sie wieder auf, begegnete James’ glühendem Blick und sah, wie er sich seitwärts neigte, um seine Breeches zu öffnen.
Ehe sie wußte, wie ihr geschah, nahm er sie in die Arme und drang in sie ein. Ihr zitternder Körper nahm ihn auf, und er schien sie ganz und gar auszufüllen. Mit jeder verlockenden Bewegung führte er sie näher an den Zauber heran, den sie bereits kannte.
Immer schneller, immer wilder ... Starke Muskeln preßten sich an ihre Brüste, harte Hüften forderten sie auf, dem leidenschaftlichen Rhythmus zu gehorchen. Und dann schien sein flüssiges Feuer alles in ihrem Innern zu verzehren. Bebend klammerte sie sich an ihn, von heftigen Erschütterungen erfaßt – bis sie langsam vom gleißenden Himmel zur Erde zurückkehrte, ins weiche Moos, ins mondhelle Dunkel, in die Arme des Mannes, der sie umfangen hielt.
Nach einer Weile streckte er sich neben ihr aus und starrte zu den Sternen hinauf. Teela zog ihr langes Haar unter seinem Rücken hervor, versuchte das zerrissene Kleid zusammenzuraffen und spürte, wie er sie beobachtete.
Doch das Kleid war ebenso hoffnungslos ruiniert wie die Unterwäsche. Sie streifte die Fetzen von ihrem Körper, stand auf und kniete am Flußufer nieder, um ihr erhitztes Gesicht mit klarem Wasser zu kühlen. Als er sich zu ihr setzte, flüsterte sie bitter: »Spür das Feuer.«
»Du hättest es besser wissen müssen. Mit einem Indianerjungen spielt man nicht.«
»Oh, ich spiele niemals.« Seufzend schaute sie zu ihren zerrissenen Sachen hinüber. »Heute nacht werde ich jämmerlich frieren.«
»Keine Bange, ich wärme dich. Und morgen früh überlegen wir, was du anziehen kannst.«
Entschlossen hob sie ihr Kinn. »Ich habe nicht vor, hier zu übernachten.«
»Nachdem du zu spät die Flucht ergriffen hast, bist du mein Gast.«
»Wohl eher deine Gefangene.«
»Wie du meinst. Jedenfalls bleibst du hier.« Er hob sie hoch und trug sie zu dem Unterschlupf, wo er seine wenigen Habseligkeiten verwahrte. Schnell errichtet, ebenso schnell wieder zerstört. Wenn er die Wildnis durchstreifte, brauchte er fast kein Gepäck. Was immer er benötigte, fand er überall in diesem Land, das er so gut kannte – und das er behalten wollte. Niemals würde sich sein Volk dem weißen Mann unterwerfen.
Er setzte sie auf die Decken, und als sie erschauerte, legte er ein Fell um ihre Schultern. Dann reichte er ihr eine lederne Wasserflasche, und sie trank in durstigen Zügen.
»Wenn ich gehen wollte, könntest du mich nicht zurückhalten«, behauptete sie. »Ich bin zwar in eleganten Salons aufgewachsen, aber inzwischen kenne ich mich in deinem Zypressen- und Palmendschungel aus.«
»Oh, eine Herausforderung?« James hob die Brauen. »Spar dir die Mühe. Du wirst mir nicht entkommen.«
»Verdammt ...«
»Möchtest du unbedingt einem Krieger in die Arme laufen, der die Skalps schöner weißer Frauen sammelt.«
»Nicht alle Seminolen sind Barbaren.«
»Was für ein liebenswürdiges Zugeständnis, Miss Warren!«
»Und du bist eher ein Weißer als ein Seminole. Sogar deine Mutter war ein Mischling. Das hast du mir erzählt.«
»Schau mir ins Gesicht, dann wirst du merken, daß ich ein Indianer bin. Das Leben hat mich dazu gemacht ...«
»... zu einem grausamen Mann!«
»Genug für diese Nacht, Teela.«
Krampfhaft schluckte sie und streckte sich auf den Pelzdecken aus. Nach einer Weile spürte sie, wie er sich zu ihr legte. Er umarmte sie, und seine nackte Brust wärmte ihren Rücken.
Genug für diese Nacht ...
Am Morgen hatte sie geglaubt, sie könnte an Bord eines Schiffes gehen und ein neues Leben beginnen. Oder sie würde ihr altes Leben weiterführen, das sie so leichten Herzens aufgegeben hatte, in dem sie jetzt Schutz suchen wollte vor dem Grauen.
Beinahe wäre sie gestorben, und jetzt ... Sie hatte mit einem Indianerjungen gespielt.
Nein, es war kein Spiel gewesen. Sie liebte ihn, obwohl er alles haßte, was sie verkörperte, und sie nur mit wilder Leidenschaft begehrte. Dafür verabscheute er sich selbst. Er war ihr Feind. Aber er hatte ihr das Leben gerettet. Und nun hielt er sie im Arm.
Wenn sie auch gedroht hatte, ihn zu verlassen – sie wußte nur zu gut, daß sie nicht allein durch den Sumpf wandern konnte. Wie sollte sie den Seminolen, die ihr begegnen mochten, glaubhaft erklären, sie sei ihnen friedlich gesinnt?
O Gott, was würde ihr die Zukunft bringen? Unter ihren geschlossenen Lidern brannten Tränen. Bevor sie in die Zukunft blickte, mußte sie sich an die Vergangenheit erinnern – an die Nacht, wo sie jenes wilde Feuer zum erstenmal gespürt hatte. So lange war es noch gar nicht her.
1
Die Marjorie Anne durchpflügte türkisblaues Wasser. Nie zuvor hatte Teela Warren einen so schönen Tag erlebt. Am hellblauen Himmel zogen kleine weiße Wolken dahin. Eine sanfte Brise wehte ihr ins Gesicht, während sie im Bug des Schiffs stand.
Bald würde sie Tampa erreichen, die rauhe Stadt, die rings um den Militärposten Fort Brooke entstanden war, das Tor zur Wildnis. An Bord hatte sie manchmal das süße Versprechen künftiger Abenteuer vernommen. Nicht immer war das Wetter so mild gewesen. Wütende Stürme hatten die Marjorie Anne umhergeschleudert. Aber es hatte ihr gefallen. Sie fühlte dabei irgend etwas Wildes, etwas, das ihr die Freiheit verhieß, etwas, das sie vergessen ließ ...
Glücklicherweise wurde ihre Eskorte bei jedem Unwetter seekrank. Trenton Wharton war fast eins neunzig groß und über zweihundert Pfund schwer, Buddy MacDonald noch größer und schwerer. Mühelos konnten sie ein halbes Dutzend erwachsener Männer auf einmal hochstemmen und eine mutwillige junge Frau in die Schranken weisen. Aber einer Schiffsreise zeigten sie sich nicht gewachsen.
Das spielte natürlich keine Rolle. Auf dem Atlantik konnte sie ihnen ohnehin nicht entwischen und ihr Gesicht nur in den Wind halten und träumen. Von der Freiheit.
Ihre Finger umklammerten die Reling, und sie sah das Land immer näher rücken.
Wann Teela und Michael Warren begonnen hatten, einander zu verabscheuen, wußte sie nicht. Vielleicht ließe sich einiges ändern, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnte. Als er ihre Mutter geheiratet hatte, war sie noch sehr jung gewesen, der geliebte Vater erst seit einem knappen Jahr tot. Warren behandelte die Stieftochter wie einen seiner Soldaten. Um ihr Disziplin beizubringen, schlug er sie manchmal sogar mit Reisig. Die Mutter versicherte, er sei ein guter Mann, aber eben ein Soldat und fest entschlossen, in seinem Haushalt ebenso strenge Ordnung zu halten wie in seinem Heer.
Aber er war kein guter Mann, wenn er auch täglich betete und regelmäßig zur Kirche ging.
Der Mutter zuliebe versuchte Teela, das Gute in ihm zu entdecken, doch sie sah nur seine Grausamkeit.
Er genoß es, andere Menschen leiden zu sehen. Oft genug hörte sie das Vergnügen aus seiner Stimme heraus, wenn er mit Freunden und Offizieren im Salon des Plantagenhauses in Charleston saß und seine Erlebnisse schilderte. Er liebte den Krieg und freute sich am Tod seiner Feinde.
Mit besonderer Vorliebe tötete er die Indianer, diese ›Ausgeburten der Hölle‹, wie er sie nannte.
Gemeinsam mit Andy Jackson hätte er die Creek bekämpft. Dann war Jackson Präsident der Vereinigten Staaten und erst vor kurzem von seinem Freund Martin Van Buren abgelöst worden.
Nun lebte Jackson zurückgezogen auf seiner Plantage. Seine Überzeugung, die Indianer müßten weiter nach Westen ziehen, bestimmte die amerikanische Politik immer noch. Daran hatte sich nach den Creek-Kriegen und der traurigen Auswanderung der Cherokees nichts geändert. Die Rothäute mußten Florida verlassen – von diesem Grundsatz wich die Regierung nicht ab. Die Indianer waren jedoch ebensofest entschlossen, in ihrer Heimat zu bleiben. Auf diese Weise dauerten die Kämpfe an, die Michael Warren so beglückten.
1812, im Krieg gegen die Briten, war er mehrfach für seine Heldentaten ausgezeichnet worden. Doch diese Orden bedeuteten ihm nicht viel. Den Kampf gegen die Indianer nahm er viel wichtiger.
Wegen seiner militärischen Pflichten hielt er sich nur selten zu Hause auf. Solange die Mutter lebte, war Teelas Leben einigermaßen erträglich, da die Army ihren Stiefvater zumeist von der Plantage fernhielt. Aber während des letzten Sommers, als man ihn zum Kommandanten im sogenannten ›Höllenloch‹ Florida ernannt hatte, war Lilly Warren gestorben.
Teela hatte sich gelobt, so lange daheim zu bleiben, wie die kranke Mutter sie brauchen würde. Danach wollte sie der Plantage, ihrem einstigen Erbe, den Rücken kehren. Auf der Eigentumsurkunde stand nun Michael Warrens Name, obwohl Teelas leiblicher Vater das Haus eigenhändig gebaut hatte.
So schwer ihr der Abschied von ihrem Heim auch fiel – sie konnte nicht mehr mit Warren unter einem Dach wohnen.
Bedauerlicherweise war sie noch minderjährig. Nach dem Begräbnis der Mutter erklärte der Stiefvater, wie er sich Teelas Zukunft vorstellte. Unmißverständlich teilte sie ihm mit, sie würde abreisen und seine Anweisungen nicht länger akzeptieren. Das war ein verhängnisvoller Fehler. Er sperrte sie in ihrem Zimmer ein und ließ sie von seinen Soldaten bewachen. Trotzdem gelang es ihr zu fliehen, doch sie wurde gewaltsam zurückgebracht – von dem Mann, den sie auf Wunsch ihres Stiefvaters heiraten sollte.
Vor dem Traualtar sagte sie einfach nein. Natürlich war Warren wütend über die Blamage. Am Abend schlug er sie mit seinem Gürtel. Aber wenn er ihr auch Tränen in die Augen trieb, er konnte sie nicht zur Kapitulation zwingen.
Als die Kämpfe zwischen der Regierung und den Seminolen einen neuen Höhepunkt erreichten, hielt sich Warren zumeist in Florida auf. Daheim wurde Teela strenger denn je bewacht, eine Flucht war unmöglich.
Immer heftiger tobte der Krieg. Im Sumpfgebiet, das die Indianer so gut kannten, konnten sie wie aus heiterem Himmel zuschlagen, sich verstecken, plötzlich wieder aus dem Dunkel auftauchen und erneut angreifen. Zahlreiche Soldaten fielen. Vielleicht würde auch Michael Warren sterben ...
Es war falsch, um den Tod eines Menschen zu beten, und Teela wollte es auch nicht tun. Statt dessen hoffte sie, er würde einfach im Sumpf verschwinden.
Aber er war nicht verschwunden. Er hatte seine Stieftochter nach Florida beordert. Nun stand sie an der Reling der Marjorie Anne und näherte sich der Küste des wilden Landes, in dem ein so brutaler Krieg geführt wurde.
Seufzend beobachtete sie die Wellen. In diesem Land hatten schon viele die Freiheit gesucht. Teela las manchmal in Zeitungen und Magazinen die Berichte über Sklaven, die ihren Herrn entflohen und sich den Indianern anschlossen. Seit Jahrzehnten wurden die Creek und andere Indianer von den Weißen immer weiter nach Süden getrieben und gesellten sich zu fast ausgestorbenen Stämmen. Nun wurden die Creek, die Seminolen, die Muskogee sprachen, und die Mikasukis, die den Hitichi-Dialekt pflegten, von den Weißen unter dem Sammelnamen Seminolen zusammengefaßt – Cimarrons, Renegaten, Flüchtlinge.
Verträge waren unterzeichnet und gebrochen worden. Immer neue Kämpfe tobten. Und nach dem wilden Gemetzel, das als Dade-Massaker in die Geschichte einging, verschlimmerte sich die Situation. Wie Teela den Zeitungsartikeln entnahm, huldigten die Seminolen einem neuen Helden, ihrem Kriegerhäuptling oder mico Osceola. Unter seiner Führung lernten die Indianer, zu kämpfen und davonzulaufen, zu töten und zu zerstören und dann im Sumpf zu verschwinden. Obwohl die Weißen glaubten, ein paar tüchtige Army-Truppen müßten genügen, um die Unruhen zu beenden, stürzten die Seminolen das Land in einen schrecklichen Krieg. Die Amerikaner waren Expansionspolitiker, die neue Gebiete erschließen wollten, ganz egal, ob dort Indianer lebten oder nicht. Und so befahlen sie den Seminolen, nach Westen auszuwandern, in die Reservate.
Manche wurden tatsächlich vertrieben, aber viele blieben in den Sümpfen, wo sie sich schnell wie der Wind bewegten, lautlos wie das Flüstern der Abenddämmerung, und weiße Siedler niedermetzelten – Männer und Frauen und Kinder. Doch auch ganze Indianerdörfer wurden von den Weißen ausgerottet.
Trotzdem kämpften die Seminolen weiter, wobei sie eine geradezu unheimliche Raffinesse entwickelten. Hilflos stand die gut ausgebildete Army der U.S.-Regierung dem Guerillalampf der Ureinwohner gegenüber.
Nur ein Mann wie Michael Warren würde darauf bestehen, seine Stieftochter unter so gefährlichen Umständen nach Florida zu holen, dachte Teela. Aber er war der Ansicht, sie müßte seinen Befehlen gehorchen, oder sie würde es verdienen, von Wilden ermordet zu werden. Außerdem stand ein Waffenstillstand bevor. Im März hatte man einen neuen Vertrag ausgehandelt.
Doch diese Vereinbarungen wurden ebensowenig eingehalten wie die vorangegangenen. Die Soldaten fielen erneut über Indianerdörfer her, die Seminolen griffen die Farmen und Plantagen der Weißen an.
Während Teela zur Wildnis der Halbinsel segelte, dauerte der Krieg an, entlang der Ostküste bis zum Atlantik und an der Westküste am Golf von Mexico.
Wenn Teela ihren Stiefvater auch haßte, sie freute sich auf Florida, die exotischen Vögel, über die sie so viel gelesen hatte, und die Sonnenuntergänge. Nicht einmal die Moskitos fürchtete sie oder das beschwerliche Leben im Militärstützpunkt Fort Brooke, wo Warren stationiert war.
Zu Lillys Lebzeiten hatte sich Teela bemüht, die Wünsche der Mutter zu erfüllen, Gäste bewirtet, oft auf dem Spinett gespielt und Balladen gesungen, Teeparties und Bälle besucht, charmant geflirtet, wie es ihre Gesellschaftsschicht erwartete. Regelmäßig ging sie zur Kirche, betreute Arme und Kranke. Das alles tat sie gern. Vor allem die Krankenpflege verschaffte ihr eine tiefe Befriedigung, und sie hätte gern Medizin studiert.
Aber nun war Lilly gestorben, ein neues Leben begann. Von wachsender Abenteuerlust erfaßt, blickte sie diesem wilden Land entgegen, seiner Schönheit und seinen Gefahren. Allerdings mußte sie auch mit Problemen rechnen. Michael Warren hatte sie sicher nicht grundlos zu sich bestellt. Vermutlich würde er sie wieder verloben, diesmal mit einem reichen alten Mann, der stark genug wäre, eine widerspenstige Frau zu zähmen.
Niemals, gelobte sie sich. Michael Warren konnte sie nicht zu einer Heirat zwingen. Und da ihn der Krieg vollauf beschäftigte, sah sie in der Wildnis von Florida bessere Chancen, ihre Freiheit zu gewinnen, als in Charleston, wo man strenge gesellschaftliche Regeln befolgte.
Plötzlich ertönte die Schiffsirene, und Teela beobachtete hektische Aktivitäten an Bord. Die Besatzung trimmte die Segel und wendete die Marjorie Anne, um den Hafen des Forts anzusteuern.
Fasziniert schaute sie zu den hohen Wällen und Türmen hinüber. Mehrere armselige Holzhäuser umgaben die Festung. Aber die kleine Gemeinde Tampa lag in einer atemberaubenden Landschaft. Der grün schimmernde Fluß verlor sich zwischen dichten Bäumen. Im aquamarinblauen Wasser der Bucht schienen unzählige Diamanten zu funkeln. Weiße Strände erstreckten sich an der Küste wie leuchtende Seidentücher, die man hingeworfen hatte, um alles Häßliche zu verbergen.
»Gleich legen wir an, Miss Warren.« Teela drehte sich zu dem leichenblassen Trenton um. Auch das Gesicht des armen seekranken Buddy war fast so weiß wie die Sandstrände.
»Sieht nicht besonders aus«, meinte er entschuldigend, »aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran.« Er stammte aus Tennessee, ein sommersprossiger Farmerssohn, in der militärischen Tradition aufgewachsen. Die Soldatenpflicht ging ihm über alles. Aber er besaß ein gutes Herz, und sie war gerührt, weil er sie aufzumuntern versuchte.
»Oh, es sieht wundervoll aus«, widersprach sie, und sie mußte nicht einmal lügen. So schäbig die kleine Stadt auch wirkte – die Küste und das Meer und der Himmel erstrahlten in magischer Schönheit.
Inzwischen hatten sie den Hafen erreicht. Gellendes Geschrei ertönte, halbnackte Männer kletterten in der Takelage umher, während das Schiff an seinem Liegeplatz schaukelte und vertäut wurde. Die Laufplanke sank hinab, aber bevor irgend jemand an Land gehen durfte, eilten die Soldaten an Bord und sprachen mit dem Captain.
»So ist das immer«, erklärte Trenton. »Zuerst müssen Informationen ausgetauscht werden.«
»Jedenfalls ist es eine gute Neuigkeit, daß Tampa noch steht und noch nicht in Schutt und Asche liegt«, bemerkte Buddy.
Nachdem die Soldaten das Schiff verlassen hatten, kam der freundliche alte Captain Fitzhugh zu Teela. Bei seinem Anblick mußte sie ein Lächeln unterdrücken. Er war ein seltsamer kleiner Mann, mit rundem Bauch, dünnen Beinen und winzigen Füßen, das Gesicht voller weißer Barthaare. Ständig schien er sich irgendwelche Sorgen zu machen. »O Miss Warren, ich bin ganz verzweifelt! Eigentlich wollte Ihr Stiefvater Sie hier begrüßen, Aber er mußte nach Norden reiten, um die Heiden zu bekämpfen.« Mit einer dramatischen Geste bekreuzigte er sich.
»Ach, wie schade!« log Teela, und ihre Augen glänzten.
»Nur keine Bange. Unsere guten Freunde Josh und Nancy Reynolds, die einen großartigen Laden in der Stadt betreiben, kümmern sich um Sie und bringen Sie nach Cimarron. Dort wartet ein Army-Trupp, der Sie zu Ihrem Vater eskortieren wird.«
»Vielen Dank, Captain.« Erleichtert atmete sie auf. Also durfte sie das Wunder dieser neuen Welt vorerst allein genießen. Sie ergriff Fitzhughs Arm und ließ sich die Laufplanke hinabführen, um ihren Fuß zum erstenmal auf Florida-Boden zu setzen.
Auf dem Kai stand eine hübsche, rundliche Frau. Braune Locken hingen unter einem breitrandigen Hut herab. Mit einem freundlichen Lächeln begrüßte sie Captain Fitzhugh, dann reichte sie Teela die Hand. »Willkommen, Miss Warren! Wie schön, daß Sie endlich da sind! Wir haben schon so viel von Ihnen gehört. Ich bin Nancy Reynolds, und das ist Josh«, fügte sie hinzu und zeigte auf einen hochgewachsenen, kräftig gebauten Mann, der hinter ihr stand.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Miss Warren. Keine Angst, hier beurteilen wir die Leute nicht nach Charleston-Maßstäben .«
»Josh!« schimpfte Nancy und stieß ihren Ellbogen zwischen seine Rippen.
Leicht verwirrt hob Teela die Brauen. Offenbar war die Geschichte von der vereitelten Hochzeit bis in die Wildnis gedrungen. Doch das störte sie nicht, im Gegenteil. Immerhin hatte sie das Interesse des warmherzigen Ehepaars erregt. »Danke, Mrs. Reynolds – Mr. Reynolds. Ich bin ja so froh, daß ich hier bin.«
»Tatsächlich?« fragte Josh und musterte sie ungläubig. »Die meisten jungen Damen würden unsere abgeschiedene, arme kleine Stadt verachten.«
»Nun, obwohl sie in einer so entlegenen Gegend leben, haben Sie schon von mir gehört.«
»Oh, für Klatschgeschichten haben wir nichts übrig ...«, begann Nancy, dann lachte sie etwas verlegen. »Sicher werden Sie sich wohl in unserer Wildnis fühlen.«
»Das reinste Paradies!« behauptete Josh.
Zwanzig Minuten später betraten sie den Laden. Die Reynolds versorgten mehrere Händler und Marketender, die regelmäßig ins Landesinnere zogen, mit Waren. Wie Josh seinem Gast erklärte, war dort nicht mehr viel von der Zivilisation der Weißen übriggeblieben. Zu oft hatte die Army ihre verschiedenen Posten verlassen müssen. Entweder wurden die weißen Siedler von den Indianern vertrieben oder von Fieberkrankheiten, die schon mehr Menschen hinweggerafft hatten als der Krieg.
Aber trotz diverser Schwierigkeiten florierte das Geschäft der Reynolds. Sie verkauften Lebensmittel, Arzneien, Werkzeuge, Kleider, Stiefel, Alkohol und sogar Nutztiere, außerdem Kokosnüsse und die Federn exotischer Vögel, von Indianern gesammelt.
Hinter dem Laden lag eine Wohnküche, ein großer, zugiger Raum. Im Herd knisterte ein helles Feuer. Die Frühlingstage waren immer noch kühl. Überall schwirrten kleine Kinder herum, das älteste hatte eben erst seinen siebten Geburtstag gefeiert.
Was für ein sonderbares Paradies, dachte Teela. Aber während sie mit den Kindern Verstecken spielte, erkannte sie, daß sie schon lange nicht mehr so glücklich gewesen war. Josh bediente einige Kunden, und Nancy suchte derbe Stiefel für ihren Gast hervor.
Was für ein gemütliches Heim, dachte Teela. Wenn doch Michael Warren niemals hierherkommen würde ...
Sie lag gerade auf den Knien und warf der dreijährigen Tochter des Hauses einen Ball zu, als sie plötzlich spürte, daß sie beobachtet wurde. Verwirrt wandte sie sich zur Tür und begegnete dem Blick eines großen Mannes mit ebenholzschwarzem Haar.
»Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken.« Er sah ungewöhnlich gut aus, kraftvoll und elegant zugleich.
Kreischend rannte das kleine Mädchen zu ihm. »Onkel Jarrett! Onkel Jarrett!«
Er schwenkte sie hoch in die Luft, küßte ihre Wange und stellte sie wieder auf den Boden. Inzwischen hatte Teela sich erhoben und schaute ihn abwartend an. »Miss Warren, ich bin Jarrett McKenzie. Meine Frau und ich wohnen weiter unten am Fluß, und wenn Sie einverstanden sind, würden wir Sie gern bei uns aufnehmen, bis Lieutenant Argosy zurückkehrt und Sie zu Ihrem Vater bringt.«
»Ja, natürlich, vielen Dank.«
»Sicher sind Sie sehr enttäuscht, weil Sie Ihren Vater nicht angetroffen haben.«
»Meinen Stiefvater.«
»Ah ... Es muß schwierig für Sie sein, ohne ihn, in diesem fremden Land ...«
»So leicht bin ich nicht zu erschrecken, Mr. McKenzie.«
»Sehr gut«, erwiderte er lächelnd. »Mein Schiff liegt im Hafen. Am besten lasse ich Ihr Gepäck gleich an Bord bringen, Miss Warren. In einer Stunde möchte ich aufbrechen, solange es noch hell ist.«
»Danke.« Als er sich zur Tür wandte, die in den Laden führte, rief sie leise: »Mr. McKenzie!« Er drehte sich um und hob die Brauen. »Warum tun Sie das für meinen Stiefvater? Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie mögen ihn nicht besonders.«
Unbehaglich zuckte er die Achseln. »Nun, ich würde Sie nicht allein in diese Wildnis schicken, Miss Warren.«
»Jedenfalls mögen Sie meinen Vater nicht.«
»Das habe ich nicht behauptet«, entgegnete er zögernd.
»Mr. McKenzie, ich mag ihn auch nicht.«
Zu ihrer Verwunderung lachte er. »Dann hoffe ich, Sie bleiben möglichst lange bei uns in Cimarron.« Mit diesen Worten verließ er die Küche.
Sie sah ihn erst wieder, als die Reynolds sie an Bord seines Schiffes begleiteten und ihr zahlreiche Ratschläge erteilten. Im Sumpfgebiet mußte sie sich vor Fieberkrankheiten hüten, vor Insektenstichen, Schlangen und Krokodilen.
»Glücklicherweise gibt’s nur vier gefährliche Schlangen«, erklärte Nancy, »die Klapperschlange, die Zwergklapperschlange, die Korallenotter und die Wassermokassinschlange. Wenn Sie die in Ruhe lassen, tun sie Ihnen nichts.«
Das Schiff war nicht so groß wie Marjorie Anne, und die Besatzung bestand nur aus fünf Mann. Während Teela den gutgemeinten Anweisungen lauschte, sah sie, wie einer der Seemänner die Augen verdrehte, und sie mußte lächeln.
Dann erklang die tiefe Stimme ihres Gastgebers hinter ihr. »Allem Anschein nach ist sie eine intelligente junge Dame, Nancy«, meinte Jarrett, »und sie kann sicher gut auf sich aufpassen.«
»Wer gewarnt ist, der ist auch gerüstet«, entgegnete Nancy. »Also, meine Liebe, seien Sie vorsichtig!« mahnte sie und umarmte Jarrett. »In diesem Beutel ist eine Decke für das Baby. Gib dem kleinen Schatz einen Kuß von mir. Und Tara auch. Sag ihr, ich besuche sie bald. Wahrscheinlich traut sie sich nicht hierher. Die Siedler glauben, die Seminolen könnten Tampa jederzeit angreifen.«
»Sicher nicht, solange ich in der Nähe bin«, erwiderte Jarrett und schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. Dann küßte er ihre Wange und schüttelte Joshs Hand. »Und jetzt verschwindet von meinem Schiff! Die Fahrt dauert gute vierundzwanzig Stunden, und ich will endlich meine Frau und mein Kind wiedersehen.«
»Wenn wir Ihnen helfen können, wir sind jederzeit für Sie da, Teela!« rief Nancy, während ihr Mann sie energisch an Land führte.
Das Schiff legte ab, und Teela winkte dem freundlichen Ehepaar zu. Dann hielt sie den Atem an. Zwei uniformierte Männer rannten den Kai entlang.
»Ihre Freunde?« fragte McKenzie.
»Nicht direkt«, antwortete sie etwas beklommen. »Meine Eskorte.«
»Wachhunde?«
»Eigentlich sind’s keine üblen Burschen.«
»Sollen wir zurückfahren und sie an Bord holen?« erbot er sich höflich.
»O nein, bitte nicht.«
»Sicher können die beiden den Weg nach Cimarron auch allein finden.«
Seufzend blickte sie ins Wasser. »Vielleicht sollten wir doch umkehren. Mein Stiefvater wird sich furchtbar aufregen, wenn er hört, wir hätten meine Beschützer absichtlich zurückgelassen.«
»Tatsächlich?«
Teela wandte sich zu ihm und sah einen fast teuflischen Glanz in seinen Augen.
Verschwörerisch flüsterte er ihr zu: »Dann müssen die beiden natürlich hierbleiben ... Volle Kraft voraus!« befahl er seinen Leuten. »Setzt alle Segel! Verschwinden wir von hier, so schnell wie möglich.«
Lächelnd beobachtete Teela die Aktivitäten, hochzufrieden mit den ersten Erfahrungen, die sie in der fremden Wildnis gesammelt hatte.
2
Cimarron
Während James über den Rasen ritt und das Heim seines Bruders betrachtete, schlug sein Herz höher. Zusammen mit Jarrett hatte er dieses Haus erträumt und erbaut, und er liebte es.
Sie hatten beabsichtigt, ein zweites Haus für ihn selbst zu errichten. Obwohl beide zumeist bei den Seminolen aufgewachsen waren, hatten sie einen Teil der Jugend bei ihrem gütigen schottischen Vater verbracht und die Kultur der Weißen ebenso kennengelernt wie die indianische. James wußte, wie man ein solches Haus plante und baute. Genausoviel verstand er von der Viehzucht und Feldwirtschaft. Er kannte auch die Werke Defoes, Bacons, Shakespeares und anderer Autoren, ebenso wie Beethovens und Mozarts Musik.
Als blutjunger Mann hatte er eine Indianerin liebgewonnen und sich ihrem Clan angeschlossen, weil er gebraucht worden war. Zu den Vorfahren seiner Mutter zählte ein mico. Deshalb wurde er mit dem Amt des Häuptlings betraut und lebte mit seinem Stamm in einem großen, schönen Dorf. Bis der Krieg begonnen hatte ...
Aber obwohl er dem weißen Feind erbittert grollte – er liebte seinen Bruder, so wie er den Vater geliebt hatte. Daran konnten die gräßlichen Kämpfe nichts ändern.
»James!«
Als der Ruf zu ihm drang, stieg er ab und sah seine Schwägerin Tara die Verandastufen herunterlaufen. Lachend nahm er sie in die Arme. Sie war eine schöne Blondine mit blauen Augen, zart wie Porzellan und doch stark und entschlossen, genau die richtige Frau für seinen Bruder.
Mißbilligend musterte sie seine Kleidung – eine Drillichhose, eine ärmellose Lederweste und Mokassins. »Du wirst dich erkälten. Wenn der Frühling auch begonnen hat – es ist immer noch kühl.«
»Unsinn, ich friere nie. Was macht meine Tochter?«
»Oh, sie blüht und gedeiht. Ein unglaublich hübsches, kluges Mädchen! Und sie kann großartig mit dem Baby umgehen.«
»Wie entwickelt sich mein Neffe, der kleine Racker?«
»Prächtig, aber so darfst du ihn nicht nennen«, protestierte Tara. »Er ist doch erst sechs Monate alt, und in diesem Stadium sind alle Kinder die reinsten Engel.«
»Dabei wird’s nicht mehr lange bleiben, da er der Sohn meines Bruders ist«, warnte James. »Und Jennifer geht’s gut?« Seine Stimme klang ein wenig gepreßt. Manchmal konnte er die Angst nicht bezwingen. Er war dem Krieg sogar dankbar, der ihn daran hinderte, allzu gründlich nachzudenken, zu wünschen, er könnte selbst sterben, dem unheilbaren Schmerz in seiner Seele entrinnen – seinem Haß gegen die Weißen ...
»Natürlich«, versicherte Tara und ergriff seine Hand. »Komm, ich bringe dich zu ihr.« Während sie zum Haus wanderten, fragte sie: »Gibt’s Neuigkeiten?«
»Nur über Colonel Warrens letzte Schandtaten.«
»Davon habe ich schon gehört«, seufzte sie bedrückt.
Warren, dessen Macht in den militärischen Kreisen des Territoriums ständig wuchs, war ein blutrünstiger Bastard. Im Lauf der Kämpfe hatte James festgestellt, daß man mit vielen Weißen vernünftig reden konnte – sogar mit jenen, die in der Seminolen-Emigration nach Westen die einzige Lösung des ›Indianerproblems‹ sahen. Die meisten U.S.-Soldaten weigerten sich auch, Frauen und Kinder zu töten. So wie in der Indianer weit gab es bei den Weißen gute und böse Menschen. Warren gehörte eindeutig zu den letzteren.
Seit Kriegsbeginn kämpfte James immer wieder gegen das Volk seines Vaters, weil ihm nichts anderes übrigblieb. Wenn auf seine indianischen Verwandten und Freunde geschossen wurde, feuerte er zurück. Aber er hatte niemals die Plantagen der Weißen niedergebrannt, weder Frauen noch Kinder getötet.
Wann immer es möglich war, übernahm er die Rolle des Vermittlers. Er half den Seminolen, die sich dem Diktat der Weißen beugen und nach Westen ziehen wollten, und er kämpfte für jene, die sich nicht aus ihrer Heimat vertreiben ließen. Oft genug mußte er gefährliche Gratwanderungen bewältigen. Doch es gelang ihm, seine respektable Position in Indianerkreisen zu verteidigen, ohne die Freundschaft der Weißen zu verlieren, die ihm nahestanden. Im Grunde haßte er diesen Zwiespalt. Seit dem Tod Naomis und seines Kindes fürchtete er, eines Tages könnte er sich von seinem Zorn hinreißen lassen und wilde, grausame Rache an den Weißen üben ...
Die beiden waren nicht niedergeschossen oder mit Bajonetten erstochen worden (wie die Frauen und Kinder und alten Leute in dem Dorf, das Warren kürzlich überfallen hatte), sondern an einer Seuche gestorben.
Viel zu lebhafte, grauenvolle Erinnerungen ... Auf der Flucht waren sie erkrankt. Die weißen Soldaten trieben sie immer tiefer in den Sumpf hinein – Soldaten, die alle Indianer getötet hätten, alte und junge, Männer und Frauen und Kinder.
Als James’ Familie vom Fieber befallen wurde, verhandelte er gerade in der Nähe von Fort Brooke mit Vertretern der amerikanischen Regierung, beauftragt von entmutigten, kriegsmüden Seminolen, die sich bereiterklärt hatten, in den öden, dürren Westen zu ziehen. Dort sollten die Indianer mit dem Segen der Weißen ein freies Leben führen.
Von Freunden erfuhr er, seine Frau sei unfähig, die Flucht fortzusetzen. So schnell er konnte, ritt er zu ihr. Aber er kam zu spät, ebenso wie sein Bruder, der am Boden kniete und die tote Schwägerin im Arm hielt. Jarretts Tränen tropften auf das schöne, fahle Gesicht.
Schluchzend preßte James seine Frau an sich, bis seine Tränen versiegten.
Auch sein Kind hatte er verloren. Er wollte nicht weiterleben. Tagelang trauerte er, ohne Nahrung, ohne Wasser. Und Jarrett war bei ihm geblieben.
Nein, er konnte den Bruder niemals hassen. Aber ein heißer, fast übermächtiger Zorn gegen die Weißen und quälende Rachsucht erfüllten sein Herz.
»Wie viele Menschen wurden bei Warrens Überfall getötet?« fragte Tara und holte ihn in die Gegenwart zurück.
»Fast hundert. Kurz zuvor ließ er verlauten, die Indianer, die innerhalb eines Monats nach Westen übersiedelten, würden Kleidung, Lebensmittel und Goldmünzen bekommen. Viele Frauen, die von der Flucht völlig erschöpft waren und ihre Kinder verhungern sahen, glaubten ihm. Wäre ich rechtzeitig zu ihnen gelangt, hätte ich sie eines Besseren belehrt. Aber ich hielt mich gerade bei Micanopy auf, während sie südlich von St. Augustine lagerten. Sie wollten sich ergeben, und Warren fiel nachts über sie her. Gegen diese unmenschliche Attacke protestierten sogar die Florida-Siedler, die den Indianern feindlich gesinnt sind. Aber er behauptete, er habe geglaubt, das Lager würde von Seminolen-Kriegern bewohnt, die einen Angriff auf die Farmen der Weißen planten.«
Die Einzelheiten wollte er Tara nicht zumuten. Die Soldaten hatten alle Leichen verscharrt. Trotzdem sickerten gewisse Information durch. Den Kindern hatte man einfach die Köpfe eingeschlagen – warum sollte man Kugeln vergeuden? Frauen waren aufgeschlitzt, alte Männer verstümmelt und regelrecht abgeschlachtet worden.
»Nun wissen wir, was von der Feuerpause zu halten ist, die für den März vereinbart wurde.«
James runzelte die Stirn.
»O Gott, es tut mir so leid«, beteuerte Tara. »Bitte, denk daran, nicht alle Weißen sind so ...«
»... wie Warren«, vollendete er den Satz. »Trotzdem – es gibt viel zu viele von seiner Sorte.«
Inzwischen hatten sie die Veranda erreicht. Tara führte ihn zu der Wiege, die sanft im Wind schaukelte. Darin lag sein kleiner Neffe Ian und schlief friedlich. James lächelte. Zweifellos war der Junge ein echter McKenzie, mit dichtem, glänzendem schwarzem Haar. »Vor diesem Engel mußt du dich in acht nehmen«, erinnerte er Tara.
Belustigt drohte sie ihm mit dem Finger. »Und jetzt ...«
Mehr konnte sie nicht sagen. James’ fünfjährige Tochter Jennifer stürmte aus dem Haus und warf sich in seine Arme. »Daddy!«
Liebevoll hob er sie hoch, drückte sie ganz fest an seine Brust, spürte ihren lebhaften Herzschlag, roch Taras Parfüm, das sie ausprobiert hatte. Nichts auf der Welt bedeutete ihm so viel wie Jennifer.
Seit dem Tod seiner Mutter und seiner Schwester wohnte sie bei Tara und Jarrett, und sie verstand, daß der Vater sich nur selten um sie kümmern konnte. Für ihr Alter war sie schon sehr vernünftig.
Voller Stolz betrachtete er ihr hübsches, goldbraunes Gesicht, die bernsteinbraunen Augen mit den grünen Pünktchen, von der Mutter geerbt. Pechschwarze Locken reichten ihr bis zur Taille, und sie war so elegant gekleidet wie die kleinen Kinder der Weißen, weil Tara immer wieder hübsche Sachen für sie nähte.
In diesem Haus wurde sie mit Liebe überschüttet.
Armes Kind, dachte James, was habe ich dir angetan? So wie er selbst würde sie stets zwischen zwei Welten hin und her wandern und sich zerrissen fühlen. Er drückte seine Tochter wieder an sich, und über ihre Schulter hinweg schaute er die Schwägerin an. Danke, formten seine Lippen.
»Wie gut du aussiehst, Daddy!« Jennifer nahm sein Gesicht zwischen ihre dicken Händchen. »So formidabel! Und so gefährlich! Ganz einfach toll!«
Erstaunt über diese Ausdrucksweise einer Fünfjährigen, wandte er sich zu Tara, die unbehaglich errötete.
»Nun ja, du erregst großes Aufsehen in dieser Gegend«, erklärte sie. »Neulich kamen Chloe, die Tochter der Smithsons, und ihre Kusine Jemma Sarne zum Tee.«
»Und?« fragte er verständnislos.
»Die beiden sind blutjunge Mädchen und leicht zu beeindrucken. In ihren Augen bist du ein grandioser ...«
»Wilder?«
»James!«
»Schon gut. Also plappert meine Tochter diesen Unsinn nach.«
»Du bist ja auch sehr attraktiv, James. Das habe ich dir schon oft genug gesagt.«
»Und du bist außer meinem Bruder die einzige weiße Person, die ich mag. Verschone mich mit deinen Freunden, die für edle, grandiose Barbaren schwärmen.«
»So ist es doch gar nicht ...«
»O Tara, ich habe deine Parties oft genug besucht, um zahlreiche Angebote von scheinbar sittsamen Damen zu erhalten, die mich in meiner Trauer trösten wollten. Seltsam, welche Wirkung ich erziele, wenn ich in meiner hocheleganten europäischen Kleidung auftrete ... Würden mich diese Damen im Lendenschurz sehen, in voller Kriegsbemalung, wären sie wohl nicht so fasziniert.«
»Vielleicht wärst du überrascht.«
»Dann frag doch einmal die Väter dieser illustren Mädchen, wie es ihnen gefiele, wenn ihre Töchter eine Affäre mit einem Halbblut hätten.«
»So voreingenommen, wie du tust, bist du gar nicht. Immerhin habe ich schon einige Gerüchte über deine Liebschaften gehört.«
Er seufzte unmutig und stellte Jennifer auf den Boden. »Siehst du Othello da drüben?« Er zeigte auf seinen hochbeinigen braunen Hengst. »Nimm ihn am Zügel und führ ihn zu den Büschen, da wächst saftigeres Gras.«
Erfreut und sichtlich stolz, weil ihr eine so wichtige Aufgabe anvertraut wurde, rannte sie davon.
James schaute ihr nach. Dann wandte er sich wieder zu seiner Schwägerin. »Tara, ich bin ein unglücklicher, verbitterter Mann. Sicher, seit Naomis Tod habe ich mich mit einigen Frauen eingelassen. Doch das waren keine ›Liebschaften‹. Ich überlege mir sehr genau, bei wem ich Trost suche. Denn ich habe nichts zu geben. Deine kichernden Freundinnen amüsieren und ärgern mich gleichermaßen. Erst werfen sie mir begehrliche, schmachtende Blicke zu, dann laufen sie davon, sobald ihre gestrengen Väter ins Zimmer kommen. Aber ich habe ohnehin keine Lust, mit irgendwelchen Frauen zu flirten, weder mit roten noch mit weißen oder gestreiften, wie du’s mal formuliert hast.«
»Wart’s doch ab. Morgen gebe ich eine Party. Nur gute alte Freunde, keine Soldaten, nicht einmal Tyler Argosy. Übrigens, er hat mir einen seltsamen Brief geschrieben. Er wollte nach Fort Brooke reiten, um das Kind irgendeines Kommandanten abzuholen. Aber er ist verhindert, und deshalb soll es vorerst bei uns wohnen. Jarrett wird’s mitbringen. Heute abend oder morgen kommt er nach Hause, und wir werden seinen Geburtstag feiern. Du bleibst doch hier?«
»Tara ...«
»Hör mal, James, es ist der Geburtstag deines Bruders.«
»Also gut, dann werde ich mich wieder mal herausputzen und zur Schau stellen und den Leuten zeigen, wie zivilisiert sich ein Wilder benehmen kann.«
»James!«
»Tut mir leid. Mein Groll gilt nicht dir. Natürlich bleibe ich hier. Ich muß ohnehin einiges mit Jarrett besprechen, und ich möchte ihn wiedersehen.«
Lächelnd küßte sie seine Wange. »Dann werde ich Jeeves jetzt sagen, daß du zum Dinner bleibst und bei uns übernachtest. Dein Zimmer ist bereit, so wie immer.«
»Danke. Eine gute Mahlzeit und ein weiches Bett – das kann ich wirklich gebrauchen.«
»Gleich bin ich wieder da«, versprach sie und eilte ins Haus.
Ein paar Minuten später kehrte Tara McKenzie auf die Veranda zurück.
James schaute nach Westen, zur Grenze des Anwesens, wo dichte Büsche und Bäume wuchsen. Im goldenen Licht des Sonnenuntergangs schimmerte seine Haut wie Kupfer. Sie sah die breite, kraftvolle Brust unter der offenen Weste, die muskulösen Schultern und Arme.
In diesem Augenblick sah er tatsächlich wie ein grandioser Wilder aus. Unwillkürlich erschauerte sie. Mochte der Himmel allen beistehen, die jemals seinen Zorn erregen würden ...
Tara kehrte unbemerkt ins Haus zurück und ließ ihn mit seinen Gedanken allein.
3
In erstaunlich kurzer Zeit erreichte Jarrett McKenzies Schiff den heimatlichen Kai am Flußufer. Die Sonne hatte den Zenit eben erst überschritten. Schon seit mehreren Stunden stand Teela im Bug und schaute sich fasziniert um.
Jarrett beobachtete sie lächelnd. Warrens Tochter! Wer hätte das gedacht? Stieftochter, verbesserte er sich. Darauf hatte sie energisch hingewiesen.
Doch sie war in Michael Warrens Obhut aufgewachsen und irgendwie dem Bösen entronnen, das ihm wie eine unheilbare Krankheit anzuhaften schien. Ein lebhaftes, kluges, offenherziges Mädchen – und bildschön ...
Zum Glück führte er eine gute Ehe. Sonst wäre es ihm vielleicht schwergefallen, seiner Frau zu erklären, warum sich ein so reizvolles Geschöpf an Bord seines Schiffes befand, noch dazu ohne Anstandsdame.
Teela Warrens kastanienrotes Haar schimmerte im Sonnenlicht, die grünen Augen, die ein herzförmiges Gesicht mit einer zierlichen kleinen Nase und provozierend geschwungenen dunklen Brauen beherrschten, glichen einer Sommerwiese. Für eine Frau war sie ziemlich groß, und sie besaß eine Schlanke, wohlgeformte Figur. Ihr rastloses Temperament wirkte genauso bezaubernd wie ihre offensichtlicheren Vorzüge. Sicher würde sie Tara ebensogut gefallen wie ihm.
Und es freute ihn diebisch, daß er einen Entschluß gefaßt hatte, der Warren ärgern würde.