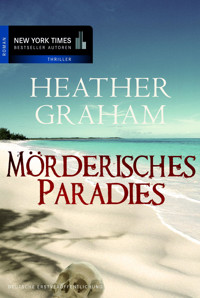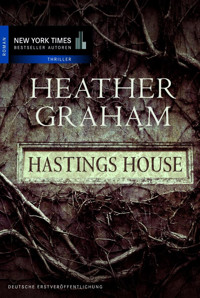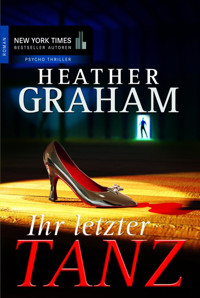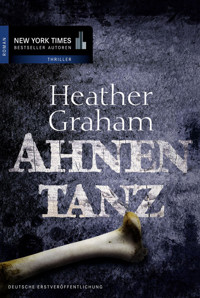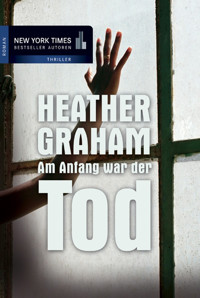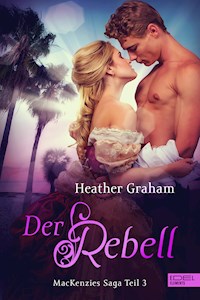
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: MacKenzies Saga
- Sprache: Deutsch
Ihre leidenschaftliche Liebe zu dem eleganten Nordstaaten-Major Ian McKenzie stellt Alaina vor eine schwere Entscheidung: Soll sie einen Skandal riskieren und einen Mann heiraten, der bald auf der Seite des Feindes stehen wird?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Ihre leidenschaftliche Liebe zu dem eleganten Nordstaaten-Major Ian McKenzie stellt Alaina vor eine schwere Entscheidung: Soll sie einen Skandal riskieren und einen Mann heiraten, der bald auf der Seite des Feindes stehen wird?
Heather Graham
Der Rebell
MacKenzies Saga Teil 3
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2020 by Heather Graham
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Meller
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-340-3
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Prolog Ein gefährliches Spiel
Mai 1862
Die Nacht war unheimlich in dieser fremden Wildnis, wo flüsternde Brisen und leise plätschernde Wellen an die verstohlenen Bewegungen eines Raubtiers erinnerten. Am schwarzen Samthimmel stieg ein Vollmond empor und warf sein elfenbeinweißes Licht auf die Landschaft.
Manchmal verdeckten ihn dichte Wolken, und dann glich das Dunkel einem bodenlosen Abgrund. Insekten summten, eine Eule kreischte. Den neuen Rekruten der Unionskompanie Panther’s Men erschienen diese Nacht im südlichen Florida noch schlimmer als das drohende Grauen des Schlachtfelds.
Nur ihr Kommandant empfand keine Angst. Mit sicheren Schritten hatte er den gefährlichen tropischen Wald voller Reptile und Panther durchquert, denen seine Kompanie und er selbst den Spitznamen verdankten.
Angeblich konnte er völlig lautlos einen Fuß vor den anderen setzen. Seine Augen durchdrangen die schwärzesten Schatten. Wenn er die tödlichen Kreaturen der Sümpfe, des Dickichts und des Meeres auch respektierte, er fürchtete sie nicht. Er führte seine Männer auf Wege, die sie niemals gefunden hätten. Wann immer er die Wildnis durchquerte, wurde er eins mit ihr. Manchmal erschreckte er seine eigenen Leute, indem er wie ein Geist auftauchte oder verschwand.
In dieser Nacht hatten sie ihre Pferde in einem Quartier auf einem Hügel festgebunden, etwa eine Viertelmeile entfernt, und die Zivilisation zu Fuß verlassen. Sie waren in ein Gebiet südlich des alten, während der Seminolenkriege benutzten Außenpostens Fort Dallas eingedrungen. Doch er versicherte seinen Männern, sie würden sich immer noch im Dade County befinden, nach dem Kommandanten genannt, der im zweiten Seminolenkrieg gefallen war.
Obwohl er nicht von Indianern abstammte, hatte er Verwandte unter den Seminolen, und er kannte die Sümpfe und das Meer ebensogut wie sie. Man munkelte, er sei auch mit Panthern und Alligatoren verwandt und könne wie eine Katze durch den Dschungel laufen, wie eine große Echse durch brackige Wasser gleiten.
Auf den ersten Blick glich der Major mit seinem schulterlangen ebenholzschwarzen Haar und seinem schlanken, muskulösen, bronzebraunen Körper einer Rothaut. Seine kobaltblauen Augen verstärkten diesen Eindruck, weil sie manchmal so schwarz und gefährlich wie die Hölle schimmerten.
Es war gut, daß Major Ian McKenzie selbst ein gefährlicher Mann war, denn er führte seine Soldaten zu einem gefährlichen Ort. Nun warteten und lauschten sie angespannt, in der Hoffnung, die Mokassinschlange gefangenzunehmen, einen berüchtigten Rebellenspion, der an der Küste Floridas operierte.
Alle Unionssoldaten fürchteten einen Einsatz in Florida, in einem Niemandsland, das die Rebellen nicht halten und ihre Gegner nicht erobern konnten. An der meilenlangen Küste voller versteckter Buchten und Meeresarme wirkte die Unionsblockade geradezu lächerlich. Andererseits waren die Ufergebiete jederzeit den Angriffen der Union ausgeliefert. Schon mehrmals hatte Jacksonville den Besitzer gewechselt. St. Augustine war von den Truppen der Nordstaaten erobert und bisher gehalten worden. Auch der Navy-Stützpunkt Key West befand sich in den Händen der Union. Aber im restlichen Teil des Staates dominierten die Feinde. Florida war als dritter Staat von der Union abgefallen, und seine Konföderierten verfochten leidenschaftlich die Interessen der Südstaatler.
Obwohl viele Rebellentruppen aus Florida häufig in Virginia, Tennessee und anderen Südstaaten eingesetzt wurden, durfte man die Verteidigung der Halbinsel nicht vernachlässigen, die äußerst wichtig für das Kriegsgeschehen war. Denn ein Großteil des Rindfleisch- und Salzvorrats, den die Truppen der Konföderierten benötigten, stammte aus Florida. Deshalb tat die Union ihr Bestes, um den Staat unter Kontrolle zu bekommen, und die Mokassinschlange mußte geschnappt werden.
Seit man im Norden Floridas vor ein paar Wochen mehrere Rebellen der Spionage verdächtigt und gehängt hatte, war der Major fest entschlossen, diesem unseligen Treiben ein Ende zu bereiten.
Schon seit einiger Zeit strapazierte die Mokassinschlange die Nerven der Nordstaatler. Wenn die Unionsschiffe Blockadebrecher aufzuhalten suchten, wußten die Kapitäne der Rebellen viel zu oft Bescheid, und in der nächsten Bucht oder hinter der nächsten Düne lauerte ihre Verstärkung. Konföderiertenschiffe mit Waffenladungen durchbrachen die Blockade und erreichten durch Meerengen die Rebellentruppen. Auf diese Weise gelangte auch Gold in Feindeshand. Immer wieder wurden Unionssoldaten jenseits des St. Johns River und außerhalb St. Augustines von verzweifelten Rebellentruppen gefangengenommen, die den Nordstaatlern auch entlang der Küste zusetzten.
Major McKenzie hatte freie Hand und die Order, die Aktivitäten aller Spione, Verräter und Blockadebrecher zu unterbinden. Dabei sollte er die Methoden anwenden, die er für richtig hielt. Und seit man jene Spione gehängt hatte, wuchs seine innere Anspannung. Nach seiner Ansicht durfte das Militär nicht das Gesetz verkörpern. Soldaten starben auf dem Schlachtfeld, eine traurige Tatsache. Aber wenn die Unionskommandanten das Gesetz zu oft in die eigenen Hände nahmen, würde der Krieg seinen Sinn verlieren. Dann würden sie nicht mehr für die Einheit des Landes kämpfen, für Ruhm und Ehre, sondern auf der gleichen Stufe stehen wie gemeine Mörder.
»Ein Schiff! O Gott, Major, Sie hatten recht!« flüsterte der alte Sam Jones.
»Immer mit der Ruhe, Jungs!« McKenzies Stimme schien aus dem Nichts heranzudringen. »Vorerst können wir das Schiff nicht kapern. Niemand soll Wind von uns bekommen und die Fracht wegschaffen, die wir erbeuten können.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Wir wollen den Landetrupp gefangennehmen, Gentlemen – und die Mokassinschlange.«
Der Spion starrte zur Küste, die sich rasch näherte. Fast daheim, dachte er erleichtert, denn der Krieg ermüdete und deprimierte ihn. Manchmal bereute er, daß er so loyal gewesen war, in die Rolle der Mokassinschlange zu schlüpfen und dieses gefährliche Spiel zu spielen.
Leidenschaftlich hatte der Spion an die Staatenrechte des Südens geglaubt, an das Recht der Südstaatler auf Unabhängigkeit, an ihr Recht, so zu leben, wie sie es wünschten. Wenn die Nordstaatler das verstünden, wäre kein Krieg ausgebrochen.
Aber nun wurde die Mokassinschlange immer öfter von Angst und Sorge gequält. Vielleicht sollte sie den Rückzug antreten. Sie hatte gute Arbeit geleistet, vielen Rebellen das Leben gerettet, wichtige Informationen weitergeleitet und gut geplante Operationen durchgeführt. Doch die Zeiten änderten sich. Was würde geschehen? Sollte der Spion einfach ins Wasser tauchen und im Dunkei der Legende verschwinden, wieder ein eigenes Leben führen, vielleicht verbittert – und trotzdem nicht ohne Hoffnung.
Kurz bevor das Schiff auf Grund laufen konnte, drehte es in der schmalen Bucht bei. »Laßt ein Boot hinab!« befahl der Kapitän, ein tüchtiger, erfahrener alter Seemann und erprobter Blockadebrecher, der oft mit der Mokassinschlange zusammenarbeitete. Die beiden waren gute Freunde.
Niemals hatten sie versucht, sich am Krieg zu bereichern. Die wichtigste Schmuggelware bestand aus Chinin, Äther, Chloroform und Laudanum. Und es war das vornehmste Ziel, Menschenleben zu retten. Die Mokassinschlange hatte der Union schon schweren Schaden zugefügt. In allen Yankee-Häfen behauptete man, sie sei gefährlicher als echte Schlangen. Und man gab die Parole aus, sie müsse endlich gefaßt werden, tot oder lebendig, gehängt oder erschossen – gnadenlos.
Solche Drohungen pflegte der Spion zu ignorieren. Nur wenn er die Angst verdrängte, vermochte er seine Pflicht zu erfüllen. An diesem Abend trug er einen großen Schlapphut, der sein Gesicht verdeckte, und einen weiten Mantel mit vielen Taschen. Darin steckten Korrespondenz, Gold, harte Yankee-Währung und Laudanum. Sollte der Feind die Mokassinschlange über Bord werfen, würde das Gewicht des Mantels ihren Körper in die Wassertiefe hinabziehen. Doch sie konnte ihn jederzeit ablegen und, wenn es möglich war, später holen.
Doch in dieser Nacht müßte die Aktion reibungslos verlaufen. Das Niemandsland lag in der Nähe seiner Heimat. Mit scharfen Augen spähte er zur Küste, wo er nichts Verdächtiges entdeckte.
Immer wieder verkroch sich der Mond hinter den Wolken, und wenn er hervorkam, verbreitete er ein seltsames gelbliches Licht. Das Wasser schimmerte schwarz, die Bäume verschwammen in schweigenden Schatten. Nichts, aber da drüben ... »Warte!« flüsterte er.
Der Kapitän, der gerade einem Mann befehlen wollte, die Mokassinschlange ans Ufer zu rudern, hielt inne. »Siehst du was?«
Da hatte sich etwas bewegt. Ein plötzliches Grauen erfaßte den Spion. Zwischen den Baumstämmen funkelten zwei rote Lichter, und er atmete auf. »Ein kleines Reh.«
»Bist du sicher?«
»Ja.«
»Jenkins, bringen Sie die Mokassinschlange an Land.«
»Ja, Sir.« Der junge Seemann salutierte, und der Kapitän wandte sich wieder zu der Mokassinschlange.
»Sei vorsichtig.«
»Natürlich.«
»Vergiß nicht – dein Leben ist kostbarer als deine Fracht, weil du unersetzlich bist.«
»Daran werde ich stets denken. Jetzt muß ich gehen.«
Der Kapitän nickte bedrückt, suchte nach Worten und fand keine. Auch er wurde von einer bösen Ahnung gequält. Das spürte der Spion und erschauerte.
»Sei vorsichtig«, mahnte der Kapitän noch einmal.
»Keine Bange, ich verstehe mein Handwerk.«
»Nun sollten wir losfahren«, meinte Jenkins unbehaglich. Er stammte aus Jacksonville, und er haßte das Sumpfgebiet im Süden des Staates, wo die täuschend schöne Küste nur einen schmalen Landstrich am Rand des feuchten Everglades-Dschungels bildete.
Geschmeidig kletterte die Mokassinschlange über die Steuerbordreling und folgte Jenkins in das kleine Boot. Der Seemann tauchte die Ruder ins Wasser, und der Kahn glitt über das nachtschwarze Meer.
»Halt!« wisperte der Spion plötzlich. Ein sonderbares Gefühl beschleunigte seinen Puls. Wurden sie beobachtet – und erwartet? Der keuchende Atem einer großen, schrecklichen Kreatur schien im Dunkel widerzuhallen. Aber an der Küste regte sich nichts.
Obwohl Jenkins das Boot zu bremsen versuchte, fuhr es weiter, immer noch getrieben von der Kraft seiner Ruderschläge.
Dann erwachte der Waldrand zum Leben. Der Mond, wieder hinter Wolken versteckt, erhellte die Szenerie nicht. Aber die Mokassinschlange hörte die Schritte der Männer, die zwischen den Bäumen hervorrannten und Gewehre auf den Kahn richteten.
»Ergeben Sie sich, und Ihr Leben wird geschont!«
Der Mond verbreitete erneut seinen geisterhaften Glanz und beleuchtete acht Männer in den verhaßten blauen Yankee-Uniformen, die sich am Ufer postiert hatten. Vier knieten, vier standen. Und alle Gewehre zielten auf die Insassen des Boots.
»Verdammt!« fluchte Jenkins. Er konnte und wollte nicht fliehen. Ehe er auch nur die Zehen in dieses grausige Gewässer tauchte, würde er lieber hundert Unionssoldaten gegenübertreten. »Wir müssen kapitulieren!«
Aber die Mokassinschlange warf ihm nur einen verächtlichen Blick zu und glitt ins Wasser.
»Zum Teufel mit dem Schurken!« fauchte Ian McKenzie, zog das Jackett seiner Kavallerieuniform aus, nahm den Waffengurt ab und schlüpfte aus den Stiefeln. »Holt den Rebellen aus dem Boot und paßt auf, ob unser Freund irgendwo an Land schleicht. Und Sie, Gilbey Clark ...« Er zögerte nur kurz. Obwohl Gilbey zu den neuen Rekruten zählte, hatte er seine Kompetenz bereits bewiesen. »Gehen Sie an den Bäumen entlang. Sam, folgen Sie ihm im Abstand von fünfzig Metern. Lassen Sie das Wasser nicht aus den Augen!« Dann warf er sich in die seichten Wellen und schwamm in die Richtung des Kahns.
Dieser verrückte Spion! Alle trugen die Schmuggelware in der Kleidung bei sich. Also würde der Idiot wie ein Sack voller Blei untergehen.
Aber die Mokassinschlange war unauffindbar. Ian suchte noch einmal den Meeresboden ab. Triumphierend prustend tauchte er dann wieder auf und zog den schweren Mantel des Spions an Land.
»Hier!« erklang ein atemloser Schrei.
Ian ließ den Mantel fallen und rannte die Uferböschung hinauf. Ganz in der Nähe erhob sich ein Schatten aus dem Wasser.
»Halt, oder ich schieße!« rief Gilbey.
Ian stürmte zu ihm und stieß das Gewehr beiseite. »Nicht! Ich will ihn lebend haben.«
Er rannte an dem jungen Mann vorbei, ohne den rauhen Boden unter seinen nackten, schwieligen Sohlen zu beachten. In einer kleinen Sandgrube zwischen knorrigen Wurzeln holte er den Spion endlich ein, stürzte sich auf ihn, und sein Gewicht riß die schmale Gestalt zu Boden. Mühelos überwältigte er den Feind und saß rittlings auf seinen Hüften.
Hell strahlte der Mond. Obwohl das nasse blonde Haar, mit Seegras verflochten, am bleichen Gesicht der Mokassinschlange klebte, war sie unglaublich schön. In ihren grünbraunen Augen, von langen honigfarbenen Wimpern umrahmt, funkelten goldene Lichter. Ian betrachtete eine zierliche gerade Nase, hohe Backenknochen, ein eigenwilliges Kinn und verführerische volle Lippen.
In seinem Herzen hatte er die Wahrheit geahnt und sich geweigert, daran zu glauben. Was sie in seinen Zügen las, wußte er nicht. Aber es schien zu genügen, um die letzte Farbe aus ihren Wangen weichen zu lassen. Offenbar spürte sie seine momentane Schwäche, die der Schock auf seine Entdeckung war. Und sie nutzte ihren Vorteil. Plötzlich riß sie einen Arm hoch, und ihre Faust traf schmerzhaft sein Kinn.
Was für eine erstaunliche Frau ... Wie auf Wolken konnte sie durch einen Ballsaal schweben und mit ihrem Lächeln sogar hartgesottene, abgebrühte Soldaten entwaffnen. Sie war klein und zart wie eine fragile Rose. Trotzdem hatte er ihre innere Stärke gespürt, ihren eisernen Willen – und jetzt in seinem Zorn vergessen.
Der kraftvolle, zielsichere Schlag warf ihn vorübergehend aus dem Gleichgewicht. Verzweifelt bäumte sie sich auf und versuchte, ihn wegzustoßen.
Aber er ließ sie nicht los. Sie glaubte, sie müßte sich aus seinem unerbittlichen Griff befreien, um ihr Leben zu retten, doch er wußte es besser. Nur wenn sie seine Gefangene blieb, durfte sie Hoffnung schöpfen. Er hatte seine bittere Lektion gelernt und wußte, daß er nicht alle Rebellenspione vor dem Galgen bewahren konnte. Zudem hatte er oft genug die grausig verzerrten Gesichter seiner gehängten Landsleute gesehen. Bis zu seinem letzten Atemzug würde ihn dieser Alptraum verfolgen.
Der Aufruhr seiner Gefühle drohte ihn zu überwältigen. Er packte wütend ihre Handgelenke und warf sie in den Sand zurück. Entsetzt rang sie nach Luft, starrte ihn an und schien zu glauben, er würde sie töten.
Mühsam bezwang er seinen Zorn. »Du bist also die gottverdammte Mokassinschlange.« Nicht nur seine Unbeherrschtheit mußte er bezähmen, sondern auch seine Angst, den Schmerz, die Erinnerungen – und seine Begierde. Denn sie war immer noch Alaina, warm und weich und verlockend unter seinem Körper, Alaina mit ihren Katzenaugen, ihrem Lächeln, ihrem leidenschaftlichen Temperament, ihrer Hingabe, die einzig und allein den Interessen der Südstaaten galt. »Wie kannst du es wagen?«
»Und du bist der gottverdammte Panther! Der Verräter! Um Himmels willen, das ist Florida! Wie kannst du es wagen?«
Als sie verstummte, hörte er die leisen Schritte seiner Männer. Inzwischen hatten sie die Pferde geholt. Sam Jones, seit langer Zeit seine rechte Hand, hielt die anderen mit einer knappen Geste zurück. Sofort blieben die acht Männer, von Ian sorgsam für diese nächtliche Operation ausgewählt, reglos stehen und warteten. Sie würden seine Befehle befolgen, was immer er auch fordern mochte. In erster Linie fühlten sie sich nicht der Union, sondern dem Major verpflichtet, denn er hatte sie zu überleben gelehrt.
In dieser Nacht war er für ihre Loyalität so dankbar wie nie zuvor. Hoffentlich würden sie seine Angst nicht bemerken – seine Angst um die Mokassinschlange. Er kannte das Schicksal, das den Spionen drohte.
»Major, der Rebell, der das Boot gerudert hatte, geriet in Panik und ertrank«, berichtete Sam. »Leider konnten wir ihn nicht retten.«
Sekundenlang schloß Ian die Augen. Im Krieg war der Tod alltäglich. Aber der Gedanke an ein vergeudetes Menschenleben bedrückte ihn. »Schon gut, Sam.« Wie erstaunlich ruhig seine Stimme klang ... »Brian, Reggie, kümmern Sie sich um die Leiche. Wir kehren zum Basiscamp zurück.« Dann flüsterte er der Mokassinschlange zu: »Versuch nicht noch einmal, mir zu entkommen.«
»Würdest du mich erschießen?« Offenbar brauchte sie tatsächlich eine Antwort auf diese Frage.
»Im Sumpf werden meine Männer leicht nervös. Manchmal schießen wir auf alles, was sich bewegt.« Das war eine Lüge. Trotz aller Gefahren verhielten sich seine Leute mustergültig und sehr diszipliniert. Er erhob sich, zog Alaina auf die Beine und setzte sie in den Sattel seines Hengstes Pye, einem Arabermischling aus der Zucht seiner Familie, der weder den Sumpf noch die Schlangen fürchtete. Seit dem Ausbruch des Krieges lebte Pye im Dschungel.
Immer noch von Wut und Angst erfüllt, stieg Ian hinter der Mokassinschlange auf. Großer Gott, was sollte er tun?
Eine halbe Stunde später erreichten sie ein paar Hütten, in einer sumpfigen Lichtung auf Stelzen gebaut, von hohen Kiefern abgeschirmt. In der kalten Nachtluft begann Alaina zu frösteln. Sie trug durchnäßte Breeches, ein Baumwollhemd und Stiefel. Ganz in der Nähe lag das Haus, wo sie aufgewachsen war. Dort könnte sie Hilfe finden. Aber ihre Rettung würde Ians Tod bedeuten. Ehe er sich seine Gefangene entreißen ließ, würde er sein Leben opfern. Also gab es kein Entrinnen – sie würde am Galgen enden.
Nein! Das durfte nicht geschehen ... Was für eine naive Närrin bin ich gewesen, dachte sie. Jetzt erschien es ihr unvermeidlich, daß sie in ihr Verderben gerannt war. Hätte er seinen Soldaten doch befohlen, sie zu Fuß durch den Sumpf zu schleifen! Es war unerträglich gewesen, mit ihm zu reiten, an seiner kraftvollen Brust zu lehnen, seinen Zorn zu spüren.
Am Rand der Lichtung sprang er vom Pferderücken. Seine Kobaltaugen schauten Alaina kurz an. Blaues Feuer ... Dann wandte er sich zu seinen Männern. »Kümmert euch um die Gefangene«, befahl er brüsk, ehe er eine der Hütten betrat.
Vielleicht wollte er aus ihrer Nähe fliehen, weil er fürchtete, er würde sie sonst erwürgen. Welche Rolle spielte das schon, wenn sie ohnehin hängen sollte? Sie würde einen schnellen Tod unter seinen Händen vorziehen.
Aber er war der berühmte Major Ian McKenzie. Niemals würde er so tief sinken und eine Gefangene kaltblütig ermorden. Statt dessen würde er das Gesetz – das Gesetz der Union – befolgen.
Nachdem er in der Hütte verschwunden war, starrten seine Männer die Mokassinschlange verwirrt an. Einer kam zu ihr. »Ich heiße Sam. Bitte versuchen Sie nicht zu fliehen, Ma’am. Pye würde Sie abwerfen.«
Natürlich, das Pferd war ihm ebenso treu ergeben wie seine Truppe.
Sam hob sie aus dem Sattel. Erst jetzt merkte sie, wie sehr die Ereignisse dieser Nacht sie mitgenommen hatten. Sie konnte kaum stehen, und ein anderer Soldat eilte herbei, um sie zu stützen. Mit großen braunen Augen starrte er sie an, sichtlich fasziniert. Zu schade, daß dieser Junge nicht ihr Gefängniswärter war ... Sie wäre in wenigen Minuten frei. »Danke«, sagte sie leise.
Warum hatte man sie die Mokassinschlange genannt? Weil sie den Fallen, die man ihr gestellt hatte, stets mühelos entgangen war? In dieser Nacht würde ihr die Flucht nicht gelingen.
»Kommen Sie, Ma’am, ich bringe Sie in Ihre Hütte. Gilbey, holen Sie frisches Wasser für die Lady. Und Sie, Brian, halten Wache vor der Tür.«
Locker umfaßte seine Hand ihren Ellbogen, als er ihr die Stufen hinaufhalf, die zu der kleinen, auf Pfählen gebauten Plattform führten. Er war höflich, aber unerbittlich. In der Hütte zündete er eine Kerosinlaterne an. »Hier müßten Sie’s bequem genug haben. Ein Bett und Decken, saubere Laken, in die Sie sich wickeln können, während Ihre Kleidung trocknet ... Sonst kann ich Ihnen leider nicht viel bieten. Ah, da ist ein Stück Seife. Und hier finden Sie eine Waschschüssel und einen Krug. Gilbey wird Ihnen Wasser bringen. Außer dem Bett, diesem Tisch und dem Stuhl haben wir keine Möbel.«
»Trotzdem bin ich tief beeindruckt, Sam«, erwiderte sie.
Es klopfte an der Tür, und der junge Soldat trug einen großen Eimer herein. Während er Wasser in die Schüssel goß, flüsterte er: »Ist sie wirklich die Mokassinschlange, Sam?«
»Ja«, bestätigte Sam müde. »Ma’am, jetzt lassen wir Sie allein.«
Brian saß am Fuß der Treppe, und Sam gesellte sich zu ihm. An einen der dicken Kiefernstämme gelehnt, die den kleinen Holzbau stützten, zog er sein Messer und eine Schnitzerei hervor. Daran arbeitete er schon sehr lange. »Sagen Sie dem Major, wir hätten die Gefangene in ihr Quartier geführt«, befahl er Gilbey.
Das frische Wasser schmeckte köstlich. Für ein paar Sekunden vergaß Alaina ihre mißliche Lage und stillte ihren Durst. Dann fluchte sie leise, zog ihre nassen Sachen aus und wusch sich gründlich. Fröstelnd hüllte sie ihren Körper in ein Laken. In der Hütte brannte kein Feuer, und die Frühlingsnacht war bitterkalt. Mit gekreuzten Beinen saß sie auf dem Bett. Wenigstens vergönnte man ihr eine Lampe und Wasser, wahrscheinlich viel mehr, als die Mokassinschlange verdiente.
Würde sie Ian noch einmal sehen, bevor sie am Galgen baumelte? Würde er ihr eine Gelegenheit geben, ihm zu sagen ...?
Was? Sie hatten ganz verschiedene Wege gewählt. Daran ließ sich nichts mehr ändern. Oft genug hatte sie ihn gehaßt. Auch jetzt müßte sie ihn hassen. Doch es gelang ihr nicht.
Sollte sie ihn um Gnade bitten? Sie hatte sich stets geschworen, in Würde zu sterben, falls man sie eines Tages gefangennahm. Trotzdem würde sie ihn in dieser Nacht anflehen ... Nein, unmöglich. Welche Argumente konnte sie dann vorbringen? Er würde ihr bestimmt kein Wort glauben. Verzweifelt sprang sie auf. Es war sinnlos, mit Ian zu verhandeln, weil sie nichts mehr besaß, was er vielleicht haben wollte. In ihrer Kehle stieg ein leises Schluchzen auf.
Dann hörte sie Schritte auf den Stufen. Die Tür schwang auf, und Ian trat ein. Inzwischen hatte er trockene Sachen angezogen. Sein Gesicht schimmerte bronzebraun im Laternenlicht, die Augen wirkten nicht blau, sondern schwarz. Durchdringend starrte er sie an, so lange, daß sie schreien und ihn bitten wollte, sie sofort zu erschießen und die Qual nicht unnötig zu verlängern. Endlich brach er das Schweigen. »Die Mokassinschlange ... Zum Teufel mit dir!«
»Nein, zum Teufel mit dir! Du hast deinen Staat verraten! Nicht ich!«
Eine pechschwarze Haarsträhne fiel ihm in die Stirn und verbarg, was Alaina vielleicht in seinen Augen gelesen hätte. Aber es war sicher besser, wenn sie nicht wußte, was er dachte.
»Da irrst du dich«, entgegnete er. »Mein Staat hat meine Nation verraten. Wie auch immer, die Politik ist nicht mehr wichtig. Und es spielt auch keine Rolle, ob der Allmächtige auf deiner Seite steht oder auf meiner. Jetzt kommt’s nur darauf an, daß du vom Feind geschnappt wurdest, meine liebe Mokassinschlange, während ich diesem Schicksal entronnen bin.«
»Und was hast du jetzt mit mir vor?« fragte sie tonlos.
Er hob die ebenholzschwarzen Brauen. »Was macht man mit gefährlichen Schlangen? Vielleicht sollte ich dir all die schlimmen Dinge antun, die zarte Treibhauspflanzen wie du angeblich in der Gewalt brutaler Yankees erdulden mußten. Vergewaltigung, Mord ...«
»Bitte, Ian ...«
Langsam ging er auf sie zu.
Ein Schrei zerriß die nächtliche Stille und verstummte sofort.
Nachdem Gilbey dem Major die Nachricht überbracht hatte, die Gefangene sei in Gewahrsam, war er ihm zur Hütte gefolgt. Nun sprang er erschrocken von den Stufen auf.
»Haben Sie das gehört, Sam?«
Gleichmütig zuckte Sam die Achseln und schnitzte an seinem Eichenholz.
»Ich weiß, er hält sie für die Mokassinschlange ...«
»Das ist sie.«
»Noch nie habe ich den Major so wütend gesehen.« Gilbey schüttelte besorgt den Kopf. »Gewiß, sie ist eine Feindin. Aber – der Major hat stets betont, er würde nicht das Gesetz vertreten und jede Form vom Lynchjustiz verabscheuen. Und jetzt ist er vor Zorn außer sich. Dürfen wir ihm diese junge Frau ausliefern? Er könnte sie ernsthaft verletzen.«
»Keine Bange, er wird sie nicht umbringen.«
Erbost stand Gilbey vor Sam und stemmte seine Hände in die Hüften. »Wie können Sie da denn nur so sicher sein?«
»Haben Sie’s noch nicht erraten, Gilbey? Er wird sie nicht töten, weil sie Alaina ist.«
»Alaina?«
»Alaina McKenzie, verdammt noch mal! Seine Frau.«
Gilbeys Kinnlade klappte nach unten, und es dauerte eine Weile, bis ihm die Stimme wieder gehorchte. »Was? Der Panther und die Mokassinschlange sind miteinander verheiratet?«
»Wie man so schön sagt – im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt.« Seufzend schaute Sam zum bleichen Mond hinauf. Der Krieg hatte den Menschen sehr viel angetan, vor allem den McKenzies, die so großen Wert auf Ehre, Loyalität, Hingabe und Liebe legten. Brüder, die gemeinsam durch dick und dünn gegangen waren, wurden wegen ihrer unterschiedlichen Überzeugungen plötzlich auseinandergerissen. Bruder gegen Bruder. Vater gegen Sohn. Ehemann gegen Ehefrau ...
Sam empfand tiefes Mitleid mit Ian und Alaina, die nicht wissen konnte, was ihren Mann seit einiger Zeit motivierte – und warum er jetzt so unbarmherzig war. Und Ian? Nun, vielleicht fragten sich die beiden gerade, wann und wie die Liebenden zu Feinden geworden waren.
1
Mai 1860, Cimarron
»Was zum Teufel ...« Als Ian seinen Hengst Pye vom Flußschiff zu seinem Haus Cimarron führte, entdeckte er die seltsame Versammlung auf dem Rasen. Mehrere Männer, einige in Uniform, standen einer jungen Frau gegenüber, die ein Schwert zückte, ebenso wie einer der Soldaten. Was ging da vor? Er sprang in den Sattel und galoppierte zum Schauplatz der beängstigenden Szene. Zu seiner Verblüffung hörte er helles Gelächter.
»Ich soll den Angriff parieren?«
»Aye, Mistress, parieren und attackieren.«
Verwundert zügelte Ian sein Pferd und beobachtete das zierliche blonde Mädchen, das wie ein Engel aussah. Irgend etwas in ihrem Blick hätte die jungen Männer warnen müssen. Offenbar wußte sie genau, was sie tat. Ihre rechte Hand umfaßte in vorbildlicher Haltung ein geliehenes Kavallerieschwert, das einen sonderbaren Kontrast zu ihrem eleganten Tageskleid aus taubenblauem Brokat mit elfenbeinweißer Spitze bildete. Unter dem engen Oberteil zeichneten sich volle Brüste ab, der weite, schwingende Rock betonte die schmale Taille. Goldene Lichter tanzten in den grünbraunen Katzenaugen.
O ja, sie wußte, daß sie ihren Gegner besiegen konnte. Blitzschnell sprang sie vor, Stahl klirrte, und die Waffe des jungen Mannes landete im Gras. Ian kannte Lieutenant Jay Pierpont. Vor kurzem hatte er ihn im Stützpunkt Tampa getroffen. Es sprach für ihn, daß er ein guter Verlierer war und seine Niederlage mit Humor trug. »Brava!« rief er.
Ringsum erklang lautes Gelächter.
»Was, du läßt dich von einer Frau schlagen, Jay?«
Die junge Dame wandte sich zu seinem Freund, der ihn gehänselt hatte. »Sir, ich habe in Jay einen ausgezeichneten Lehrer gefunden.«
»Und Sie sind eine noch bessere Schülerin, Mistress«, erklärte der Lieutenant.
»Offensichtlich. In diesen letzten zehn Minuten habe ich alles, was ich über die Fechtkunst weiß, von Ihnen gelernt.«
Neues Gelächter folgte diesen Worten. Formvollendet verneigte er sich, und sie knickste. Die Soldaten umringten sie, und jeder versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
Lächelnd musterte sie ihre Bewunderer. Noch nie hatte Ian eine so temperamentvolle, anmutige Schönheit gesehen – oder eine Frau, die sich ihrer Reize und ihrer Überlegenheit so sicher gewesen war. Zweifellos konnte sie nicht nur ausgezeichnet fechten, sondern ebenso raffiniert flirten.
Wie sie mit diesen jungen Narren spielt, dachte er. Belustigt fragte er sich, ob sie auch sein Herz gefährden würde, hätte er nicht beschlossen, Risa zu heiraten, Colonel Angus Magees schöne, selbstbewußte Tochter. Als er absteigen und Pierpont bitten wollte, ihn mit der charmanten Dame bekannt zu machen, hörte er den Ruf seiner Mutter, die auf der Veranda stand. »Ian!«
Er ritt zum Haus, sprang aus dem Sattel und lief die Stufen hinauf. »O Mutter!« Liebevoll nahm er Tara McKenzie in die Arme und schwenkte sie im Kreis herum. »Ich habe dich so schmerzlich vermißt. Großer Gott, du wirst immer schöner. Wie machst du das nur?«
Lachend landete sie auf den Füßen und strich über seine Wange. »Mein teurer Erstgeborener, meine Freude und mein Stolz – du bist ein schamloser Schmeichler. Da dich deine militärische Karriere und die Politik restlos beanspruchen, hast du wahrscheinlich keinen Gedanken an deine arme Mutter verschwendet. Aber ich bin froh, daß du heute heimgekommen bist.«
»Ich habe drei Tage Urlaub – und zwei Tage Zeit, um nach Washington zurückzukehren.« Zögernd fügte er hinzu: »Ich muß eine wichtige persönliche Angelegenheit mit dir besprechen, Mutter. Und die augenblickliche politische Lage beunruhigt mich. Bald müssen gewisse Entscheidungen getroffen werden. Darüber möchte ich mit Vater reden.«
Unbehaglich runzelte Tara die Stirn, und Ian bereute, daß er dieses Thema schon jetzt angeschnitten hatte. Seine Mutter war keine naive, zartbesaitete Südstaatenschönheit. In mittleren Jahren immer noch attraktiv, die perfekte Hausherrin im geliebten Cimarron seines Vaters, verkörperte sie alles, was das Wesen einer typischen vornehmen Südstaatenlady prägte. Aber sie besaß einen weiteren Horizont als die meisten Frauen ihres Standes. Die heikle Position der McKenzies bezüglich der Seminolenfrage in Florida hatte Tara stets veranlaßt, sich mit politischen Problemen zu befassen.
»Ist es wirklich so schlimm, Ian?«
»Bevor ich nach Key West versetzt wurde, sah ich John Brown in Washington hängen. Dadurch hat er den Status eines Märtyrers erlangt, und er wird nach seinem Tod ein viel schrecklicheres Blutbad anrichten als zu seinen Lebzeiten. Ich fürchte deshalb, wir steuern auf einen Krieg zu.«
»Gewiß, in Florida hat sich eine wütende Fraktion gebildet. Die Plantagenbesitzer wollen mit aller Macht an der Sklaverei festhalten, der sie ihren Wohlstand verdanken. Aber ich glaube, es gibt genug vernünftige, besonnene Männer, die einen Krieg verhindern werden.«
»Wohl kaum, wenn Lincoln zum Präsidenten gewählt wird. Mutter, du weißt doch, wie unsere Nachbarn denken.«
»In Florida wird niemand für Lincoln stimmen. Und seine Wahl steht noch lange nicht fest.«
Ian zuckte die Achseln. Vielleicht nicht. Aber während eines Besuchs bei Freunden in Illinois hatte er Abraham Lincoln reden hören. Und er glaubte, die meisten Leute, die den Politiker nie gesehen hatten, würden ihn unterschätzen. »Vorerst wird nichts passieren.«
»Aber die Debatte ist bereits entbrannt. Die meisten unserer Nachbarn besitzen zahlreiche Sklaven und halten deinen Vater für einen Exzentriker. Andere behaupten, die Sklaverei sei ihnen egal, und sie würden sich nur für die Frage der Staatenrechte interessieren. Nun, wie du sagst, das alles gehört der Zukunft an, wenn auch einer unmittelbaren Zukunft. Gleich wird der Tee serviert. Mach dich frisch, mein Lieber, und komm so schnell wie möglich herunter. Du bist das schönste Geburtstagsgeschenk für deinen Vater, und er freut sich wie ein Kind auf das Wiedersehen.«
»Sind Julian und Tia schon zu Hause?«
»Julian hat in St. Augustine gearbeitet. Gegen Abend müßte er eintreffen. Vorher holt er Tia in ihrer Akademie ab. Beeil dich, Ian.«
»Ja, natürlich.« Er küßte die Stirn seiner Mutter, ging ins Haus und stieg die Treppe hinauf.
Am Ende eines langen Flurs lag sein Zimmer. Er hatte versprochen, sich zu beeilen. Aber wie immer, wenn er nach Hause zurückkehrte, mußte er erst einmal die Aussicht bewundern. Er liebte Cimarron. Als Taras und Jarretts ältester Sohn würde er Cimarron erben. Das war ihm stets bewußt gewesen, und er hatte die Verantwortung ernst genommen. Auch sein jüngerer Bruder Julian liebte sein Zuhause. Aber die Medizin bedeutete ihm noch mehr, und so war er Arzt geworden. Und Tia, die kleine Schwester, interessierte sich für die Welt, die Menschen und die Politik. Sie konnte es kaum erwarten, auf Reisen zu gehen. Nur mühsam hatten die Eltern sie dazu überredet, ihre Ausbildung an Madame de la Verres Schule für junge Damen zu beenden.
Cimarron ... Sein Vater und sein Onkel hatten das Haus entworfen und gebaut, als diese Gegend noch eine Wildnis gewesen war. In Ians Zimmer stand ein großes Vierpfostenbett aus kunstvoll geschnitztem Eichenholz mit Löwenfüßen und Greifvogelklauen am Kopfteil. Ein Schreibtisch mit zwei Stühlen beherrschte die Mitte des Raumes. Vor dem Kamin luden bequeme Polstersessel zur Erholung ein. An der Nord wand reihten sich ein hoher Schrank und eine Kommode aneinander, die Türen eines zweiten Schranks an der Südwand waren mit Spiegeln verkleidet. Unter dem Bett lag ein Orientteppich in leuchtenden Blau- und Rottönen, der mit den blauen Vorhängen und der blauen Tapete harmonierte.
Eine Glastür führte zum Balkon, und Ian trat hinaus. Auf die Balustrade gestützt, betrachtete er die Landschaft, den Fluß und den Nebenfluß, in dem Rundschwanz-Seekühe und Ottern hausten. Im Süden grenzten dichte Kiefernwälder an die kleine Siedlung der Weißen. Und am Ende eines Waldwegs sprudelte eine Quelle, die einen Teich speiste. Sogar im Winter leuchtete der Rasen vor dem Haus smaragdgrün, und der Fluß schimmerte in dunklem Blau.
Während Ian einen Adler zum Himmel emporfliegen sah, dachte er mit wachsendem Grauen an die Gefahr, die seinem geliebten Heim drohte. Vernünftige, besonnene Leute würden einen Krieg verhindern, hatte seine Mutter behauptet. Aber sogar in gebildeten Militärkreisen schloß man eine Auseinandersetzung auf dem Schlachtfeld nicht aus. Männer, die zuvor Seite an Seite geritten waren, würden einander bekämpfen. Und für welche Partei Ian sich auch entscheiden mochte, er würde seine Waffe gegen einstige Klassenkameraden, Lehrer und Freunde erheben. Vielleicht sogar gegen seine Verwandten.
Bedrückt schüttelte er den Kopf und sagte sich, noch sei keine Entscheidung gefallen. Nicht zum erstenmal stand das Land am Rand eines Kriegs. Bis jetzt hatte man immer Kompromisse gefunden. Trotzdem – was zum Teufel sollte er tun?
Er kehrte ins Zimmer zurück und fand kühles Wasser im Krug auf dem Waschtisch. Hastig machte er sich frisch. Doch er hatte sich zuviel Zeit gelassen. Als er den Speiseraum erreichte, räumten die Dienstboten gerade das Teegeschirr weg, und die Gäste erhoben ihre Limonadengläser, um auf Peter O’Neills und Elsie Fitchs Verlobung zu trinken. Also mußte man den beiden gratulieren. Elsie war hübsch und nett, nach Ians Meinung ein bißchen oberflächlich, aber für einen Mann wie Peter wahrscheinlich genau die richtige Frau, und außerdem steinreich.
»Ian!« Dicht hinter ihm erklang die Stimme seines Vaters. Er drehte sich um und vergaß alle anderen Anwesenden. Liebevoll umarmten sie sich. Dann trat Jarrett einen Schritt zurück, um seinen Sohn zu mustern. »Verdammt gut siehst du aus. Was für ein erfreulicher Anblick für meine alten Augen!«
»Da wir gerade vom Alter reden«, erwiderte Ian lächelnd, »alles Gute zum Geburtstag, Vater.«
»Ein wunderbarer Geburtstag. Meine Kinder kommen nach Hause. Und ich freue mich auf lange Gespräche mit dir, über die Welt da draußen.«
»Vater, ich bin mir nicht sicher, ob du das alles wissen willst. Vermutlich kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sich die Lage zuspitzt.«
»Glaub mir, ich habe in meinem Leben genug gesehen, und ich kann mir sehr gut vorstellen, was du mir erzählen wirst. Ich sorge mich um unser Land und unseren Staat. Natürlich dringen die Neuigkeiten auch in diese abgeschiedene Gegend vor, allerdings sehr langsam. Hier herrscht eine gefährliche, düstere Stimmung, die mich bedrückt.«
»Ich fürchte, die Kluft ist so tief, daß sie nicht überbrückt werden kann.«
»Darüber reden wir später. Soeben hat deine Mutter die Gentlemen in die Bibliothek geschickt, und die jungen Damen werden bald nach oben gehen, um sich vor den abendlichen Festivitäten auszuruhen. Hast du deinen Onkel und deine Tante schon begrüßt?«
»Nein, aber ich habe Onkel James und Tante Teela vor kurzem getroffen.«
»Offenbar bekommen sie dich öfter zu Gesicht als wir, weil du einen Großteil deiner Zeit in Key West verbringst. Komm, wir sollten dem Ansturm der Damen ausweichen und in die Bibliothek flüchten.«
»Wie du willst.«
Ehe sie die Bibliothekstür erreichten, füllte sich die Halle mit kichernden Geschöpfen in voluminösen Röcken. Ein paar Töchter alter Freunde entdeckten Ian, umarmten ihn und drückten schwesterliche Küsse auf seine Wangen.
Inmitten des Tumults sah er taubenblauen Brokat und elfenbeinweiße Spitze – die goldblonde Schönheit, die so erfolgreich gegen Lieutenant Pierpont gefochten und dann ihre Bewunderer um sich geschart hatte. Er wollte seinen Vater fragen, wer das Mädchen sei, doch da erschien seine Tante in der Halle. »Ian!« rief sie erfreut und nahm ihn in die Arme. Als er wieder aufblickte, war die kleine Sirene verschwunden.
»Bitte, Alaina, warte auf mich!«
Beinahe wäre es ihr gelungen, aus dem Haus zu flüchten. Sie blieb am hinteren Ausgang der Halle stehen, der zum Kiefernwald führte. Unglücklicherweise zögerte sie zu lange, denn Peter O’Neill eilte bereits in ihre Richtung.
»Laß mich in Ruhe, Peter!« befahl sie.
Aber er kam unbeirrt auf sie zu und schaute sie flehend an. Bis zu diesem Tag hatte sie sein Gesicht hübsch gefunden – seine sanften blauen Augen, die aristokratischen Züge, die hellbraunen Locken, die bis zum Kragen reichten. In seinem grauen Gehrock und dem gestärkten Hemd und der Brokatweste wirkte er sehr elegant. Aber während sie ihn jetzt betrachtete, empfand sie nichts mehr für ihn. Seine blauen Augen erschienen ihr nicht mehr schön, weil sie seine Charakterschwäche verrieten.
Trotzdem umfaßte er ihren Arm mit erstaunlich starken Fingern. »Bitte, ich muß mit dir reden!«
Sie hätte sich losreißen oder ihm drohen können, gellend zu schreien. Dann würde er sie sofort loslassen, wie eine heiße Kartoffel, weil er Skandale verabscheute. Wider ihr besseres Wissen folgte sie ihm in die Anrichtekammer des Butlers. Die Arme vor der Brust verschränkt, starrte sie Peter an. Hatte sie ihn jemals geliebt oder sich das nur eingebildet? »Nun, was willst du von mir?«
»Versuch mich doch zu verstehen!« flehte er verzweifelt. »Mein Vater hat mich zu dieser unseligen Verlobung mit Elsie Fitch gezwungen.«
Hätte sie sich nicht so gedemütigt gefühlt, als seine Verlobung beim Tee verlautbart worden war, würde sie vielleicht seine Wange streicheln und versichern, das sei schon in Ordnung.
Aber es war nicht in Ordnung. Peter hatte ihre Insel mehrmals mit seinem Vater besucht und ihren Papa um Hilfe gebeten, weil seine Orangenplantage nicht florierte. Dabei hatte Peter ihr stets seine unsterbliche Liebe geschworen und versichert, es sei nur mehr eine Frage der Zeit, bis er es wagen würde, um ihre Hand anzuhalten.
An diesem Tag hatte er bewiesen, was von seinen glühenden Versprechungen zu halten war. Ihr Vater verließ die Insel im Süden nur selten, und sie verkehrte fast nie in gehobenen Gesellschaftskreisen. Obwohl Papa ein angesehener Wissenschaftler war, gehörte er nicht zum Geldadel, und sie kannten die McKenzies von Cimarron nur wegen ihrer Freundschaft mit den McKenzies von Mirabella.
An die Aufmerksamkeit junger Männer nicht gewöhnt, hatte Alaina die Bewunderung der Gentlemen an diesem Nachmittag in vollen Zügen genossen. Es war amüsant gewesen, ihre Wirkung auf das andere Geschlecht zu erproben, und sie hatte sogar gedacht, es würde Spaß machen, Peters Eifersucht zu wecken. Und dann gab er seine Verlobung mit Elsie Fitch bekannt! Krampfhaft lächelte sie und fragte sich, ob ihre zusammengebissenen Zähne zerbrechen und aus ihrem Mund bröseln würden.
Gewiß, Elsie Fitch war keine überwältigende Schönheit, aber recht attraktiv, mit braunem Haar und großen dunklen Augen. Kichernd hatte sie ihren Freundinnen anvertraut, sie sei schon seit einer Ewigkeit in Peter verliebt. Natürlich würde er ihre Gefühle mit gleicher Glut erwidern und könne es kaum erwarten, mit ihr vor den Traualtar zu treten.
»Alles Gute zur Verlobung, Peter. Und jetzt laß mich gehen.«
»Alaina, du verstehst nicht ...«
»Was gibt es da zu verstehen? Du wirst Elsie Fitch heiraten, und damit basta.«
»Hör mich doch an! Als ich dich heute mit diesen Männern flirten sah, wäre ich fast gestorben. Beinahe hätte ich dir gesagt, du dürftest dich nicht wie ein Flittchen benehmen ...«
»Sei nicht unverschämt! Ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Und wie ich mich in Gesellschaft anderer Männer verhalte, geht dich nichts an.«
Sie versuchte sich an ihm vorbeizuschieben. Aber er packte ihre Schultern und drückte sie gegen die Wand. »Um Himmels willen, Alaina, quäl mich nicht so! Spürst du denn nicht, wie sehr ich dich begehre? Komm mit mir in den Wald ...«
»In den Wald!« rief sie. »Mit dir?« Sollte sie lachen oder weinen? O ja, sie hatte in den Wald wandern wollen, aber allein, um die schmerzliche Erniedrigung zu verwinden.
»O Alaina, ich liebe dich, ich brauche dich, ich bete dich an! Glaub mir, ich bin todunglücklich, weil wir nicht heiraten können. Machen wir das Beste aus der Situation. Da mir meine Mutter einen Trustfonds hinterlassen hat, bin ich nicht mittellos. Ich würde ein Haus für dich kaufen und ...«
»Hör auf. Ich traue meinen Ohren nicht. Glaubst du wirklich, ich würde jetzt, wo du mit einer anderen verlobt bist ...«
»Sei doch nicht albern, Alaina! Kein respektabler junger Mann würde jemals um deine Hand bitten.«
»Kein respektabler junger Mann würde jemals um meine Hand bitten?« wiederholte sie in eisigem Ton.
»Nun, dein Vater ist arm wie eine Kirchenmaus, und du bist in der Wildnis aufgewachsen. Außerdem wurdest du nicht richtig erzogen. Aber das braucht dich nicht zu bekümmern, weil ich dich vergöttere. Alles will ich dir geben, alles, was dein Herz begehrt ...«
Seine Stimme erstarb. Ungläubig schaute sie ihn an. Ehe ihr seine Absicht bewußt wurde, küßte er sie. Sein Körper preßte sie an die Wand und ließ keinen Zweifel an seinem Verlangen. Als er seine Zunge in ihren Mund schob, war sie sekundenlang wie betäubt. Dann spürte sie seine Hand, die am Ausschnitt ihres Kleides zerrte. Erbost rammte sie ihr Knie zwischen seine Beine, und er sprang stöhnend zurück. Mit aller Kraft schlug sie in sein Gesicht. »Fahr zur Hölle, Peter, mitsamt deinen abscheulichen Vorschlägen!«
»Alaina!« jammerte er gequält.
Ob ihn die Abfuhr schmerzte, die sie ihm erteilt hatte, oder der gezielte Stoß ihres Knies, wußte sie nicht. Es war ihr auch egal. Sie konnte die Gesellschaft des reichen, respektablen Mr. Peter O’Neill nicht länger ertragen, nutzte seine augenblickliche Schwäche und schob ihn beiseite. Dann floh sie aus der Anrichtekammer, hinaus ins Freie, in die schützenden Schatten zwischen den Bäumen.
2
Ian spürte einen warmen Atemhauch an seiner Wange. »Am üblichen Ort!«
Vor einiger Zeit waren die jungen Damen nach oben gegangen, und die älteren überließen die Gentlemen ihrem Brandy und den Zigarren. Die Flüsterstimme gehörte Lavinia, der schönen, sinnlichen dreißigjährigen Witwe des steinreichen alten Lawrence Trehorn. Obwohl er beschlossen hatte, seinen Eltern mitzuteilen, er würde Risa Magee heiraten, die er liebte und begehrte, würde es vielleicht noch lange dauern, bis er sie heimführen konnte. Und an Liebe dachte Lavinia in dieser Phase ihres Lebens nicht – nur an Lust.
»Was sagten Sie, Ian?«
Er blinzelte verwirrt, von Lavinias Parfum abgelenkt, dessen Duft ihn immer noch einhüllte. Offenbar fragte Alfred Ripply, ein Schiffsbauer aus Tampa, nach seiner letzten Bemerkung. Irgend etwas über die Union ... Daran erinnerte er sich nicht mehr, weil ihn das Flüstern auf ganz andere Gedanken gebracht hatte. Er räusperte sich und begegnete dem glühenden Blick einer anderen Frau, die gerade den Salon betreten hatte und die Brandygläser nachfüllte.
Seit langer Zeit war er mit der exotischen Lilly befreundet, in deren Adern das Blut weißer, schwarzer und indianischer Vorfahren floß. Sie verachtete Lavinia und bedeutete ihm mit ihrem ausdrucksvollen Blick – ohne die Grenzen einer Dienerin zu überschreiten –, er dürfe der Witwe nicht folgen. Lächelnd hob er die Brauen und gab ihr zu verstehen, er könne sehr gut auf sich selbst aufpassen. Er war immer noch unverheiratet, über einundzwanzig und durchaus fähig, den verführerischen Klauen einer Frau wie Lavinia zu entrinnen. Wenn ihn ihre Verführungskünste auch maßlos reizten ...
Lilly seufzte fast unhörbar. Da auf Cimarron niemals Sklaven gelebt hatten, war sie eine freie Frau. Ians Großvater, der mit seinen Söhnen nach Florida gezogen war, hatte die Sklaverei verabscheut und erklärt, er könne die Plantage genausogut mit der Hilfe bezahlter Angestellter betreiben.
Nach dem dritten Seminolenkrieg war Lilly nach Cimarron gekommen. Es war der letzte Aufschrei des vernichteten Volkes gewesen, und lan hatte die kurzen, aber erbitterten Feindseligkeiten besser verstanden als sonst jemand. Denn in den Adern seiner engsten Verwandten, abgesehen von seinen nächsten Angehörigen, floß Indianerblut.
Lilly hatte bei einem kleinen Creek-Stamm bei Tampa Bay gelebt. Bei jenen letzten Kämpfen zählte ihr Mann zu den Kriegern, die wieder einmal Gerechtigkeit suchten, und der Konflikt fand das gleiche Ende wie die vorangegangenen Gefechte. Die überlebenden Seminolen zogen sich noch tiefer in die Everglades zurück, und die Weißen atmeten erleichtert auf.
Glücklicherweise hatte lan nicht in die Kämpfe eingreifen müssen, weü er mit seinem Kommando gerade in Texas stationiert gewesen war. Lieber hätte er den Dienst quittiert, als seine Waffe gegen die Seminolen zu erheben. Später wurde er nach Kansas und Nebraska und schließlich nach Key West versetzt, wo er den Auftrag erhielt, mit seinen Männern die Everglades zu kartographieren. Auf seinen ausgedehnten Reisen hatte er viele Erfahrungen gesammelt, und so konnte er sich eine fundierte Meinung über die derzeitige beunruhigende Lage in der Union bilden.
Aber was immer er vorhin gesagt hatte – er bereute es. Im Augenblick wollte er nicht über Politik diskutieren. Lavinias Flüsterstimme hatte viel zu verlockend geklungen.
Als er wieder zu Lilly hinüberschaute, schüttelte sie besorgt den Kopf, und er lächelte. Eigentlich müßte sie sein Interesse an Lavinia verstehen. Ehe er Risa heiraten konnte, mußte man zahlreiche Pläne schmieden. Nur der Himmel mochte wissen, wann die Hochzeitsnacht endlich stattfinden und wann er sein Verlangen auf ehrbare Weise stillen würde. Zu Lavinia unterhielt er eine rein sexuelle Beziehung, und er war nicht ihr einziger Liebhaber. Als Witwe – die ihr Erbe an den Bruder ihres verstorbenen Mannes verlieren würde, wenn sie wieder heiratete – sah sie keinen Grund, sich die Freuden des Lebens zu versagen.
»Sir, das ergibt doch keinen Sinn.« Alfred Ripplys Spazierstock trommelte auf den blankpolierten Hartholzboden der Bibliothek. »Da sitzen Sie und behaupten, John Brown habe den Galgentod verdient. Und im gleichen Atemzug erklären Sie, dieser elende Lincoln würde sich nicht gegen den Süden wenden und nur die Union zu stärken suchen.«
Seufzend sah Ian seinen Vater an, der vor dem Kamin stand, einen Ellbogen auf dem Sims. Im Lauf der Jahre hatte sich der hochgewachsene, kraftvoll gebaute Jarrett McKenzie kaum verändert. Nur wenige graue Fäden durchzogen das pechschwarze Haar.
Vater und Sohn waren oft verschiedener Meinung gewesen. Aber seit einiger Zeit merkten sie, wie ähnlich sie einander waren. Und Ian erkannte, daß er Jarrett nicht nur liebte, sondern bewunderte. Zweifellos hatten die Anschauungen des Vaters sein Denken beeinflußt, doch seine Überzeugungen basierten vor allem auf eigenen Erlebnissen. Jarrett hatte ihm versichert, nur darauf komme es an.
»Nach meiner Ansicht ist John Brown, der so fanatisch für die Sklavenbefreiung kämpfte, zu bedauern. Er glaubte felsenfest, der Allmächtige würde seine Taten billigen, weil sie einem höheren Ziel dienten. Trotzdem verdiente er nach unseren Gesetzen den Galgentod. Immerhin ermordete er zahlreiche Menschen, um sich an den Südstaatlern zu rächen, die über die Gegner der Sklaverei hergefallen waren.«
Als Ian aufstand und sich verneigte, warf ihm sein Onkel James einen seltsamen Blick zu, den er mit einer gequälten Grimasse beantwortete. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, Gentlemen – ich muß mich um die Weinliste für heute abend kümmern. Vater?«
Offenbar spürte Jarrett, wie unangenehm sein Sohn diese Diskussion fand. Ripply wollte immer nur eine Bestätigung seiner eigenen Ansichten hören. Wahrscheinlich ahnte er nicht einmal, was für schreckliche Ausmaße der Streit um die Sklaverei annehmen konnte. Er hatte die Greueltaten in Kansas, Nebraska und Missouri nicht beobachtet, wo jede Partei verbissen kämpfte, um zu beweisen, Gott stehe auf ihrer Seite.
»Ja, bitte, Ian«, stimmte sein Vater zu.
Damit konnte er die Flucht ergreifen. Natürlich mußte er sich nicht mit der Weinliste befassen, den diese Arrangements waren längst getroffen worden. Jarrett wußte nichts von Ians Liaison mit Lavinia. Aber er merkte, daß sein Sohn den Gentlemen entrinnen wollte, und dafür hatte er Verständnis.
Um das Haus durch die Hintertür zu verlassen, ging er an der Küche vorbei. Er sah die junge Dame im Anrichtezimmer nicht. Doch er hörte Peter O’Neills begehrliches Stöhnen – und eine schallende Ohrfeige.
Er verachtete O’Neill, dessen Vater im ganzen Staat mehrere Kinder gezeugt und die Mütter skrupellos im Stich gelassen hatte. Offenbar versuchte der Sohn, in die Fußstapfen des Schwerenöters zu treten.
Wer immer die junge Frau sein mochte, in diesem Haus hatte sie ein Recht auf Ians Schutz. Als er die Anrichtekammer betrat, war O’Neill allein und preßte eine Hand auf seine gerötete Wange. Da er sich zusammenkrümmte, waren vermutlich auch andere Körperteile verletzt worden.
»Verzeih mir, Ian. Nur ein kleines Problem mit einer affair de coeur,