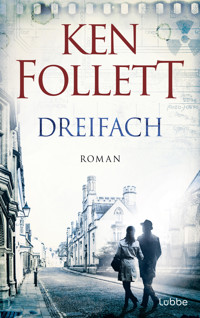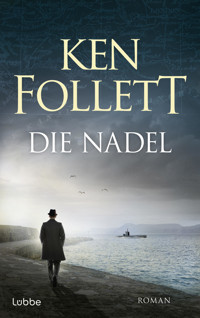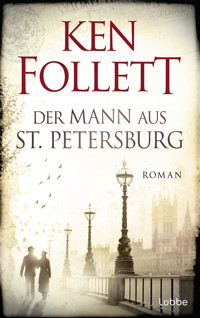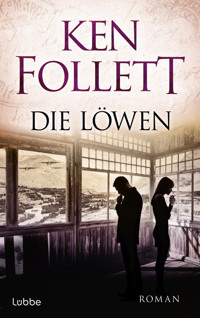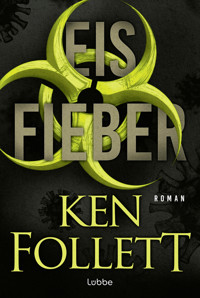9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Thriller um die Befreiung der amerikanischen Geiseln Paul Chiapparone und Bill Gaylord - in die Geschichte eingegangen als "Operation Hotfoot"
Teheran, 1978: Streiks und antiamerikanische Ausschreitungen künden den bevorstehenden Zusammenbruch des Schah-Regimes an. Ohne Angabe von Gründen werden zwei Spitzenmanager eines texanischen Computerkonzerns verhaftet. Alle Bemühungen, sie auf diplomatischem Wege wieder freizubekommen, scheitern. Kurzerhand entschließt sich der Konzernchef zu einem ungewöhnlichen Schritt: Er heuert auf eigene Faust ein Rettungskommando an. Auftrag der "Adler": die beiden Gefangenen befreien. Um jeden Preis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Motto
Personen
Vorwort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
Epilog
Anhang
Danksagung
Bibliographie
Über den Autor
Ken Follett, geboren 1949 in Cardiff, Wales, gehört zu den erfolgreichsten Autoren der Welt. Berühmt wurde er mit DIE SÄULEN DER ERDE und deren Fortsetzung DIE TORE DER WELT, die beide auch erfolgreich verfilmt wurden. Mit KINDER DER FREIHEIT hat er nach STURZ DER TITANEN und WINTER DER WELT gerade seine groß angelegte Jahrhundertsaga abgeschlossen, in der er meisterhaft die spannende Chronik des 20. Jahrhunderts anhand der Geschichte von fünf miteinander verbundenen Familien aus Amerika, Deutschland, Russland, England und Wales erzählt.
Neben seinem Interesse für Geschichte engagieren sich Ken Follett und seine Frau Barbara auch politisch. Außerdem spielt er zum Vergnügen Bass-Gitarre in einer Bluesband und setzt sich im Rahmen einer Stiftung für die Leseförderung ein.
KEN FOLLETT
Auf den Schwingen des Adlers
Thriller
Aus dem Englischen von Christel Rost und Gabriele Conrad
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der Originalausgabe:
ON THE WINGS OF EAGLES
Originalverlag: William Morrow and Company, Inc., New York
© 1983 by Ken Follett
© 1980 für die deutschsprachige Ausgabe by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Pencil Corporate Art, Braunschweig
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0347-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Ich trage euch auf Adlerschwingen und bringe euch zu mir.
2. Mose 19,4
PERSONEN
Dallas:
Ross Perot, Aufsichtsratsvorsitzender der Electronic Data Systems Corporation, Dallas, Texas
Merv Stauffer, Perots rechte Hand
T. J. Marquez, einer der Vizepräsidenten von EDS
Tom Walter, Finanzchef von EDS
Mitch Hart, ein ehemaliger Präsident von EDS mit guten Verbindungen zur Demokratischen Partei
Tom Luce, Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Hughes & Hill in Dallas
Bill Gayden, Präsident von EDS World, einer EDS-Tochtergesellschaft
Mort Meyerson, einer der Vizepräsidenten von EDS
Teheran:
Paul Chiapparone, Chef der EDS Corporation Iran
Bill Gaylord, Pauls Stellvertreter
Lloyd Briggs, Nummer drei in der Hierarchie
Rich Gallagher, Pauls Verwaltungsassistent; Cathy Gallagher, Richs Frau; Buffy, Cathys Pudel
Paul Bucha, ehemals Chef der EDS Corporation Iran, neuerdings in Paris stationiert
Bob Young, EDS-Chef in Kuwait
John Howell, Rechtsanwalt bei Hughes & Hill
Keane Taylor, Manager des Bank-Omran-Projekts
Das Team:
Oberstleutnant Arthur D. »Bull« Simons
Jay Coburn
Pat Sculley
Jim Schwebach
Joe Poché
Ralph Boulware
Ron Davis
Glenn Jackson
Die Iraner:
Abolhasan, ranghöchster iranischer Mitarbeiter und Verwaltungsassistent von Paul Chiapparone
Madjid, Assistent von Jay Coburn
Farah, Madjids Tochter
Raschid, Seyyed, der »Cycle Man«: Informatiker in der Ausbildung
Gholam, zuständig für Personal- und Einkaufsfragen unter Coburn
Hussein Dadgar, Untersuchungsrichter
In der US-Botschaft:
William Sullivan, Botschafter
Charles Naas, Botschaftsrat, Sullivans Stellvertreter
Lou Goelz, Generalkonsul
Bob Sorensen, Botschaftsangestellter
Ali Jordan, bei der Botschaft angestellter Iraner
Barry Rosen, Presseattaché
In Istanbul:
Mr. Fish, Besitzer eines Reisebüros mit ausgezeichneten Verbindungen
Ilsman, Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT
Charlie Brown, Dolmetscher
In Washington:
Zbigniew Brzezinski, Nationaler Sicherheitsberater
Cyrus Vance, Außenminister
David Newsom, Staatssekretär im Außenministerium
Henry Precht, Leiter der Abteilung Iran im Außenministerium
Mark Ginsberg, Verbindungsmann zwischen Weißem Haus und Außenministerium
VORWORT
DIES IST EINE wahre Geschichte über Menschen, die, da sie krimineller Vergehen beschuldigt wurden, die sie nicht begangen hatten, beschlossen, sich ihr Recht selbst zu verschaffen.
Nachdem ihr Abenteuer vorüber war, gab es ein Gerichtsverfahren, in dem sie von jeglicher Schuld freigesprochen wurden. Dieses Verfahren gehört nicht zu meiner Geschichte, doch da es die Unschuld der Beteiligten bestätigt, gebe ich im Anhang dieses Buches Auszüge aus der Beweisführung und dem Urteil des Gerichts wieder.
Bei der Erzählung der Geschichte habe ich mir die Freiheit genommen, in zwei Details von der Wahrheit abzuweichen.
Einigen Personen habe ich ein Pseudonym gegeben oder einen Spitznamen, vor allem, um sie vor der Vergeltung der iranischen Regierung zu schützen. Die falschen Namen lauten: Madjid, Farah, Abolhasan, Mr. Fish, Deep Throat, Raschid, Cycle Man, Mehdi, Malek, Gholam, Seyyed und Charlie Brown. Alle anderen Namen sind echt.
Zweitens: Bei Gesprächen, die vor drei oder vier Jahren stattgefunden haben, erinnert man sich selten noch an den genauen Wortlaut; darüber hinaus ergeben normale Unterhaltungen – mit ihren Gesten und Unterbrechungen und unvollendeten Sätzen – oftmals keinen Sinn, wenn sie niedergeschrieben werden. Die Dialoge in diesem Buch wurden folglich rekonstruiert und bereinigt. Jede rekonstruierte Unterhaltung wurde jedoch zumindest einem der Beteiligten zur Korrektur oder Zustimmung vorgelegt.
Ich glaube, daß – von diesen beiden Ausnahmen abgesehen – im folgenden jedes einzelne Wort der Wahrheit entspricht. Ich habe nichts erfunden. Alles, was Sie im folgenden lesen werden, ist wirklich geschehen.
1
ES BEGANN AM fünften Dezember 1978.
Jay Coburn, Personalchef der EDS Corporation Iran, saß in seinem Büro im Norden Teherans und zerbrach sich den Kopf.
Das Büro befand sich in einem zweistöckigen Betonbau, der, da er in einem Seitensträßchen der Bucharest Street lag, Bukarest genannt wurde. Coburn saß im ersten Stock in einem selbst für amerikanische Verhältnisse großen Raum, der mit Parkettboden und mit einem mächtigen Schreibtisch aus massivem Holz ausgestattet war. An der Wand hing ein Porträt des Schahs. Coburn saß mit dem Rücken zum Fenster. Durch die Glastür konnte er in das Großraumbüro sehen, wo seine Mitarbeiter Schreibmaschinen und Telefone bedienten. Die Vorhänge an der Glastür zog Coburn nie zu. Es war kalt. Es war immer kalt. Tausende von Iranern streikten, die Stromversorgung der Stadt war häufig unterbrochen, und fast jeden Tag fiel die Heizung für mehrere Stunden aus.
Coburn war ein großer, breitschultriger Mann, einsachtzig groß und neunzig Kilo schwer. Sein rotbraunes Haar war seiner Stellung gemäß kurz geschnitten, sorgfältig gekämmt und gescheitelt. Obgleich er erst zweiunddreißig Jahre alt war, sah er eher aus wie vierzig. Bei näherer Betrachtung verrieten jedoch das attraktive, offene Gesicht und das rasche Lächeln sein wahres Alter; er besaß eine gewisse frühe Abgeklärtheit, das Aussehen eines Mannes, der zu schnell erwachsen geworden war.
Sein ganzes Leben lang hatte er sich Verantwortung aufbürden lassen: in seiner Kinderzeit, als er im Blumenladen seines Vaters mitarbeitete; mit zwanzig als Hubschrauberpilot in Vietnam; als junger Ehemann und Vater; und nun als Personalchef, der für die Sicherheit von 131 amerikanischen Angestellten und deren 220 Familienangehörigen zuständig war – und das in einer Stadt, in der der Mob die Straßen regierte.
Wie jeden Tag, so telefonierte er auch heute in ganz Teheran herum und versuchte herauszufinden, wo gerade Kämpfe stattfanden, wo sie wohl demnächst ausbrechen würden und wie die Aussichten für die kommenden Tage waren.
Mindestens einmal täglich rief er die amerikanische Botschaft an, deren Auskunft rund um die Uhr besetzt war. Amerikaner aus ganz Teheran pflegten dort Demonstrationen und Aufstände zu melden, und die Botschaft gab dann weiter, welche Stadtteile tunlichst zu meiden waren. Was jedoch ihre Ratschläge und Prognosen betraf, so fand Coburn sie nahezu nutzlos. Bei den wöchentlich stattfindenden Informationstreffen, an denen er stets getreulich teilnahm, bekam er jedesmal das gleiche zu hören: Amerikaner sollten sich nach Möglichkeit im Hause aufhalten und Menschenansammlungen um jeden Preis fernbleiben, der Schah habe jedoch alles unter Kontrolle, so daß derzeit noch keine Evakuierung angeraten sei. Coburn verstand ihr Dilemma: Verkündeten die Amerikaner, daß der Pfauenthron wackelte, so würde der Schah mit Sicherheit gestürzt. Die Botschaft war bei ihren Äußerungen jedoch dermaßen vorsichtig, daß sie fast überhaupt keine Informationen mehr lieferte.
Mit diesem Zustand unzufrieden, hatten die amerikanischen Geschäftsleute in Teheran ihr eigenes Informationsnetz aufgebaut. Die größte US-Firma in der Stadt war Bell Helicopter, deren hiesige Niederlassung von einem Generalmajor a. D., Robert N. MacKinnon, geleitet wurde. MacKinnon verfügte über einen erstklassigen Nachrichtendienst und gab alle seine Erkenntnisse weiter. Außerdem kannte Coburn einige Mitarbeiter des US-Militärgeheimdienstes, und auch die rief er an. Heute war es in Teheran relativ ruhig: Größere Demonstrationen fanden nicht statt. Die letzten ernst zu nehmenden Unruhen hatte es vor drei Tagen gegeben, am zweiten Dezember, dem ersten Tag des Generalstreiks, an dem den Meldungen zufolge siebenhundert Menschen getötet worden waren. Soweit Coburn informiert war, konnte man damit rechnen, daß die Ruhe bis zum zehnten Dezember, dem islamischen Feiertag Aschura, anhielt.
Coburn dachte mit Sorge an Aschura. Der islamische Winterfeiertag war überhaupt nicht mit Weihnachten zu vergleichen. An diesem Fasten- und Trauertag zum Gedenken des Todes von Hussein, dem Enkel des Propheten, herrschten Reue und Zerknirschung. Massendemonstrationen würden stattfinden, in deren Verlauf die streng Gläubigen sich selber peitschten. In solch einer Atmosphäre kam es schnell zum Ausbruch von Hysterie und Gewalt.
Coburn befürchtete, dieses Mal könnten sich die Ausschreitungen gegen die Amerikaner richten. Eine Reihe häßlicher Zwischenfälle hatte ihn überzeugt, daß die Ressentiments gegen Amerikaner rasch um sich griffen. Unter seiner Tür hatte jemand eine Karte mit den Worten »Wenn Dir Leib und Leben lieb sind, verschwinde aus dem Iran!« durchgeschoben. Freunde von ihm hatten ähnliche Postkarten erhalten. An die Mauer seines Hauses hatten irgendwelche Sprühdosenkünstler geschrieben: »Hier wohnen Amerikaner.« Der Bus, der seine Kinder in die amerikanische Schule Teherans brachte, war von der demonstrierenden Menge angehalten und fast zum Umkippen gebracht worden. Andere EDS-Mitarbeiter waren auf der Straße angepöbelt, ihre Autos demoliert worden. Eines schrecklichen Nachmittags hatten Iraner im Ministerium für Gesundheit und Soziales – dem größten Kunden von EDS – gewütet, Fenster eingeschlagen und Schahbilder verbrannt. Die EDS-Manager verschanzten sich in einem Büroraum, bis der Mob wieder abzog.
Wie düster die Lage wirklich war, kam jedoch am deutlichsten in der drastisch veränderten Haltung von Coburns Hauswirt zum Ausdruck.
Coburn hatte, wie die meisten Amerikaner in Teheran, die Hälfte eines Zweifamilienhauses gemietet: Er wohnte mit Frau und Kindern im ersten Stock, der Hausbesitzer mit seiner Familie im Erdgeschoß. Als die Coburns im März dieses Jahres eingezogen waren, hatte sie der Vermieter sofort unter seine Fittiche genommen. Die beiden Familien kamen ausgezeichnet miteinander aus. Coburn und der Hausbesitzer diskutierten des öfteren über die Religion: Letzterer gab Coburn eine englische Übersetzung des Korans, und seine Tochter las ihm aus Coburns Bibel vor. Scott, Coburns siebenjähriger Sohn, spielte mit den Söhnen des Vermieters auf der Straße Fußball. An den Wochenenden unternahmen sie gemeinsame Ausflüge aufs Land. An einem Wochenende war den Coburns sogar die seltene Auszeichnung zuteil geworden, Gäste bei einer islamischen Hochzeit zu sein. Es war faszinierend gewesen. Männer und Frauen verbrachten den ganzen Tag getrennt voneinander. Coburn und Scott blieben bei den Männern, seine Frau Liz und ihre drei Töchter bei den Frauen. Coburn hatte die Braut überhaupt nicht zu Gesicht bekommen.
Im späten Sommer hatten sich die Verhältnisse fast unmerklich geändert. Die Wochenendausflüge hörten auf. Die Söhne des Vermieters durften nicht mehr mit Scott auf der Straße spielen. Schließlich brach jeglicher Kontakt zwischen den beiden Familien ab, selbst im Haus und dem dazugehörigen Hof, und den Kindern wurden schon Vorhaltungen gemacht, wenn sie sich nur mit einem der Coburns unterhielten.
Es war keineswegs so, daß der Hauswirt plötzlich seinen Haß auf die Amerikaner entdeckt hätte. Eines Abends bewies er, daß ihm die Coburns nach wie vor am Herzen lagen. Auf der Straße hatte es eine Schießerei gegeben. Einer seiner Söhne war trotz Ausgangssperre noch unterwegs gewesen, und Soldaten hatten auf den Jungen geschossen, als er nach Hause rannte und über die Hofmauer kletterte. Coburn und Liz, die zu Tode erschrocken war, hatten den Vorfall von ihrem Balkon aus beobachtet. Der Hauswirt kam herauf, um ihnen zu erzählen, was passiert war, und um sie zu beruhigen. Aber er wußte nur zu gut, daß er sich um der Sicherheit seiner Familie willen nicht beim Umgang mit Amerikanern sehen lassen durfte: Ihm war klar, aus welcher Richtung der Wind wehte. Für Coburn war dies ein weiterer Hinweis darauf, daß die Zeichen auf Sturm standen.
Zur Zeit gab es, wie Coburn aus der Gerüchteküche vernommen hatte, in den Moscheen und Basaren wildes Gerede über einen Heiligen Krieg gegen die Amerikaner, der zu Aschura beginnen sollte. Bis dahin waren es noch fünf Tage. Doch die Amerikaner in Teheran wirkten erstaunlich gelassen.
Coburn erinnerte sich an die Einführung der Ausgangssperre: Sie hatte nicht einmal das monatliche EDS-Pokerspiel beeinträchtigt. Er und seine Mitspieler hatten einfach Frauen und Kinder mitgebracht, das Ganze in eine Pyjama-Party umfunktioniert, und alle waren bis zum Morgen geblieben. An das Knallen von Gewehrschüssen hatten sie sich gewöhnt. Die meisten heftigen Gefechte wurden zwar in der Altstadt im Süden, wo der Basar lag, und im Universitätsviertel ausgetragen, aber im Grunde waren überall immer wieder Schüsse zu hören. Schon bald nahmen sie die Knallerei seltsam gleichmütig hin. Sprach man gerade, so hielt man inne und wartete, bis die Salven verklungen waren – ebenso wie in den Staaten, wenn ein Flugzeug über einen hinwegdonnerte. Gerade so, als sei es undenkbar, daß sie zur Zielscheibe der Iraner werden könnten.
Coburn war Schüssen gegenüber nicht abgestumpft. Zu oft in seinem Leben war schon auf ihn geschossen worden. In Vietnam hatte er sowohl Kampfhubschrauber zur Unterstützung von Bodenoperationen geflogen als auch zu Truppen- und Versorgungstransporten, bei denen er auf Schlachtfeldern landen und abheben mußte. Er hatte Menschen getötet, und er hatte Männer sterben sehen. Damals hatte die Armee pro 25 Stunden Kampfflugeinsatz eine Medaille verliehen – Coburn war mit insgesamt 39 Stück heimgekehrt. Außerdem hatte er einen Silbernen Stern erhalten – und eine Kugel in die Wade, die Schwachstelle jedes Hubschrauberpiloten. In jenem Jahr hatte er die Erfahrung gemacht, daß er sich im Kampf selbst – wenn es alle Hände voll zu tun und keine Zeit zum Angsthaben gab – ganz gut in der Hand hatte; doch nach jeder Rückkehr von einem Einsatz, wenn alles vorbei war und er darüber nachdenken konnte, was er getan hatte, zitterten ihm die Knie.
In mancher Hinsicht war er dankbar für diese Erfahrung. Er war schnell erwachsen geworden, und das hatte ihm gegenüber seinen Altersgenossen im Berufsleben einen gewissen Vorteil verschafft. Es hatte ihm außerdem einen gesunden Respekt vor Schüssen eingeimpft.
Aber die meisten seiner Kollegen empfanden das anders als er, und ihre Frauen ebenso. Jedesmal wenn eine Evakuierung zur Debatte stand, stemmten sie sich dagegen. Sie hatten Zeit, Arbeit und persönlichen Ehrgeiz in die EDS Corporation Iran investiert, und all das wollten sie nicht so ohne weiteres im Stich lassen. Ihre Frauen hatten die jeweilige Mietwohnung in ein richtiges Zuhause verwandelt, und allenthalben wurden Pläne für Weihnachten geschmiedet. Die Kinder hatten ihre Schulen, ihre Freunde, ihre Fahrräder und Haustiere. Wenn wir uns nur ruhig verhalten und abwarten, so sagten sie sich, dann wird das Gewitter schon wieder abziehen.
Coburn hatte versucht, Liz zu überreden, mit den Kindern in die Staaten zurückzukehren – nicht nur ihrer eigenen Sicherheit wegen, sondern weil die Zeit kommen mochte, da er 350 Personen auf einen Schlag evakuieren mußte, eine Arbeit, der er seine ungeteilte Aufmerksamkeit würde widmen müssen, ohne daß ihn private Ängste um seine Familie ablenkten. Liz hatte abgelehnt.
Beim Gedanken an Liz seufzte er. Sie war lustig und lebhaft, und jedermann schätzte ihre Gesellschaft, aber sie war keine gute Ehefrau für einen Konzernangestellten. EDS verlangte eine Menge von ihren Führungskräften. War es zur Durchführung einer Aufgabe erforderlich, eine ganze Nacht durchzuarbeiten, dann arbeitete man eben die ganze Nacht. Liz lehnte so etwas ab. Daheim in den Staaten war Coburn als Einstellungsleiter häufig von Montag bis Freitag im ganzen Land unterwegs gewesen, und Liz hatte das gehaßt. In Teheran war sie glücklich, weil er jeden Abend nach Hause kam. Wenn er hierbliebe, sagte sie, so bliebe sie ebenfalls. Auch den Kindern gefiel es hier. Sie lebten zum erstenmal außerhalb der Vereinigten Staaten und waren fasziniert von der fremden Sprache und Kultur. Kim, mit elf Jahren die Älteste, verfügte über zuviel Selbstvertrauen, um Angst zu haben. Kristi mit ihren acht Jahren war zwar ein wenig ängstlich, aber sie war ohnehin sehr gefühlsbetont und reagierte von allen am schnellsten und heftigsten. Der siebenjährige Scott und Kelly, mit vier Jahren die Jüngste, waren beide noch zu klein, um die Gefahr zu begreifen.
Also blieben sie, wie alle anderen, und warteten darauf, daß sich die Dinge zum Guten wenden würden – oder zum Schlechten.
Coburn wurde in seinen Gedanken durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen, und Madjid kam herein, ein kleiner, stämmiger Mann um die Fünfzig mit einem üppigen Schnauzbart. Er war einmal recht wohlhabend gewesen; sein Stamm hatte große Ländereien besessen, diese jedoch bei der Landreform in den sechziger Jahren verloren. Nun arbeitete Madjid als Coburns Assistent in der Verwaltung und war für die iranische Bürokratie zuständig. Er sprach fließend Englisch und war höchst einfallsreich. Coburn mochte ihn sehr; Madjid hatte sich schier ein Bein ausgerissen, um ihm und seiner Familie bei der Ankunft im Iran behilflich zu sein.
»Herein mit Ihnen«, sagte Coburn. »Setzen Sie sich. Was gibt’s?«
»Es ist wegen Farah.«
Coburn nickte. Farah war Madjids Tochter und arbeitete mit ihrem Vater zusammen. Sie hatte dafür zu sorgen, daß alle amerikanischen Mitarbeiter stets über gültige Visa und Arbeitsgenehmigungen verfügten. »Irgendwas nicht in Ordnung?« fragte Coburn.
»Die Polizei hat sie aufgefordert, zwei amerikanische Pässe aus unseren Akten zu nehmen, ohne irgend jemandem etwas zu sagen.«
Coburn runzelte die Stirn. »Ganz bestimmte Pässe?«
»Die von Paul Chiapparone und Bill Gaylord.«
Paul war Coburns Chef, der Leiter der EDS Corporation Iran. Bill war sein Vize und Manager ihres größten Projektes, dem Auftrag des Gesundheitsministeriums.
»Was, zum Teufel, geht da vor?« wollte Coburn wissen.
»Farah ist in großer Gefahr«, sagte Madjid. »Ihr wurde ausdrücklich befohlen, niemandem etwas davon zu sagen. Sie kam zu mir, um sich Rat zu holen. Natürlich mußte ich Ihnen Bescheid sagen. Aber ich fürchte, sie wird ernsthaft in Schwierigkeiten geraten.«
»Moment mal«, sagte Coburn. »Sehen wir uns erst mal die Hintergründe an. Wie fing es eigentlich an?«
»Heute vormittag hat sie einen Anruf der Polizei, Abteilung Aufenthaltsgenehmigungen für Amerikaner, erhalten. Sie wurde gebeten, hinzukommen. Sie sagten, es ginge um James Nyfeler. Farah dachte, es sei eine Routineangelegenheit. Um 11.30 Uhr kam sie in das Büro und sprach mit dem Leiter der amerikanischen Abteilung. Erst fragte er nach Mr. Nyfelers Paß und Aufenthaltsgenehmigung. Sie sagte ihm, daß Mr. Nyfeler nicht mehr im Iran sei. Dann fragte er nach Paul Bucha. Sie sagte, Mr. Bucha sei ebenfalls nicht mehr im Lande.«
»Das hat sie gesagt?«
»Ja.«
Bucha war im Iran. Aber vielleicht wußte das Farah gar nicht, dachte Coburn. Bucha war hier ansässig gewesen, hatte das Land verlassen und war für kurze Zeit zurückgekommen. Morgen sollte er wieder nach Paris fliegen.
Madjid berichtete weiter: »Dann sagte der Polizist: ›Ich nehme an, die beiden anderen sind auch fort?‹ Farah sah, daß er vier Akten auf seinem Schreibtisch liegen hatte, und fragte, welche beiden anderen er meine. Er sagte, Mr. Chiapparone und Mr. Gaylord. Sie antwortete, sie hätte erst heute morgen Mr. Gaylords Aufenthaltsgenehmigung abgeholt. Der Polizist befahl ihr, die Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen sowohl von Mr. Gaylord als auch von Mr. Chiapparone zu holen und zu ihm zu bringen. Sie solle es heimlich tun und keinen Alarm schlagen.«
»Was hat sie geantwortet?« fragte Coburn.
»Sie sagte ihm, heute könne sie die Papiere nicht mehr bringen. Da befahl er ihr, sie morgen früh zu bringen. Er sagte, er mache sie offiziell dafür verantwortlich, und er sorgte dafür, daß bei seinen Anordnungen Zeugen zugegen waren.«
»Das klingt total unsinnig«, meinte Coburn.
»Wenn sie erfahren, daß Farah ihnen nicht gehorcht hat …«
»Wir werden uns was ausdenken, um sie zu schützen«, sagte Coburn. Er fragte sich, ob Amerikaner eigentlich dazu verpflichtet waren, ihre Pässe auf Verlangen der Polizei auszuhändigen.
»Warum sie diese Pässe haben wollen, sagten sie nicht?«
»Nein.«
Bucha und Nyfeler waren die Vorgänger von Chiapparone und Gaylord. Hatte das etwas zu bedeuten?
Coburn wußte es nicht.
Er stand auf. »Zuerst einmal müssen wir entscheiden, was Farah der Polizei morgen früh erzählen soll«, sagte er. »Ich rede jetzt mit Paul Chiapparone und melde mich dann wieder bei Ihnen.«
*
Im Erdgeschoß des Gebäudes saß Paul Chiapparone in seinem Büro. Auch hier gab es Parkettboden, einen mächtigen Schreibtisch, ein Schahporträt an der Wand und allerhand zum Nachdenken.
Paul war neununddreißig Jahre alt, von mittlerer Größe und ein wenig übergewichtig, was vor allem auf seine Vorliebe für gutes Essen zurückzuführen war. Mit seiner olivfarbenen Haut und seinem dichten schwarzen Haar sah er aus wie ein Italiener. Seine Aufgabe war es, in einem rückständigen Land ein modernes Sozialversicherungssystem aufzubauen. Das war gar nicht leicht.
Zu Beginn der siebziger Jahre hatte der Iran ein primitives Sozialversicherungssystem besessen. Es war jedoch beim Eintreiben der Beiträge völlig ineffizient und darüber hinaus so leicht zu übervorteilen, daß man mehrmals aus ein und derselben Krankheit Gewinn schlagen konnte. Nachdem der Schah beschlossen hatte, einen Teil seiner zwanzig Milliarden Öldollars jährlich auf die Errichtung eines Sozialstaats zu verwenden, bekam EDS den Zuschlag. EDS organisierte die Kranken- und Sozialversicherungen verschiedener Bundesstaaten in den USA, doch im Iran mußten sie praktisch bei Null anfangen. Es galt für jeden der 32 Millionen Einwohner eine Versicherungskarte auszustellen, Lohnabzüge einzuführen, damit regelmäßig Verdienende ihre Beiträge bezahlten, und die Anträge auf Versicherungsleistungen zu bearbeiten. Das ganze System sollte über Computer laufen – eine Spezialität von EDS.
Im Iran ein EDV-System einzurichten, fand Paul, hatte mit der gleichen Aufgabe in den Staaten ungefähr so viel gemein wie das Kuchenbacken: Hier machte man das auf die althergebrachte Weise und verwendete Originalzutaten, dort nahm man einfach ein Fertigpaket. Oft fühlte er sich frustriert. Die Iraner besaßen nicht die Macher-Mentalität amerikanischer Manager, und häufig schien es, als schüfen sie Probleme, statt sie zu lösen. Am EDS-Stammsitz in Dallas, Texas, wurde von den Mitarbeitern nicht nur erwartet, Unmögliches möglich zu machen – normalerweise sollte es auch schon gestern erledigt worden sein. Hier im Iran hingegen war alles zuerst einmal unmöglich und auf jeden Fall nicht vor farda zu bewerkstelligen – wobei farda üblicherweise mit »morgen« übersetzt wurde, in der Praxis jedoch »irgendwann in der Zukunft« hieß.
Paul war die Schwierigkeiten auf seine Art angegangen: mit Entschlossenheit und harter Arbeit. Er war kein Intellektueller. Als Kind war ihm die Schule schwergefallen, doch sein italienischer Vater mit seinem für Einwanderer typischen Glauben an die Allmacht einer guten Ausbildung hatte ihn zum Lernen gezwungen, und Paul hatte gute Noten nach Hause gebracht. Und diese simple Hartnäckigkeit war ihm seither stets zustatten gekommen. Er konnte sich noch gut an die Gründungszeit bei EDS Amerika in den sechziger Jahren erinnern, als es bei jedem neuen Auftrag ums Ganze ging. Er hatte mitgeholfen, aus EDS einen der dynamischsten und erfolgreichsten Konzerne der Welt zu machen, und war sich absolut sicher gewesen, daß auch das Iran-Projekt den gleichen Weg nehmen würde, besonders seitdem Jay Coburn in seinen Anwerbungs- und Lehrprogrammen mehr und mehr Iraner ausbildete, die für Management-Positionen geeignet waren.
Er hatte sich geirrt, und erst jetzt ging ihm allmählich auf, warum.
Als er im August 1977 mit seiner Familie in den Iran gekommen war, war der Ölboom bereits vorüber. Der Regierung ging langsam das Geld aus. Im selben Jahr erhöhte das Anti-Inflationsprogramm die Zahl der Arbeitslosen, und eine schlechte Ernte trieb gleichzeitig noch mehr hungernde Bauern in die Städte. Das tyrannische Regime des Schahs wurde durch die Menschenrechtspolitik des amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter geschwächt. Die Zeit war reif für politische Unruhen.
Eine Zeitlang hatte Paul von der hiesigen Politik kaum Notiz genommen. Er wußte, daß die Unzufriedenen hier und da Krach schlugen, aber das kam schließlich in jedem Land der Welt vor, und außerdem schien der Schah die Zügel fest in der Hand zu haben. Die Bedeutung der Ereignisse im ersten Halbjahr 1978 entging Paul – wie im übrigen auch dem Rest der Welt.
Am siebten Januar publizierte die Zeitung Etela’at einen unflätigen Angriff auf einen im Exil lebenden Geistlichen – den Ayatollah Khomeini –, in dem unter anderem behauptet wurde, er sei homosexuell. Tags darauf inszenierten aufgebrachte Theologie-Studenten in der Stadt Ghom, die etwa 130 km von Teheran entfernt lag und das Haupt und Zentrum religiöser Bildung im Lande war, einen Sitzstreik, der von Militär und Polizei brutal auseinandergeknüppelt wurde. Die Konfrontation eskalierte, und an den beiden folgenden Tagen wurden siebzig Menschen getötet. Nach islamischer Tradition organisierte die Geistlichkeit vierzig Tage später eine Gedenkprozession für die Toten, bei der es wiederum zu gewaltsamen Zusammenstößen kam, und der neuen Toten wurde wiederum vierzig Tage später mit einer neuerlichen Prozession gedacht … In den ersten sechs Monaten dieses Jahres stieg die Zahl der Prozessionen, stieg die Zahl der Teilnehmer, stieg auch die Gewalttätigkeit.
Im nachhinein erkannte Paul, daß mit der Bezeichnung »Trauerprozessionen« lediglich das Demonstrationsverbot des Schahs umgangen worden war. Damals jedoch war er gar nicht auf den Gedanken gekommen, es könne sich dabei um das Entstehen einer politischen Massenbewegung handeln. Und auch sonst war niemand auf den Gedanken gekommen. Im August desselben Jahres machte Paul ebenso wie William Sullivan, US-Botschafter im Iran, in den Staaten Urlaub. Paul hatte ein Faible für jegliche Art von Wassersport, und so fuhr er mit seinem Vetter Joe Porreca zu einem Wettangeln nach Ocean City, New Jersey, während seine Frau Ruthie mit den Töchtern Karen und Ann Marie ihre Eltern in Chicago besuchte. Paul war beunruhigt, weil das Gesundheitsministerium die Juni-Rechnung von EDS noch nicht bezahlt hatte; aber da es nicht zum erstenmal geschah, daß es mit einer Zahlung in Verzug geriet, hatte Paul die Angelegenheit seinem Stellvertreter Bill Gaylord überlassen, fest davon überzeugt, daß Bill das Geld schon eintreiben würde.
Während seines USA-Aufenthaltes kamen schlechte Nachrichten aus dem Iran. Am siebten September wurde das Land unter Kriegsrecht gestellt, und tags darauf wurden über hundert Menschen, die an einer Demonstration auf dem Jalehplatz im Herzen Teherans teilnahmen, von Soldaten getötet. Als die Chiapparones in den Iran zurückkamen, schien sich alles verändert zu haben, selbst die Luft. Erstmals hörten auch Paul und Ruthie des Nachts Schüsse auf der Straße. Das beunruhigte sie; plötzlich ging ihnen auf, daß Unruhen unter den Iranern Unruhe für sie selber bedeutete. Es kam zu einer Welle von Streiks. Dauernd wurde der Strom abgeschaltet, so daß sie bei Kerzenlicht zu Abend aßen und Paul im Büro seinen Mantel anbehielt, um sich warm zu halten. Es wurde zunehmend schwieriger, den Banken Bargeld zu entlocken, und Paul richtete einen Scheckeinlösungsdienst für die EDS-Mitarbeiter ein. Als ihnen zu Hause das Heizöl auszugehen drohte, mußte Paul so lange in den Straßen herumlaufen, bis er einen Tankwagen fand, dessen Fahrer sich schmieren ließ und ihnen Öl lieferte.
Schlimmer noch waren die geschäftlichen Probleme. Der Minister für Gesundheit und Soziales, Dr. Scheikholeslamizadeh, war verhaftet worden, und zwar nach Artikel 5 des Kriegsrechts, der es dem Staatsanwalt erlaubte, jedermann ohne Angabe von Gründen ins Gefängnis werfen zu lassen. Auch der stellvertretende Minister Reza Neghabat, mit dem Paul eng zusammengearbeitet hatte, saß im Gefängnis. Das Ministerium hatte die Juni-Rechnung noch immer nicht bezahlt und alle folgenden schon gar nicht; mittlerweile schuldete es EDS über vier Millionen Dollar.
Zwei Monate lang versuchte Paul, das Geld einzutreiben. Die Beamten, mit denen er vormals zu tun gehabt hatte, waren nicht mehr da. Ihre Nachfolger pflegten nicht auf seine Anrufe zu reagieren. Ab und zu versprach ihm jemand, sich mit der Sache zu beschäftigen und ihn dann zurückzurufen. Nach einer Woche Warten auf den Anruf telefonierte Paul selbst wieder, erfuhr aber lediglich, sein Gesprächspartner aus der vorigen Woche habe inzwischen das Ministerium verlassen. Sitzungen wurden anberaumt und wieder abgesagt. Die Schulden beliefen sich auf 1,4 Millionen Dollar monatlich.
Am vierzehnten November schrieb Paul an Dr. Heidargholi Emrani, dem für die Sozialversicherung zuständigen Staatssekretär, und machte formell darauf aufmerksam, daß EDS die Arbeit einstellen werde, wenn das Ministerium nicht innerhalb eines Monats zahle. Am vierten Dezember wurde die Mahnung wiederholt, diesmal durch Pauls Chef, den Präsidenten von EDS World, und zwar bei einer persönlichen Begegnung zwischen ihm und Dr. Emrani.
Das war gestern gewesen.
Wenn EDS sich zurückzog, so würde das gesamte iranische Sozialversicherungssystem zusammenbrechen. Andererseits wurde aber auch immer klarer, daß das Land bankrott war und die Rechnungen schlicht und einfach nicht bezahlen konnte. Was, so fragte sich Paul, würde Dr. Emrani jetzt tun?
Daran rätselte er noch immer herum, als Jay Coburn in sein Büro kam und ihm die Lösung präsentierte.
Im ersten Moment jedoch kam Paul gar nicht auf den Gedanken, daß der Versuch, sich seines Passes zu bemächtigen, darauf abzielte, ihn – und damit EDS – im Iran festzuhalten.
Nachdem ihm Coburn Bericht erstattet hatte, sagte er: »Warum, zum Teufel, haben sie das getan?«
»Ich weiß es nicht, Madjid weiß es nicht, und Farah weiß es auch nicht.«
Paul sah ihn an. Im Laufe des vergangenen Monats waren er und Coburn sich nähergekommen. Allen anderen Mitarbeitern gegenüber machte er gute Miene zum bösen Spiel, zu Coburn konnte er jedoch hinter verschlossenen Türen sagen: »Okay, und was hältst du wirklich davon?«
»Zuerst einmal fragt sich«, sagte Coburn, »was tun wir mit Farah? Sie könnte Schwierigkeiten bekommen.«
»Sie muß ihnen irgendeine Ausrede auftischen.«
»So tun, als spiele sie mit?«
»Sie könnte hingehen und ihnen sagen, daß Nyfeler und Bucha nicht mehr hier ansässig sind …«
»Das hat sie ihnen schon gesagt.«
»Zum Beweis könnte sie ihre Ausreisevisa mitnehmen …«
»Hm«, sagte Coburn unschlüssig. »Aber eigentlich sind sie ja an dir und Bill interessiert.«
»Sie könnte sagen, die Pässe würden nicht hier im Büro aufbewahrt.«
»Vielleicht wissen sie, daß das nicht stimmt – womöglich, daß Farah schon einmal Pässe bei ihnen vorgelegt hat.«
»Sagen wir also, leitende Angestellte sind nicht verpflichtet, ihre Pässe im Büro zu hinterlegen.«
»Das könnte klappen.«
»Irgendeine überzeugende Geschichte, damit sie ihr glauben, daß sie einfach nicht imstande war zu tun, was sie von ihr verlangt haben.«
»Gut. Ich werde mit ihr und Madjid darüber reden.« Coburn dachte einen Augenblick lang nach. »Weißt du, Bucha hat für morgen einen Auslandsflug reserviert. Er könnte einfach verschwinden.«
»Er sollte es wahrscheinlich sogar – sie denken ohnehin, er sei nicht hier.«
»Du könntest das auch.«
Paul dachte nach. Sollte er das Land verlassen? Und was würden die Iraner dann tun? Wahrscheinlich versuchen, jemand anders an seiner Stelle festzuhalten. »Nein«, sagte er. »Wenn wir abhauen, sollte ich der letzte sein, der geht.«
»Hauen wir denn ab?« fragte Coburn.
»Ich weiß es nicht.« Diese Frage hatten sie sich nun schon seit Wochen jeden Tag aufs neue gestellt. Coburn hatte einen Evakuierungsplan ausgearbeitet, der von einer Minute auf die andere in die Tat umgesetzt werden konnte. Paul hatte, den Finger am Abzug, immer wieder gezögert, den Startschuß zu geben. Er wußte, daß sein oberster Chef drüben in Dallas für eine Evakuierung war – aber das hieß, das Projekt, für das er sechzehn Monate lang so hart gearbeitet hatte, aufzugeben.
»Ich weiß es nicht«, wiederholte er.
»Ich werde in Dallas anrufen.«
*
In dieser Nacht war Coburn neben Liz längst fest eingeschlafen, als das Telefon klingelte.
Im Dunkeln griff er nach dem Hörer. »Ja-aa?«
»Paul hier.«
»Hallo.« Coburn drehte das Licht an und sah auf seine Armbanduhr. Es war zwei Uhr morgens.
»Wir evakuieren«, sagte Paul.
»Na endlich.«
Coburn legte auf und setzte sich auf die`Bettkante. In gewisser Weise war er erleichtert. Er würde zwei oder drei Tage lang alle Hände voll zu tun haben, aber danach wären die Menschen, um deren Sicherheit er sich so lange gesorgt hatte, in die Staaten zurückgekehrt und außer Reichweite dieser verrückten Iraner.
In Gedanken ging er die Pläne durch, die er für diesen entscheidenden Moment gemacht hatte. Zuerst mußte er 130 Familien davon unterrichten, daß sie binnen 48 Stunden das Land verlassen würden. Er hatte die Stadt in Bezirke mit je einem verantwortlichen Kontaktmann eingeteilt: Die würde er nun anrufen, und ihnen oblag es dann, die einzelnen Familien zu benachrichtigen. Er hatte Anweisungen für die Evakuierung zusammengestellt, denen zu entnehmen war, wohin man zu gehen und was man zu tun hatte. Er brauchte lediglich Datum, Uhrzeit und Flugnummern einzutragen und die Blätter vervielfältigen und verteilen zu lassen.
Er hatte einen agilen, einfallsreichen jungen Iraner ausgewählt, einen Informatiker namens Raschid, dem die Aufgabe zufallen sollte, sich um die Häuser, Autos und Haustiere zu kümmern, die die fliehenden Amerikaner zurücklassen mußten, und der ihr Eigentum peu à peu per Schiff in die USA nachsenden sollte. Er hatte einen Stab von Leuten ernannt, der mit der Logistik der Evakuierung betraut war, der also Flugtickets und den Transport zum Flughafen organisieren sollte.
Überdies hatte er mit ein paar Leuten eine kleine Evakuierungsprobe gemacht, und alles hatte geklappt.
Coburn zog sich an und kochte Kaffee. Vor Ablauf von zwei Stunden konnte er zwar nichts unternehmen, doch zum Schlafen war er zu besorgt und ungeduldig.
Um vier Uhr morgens weckte er die sechs Logistiker per Telefon und beorderte sie unmittelbar nach Aufhebung der Ausgangssperre zu sich ins Bukarest.
Die Ausgangssperre begann jeden Abend um neun und endete morgens um fünf. Eine Stunde lang saß Coburn da und wartete, rauchte, trank Unmengen Kaffee und ging seine Notizen durch.
Als die Uhr im Flur fünfmal »kuckuck« rief, stand er schon gestiefelt und gespornt an der Haustür.
Draußen herrschte dichter Nebel. Er stieg in seinen Wagen und schlich mit 25 km Stundengeschwindigkeit Richtung Bukarest.
Drei Straßen weiter sprangen plötzlich sechs Soldaten aus dem Nebel und stellten sich im Halbkreis vor seinen Wagen, ihre Gewehre auf die Windschutzscheibe gerichtet.
»O shit«, sagte Coburn.
Einer der Soldaten war noch dabei, sein Gewehr zu laden. Er versuchte, das Magazin rückwärts hineinzuschieben, aber es klappte nicht. Er ließ es fallen, ging auf die Knie und tastete auf dem Boden danach herum. Das war so komisch, daß Coburn laut herausgelacht hätte, wäre er nicht so verschreckt gewesen. Ein Offizier schrie Coburn auf Farsi an. Coburn drehte das Seitenfenster herunter. Er zeigte dem Offizier seine Armbanduhr und sagte: »Es ist schon nach fünf.«
Die Soldaten berieten sich untereinander. Der Offizier kam wieder und fragte Coburn nach seinem Ausweis.
Coburn wartete angstvoll. Wenn sie ihn ausgerechnet heute einsperrten, dann hatten sie sich den denkbar unmöglichsten Tag dazu ausgesucht. Würde man ihm glauben, daß seine Uhr richtig und die des Offiziers nachging?
Endlich räumten die Soldaten die Straße, und der Offizier winkte Coburn durch.
Coburn stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und fuhr langsam weiter.
So war es eben im Iran.
*
Coburns Logistiker gingen daran, Flüge zu buchen, Busse zu chartern und fotokopierten die zu verteilenden Anweisungen. Um zehn Uhr rief Coburn die Gruppenleiter im Bukarest zusammen und ließ durch sie die betroffenen Familien benachrichtigen.
Für die meisten bekam er einen PanAm-Flug nach Istanbul am Freitag, den achten Dezember. Der Rest – einschließlich Liz Coburn und ihrer Kinder – würde am selben Tag mit der Lufthansa nach Frankfurt fliegen.
Sobald die Buchungen bestätigt worden waren, verließen die beiden Spitzenmanager Merv Stauffer und T. J. Marquez den EDS-Stammsitz in Dallas und flogen nach Istanbul, um dort die Evakuierten zu empfangen, sie in Hotels unterzubringen und die nächste Etappe der Heimreise zu organisieren.
Im Laufe des Tages wurde der Plan ein wenig geändert. Paul sträubte sich noch immer dagegen, seine Arbeit im Iran aufzugeben. Er schlug vor, einen harten Kern von ungefähr zehn erfahrenen Mitarbeitern zurückzubehalten, die das Büro sozusagen im Leerlauf betreiben sollten – in der Hoffnung, der Iran würde zur Ruhe kommen und EDS könnte schließlich wieder zum geregelten Arbeitsablauf zurückkehren. Dallas war einverstanden. Zu denen, die freiwillig im Land blieben, gehörten Paul selbst, sein Stellvertreter Bill Gaylord, Jay Coburn und die meisten Kollegen aus dessen Logistik-Gruppe.
Die Taschen voller Schmiergeld in Form von 10 000-Rial-Scheinen (etwa 140 Dollar), besetzten Coburns Leute am Freitagmorgen praktisch einen Teil des Flughafens Mehrabad westlich von Teheran. Coburn hatte seine Leute überall: an den PanAm-Schaltern zur Ausstellung der Tickets, an den Paßkontrollen, in der Abflughalle und bei der Gepäckabfertigung. Das Flugzeug war überbelegt, und die Schmiergelder sorgten dafür, daß niemand von den EDS-Leuten das Nachsehen hatte.
Zweimal wurde es brenzlig. Eine der Ehefrauen, die einen australischen Paß besaß, hatte kein Ausreisevisum, weil die iranischen Regierungsbehörden, die die Ausreisegenehmigungen erteilten, streikten. Ihr Mann und ihre Kinder hatten amerikanische Pässe und brauchten daher keine Ausreisegenehmigung. Als der Ehemann an der Paßkontrolle stand, gab er seinen Paß mitsamt denen der Kinder in einem Stapel mit sechs oder sieben weiteren ab. Während der Beamte versuchte, die einzelnen Gesichter zu identifizieren, fingen die EDS-Leute hinten in der Schlange an, sich vorzudrängeln, um Verwirrung zu stiften. Ein paar Leute aus Coburns Team pflanzten sich vor dem Schalter auf, stellten lauthals Fragen und taten, als seien sie wütend über die Verzögerung. In dem allgemeinen Durcheinander ging die Frau mit dem australischen Paß ungehindert zur Abflughalle durch.
Eine andere EDS-Familie hatte ein iranisches Baby adoptiert und noch keinen Paß für das Kind bekommen können. Das nur wenige Monate alte Baby schlief mit dem Gesicht nach unten in der Armbeuge seiner Mutter. Da nahm eine andere EDS-Frau – Kathy Marketos, von der man sich erzählte, daß sie alles zumindest einmal ausprobierte – das schlafende Kind selbst auf den Arm, drapierte ihren Regenmantel darüber und trug es ins Flugzeug.
Dennoch dauerte es Stunden, bis alle in der Maschine saßen. Beide Abflüge hatten Verspätung. Im Flughafen gab es nichts zu essen, und da die Flüchtlinge einen Mordshunger hatten, fuhren ein paar von Coburns Leuten kurz vor Beginn der Ausgangssperre durch die Stadt und kauften alles auf, was sie an Eßbarem finden konnten. Sie erwarben das gesamte Angebot einiger Straßenstände, die Süßigkeiten, Obst und Zigaretten feilboten. Einer Kentucky-Fried-Chicken-Filiale handelten sie ihren gesamten Brötchenvorrat ab. Als sie den EDS-Leuten in der Abflughalle ihre Schätze aushändigten, wurden sie von den anderen hungrigen Passagieren bestürmt, die auf dieselben Flüge warteten. Auf dem Weg zurück in die Stadt wurden zwei von der Gruppe angehalten und verhaftet, weil sie nach Beginn der Ausgangssperre noch unterwegs waren – glücklicherweise aber wurde der Soldat von einem anderen Auto abgelenkt, dessen Fahrer einfach durchfuhr. Während er ihm hinterherballerte, machten sich die EDS-Leute aus dem Staub.
Das Flugzeug nach Istanbul startete kurz nach Mitternacht, die Maschine nach Frankfurt erst am nächsten Tag – mit einunddreißig Stunden Verspätung.
Coburn und die meisten anderen seines Teams verbrachten die Nacht im Bukarest. Zu Hause erwartete sie ohnehin niemand.
*
Während Coburn mit der Abwicklung der Evakuierung beschäftigt war, versuchte Paul herauszufinden, wer seinen Paß konfiszieren wollte und warum.
Sein Assistent Rich Gallagher, ein junger Amerikaner, geschickt im Umgang mit der iranischen Bürokratie, war ebenfalls freiwillig in Teheran geblieben, mitsamt seiner Frau Cathy, die einen guten Posten beim amerikanischen Militär hatte. Die Gallaghers wollten nicht weg. Außerdem hatten sie keine Kinder, um die sie sich hätten sorgen müssen – lediglich einen Pudel namens Buffy.
Noch am selben Tag, an dem Farah aufgefordert worden war, die Pässe abzuliefern – also am fünften Dezember –, ging Gallagher mit einem der Betroffenen zur US-Botschaft, und zwar mit Paul Bucha, der nicht mehr im Iran arbeitete, sondern nur zufällig die Stadt besuchte.
Sie sprachen mit Generalkonsul Lou Goelz, einem erfahrenen Diplomaten in den Fünfzigern. Er war ein behäbiger Mann und hätte mit seinem weißen Haarkranz einen guten Nikolaus abgegeben. Ebenfalls anwesend war Ali Jordan, ein iranischer Mitarbeiter der Botschaft.
Goelz riet Bucha, wie geplant abzufliegen. Farah hatte – in aller Unschuld – der Polizei erzählt, er sei nicht im Lande, und anscheinend hatten sie ihr geglaubt. Bucha würde sich also mit großer Wahrscheinlichkeit unbemerkt davonstehlen können.
Außerdem bot Goelz an, die Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen von Paul und Bill in Verwahrung zu nehmen. Auf diese Weise wäre EDS imstande, sollte die Polizei die Papiere offiziell anfordern, sie an die Botschaft zu verweisen. Mittlerweile sollte Ali Jordan zur Polizei gehen und herausfinden, was eigentlich gespielt wurde.
Noch am selben Tag wurden die Pässe und Bescheinigungen bei der Botschaft deponiert.
Am nächsten Morgen bestieg Bucha pünktlich das Flugzeug und verließ das Land. Gallagher rief in der Botschaft an. Ali Jordan hatte mit General Biglari von der Teheraner Polizeibehörde gesprochen. Biglari hatte gesagt, Paul und Bill müßten im Land bleiben und würden verhaftet, falls sie versuchen sollten, auszureisen.
Gallagher fragte nach dem Grund.
Sie seien »für eine Ermittlung unentbehrliche Zeugen«, soviel hatte Jordan verstanden.
»Was für eine Ermittlung?«
Das wußte Jordan nicht.
Gallaghers Bericht verwirrte Paul und beunruhigte ihn gleichzeitig. Er war in keinen Verkehrsunfall verwickelt, war nicht Zeuge eines Verbrechens, hatte keinerlei Verbindungen zum CIA … Gegen wen und in welcher Sache sollte da ermittelt werden? Gegen EDS? Oder war das Ganze nur ein Vorwand, um ihn und Bill im Iran festzuhalten, damit sie die Computer der Sozialversicherung in Gang hielten?
Ein Zugeständnis hatte die Polizei immerhin gemacht. Ali Jordan hatte dargelegt, daß sie zwar berechtigt sei, die Aufenthaltsgenehmigungen einzuziehen, da sie Eigentum der iranischen Regierung waren, nicht jedoch die Pässe, denn die waren Eigentum der US-Regierung. General Biglari hatte zugestimmt.
Am nächsten Tag gingen Gallagher und Ali Jordan zur Polizeiwache, um Biglari die Papiere auszuhändigen. Auf dem Hinweg fragte Gallagher Jordan, ob er glaube, Paul und Bill sollten irgendeines Vergehens beschuldigt werden.
»Das bezweifle ich stark«, sagte Jordan.
In der Polizeibehörde erinnerte der General Jordan daran, daß die Botschaft zur Verantwortung gezogen werde, sollten Paul und Bill auf irgendeine Weise – etwa mit Hilfe eines amerikanischen Militärflugzeugs – den Iran verlassen.
Am darauffolgenden Tag – am achten Dezember, dem Evakuierungstag – rief Lou Goelz bei EDS an. Er hatte »aus informierten Kreisen« beim iranischen Justizministerium erfahren, daß es sich bei der Ermittlung, für die Paul und Bill als unentbehrliche Zeugen galten, um einen Korruptionsvorwurf gegen den verhafteten Gesundheitsminister Dr. Scheikholeslamizadeh handelte.
Paul empfand eine gewisse Erleichterung – nun wußte er wenigstens, um was es bei der ganzen Sache ging. Er war in der glücklichen Lage, den Untersuchungsrichtern die Wahrheit sagen zu können: EDS hatte keine Bestechungsgelder gezahlt. Er bezweifelte sogar, daß der Minister überhaupt bestochen worden war. Iranische Bürokraten waren zwar berüchtigt für ihre Korruption, doch Dr. Scheik, wie Paul den Namen abkürzte, schien aus anderem Holz geschnitzt zu sein. Von Beruf Neurochirurg, besaß er eine rasche Auffassungsgabe und die bewundernswerte Fähigkeit, sich auch kleinster Details anzunehmen. Im Gesundheitsministerium hatte er sich mit einer Gruppe progressiver junger Technokraten umgeben, die sich darauf verstanden, den müden Amtsschimmel anzutreiben und zur Arbeit zu bewegen. Das EDS-Projekt war nur ein Teil seines ehrgeizigen Plans, die iranischen Gesundheits- und Sozialdienste auf amerikanisches Niveau zu heben. Paul konnte sich nicht vorstellen, daß Dr. Scheik nebenbei auch sein eigenes Schäfchen ins trockene gebracht haben sollte.
Paul hatte also nichts zu befürchten – vorausgesetzt, Goelz’ »informierte Kreise« sagten die Wahrheit. Dr. Scheik war schon vor drei Monaten verhaftet worden.
War es nur Zufall, daß den Iranern erst jetzt, da Paul ihnen mitgeteilt hatte, EDS werde das Land verlassen, wenn das Ministerium die Rechnungen nicht begliche, aufging, welch unentbehrliche Zeugen er und Bill waren?
Nach Abschluß der Evakuierung zogen die restlichen EDS-Männer in zwei Häuser um, in denen sie den zehnten und elften Dezember, die Aschura-Feiertage, verbrachten und Poker spielten. In einem der Häuser ging es um hohe, im anderen um niedrigere Einsätze; Paul und Coburn waren im ersteren. Zur Sicherheit luden sie Coburns »Schatten« ein – seine beiden Kontaktleute beim militärischen Geheimdienst –, die bewaffnet kamen. Das verstieß jedoch gegen die Regeln der Pokerrunde, daher mußten sie ihre Knarren im Flur deponieren.
Entgegen allen Befürchtungen verlief Aschura verhältnismäßig friedlich: Millionen von Iranern fanden sich im ganzen Lande zu Anti-Schah-Demonstrationen ein, aber es kam nur vereinzelt zu Ausschreitungen.
Nach Aschura erwogen Paul und Bill erneut, das Land zu verlassen, doch sie sollten eine böse Überraschung erleben. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, baten sie Lou Goelz um Rückgabe ihrer Pässe. Goelz antwortete, davon müsse er General Biglari in Kenntnis setzen, und dies bedeutete soviel wie die Polizei direkt zu benachrichtigen, daß Paul und Bill sich aus dem Staub machen wollten.
Goelz behauptete steif und fest, er hätte EDS von seinem Handel mit der Polizei berichtet, als er die Pässe in Verwahrung genommen hätte. Er mußte wohl geflüstert haben, denn keiner von ihnen konnte sich daran erinnern.
Paul schäumte vor Wut. Wieso mußte sich Goelz überhaupt auf einen Handel mit der Polizei einlassen? Er war doch nicht verpflichtet, denen zu sagen, was er mit einem amerikanischen Paß anstellte! Er mußte der Polizei doch nicht auch noch dabei helfen, ihn und Bill im Iran festzuhalten, verdammt noch mal! Die Botschaft hatte schließlich Amerikanern zu helfen, oder etwa nicht?
Konnte Goelz denn nicht einfach diese dumme Vereinbarung nicht einhalten und die Pässe in aller Stille zurückgeben, vielleicht die Polizei erst ein paar Tage später informieren, wenn er und Bill zu Hause in Sicherheit waren? Auf gar keinen Fall, meinte Goelz. Wenn er sich ihretwegen mit der Polizei anlegte, so handelte er sich Schwierigkeiten für alle anderen zwölftausend Amerikaner ein, die sich noch im Iran aufhielten und um deren Sicherheit er sich zu kümmern hätte. Außerdem stünden Pauls und Bills Name bereits auf der »Sperrliste«, die bei der Flughafenpolizei auslag: Auch mit vollständigen Papieren würden sie niemals durch die Paßkontrolle kommen.
Nachdem Dallas die Nachricht erhalten hatte, daß Paul und Bill unwiderruflich im Iran festsaßen, lief EDS mitsamt ihren Anwälten auf Hochtouren. Unter einer republikanischen Regierung wären ihre Verbindungen in Washington besser gewesen; trotzdem hatten sie noch immer zuverlässige Freunde in der Hauptstadt. Sie sprachen mit Bob Strauss, einem überaus mächtigen »Ausputzer« im Weißen Haus, der zufällig Texaner war; mit Admiral Tom Moorer, dem ehemaligen Vorsitzenden des Gemeinsamen Stabs der Oberbefehlshaber, der viele Generäle, die jetzt in der iranischen Militärregierung saßen, persönlich kannte; und sie sprachen mit Richard Helms, vormals Chef des CIA und später US-Botschafter im Iran. Der Druck, den diese Freunde auf das Außenministerium ausübten, bewirkte immerhin, daß US-Botschafter William Sullivan in Teheran Pauls und Bills Fall bei einem Treffen mit dem iranischen Premierminister, General Azhari, zur Sprache brachte.
Aber das alles führte zu nichts.
Die dreißig Tage Zahlungsziel, die Paul den Iranern gewährt hatte, liefen ab, und am sechzehnten Dezember schrieb er an Dr. Emrani und kündigte den Vertrag ordnungsgemäß. Aber noch immer gab er nicht auf. Als Zeichen seines guten Willens, die Probleme mit dem Ministerium zu bereinigen, bat er eine Handvoll ausgeflogener Führungskräfte, wieder nach Teheran zu kommen. Einige der Zurückkehrenden brachten, ermutigt durch den friedlichen Verlauf der Aschura-Feiertage, sogar ihre Familien mit.
Weder die Botschaft noch die EDS-Anwälte in Teheran hatten herausfinden können, wer eigentlich Pauls und Bills Verbleib im Iran angeordnet hatte. Schließlich war es Madjid, Farahs Vater, dem es gelang, General Biglari diese Information zu entlocken. Der Verantwortliche war der Untersuchungsrichter Hussein Dadgar, ein mittlerer Beamter der Generalstaatsanwaltschaft in einer Abteilung, die mit Vergehen von Beamten des öffentlichen Dienstes befaßt und mit großer Macht ausgestattet war. Dadgar leitete die Ermittlungen gegen Dr. Scheik, den inhaftierten ehemaligen Gesundheitsminister.
Wenn die Botschaft die Iraner schon nicht dazu überreden konnte, Paul und Bill ausreisen zu lassen, und ihnen auch ihre Pässe nicht ohne großes Aufheben aushändigen wollte – wäre sie dann nicht wenigstens in der Lage, mit diesem Dadgar so bald wie möglich eine Einvernahme von Paul und Bill anzuberaumen, damit die beiden zu Weihnachten nach Hause fahren konnten?
Weihnachten habe für die Iraner so gut wie keine Bedeutung, sagte Goelz, Neujahr hingegen schon, daher wolle er versuchen, ein Treffen noch vor dem Jahreswechsel zu arrangieren.
In der zweiten Dezemberhälfte kam es wiederum zu Unruhen, und die zurückgekehrten Manager mußten sich auf eine neuerliche Evakuierung gefaßt machen. Der Generalstreik hielt unverändert an, und die wichtigste Einnahmequelle der Regierung, der Ölexport, versiegte gänzlich. Damit sanken die Aussichten auf Begleichung der EDS-Rechnungen praktisch auf Null. Im Ministerium erschienen so wenige Iraner zur Arbeit, daß es für die EDS-Leute nichts zu tun gab, und Paul schickte die Hälfte von ihnen zu Weihnachten nach Hause in die Staaten.
Paul selbst packte seine Koffer, verschloß sein Haus und zog ins Hilton, bereit, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit heimzufliegen.
In der Stadt jagte ein Gerücht das andere. Jay Coburn schnappte die meisten auf und präsentierte die glaubhaftesten Paul. Eines der beunruhigendsten kam von Bunny Fleischaker, einer Amerikanerin mit Freunden im Justizministerium. Bunny war in den Staaten bei EDS beschäftigt gewesen und hielt in Teheran, obwohl sie der Firma nicht mehr angehörte, die Verbindung aufrecht. Sie rief Coburn an und teilte ihm mit, im Justizministerium plane man, Paul und Bill zu verhaften. Paul besprach sich mit Coburn. Das Gerücht widersprach allem, was sie von der US-Botschaft zu hören bekamen. Beide waren der Meinung, die Ratschläge der Botschaft seien fundierter als die Bunny Fleischakers, und beschlossen, nichts zu unternehmen.
Paul verbrachte gemeinsam mit anderen Kollegen ein ruhiges Weihnachtsfest im Haus von Pat Sculley, einem jungen EDS-Manager, der freiwillig nach Teheran zurückgekehrt war. Seine Frau Mary tischte ihnen ein vorzügliches Weihnachtsmahl auf. Dennoch vermißte Paul Ruthie und die Kinder schmerzlich.
Zwei Tage nach Weihnachten kam ein Anruf von der Botschaft. Endlich hatten sie einen Termin mit dem Untersuchungsrichter Hussein Dadgar für Paul und Bill vereinbaren können. Das Treffen sollte am nächsten Morgen im Gesundheitsministerium in der Eisenhower Avenue stattfinden.
Kurz nach neun Uhr kam Bill Gaylord mit einer Tasse Kaffee in Pauls Büro. Er trug seine EDS-Uniform: korrekter Anzug, weißes Hemd, unauffällige Krawatte, feste schwarze Schuhe.
Bill war, wie Paul, neununddreißig Jahre alt, mittelgroß und stämmig, aber da hörte die Ähnlichkeit auch schon auf. Paul hatte einen dunklen Teint, buschige Augenbrauen, tiefliegende Augen und eine große Nase. War er salopp gekleidet, wurde er häufig für einen Iraner gehalten – bis er den Mund aufmachte und sein Englisch mit New Yorker Akzent hören ließ. Bill dagegen besaß ein flaches, rundes Gesicht und eine sehr helle Haut – niemand würde ihn je für etwas anderes als einen Angelsachsen halten.
Ansonsten hatten sie viele Gemeinsamkeiten. Beide waren katholisch, Bill allerdings strenger gläubig als Paul. Beide hatten eine Vorliebe für gutes Essen. Beide waren Informatiker von Beruf und in den sechziger Jahren bei EDS eingetreten, Bill 1965, Paul 1966. Beide hatten rasch Karriere gemacht, doch Paul, obwohl er ein Jahr später zu EDS gestoßen war, bekleidete jetzt einen höheren Posten als Bill. Bill kannte das Krankenversicherungswesen in- und auswendig und konnte hervorragend mit Menschen umgehen, doch war er weder so draufgängerisch noch so dynamisch wie Paul. Bill war ein Grübler und sorgfältiger Organisator. Hatte er eine wichtige Vorlage auszuarbeiten, so brauchte Paul sich keinerlei Sorgen zu machen: Bill pflegte sie Wort für Wort gründlich vorzubereiten.
Bei der Arbeit ergänzten sie sich gegenseitig. War Paul einmal zu hastig, so brachte ihn Bill dazu, eine Denkpause einzulegen. Feilte Bill einmal zu pingelig an Kleinigkeiten herum, bekam er von Paul zu hören, er solle einfach ins kalte Wasser springen.
Sie kannten sich bereits aus den Staaten, waren sich jedoch erst in den vergangenen neun Monaten nähergekommen. Als Bill im März in Teheran eingetroffen war, hatte er im Haus der Chiapparones gewohnt, bis seine Frau mit den Kindern nachkam. Paul fühlte sich fast ein wenig als Bills Beschützer. Es war eine Schande, daß Bill nichts als Probleme im Iran hatte.
Bill machte sich des Aufruhrs und der Schießereien wegen wesentlich mehr Sorgen als die meisten anderen – vielleicht, weil er noch nicht lange hier war, vielleicht, weil er von Natur aus dazu neigte. Auch die Scherereien um ihre Pässe nahm er sich mehr zu Herzen als Paul. Er hatte sogar schon vorgeschlagen, mit Paul per Zug in den Nordosten zu fahren und über die Grenze nach Rußland zu gehen – mit der Begründung, niemand käme auf die Idee, amerikanische Geschäftsleute entschieden sich für eine Flucht ausgerechnet durch die Sowjetunion.
Überdies sehnte er sich nach Emily und den Kindern, wofür sich Paul irgendwie verantwortlich fühlte, weil er Bill in den Iran geholt hatte.
Aber nun war ja bald alles vorüber: Heute würden sie zu Dadgar gehen und ihre Pässe wiederbekommen. Bill hatte für morgen einen Auslandsflug gebucht. Emily bereitete für ihn schon eine Begrüßungsparty zu Silvester vor. Dann würde ihm das alles nur noch wie ein böser Traum erscheinen.
Paul lächelte Bill zu. »Können wir gehen?«
»Jederzeit.«
»Dann sag ich jetzt Abolhasan Bescheid.« Paul griff zum Telefon. Abolhasan arbeitete zusammen mit Rich Gallagher als Pauls Assistent in der Verwaltung. Er war der ranghöchste iranische Mitarbeiter und beriet Paul in Fragen iranischen Geschäftsgebarens. Er war der Sohn eines bekannten Rechtsanwalts, mit einer Amerikanerin verheiratet und sprach ausgezeichnet Englisch. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, EDS-Verträge in Farsi zu übersetzen. Heute sollte er für Paul und Bill bei Dadgar dolmetschen.
Er kam umgehend in Pauls Büro, und die drei Männer brachen auf. Sie nahmen keinen Anwalt mit. Der Botschaft zufolge galt das heutige Treffen als reine Routineangelegenheit, als inoffizielle Einvernahme. In Begleitung eines Anwalts zu erscheinen, wäre nicht nur sinnlos, sondern mochte Mr. Dadgar sogar gegen sie einnehmen und auf den Gedanken bringen, Paul und Bill hätten etwas zu verbergen. Paul hätte gerne einen Botschaftsangehörigen dabeigehabt, aber auch diese Idee hatte ihm Goelz ausgeredet: Es war nicht üblich, zu derlei Treffen einen Botschaftsvertreter zu entsenden. Immerhin hatte Goelz ihnen geraten, Unterlagen über ihre Ankunft im Iran, ihre Positionen in der Firma und über ihre Verantwortung und Befugnisse mitzunehmen.
Sie steuerten durch den wie üblich mörderischen Verkehr in Teheran, und Paul fühlte sich niedergeschlagen. Er freute sich zwar auf den Heimflug, aber er haßte es, eine Niederlage eingestehen zu müssen. Er hatte EDS im Iran aufbauen wollen, statt dessen mußte er einen Scherbenhaufen hinterlassen. Von welcher Seite man es auch betrachtete, das erste Überseeunternehmen des Konzerns war fehlgeschlagen. Zwar war es nicht Pauls Schuld, daß die iranische Regierung kein Geld mehr hatte, aber das war ihm nur ein schwacher Trost: Entschuldigungen brachten keinen Profit.
Sie fuhren die von Bäumen gesäumte Eisenhower Avenue hinunter, die breit und schnurgerade war wie eine amerikanische Schnellstraße, und bogen in den Hof eines rechteckigen, neunstöckigen Gebäudes, das ein wenig zurückgesetzt von der Straße lag und von Soldaten mit Maschinengewehren bewacht wurde. Hier war die Sozialversicherungsabteilung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales untergebracht. Sie hätte der Motor des neuen iranischen Sozialstaats werden sollen, hier hatten die iranische Regierung und EDS Seite an Seite gearbeitet. EDS belegte den gesamten sechsten Stock, in dem sich auch Bills Büro befand.
Paul, Bill und Abolhasan zeigten ihre Ausweise vor und traten ein. Die Gänge waren schäbig und schmutzig, und es war kalt: Wieder einmal war die Heizung abgestellt. Man wies ihnen den Weg zu dem Büro, das Mr. Dadgar benutzte.
Sie fanden ihn in einem kleinen Zimmer mit schmuddeligen Wänden hinter einem alten grauen Stahlschreibtisch sitzen, vor sich ein Notizbuch und einen Federhalter. Durchs Fenster konnte Paul das Datenzentrum sehen, das EDS nebenan bauen ließ.
Abolhasan übernahm die Vorstellung. Auf einem Stuhl neben Dadgars Schreibtisch saß eine Iranerin, Mrs. Nurbasch. Sie war Dadgars Dolmetscherin.
Sie nahmen auf den wackeligen Metallstühlen Platz. Es wurde Tee serviert. Dann fing Dadgar an, auf Farsi zu sprechen. Seine Stimme war leise, aber ziemlich tief, und sein Gesicht war völlig ausdruckslos. Paul musterte ihn, während er auf die Übersetzung wartete. Dadgar war ein kleiner stämmiger Mann in den Fünfzigern, und aus irgendeinem Grunde fühlte sich Paul an Archie Bunker, das englische Original von Ekel Alfred, erinnert. Dadgars Teint war dunkel und sein Haar in die Stirn gekämmt, als solle es eine beginnende Glatze überdecken. Er hatte einen Schnurrbart und trug eine Brille. Sein Anzug war unauffällig.
Dadgar beendete seine Rede, und Abolhasan sagte: »Er weist darauf hin, daß er bevollmächtigt ist, Sie verhaften zu lassen, falls er Ihre Antworten auf seine Fragen nicht zufriedenstellend findet. Wenn Sie das nicht gewußt haben sollten, sagt er, können Sie das Verhör verschieben, um Ihren Anwälten Zeit zu geben, über eine Kaution zu verhandeln.«
Diese Entwicklung der Dinge überraschte Paul, doch er schaltete schnell und erwog das Für und Wider, wie er es bei jeder anderen geschäftlichen Entscheidung getan hätte. Na gut, dachte er, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, daß er uns nicht glaubt und uns festnehmen läßt – aber wir sind keine Mörder, und wenn wir eine Kaution stellen, sind wir innerhalb von vierundzwanzig Stunden wieder frei. Dann wären wir zwar an dieses Land gebunden und müßten uns mit den Anwälten beraten und eine Lösung suchen … Aber schlimmer als die jetzige Situation kann das auch nicht sein. Er sah zu Bill hinüber. »Was meinst du dazu?«
Bill zuckte mit der Schulter. »Goelz sagt, diese Unterredung sei eine reine Routineangelegenheit. Dieses Gerede über Kautionen klingt mir eher wie eine Formalität – so wie wenn man dich über deine Rechte belehrt.«
Paul nickte. »Und eine Vertagung ist das letzte, was wir wollen.«
»Bringen wir’s also hinter uns.«
Paul wandte sich an Mrs. Nurbasch. »Bitte sagen Sie Mr. Dadgar, keiner von uns hat ein Verbrechen begangen und keiner von uns hat Kenntnis von einem Verbrechen, das ein anderer verübt hat. Wir sind daher überzeugt, daß keine Anklage gegen uns erhoben wird. Wir würden die Angelegenheit gerne heute noch erledigen, damit wir nach Hause reisen können.«
Mrs. Nurbasch übersetzte.
Dadgar sagte, er wolle zuerst Paul alleine verhören. Bill solle eine Stunde später wiederkommen.
*
Bill verließ den Raum und ging in sein Büro im sechsten Stock, von wo aus er das Bukarest anrief. Er erreichte Lloyd Briggs, den dritten in der Hierarchie nach Paul und ihm selbst.
»Dadgar sagt, er habe Vollmacht, uns festzunehmen«, sagte er zu Briggs. »Wir müssen eventuell eine Kaution stellen. Ruf die Anwälte an und finde heraus, was das zu bedeuten hat.«
»Klar«, sagte Briggs. »Wo bist du jetzt?«
»Hier in meinem Büro im Ministerium.«
»Ich ruf’ dich dann zurück.«
Bill legte auf und wartete. Der Gedanke, er könne verhaftet werden, kam ihm lächerlich vor. Trotz der im Iran weitverbreiteten Korruption hatte EDS niemals Bestechungsgelder gezahlt, um an Aufträge zu kommen. Doch selbst wenn, so wäre das nicht seine Aufgabe gewesen: Er war für die Auslieferung der Arbeit, nicht für die Beschaffung von Aufträgen zuständig.
Schon nach wenigen Minuten rief Briggs wieder an. »Ihr braucht euch keinerlei Sorgen zu machen«, sagte er. »Erst vorige Woche ist die Kaution für einen Mann, der wegen Mordes angeklagt war, auf eineinhalb Millionen Rial festgesetzt worden.«
Bill rechnete schnell um: Das waren zwanzigtausend Dollar. Die konnte EDS wahrscheinlich bar bezahlen. Schon seit einigen Wochen hatten sie große Summen an Bargeld bereitliegen, sowohl der Streiks in den Banken wegen als auch im Hinblick auf die Evakuierung. »Wieviel haben wir im Bürosafe?«
»Ungefähr sieben Millionen Rial, dazu fünfzigtausend Dollar.«
Also können wir, dachte Bill, sollten wir doch verhaftet werden, die Kaution umgehend entrichten. »Danke«, sagte er. »Jetzt fühl’ ich mich schon viel besser.«
*
Unten hatte Dadgar Pauls kompletten Namen notiert, Geburtsort und -datum, die Schulen, die er besucht hatte, seine Berufserfahrung als Computerspezialist, seine Zeugnisse. Außerdem hatte er Pauls Ernennungsurkunde zum Generalmanager der EDS Corporation Iran gründlich studiert. Jetzt bat er Paul zu berichten, wie der Vertragsabschluß zwischen EDS und dem Gesundheitsministerium zustande gekommen war.
Paul holte tief Luft. »Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, daß ich nicht im Iran gearbeitet habe, als der Vertrag ausgehandelt und unterzeichnet wurde. Meine Kenntnisse darüber stammen also aus zweiter Hand. Dennoch bin ich bereit, Ihnen mitzuteilen, was ich über die Vertragsabwicklung weiß.«
Mrs. Nurbasch übersetzte, und Dadgar nickte zustimmend.
Paul sprach langsam weiter und wählte seine Worte sorgfältig, um der Übersetzerin die Arbeit zu erleichtern. »1975 erfuhr ein Manager von EDS, und zwar Paul Bucha, daß das Ministerium eine EDV-Firma suchte, die über Erfahrung auf dem Gebiet der Kranken- und Sozialversicherung verfügt. Er flog nach Teheran, besprach die Angelegenheit mit Ministerialbeamten und machte sich ein Bild von Art und Umfang der Anforderungen. Man sagte ihm, das Ministerium habe bereits Angebote für das Projekt erhalten, und zwar von Louis Berger & Co., von Marsh & McClennan, ISIRAN und Univac, und ein fünftes Angebot von Cap Gemini Sogeti sei unterwegs. Bucha erklärte, EDS sei die führende EDV-Firma in den Vereinigten Staaten und genau auf diese Art von Arbeit auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge spezialisiert. Er bot dem Ministerium die kostenlose Erstellung einer vorläufigen Projektbeschreibung an. Das Angebot wurde angenommen.«
Als er eine Pause für die Dolmetscherin machte, fiel Paul auf, daß Mrs. Nurbasch weniger zu sagen schien als er – und was Dadgar schließlich niederschrieb, war noch weniger. Nun sprach er noch langsamer und machte häufiger eine Pause. »Dem Ministerium gefielen die Angebote von EDS offenbar, denn es bat uns dann, eine detaillierte Studie für 200 000 Dollar zu erstellen. Diese Studie legten wir im Oktober 1975 vor. Das Ministerium akzeptierte unsere Vorschläge und begann mit den Vertragsverhandlungen. Im August 1976 wurde der Vertrag abgeschlossen.«
»Ist dabei alles mit rechten Dingen zugegangen?« ließ Dadgar durch Mrs. Nurbasch fragen.
»Gewiß doch«, sagte Paul. »Wir brauchten weitere drei Monate für die Abwicklung des Verfahrens, bis wir alle notwendigen Bestätigungen der diversen Regierungsbehörden, einschließlich des Kaiserlichen Hofes, beisammen hatten. Keine Instanz wurde übergangen. Der Vertrag trat Ende des Jahres in Kraft.«
»War der Vertragspreis überhöht?«
»Er setzte eine maximale Gewinnspanne von zwanzig Prozent vor Abzug von Steuern fest, das steht im Einklang mit anderen Verträgen dieses Umfangs, sowohl hier als auch in anderen Ländern.«
»Ist EDS den Vertragsverpflichtungen nachgekommen?«
Das war nun etwas, worüber Paul wirklich aus erster Hand Bescheid wußte. »Ja, das haben wir getan.«
»Könnten Sie dafür Beweise erbringen?«