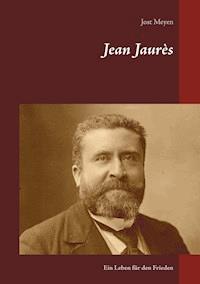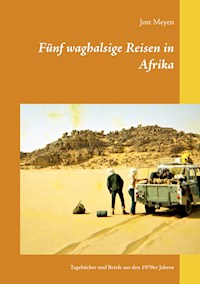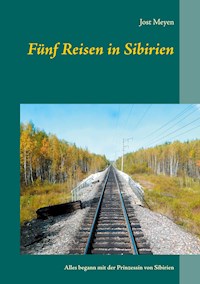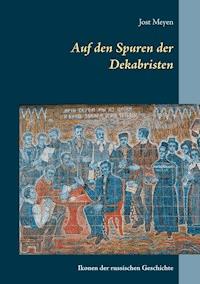
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 14. (26.) Dezember 1825 findet ein Putschversuch adliger Offiziere auf dem Senatsplatz in St. Petersburg statt. Sie setzen sich für die Beendigung der Selbstherrschaft des Zaren, für eine Verfassung und für die Befreiung der leibeigenen Bauern ein. 121 'Staatsverbrecher' werden vor ein Sondergericht gestellt. Fünf von ihnen werden gehängt. Warum scheitern diese russischen Aristokraten, die sich als Teil der postnapoleonischen europäischen Freiheitsbewegung verstehen? Welche Rolle spielen die elf Frauen, drei von ihnen Französinnen, die ihnen in die sibirische Verbannung folgen? Wenn der Aufstand Erfolg gehabt hätte, wäre die Geschichte Russlands anders verlaufen. Trotz ihrer Niederlage gewinnen die sogenannten 'Dekabristen' ein hohes Ansehen und werden noch heute in Russland geachtet. Das Buch widmet sich diesen 'Ikonen der russischen Geschichte' bevorzugt anhand zeitgenössischer Quellen. Facettenreich, informativ und mit weitem Blickwinkel vermittelt es fundierte Geschichtskenntnisse aus einer bewegenden Epoche, in der das Zarenreich eng mit Westeuropa verknüpft war. Wer Russland besser verstehen will, sollte dieses Buch lesen. Mit zahlreichen zeitgenössischen Abbildungen und ergänzenden Fotos, die der Autor Jost Meyen auf seinen Reisen vor Ort gemacht hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Der 13. Juli 1826: die Hinrichtung in St. Petersburg
Die Widersprüchlichkeit Katharinas II.
Radistschews „Reise von Petersburg nach Moskau“
Enttäuschte Hoffnungen unter Alexander I.
Gründung von Geheimgesellschaften
5.1 Rettungsbund und Wohlfahrtsbund
5.2 Nord- und Südgesellschaft und Vereinigte Slawen
Zwei Verfassungsentwürfe
6.1 „Russische Wahrheiten“ von Pawel I. Pestel
6.2 „Die Konstitution“ von Nikita M. Murawjow
Der 14. Dezember 1825: Aufstand auf dem Senatsplatz
Aufstand des Tschernigower Regiments
Verhöre und Urteile
Verbannung nach Sibirien
10.1 Die Überführung
10.2 Nertschinsk
10.3 Tschita
10.4 Die Verlegung
10.5 Petrowski Sawod
10.6 Die Ansiedlung
Die Frauen der Dekabristen
Kurzportraits von 5 bemerkenswerten Dekabristen
12.1 Nikolai A. Bestuschew
12.2 Iwan D. Jakuschkin
12.3 Iwan I. Pustschin
12.4 Wilhelm K. Küchelbecker
12.5 Michail S. Lunin
Die Autokratie von Nikolaus I.
Was bleibt von den Dekabristen?
Exkurs: Deutsche Einflüsse auf die Dekabristen
Auszug von F. Dostojewski: „Aufzeichnungen aus dem Totenhaus“
Epilog: Aus dem Tagebuch eines Spurenlesers
Zeittafel
Verzeichnis der Verurteilten vom 10. Juli 1826
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Der Autor
Vorwort
Wer waren die Dekabristen? Außerhalb Russlands weiß dies heute kaum noch jemand. Jeder Russe hingegen kennt diese idealistischen Freiheitskämpfer. Rund 15.000 Veröffentlichungen sind im Zusammenhang mit diesem Thema erschienen.1
Am 14. Dezember 1825 fand auf dem Senatsplatz in St. Petersburg ein Putschversuch adliger Offiziere statt2. Sie wollten die Autokratie des russischen Zaren beenden und die Leibeigenschaft aufheben, von der fast die Hälfte der Bevölkerung betroffen war.
Wenn dieser Staatsstreich geglückt wäre, hätte das riesige Reich 80 Jahre früher eine Verfassung erhalten und die Bauernbefreiung 35 Jahre eher erfolgen können. Stattdessen wurden fast 600 Verdächtige eingekerkert und nach intensiven Verhören 121 „Staatsverbrecher“ vor ein Sondergericht gestellt und zu harten Strafen verurteilt.
Wer waren die Aristokraten, die sich gegen ihren eigenen Stand wandten? Worin bestanden ihre Motive, ihre Reformideen? Unter welchen Bedingungen agierten diese „Kinder des Jahres 1812“, von denen etwa ein Drittel daran beteiligt gewesen war, Moskau und Europa von Napoleon I. und der französischen Hegemonie zu befreien? Welche Bedeutung hatten die Ideen der französischen Revolution, die westliche Bildung, die Fremdsprachenkenntnisse für das Denken der 'Dezembermänner'? Welche Rolle spielte die Person des Zaren für den Verlauf der russischen Geschichte?
Warum sind diese „Märtyrer“ trotz ihrer Niederlage in Russland unvergessen und werden im Geschichtsunterricht der Schulen ausführlich behandelt? Keine Frau hatte sich an der Bewegung beteiligt. Aber elf Frauen, darunter drei Französinnen, die ihren Männern nach Sibirien folgten, wurden dann zu „Schutzengeln“ der Verbannten.
Eine knappe Darstellung des historischen Hintergrunds erleichtert die Einordnung. Die detaillierte Beschreibung von fünf Einzelschicksalen ergänzt das Bild. Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss des Schriftstellers Alexander Radistschew. Zarin Katharina II. forderte, dass er wegen seines kritischen Werkes die Todesstrafe erhält.
Für die Jahresangaben verwende ich den von 1700 bis 1918 in Russland geltenden alten Julianischen Kalender (AZ). Bei einer Umrechnung in den in Westeuropa gültigen Gregorianische Kalender (NZ) müssen während des hier behandelten Zeitraums 12 Tage addiert werden. Der 14. Dezember in Russland war also in Westeuropa bereits der 26. Dezember.
Die russischen Namen bestehen aus drei Einzelnamen. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, verzichte ich auf den Vaternamen. Bei der Schreibweise der Namen habe ich mich für eine leicht lesbare Version entschieden. Dabei orientiere ich mich an dem unverzichtbaren Dekabristenlexikon von Joachim Winsmann3.
Wegen meiner geringen Russischkenntnisse konnte ich die in russischer Sprache erschienene Literatur nicht hinzuziehen. Die französischen Zitate habe ich ins Deutsche übersetzt und jeweils in Klammern oder in der Anmerkung angefügt.
Die Autobiographien der Dekabristen waren für mich die zentrale Quelle. Auch wenn sie erst nach den 30 Verbannungsjahren der Verurteilten veröffentlicht wurden, stellen sie einen lebendigen, authentischen Zugang dar.4 Bemerkenswert ist, dass Sergej Wolkonski und seine Frau Maria Wolkonskaja eigene Erinnerungen geschrieben haben, die durch die Darstellung des Sohnes Michail und des Enkels Sergei noch vervollständigt wurden.
Dass Memoiren subjektive Eindrücke wiedergeben, mit bestimmter Absicht und oft nur für die Familie geschrieben wurden, ist mir bewusst.5 Ich vertraue auf das kritische Urteil des Lesers.
Für mich waren die 1869 in Leipzig gedruckten präzisen Erinnerungen des Deutschbalten Baron Andrej Rosen besonders wertvoll.6 Der Historiker Glynn Barratt schreibt über ihn: „Rozen's memoirs are of very special value to historians in their account of the period and of the rise of Russian liberal thought at the time. Incomparably accurate und factual, yet pervaded by a pleasant sence of balance.“7 „Of all Decembrist memoirs, his most merit confidence.“8
Russland ist vielen fremd und gilt als schwer zu verstehen. In diesem Zusammenhang wird noch heute gerne das Bonmot des Dichters und Diplomaten Fjodor Tjutschew (1803-1873) zitiert:
„Mit dem Verstand ist Russland nicht zu begreifen.
Mit gewöhnlichem Maße nicht zu messen.
Es hat ein besonderes Wesen.
An Russland kann man nur glauben.“
Ich sehe meine Aufgabe darin, über ein Ereignis zu schreiben, das für Russland von großer Bedeutung war, aber heute in Deutschland fast unbekannt ist. Ich hoffe, dass diejenigen, die sich mit mir 'auf die Spuren der Dekabristen' begeben, mehr Verständnis für Russland bekommen und ein differenziertes Bild einer bewegenden Epoche erhalten, in der Russland eng mit Westeuropa verknüpft war. Die Friedensordnung des Wiener Kongresses (1814-1815) hat einerseits für einige Jahrzehnte Kriege zwischen den Ländern verhindert. Aber in dieser Zeit der Restauration wurden andererseits demokratische Reformbewegungen gewaltsam niedergeschlagen.
In den Jahren 2015 und 2016 unternahm ich drei Reisen nach Russland: eine führte mich nach St. Petersburg, die anderen beiden im Sommer und Winter nach Sibirien. So konnte ich den Senatsplatz in St. Petersburg, die Peter-Paul- und Schlüsselburger Festung sowie die Gefängnisorte Tschita und Petrowski Sawod in Ostsibirien kennenlernen. In den kleinen Verbannungsdörfern um den Baikalsee sind die Erinnerungen an die Dekabristen noch heute, 190 Jahre nach ihrer Niederlage, besonders lebendig. Dort bin ich auf russischer Seite auf motivierendes Interesse und große Hilfsbereitschaft gestoßen.
Im Sommer 2017 besuchte ich mit meiner Frau die Verbannungsorte am Jenissei: Jenisseisk, Krasnojarsk, Minussinsk und Schuschenskoje. Am bedeutendsten war Minussinsk, wo zeitweise 9 'Dezembermänner' zwangsangesiedelt wurden. Es existieren hier noch drei Holzhäuser, in denen Verbannte wohnten. Im Haus der Brüder Krjukow besteht seit 20 Jahren auch ein kleines Dekabristenmuseum.
Das Kapitel 'Die Ansiedlung' habe ich erweitert und über die vielfältigen Aktivitäten der Brüder Beljajew in Minussinsk berichtet. Neu ist auch ein Exkurs über den deutschen Einfluss auf die Dekabristenbewegung.
Schließlich erkundeten wir im Mai 2018 die westsibirischen Wohnorte der Dekabristen. Mehrere ehemalige Häuser wurden zu Museen. Aber auch zusätzliche Erinnerungsstätten sind entstanden. Zu den wichtigsten Orten zählen neben der „Dekabristenstadt Jalutorowsk“ Kurgan, Tobolsk und Turinsk. Viele der verwendeten Fotos entstammen diesen Reisen.
Danken möchte ich vor allem meiner Frau Ingeborg für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.
1 Hans Lemberg: Die Dekabristen, in Klaus Zernack (Hrg): Handbuch der Geschichte Russlands. Band II, Stuttgart 2001, Seite 1021
2 Dekabrist leitet sich von der russischen Bezeichnung für den Monat Dezember (Декабрь/Dekabr) ab.
3 Joachim Winsmann: Dekabristenlexikon, Bergisch-Gladbach 2015
4 So die Berichte von Jakuschkin, Obolenski, Lohrer, Beljajew oder die Briefe Lunins aus Sibirien.
5 Ein Beispiel für wenig hilfreiche Memoiren sind die Erinnerungen von Katharina II., die ganz der Selbstdarstellung und Rechtfertigung dienten.
6 Baron Andrej Rosen: Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen. Beiträge zur Geschichte des St. Petersburger Militäraufstandes vom 14. (26.) December 1825 und seiner Teilnehmer, 2. Aufl. Leipzig 1874. Sein vollständiger deutscher Name lautet: Baron Andreas Hermann Heinrich von Rosen.
7 Glynn Barratt: The rebel on the bridge, London 1975, Seite XIII
8 Ebenda, Seite XVI
1 Der 13. Juli 1826: die Hinrichtung in St. Petersburg
Im Morgengrauen des 13. Juli 1826 stellten sich in der Peter-Paul-Festung Soldaten so auf, dass ein viereckiger Platz für die Verurteilten frei blieb. Die Gefangenen hatten ein halbes Jahr in Einzelhaft verbracht und freuten sich über ihr Wiedersehen. Nach ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Truppenteilen wurden sie in Gruppen aufgeteilt. Offiziere der 1. Gardedivision, der 2. Gardedivision, der Armee und schließlich die Zivilisten. Man brachte die Marineangehörigen zur Verurteilung nach Kronstadt.
Die Häftlinge gingen durch das Festungstor vor die Kronwerksche Kourtine, wo schon Truppenteile aus ihren jeweiligen Regimentern warteten. Auf dem Wall befand sich ein Gerüst mit Stricken, neben jeder Gruppe brannte ein Feuer.
Das allgemeine Urteil wurde verlesen. Die nach der jeweiligen Strafkategorie Aufgerufenen mussten niederknien. Ein Henker zerbrach den angesägten Degen auf ihrem Kopf, riss Orden und Schulterstücke ab und warf schließlich alles mit den Uniformen ins Feuer.
Nach dieser erniedrigenden Degradierung wurden sie in grauen Häftlingskitteln in die Festung zurückgeführt. Baron Rosen kam in die Zelle 14. Hier war bisher einer der Anführer des Aufstandes, der Dichter Kondrati Rylejew, untergebracht gewesen. „Ich trat wie in ein Heiligthum, fiel auf die Knie und betete für ihn, für seine Frau und seine Tochter, denen er hier in diesem Gefängnis soeben seinen letzten Brief geschrieben hatte. Aus dem zinnernen Trinkgefäße des Gefängnisses stärkte ich mich mit dem Reste seines letzten Trunkes.“9
Peter-Paul-Festung in St. Petersburg
Gegen fünf Uhr früh schritten die fünf zum Tode Verurteilten mit ihren schweren Ketten an den Füßen aus der Festungskirche zum Galgen: Kondrati Rylejew und Piotr Kachowski vom Nordbund, Pawel Pestel, Sergej Murawjow-Apostol und Michail Bestuschew-Rjumin vom Südbund. Bis auf den sehr jungen Bestuschew-Rjumin sahen alle der Hinrichtung gefasst entgegen. Nachdem sie sich voneinander verabschiedet hatten, wurden ihnen die Totenhemden und Kapuzen übergezogen und die Hände gebunden. Die Musiker des Pawlowschen Regiments begannen zu spielen. Als aber die Bank, auf der die Delinquenten standen, umgeworfen wurde, blieben nur Betuschew-Rjumin und Pestel am Galgen hängen. Bei den drei anderen waren die nassen Stricke an den Kapuzen abgerutscht. Murawjow-Apostol, der sich beim Sturz in die Grube den Fuß gebrochen hatte, soll gerufen haben: „Armes Rußland! Bei uns versteht man nicht einmal zu hängen!“10 Der die Hinrichtung kommandierende Generalgouverneur Pawel Kutusow ließ die drei Überlebenden zum zweiten Mal aufhängen.
In der folgenden Nacht sollten die Leichen zur Wassili-Insel gebracht werden. Sie sind wahrscheinlich in einer Grube am Ufer der Finnischen Meeresbucht begraben worden.
9 Andrej Rosen, Seite 117-118
10 Memoiren von Iwan Jakuschkin in: Ernst Schultze (Hrg): Aus der Dekabristenzeit, Hamburg 1907, Seite 134
2 Die Widersprüchkeit Katharinas II.
Auf Wunsch der Zarin Elisabeth (1709-1762) heiratete Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst (1729-1796) im Jahre 1745 den in Kiel geborenen Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorf (1728-1762), den Enkel Peters I. (der Große)11. Die ehrgeizige Prinzessin Sophie, die mit knapp 15 Jahren nach St. Petersburg kam, lernte rasch die russische Sprache und integrierte sich in das russische Hofleben. Sie erhielt nach der orthodoxen Taufe den Namen Jekaterina Alexejewna.
Ihr Gatte, der in Russland Großfürst Pjotr Fjodorowitsch genannt wurde, bewunderte den preußischen König Friedrich II. und ermöglichte nach Elisabeths Tod als Zar Peter III. das Überleben Preußens im 'Siebenjährigen Krieg'. Durch seine Parteinahme für Preußen fand dieser 'Erste Weltkrieg' sein Ende.
Anders als seine Frau schätzte der eigenwillige Zar das Hofleben nicht, sondern hielt sich am liebsten unter seinen holsteinischen Offizieren auf. Schon bei seiner Thronbesteigung erwies sich der neue Zar12 großmütig und amnestierte die politischen Häftlinge. Als aufgeklärter Reformer erließ er in seiner halbjährigen Regierungszeit etwa 200 Gesetze. So wurde die Folter verboten, die Geheimpolizei aufgelöst, Gerichtsverfahren sollten öffentlich werden. Er kündigte die Bauernbefreiung an. Die Kirchengüter kamen in staatlichen Besitz. Dort erwarteten die Leibeigenen als Staatsbauern bessere Lebensbedingungen.
Peter III. hat m. E. nicht das negative Bild verdient, das viele Historiker von ihm zeichnen. Zu dieser nachteiligen Bewertung haben sicherlich seine Nachfolgerin Katharina II. und ihr Umfeld beigetragen. Sie konnte den Machtkampf gegen ihren Mann gewinnen.13
Denkmal von Zar Peter III. von 2014 vor dem Kieler Schloss
Nachdem Katharina im April 1762 einen Sohn von ihrem Geliebten Grigori Orlow zur Welt gebracht hatte, der eine Gefahr für den von Peter als Sohn anerkannten Paul, den vorgesehenen Thronfolger, darstellte, gab es Gerüchte, dass sich Peter III. scheiden lassen und seine Geliebte Elisabeth Woronzowa zur Zarin ernennen würde. Am 28. Juni 1762 wagte Katharina den Staatsstreich. Sie ließ ihren Mann in Oranienburg durch bestochene Gardeoffiziere verhaften und eine Abdankungsurkunde unterschreiben. Ob seine anschließende Ermordung durch die Brüder Orlow mit Katharinas Zustimmung erfolgte, lässt sich nicht klären.
Obwohl der Sohn Paul der rechtmäßige Nachfolger seines Vaters gewesen wäre, ließ sich Katharina zur Zarin krönen. Die Usurpatorin regierte Russland 34 Jahre lang und verstand es, sich in einem vorteilhaften Licht darzustellen. Sie erhielt die Titel 'Mutter des Vaterlandes' und 'die Große'.
Sie träumte davon, wie ihr Vorbild Peter der Große aufgrund von herausragenden Modernisierungen in die russische Geschichte einzugehen. Von den Ideen der französischen Philosophie begeistert, korrespondierte sie mit François Voltaire über Montesquieus Gewaltenteilung oder das Rechtssystem. Er pries sie als 'Stern des Nordens'. Den Enzyklopädisten Denis Diderot lud sie nach St. Petersburg ein, gewährte ihm Audienzen und beauftragte ihn mit der Erstellung von Schulplänen.14 Bildung und Wissenschaften sollten gefördert werden. Aber am Ende ihrer langen Herrschaftsperiode gab es nur 316 Schulen mit etwa 17.000 Schülern.15
Beunruhigende Bauernaufstände ließen sie vorsichtiger werden. Die gefährlichste Revolte begann im August 1773 unter der Führung des Don-Kosaken Jemeljan Pugatschow (1742-1775). Er setzte das Gerücht in die Welt, der angeblich vor den Mördern geflohene Zar Peter III. zu sein, der sich für die Aufhebung der Leibeigenschaft ausgesprochen hatte. Pugatschow genoss ein hohes Ansehen, da er den Bauern versprach, ihnen die früheren Privilegien und Autonomierechte zurückzugeben. An der sich ausweitenden Erhebung beteiligten sich viele (altgläubige) Kosaken,16 aber auch nichtrussische Völker wie Baschkiren, Tataren, Kasachen und Kalmücken, die sich gegen die Zwangschristianisierung wehrten. Viele Adlige wurden während dieser „sozialen Revolution“ ermordet und ihre Wohnsitze angezündet. Erst im Januar 1775 konnte Pugatschows Heer von der Armee geschlagen werden.
Jemeljan Pugatschows Urteil (Wassili Perow 1879)
Der Aufstand kosteten über 20.000 Menschen das Leben. Die Anführer wurden hingerichtet.17
Wie Peter I. unterstützte Katharina II. den Zuzug von Ausländern. Mit ihrem Einwanderermanifest von 1763 förderte sie die Gründung deutscher Kolonien an der Wolga.18 Durch finanzielle Hilfen und Vorrechte angelockt, folgten den Werbern etwa 23.000 Deutsche.19
Der baltendeutsche Graf Jacob Johann Sievers (1773-1808) hatte als Gouverneur von Novgorod grundlegende Verwaltungsreformen durchgeführt. Er stand in regem Briefkontakt mit der Zarin. Seine Reformvorschläge wurden für ganz Russland übernommen, 40 Gouvernements eingerichtet und die Stellung der Gouverneure gestärkt. Endlich war die Verwaltung im ganzen Reich vereinheitlicht, die Staatsgewalt präsenter. Sibirien verlor den Status einer Kolonie. Es gab nun zwei Gouvernements mit den Verwaltungszentren Tobolsk und Irkutsk. Auf Sievers Vorschlag wurde, nicht zum ersten Mal, die Abschaffung der Folter (1767) verkündet.20
Die Einführung der staatlichen Regelverwaltung in den bisher autonomen Kosakengebieten (Kleinrussland 1764) zwang auch hier die Bauern in die Leibeigenschaft.21 Statt als „aufgeklärte Zarin“ die von ihrem Mann angekündigte Bauernbefreiung anzugehen, verschlechterte sie die Lebensbedingungen vieler Bauern22 Jetzt durften nur noch Adlige Leibeigene kaufen. Sie konnten ohne Schollenbindung umgesiedelt werden. Weniger leistungsfähige oder widerspenstige Leibeigene konnte der Gutsherr nach Sibirien abschieben oder als Soldaten der Armee übergeben. Die gefürchtete Dienstpflicht von 25 Jahren überlebten nur wenige. 1767 nahm Katharina II. den Leibeigenen das Recht, bei Misshandlungen gegen den Gutsherrn zu klaen.23 Auch die Sendung von Bittschriften an die Zarin wurde untersagt.
Reformansätze blieben zaghaft, so wurde es z. B. lediglich verboten, Bauern öffentlich auf Jahrmärkten zu versteigern. Unter der Herrschaft der „aufgeklärten Despotin“ erreichte die Leibeigenschaft ihren Höhepunkt.24
Auch wenn der adlige Gutsherr über seine 'Seelen' verfügte, blieb eine gewisse Selbstverwaltung (Obschtschina-Verwaltung) des Dorfes bestehen. Dies war für den Staat praktisch, da die Dorfgemeinschaft (Mir) die Eintreibung der Kopfsteuer zu übernehmen hatte. In der Dorfversammlung wählten die Männern u. a. den Dorfältesten. Nach Familiengröße erfolgte immer wieder eine Umverteilung des gemeindeeigenen Landes.
Um sich die Unterstützung der Adligen zu sichern, gab Katharina II. ihnen weitere Privilegien. Sie hob 1762 die Dienstpflicht auf und stärkte die Freiheit der Selbstverwaltung. Ihre Reformträume hatte sie „den Interessen des Adels geopfert. Alles wurde dem Kalkül der Macht untergeordnet.“25 Der russische Ständestaat wurde noch undurchlässiger. Angst vor den Folgen der französischen Revolution 1789 ließ sie noch restriktiver werden.
Die Herrscherin führte eine aggressive Außenpolitik. Die ließ im Westen und Süden, von Kurland bis zur Krim, große Gebiete für Russland erobern und begann den fast 100 Jahre andauernden gnadenlosen Krieg um den Kaukasus. Die Zarin war maßgeblich an den Teilungen und der Auflösung Polens beteiligt. Durch ihre Eroberungspolitik wurden zukünftige Konflikte mit Nachbarstaaten wahrscheinlicher.26
11 Ihre Mutter war Johanna Elisabeth von Holstein-Gottorf. Sophie heiratete also ihren Cousin 2. Grades. Die beiden trafen sich zum ersten Mal 1739 im Eutiner Schloss.
12 Die offizielle Bezeichnung ab dem Jahr 1721 ist Imperator oder Kaiser. Ich benutze den seit 1478 üblichen Begriff Zar, da er vom russischen Volk weiter verwendet wurde.
13 „(...) man darf Katharinas Memoiren nicht einfach als Erinnerungen lesen, sondern in erster Linie als politisches Pamphlet. Es wurde geschrieben, um das eigene Handeln zu rechtfertigen, die Widersacher zu diskreditieren und den Gemahl rückblickend satirisch und grotesk darzustellen.“ Alexander Mylnikow: Pjotr III., Moskau 2002 (Russisch). Zitiert nach: Der Kieler Zarenverein (Hrg): Festschrift anlässlich der Denkmalaufstellung für Zar Peter III. von Rußland zugleich Herzog von Holstein-Gottorf im Kieler Schlossgarten am 13. Juni, Kiel 2014, Seite 25
14 Seine Schulpläne lehnte sie schließlich als nicht zeitgemäß ab. Auch seine Forderungen nach Volkssouveränität statt absolutistischer Monarchie, nach einem einheitlichen Rechtssystem und nach mehr Freiheit fanden keine Berücksichtigung.
15 Heiko Haumann: Geschichte Russlands, München 1996, Seite 272
16 Kosaken ('freie Krieger') lebten in Gemeinschaften freier Reiterverbände. Hier konnten auch geflohene Leibeigene und Sträflinge unterkommen. Viele ihrer Siedlungen lagen in den südlichen Steppengebieten Russlands und der Ukraine. Sie bekämpften z. B. die Krimtataren und spielten eine wichtige Rolle bei den russischen Eroberungen des Nordkaukasus' und Sibiriens.
17 Alexander Puschkin schrieb die 'Geschichte des Pugatschowschen Aufruhrs' und die Novelle 'Die Hauptmannstochter'.
18 Michael Schippan und Sonja Striegnitz: Wolgadeutsche, Berlin 1992, Seite 21
19 Ebenda, Seite 22. Vor Ort waren viele Siedler enttäuscht, z. B. durch die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und den Zwang, nur als Bauern arbeiten zu dürfen. Eine Rückkehr war kaum möglich.
20 Sievers verfasste auch eine Denkschrift über die Verbesserung der Zustände in den Gefängnissen (1779).
21 Die Verfügungsgewalt eines Leibherren über einen Leibeigenen seit seiner Geburt. Zar Peter I. hatte 1723 dafür die gesetzliche Grundlage fixiert.
22 1797 hatte Russland 36 Mio. Einwohner. Davon waren 24 Mio. Bauern: 57% Gutsbauern, 43% Staatsbauern. Siehe Heiko Haumann, Seite 277
23 Die übliche Prügelstrafe durfte nicht zum Tod führen.
24 Katharina II. verschenkte gerne Staatsbauern an ihre Günstlinge.
25 Hans-Heinrich Nolte: Kleine Geschichte Russlands, Stuttgart 2012, Seite 125
26 Um ihr Ansehen zu steigern, gab die Zarin Unsummen für den Bau von Schlössern und für den Aufkauf von Gemäldesammlungen ( heute Eremitage) aus.
3 Radistschews 'Reise von Petersburg nach Moskau'
Der Schriftsteller Alexander Radistschew (1749-1802), Verfasser des Buchs 'Reise von Petersburg nach Moskau', war einer der schärften Kritiker der Autokratin Katharina II. und sein Werk hatten großen Einfluss auf die Dekabristen.
Alexander Radistschew, Sohn eines Grundbesitzers, wurde von Privatlehrern und Professoren der Moskauer Universität unterrichtet, bevor er mit 15 Jahren in das von Katharina II. gegründete Petersburger Pagenkorps eintrat. Die Zarin schickte ihn mit elf weiteren Adligen zum Jura- und Sprachstudium nach Leipzig.27 Hier lernte er die Werke der französischen Aufklärer Jean-Jacques Rousseau, François Voltaire und Claude Helvétius kennen.
Nach dem Studium kehrte er nach St. Petersburg zurück, begann die vorgesehenen Beamtenlaufbahn und stieg zum Direktor des Zollamts auf.
In dem harmlos klingenden Roman 'Reise von Petersburg nach Moskau' versuchte er, seine tiefgreifende Kritik an den bestehenden Verhältnisse unter Katharina II. an der Zensur vorbei zu veröffentlichen. In Moskau erhielt er keine Erlaubnis, aber in St. Petersburg hatte er Erfolg. 1790 stellte er im Eigendruck in seiner Wohnung 650 Exemplare her. 25 Exemplare kamen in den Buchhandel und waren sofort vergriffen.28 Der 'Reiseroman' erregte Aufsehen, Abschriften gingen von Hand zu Hand bis nach Sibirien.29 Alle bedeutenden Schriftsteller und viele liberal eingestellte Persönlichkeiten dieser Epoche haben diese 'beißende Satire' gelesen.
Das Buch ist keine Reisebeschreibung, auch wenn der Autor die Poststationen bis Moskau als Überschriften verwendet. Das Ziel des Aufklärers ist es, die unverstellte, bedrückende Wirklichkeit Russlands kritisch darzustellen, um so einen Weg zur Überwindung der unhaltbaren Zustände zu zeigen.
Die Reise in einer Kibitka30 ermöglicht eine Folge von Begegnungen mit Menschen aus allen Schichten. Dabei erzählt er Geschichten und und gibt seine eigenen Gedanken wieder. In seiner einleitenden Widmung schreibt Radistschew: „Ich blickte um mich und die Leiden der Menschheit verwundeten wie mit Schlangenbissen meine Seele. Ich kehrte den Blick in mein Inneres und erkannte, daß die Not des Menschen vom Menschen selbst kommt und oftmals nur daher, daß er die Dinge in seiner Umwelt nicht gerade ansieht.“31
Alexander Radistschew (um 1790)
Von den Ideen der französischen Revolution befeuert, ist sein Buch eine leidenschaftliche Anklage gegen die Not des Volkes, die Verweigerung des Naturrechts auf Freiheit.
Radistschew ist in der russischen Literatur der erste, der das Ende der Selbstherrschaft und die Aufhebung der Leibeigenschaft fordert.32
Der Reisende hat unterwegs einen Traum: „Mir träumte, ich sei Zar, Schah, Khan, König, Bei, Nabob, Sultan (…). Mein Sessel war aus reinem Gold und so kunstvoll mit verschiedenen Edelsteinen ausgelegt, dass er in tausend Strahlen leuchtet. Nichts kam dem Glanz meiner Gewänder gleich. Mein Haupt schmückte ein Lorbeerkranz (...). Allenthalben sah man meinem Namen, vom Genius des Ruhms getragen (...). In banger Ergebenheit scharten sich die Reichsstände um meinen Thron und harrten meiner Winke.“33
Katharina II., die Radistschews 'Reise' gelesen hatte, war empört über die scharfe Ironie, mit der ihre Günstlingswirtschaft hier dargestellt war und kommentierte in einer Randbemerkung: “Diese Seiten sind mit grober Schimpferei und Böswilligkeit bedeckt. Dieses Kapitel zeigt zur Genüge die Absicht, die der Niederschrift des ganzen Buches zugrunde lag.“34
Getroffen hat sie auch Radistschews Anspielung auf ihre bekannte Behauptung, der Begriff Slawen (Slawa) leite sich von dem Wort Ruhm her. „Und wir Söhne der Slawa, das heißt Söhne des Ruhms, der unseren Namen und die Kunde unserer Taten zu allen Bewohnern der Erde trug, wir ließen uns durch diese finstere Unwissenheit niederschlagen und nahmen diese Sitte (der Sklaverei) an; zu unserer Schande (...). Bis auf den heutigen Tag sind die Ackerbauern unter uns Sklaven; wir erkennen sie nicht als gleichberechtigte Mitbürger an, wir haben vergessen, daß sie Menschen sind.“35
Auch zu diesem Absatz schrieb die Zarin eine Anmerkung: „Hier wird im lächerlichen Sinne über die Glückseligkeit gesprochen und zu verstehen gegen, daß es sie nicht gibt; das dient hier als Einleitung zu dem, was der Verfasser über die unfreie Lage der Bauern und über die Soldaten sagen will, die in der Unfreiheit leben müssen, um Ruhe und Ordnung zu erhalten, das soll die Bauern gegen die Grundherren und die Truppe gegen ihre Vorgesetzten aufwiegeln.“36 Der Reisende prangert auch Katharinas II. 1769 erlassenes Klageverbot für Leibeigene an. „Doch im Gesetz ist der Bauer tot, sagten wir. Nein, nein, er lebt, er wird leben, wenn er es will.“37
Hierzu die Randnotiz der Zarin: „Das sind Äußerungen, wahrhaftig nur eines Aufruhrs würdig.“38
In dem Buch wird mit vielen Argumenten auch die Abschaffung der Zensur verlangt. „Dem Verstand, dem Witz, der Phantasie, den Schöpfern alles Großen und Schönen hat man die Zensur als Kinderfrau beigegeben.“39 Er zitiert aus Johann Gottfried Herders Schrift 'Vom Einfluß der Regierung auf die Wissenschaft und der Wissenschaft auf die Regierung': „Das leichteste Mittel, das Gute zu fördern, ist das Nichthindernis, die Erlaubnis, eine gute Sache zu treiben, die Gedankenfreiheit. Alle Inquisition ist dem Reich der Wissenschaft schädlich. (…) Nur Tyrannen sind argwöhnisch, nur geheime
Bösewichter furchtsam.“40 Die Reaktion Katharinas II. auf Radistschews Spott war eine drastische Verschärfung der Zensur.
Der Held des Buches begegnet auch den Missständen im Militärwesen. Als er mit seiner Kibitka in die Poststation von Gorodnja einfährt, hört er schon von weitem die Klageschreie bei einer Rekrutenaushebung für den 25jährigen Militärdienst. Der Verkauf von leibeigenen Bauern war ein gutes Geschäft für ihre adligen Besitzer. Die nicht so vollkommen abhängigen staatsleibeigenen Bauern konnten sich vom Militärdienst freikaufen. Die Verkauften rückten an ihre Stelle. Der Schriftsteller lässt eine Pilgerin über die Zustände berichten, die während der Kriegsführung herrschen. „Mein Feldherr, den ich auf Eroberungen geschickt hatte, schwelgte in luxuriösen Vergnügungen. Dem Heer fehlte jede Disziplin. Meine Krieger wurden geringer geachtet als das Vieh. Man sorgte weder für ihre Gesundheit noch für ihre Ernährung; ihr Leben galt als wertlos. (…) Mehr als die Hälfte der Soldaten starb infolge der Nachlässigkeit ihrer Vorgesetzten oder infolge ihrer unnötigen und unangebrachten Härte.“41
Auf dem Friedhof der Poststation Jashelbizy hört der Reisende eine Klagerede über lockere Moral. „Sie will ungestört in der eigenen Größe schwelgen und in ihrer Wollust versinken.“42 Katharina II. wird diese versteckte Kritik an ihrem hemmungslosen Privatleben mit 21 namentlich bekannten Geliebten darin bestärkt haben, für den Autor der 'Reise' die Todesstrafe zu fordern.
Die umstürzlerische Gesinnung Radistschews zeigte sich am klarsten in seinen 'Oden an die Freiheit', die nicht nur scharf anklagen, sondern zu Aufstand und Zarenmord auffordern:
„Die Quelle aller großen Taten,
Des Himmels köstlichstes Geschenk,
Erlaub, o Freiheit, daß ein Sklave
In einer Ode dein gedenk.
O laß mein Herz von dir erglühen
Und es durch deine Kraft erblühen,
Brich ab des Sklaventumes Nacht,
Laß Tell und Brutus nochmals wecken,
Ergreif die Macht und laß erschrecken
Vor deinem Wort der Zaren Macht. (…)
Ein Heer der Rächer wird erstehen,
Die, von der Hoffnung jäh entflammt,
Dereinst die Schande tilgen werden
Im Blut des Quälers allesamt.
Ich sehe scharfe Schwerter glänzen
Und alle Arten Tod umkränzen
Das stolze Haupt, den halben Gott.
Frohlockt, Gefesselte und Knechte:
Man führt kraft angebor'nem Rechte
Den Zaren selbst auf das Schafott.“43
Nach der Lektüre ließ Katharina II. den Autor am 30. Juni 1790 verhaften und in die für politische Gefangene vorgesehene Peter-Paul-Festung sperren, in der 35 Jahre später auch die Dekabristen auf ihr Urteil warteten. Für die Zarin war Radistschew gefährlicher als Pugatschow. Wie von ihr gewünscht, erhielt er nach einem erniedrigenden Prozess die Todesstrafe. Anlässlich der Feiern zum Sieg über Schweden hob sie das Todesurteil auf und verbannte ihn für 10 Jahre nach Sibirien. Durch die Fürsprache seines ehemaligen Vorgesetzten Graf A. P. Woronzow wurden ihm die Ketten abgenommen. Seine Frau folgte ihm in die Verbannung.
Nach dem Tod Katharinas II. amnestierte der neue Zar Paul I. die politischen Häftlinge und Radistschew konnte ab 1797 unter Polizeiaufsicht auf seinen Gütern leben. Graf Woronzow sorgte dafür, dass der ausgebildete Jurist 1801 in die Gesetzeskommission des liberal erzogenen Zaren Alexander
I. berufen wurde. Die von Radistschew mit großem Engagement verfassten Denkschriften und Gutachten zur Gesetzgebung wurden aber als zu radikal angesehen und fanden keine Zustimmung. Diese misstrauische Ablehnung entmutigte ihn endgültig, und er wählte am 11. September 1802 als Zeichen des Protestes den Freitod.
Alexander Herzen (1812-1870), russischer Schriftsteller und Kritiker des zaristischen Russlands, druckte 1858 im Londoner Exil als erster die 'Reise'. Er schrieb über die Wirkung des Werks auf die Dekabristen: „In allem, was er (Radistschew) schrieb, hören wir den vertrauten Klang, der uns aus den ersten Versen Puschkins entgegentönt, den wir in den 'Gedanken' Rylejews (gemeint ist der Dekabrist Rylejew) vernehmen und der wie der Schlag unseres eigenen Herzens ist. Seine Tränen, sein Zorn, sein Mitgefühl, seine Ironie, sein glühendes Racheverlangen - das sind wir selbst, wir Dekabristen und unsere Träume.“44
Auch Wladimir Lenin ordnete Radistschew in seine Interpretation russischer Revolutionsgeschichte ein: „Wir sind stolz darauf, daß dieser Unterdrückung aus unserer Mitte, aus der Mitte unseres großrussischen Volkes Widerstand geboten wurde, daß unser Volk einen Radistschew, die Dekabristen und die revolutionären Rasnotschinzy45 der siebziger Jahre hervorbrachte.“46
Alexander Radistschews 'Reise von Petersburg nach Moskau' (1790) Dekabristenmuseum Tschita
27