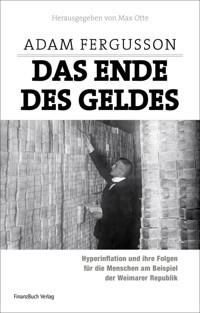2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ökonom, Investor, Unternehmer und bekannter »Krisenerklärer « (Handelsblatt) – Max Otte ist all das. Nun macht er sich in diesem Buch auch auf die Suche nach sich selbst. Es zeichnet die Herkunft und Ursprünge eines visionären Denkers nach. Was hat ihn geprägt und befähigt, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen? Wie funktioniert sein Kompass? Er spricht über seine Kindheit, seine Eltern, die Großeltern und die Menschen, die ihn beeinflusst haben. Über seine mennonitischen Vorfahren mütterlicherseits, Flucht und Vertreibung in Vaters Familie, seine Lehrer und die Zeiten, in denen er aufgewachsen ist. Wie all das einen Menschen prägt, erzählt er in diesem sehr persönlichen Buch. Max Otte will sie mitnehmen auf Die Suche nach dem verlorenen Deutschland. Entdecken Sie, welche Schätze unsere Erinnerung zu bieten haben. Wenn wir sie heben und bewahren, geben sie uns Kraft für die Gegenwart und weisen in die Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Ähnliche
Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland
Notizen aus einer anderen Zeit
Max Otte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Originalausgabe, 2. Auflage 2021
© 2021 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Matthias Michel
Korrektorat: Silvia Kinkel
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: shutterstock.com/Hane Street
Abbildungen Inhalt: S. 17: © Marcus Kaufhold, 2011; S. 38: © Boston University, Photography Department, S. 100, 101 und 103: © Toni Meyer; S. 132: © Dietmar Krüger S. 163: © Telefunken; S. 164: © ullstein bild/00270844; S. 168: © Benjamin Balsereit; S. 191: © Jean Nicolas Ponsart/Wikimedia Commons; S. 225: © ullstein bild/00819767; S. 252: © 1954 Getty Images; S. 253: © picture alliance/dpa
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-403-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-749-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-750-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Was man an seinen Muskeln versäumt hat, holt sich später noch nach; der Aufschwung zum Geistigen, die innere Griffkraft der Seele dagegen übt sich einzig in jenen entscheidenden Jahren der Formung, und nur wer früh seine Seele weit auszuspannen gelernt, vermag später die ganze Welt in sich zu fassen.
STEFAN ZWEIG,DIE WELT VON GESTERN (1942)
Inhalt
Prolog
Der Seher
Der lange Weg zurück
Into the Great Wide Open
Von der Welt …
… in die Provinz
Die Sippe
Mein Vater
Ernst und Emilie Otte – und Onkel Gustav
Familiengeschichten
Mein Bruder
Meiner Mutter Land und Stamm
Eine andere Welt
Die Straße
Das Dorf
Die Stadt oder: Was hat Plettenberg mit Berlin zu tun?
Jugend
Erwachen
Die Überlieferung
Geschichten und Geschichte
Meine Bibliothek
Gedichte und Lieder
Die Landschaft
Mein Mikrokosmos
Die Glocken von Eifeldorf
Der Hauptort
Das Freibad oder die Entdeckung des Mutes
Von Gärtnern und Jägern
Die Mittelgebirge, der Wald
The Rise of the Giant Windmills
Das Land
Ökosysteme, Verdrängungsprozesse und Zeigerpflanzen
Die letzten Kneipen
Der Männerchor
Selbsthilfevereine
Die Bäckerei
Charakter und Ethik
Was hat die Kirmes mit öffentlichen Gütern zu tun?
Unsere Idole verblassen
Die Nebel von Avalon
Der letzte Deutsche
Tagebuch-Eintrag
Coda
Anhang I – Augsburger Allgemeine Zeitung: Porträt Max Otte
Anhang II – Anmerkungen
Prolog
In den 1960er-und 1970er-Jahren des letzten Jahrhunderts waren die Doors und besonders ihr 1971 verstorbener Frontmann und Songwriter Jim Morrison eine Legende und Inspiration für unzählige, meist junge Menschen. Auch heute noch sind sie das, aber es haben sich doch mehr als vierzig Jahre dazwischengeschoben. Die Unmittelbarkeit, die wir als nur ein paar Jahre zu spät Gekommene noch gespürt haben, verblasst.
Der charismatische, exzentrische Morrison war ein echter Rockpoet, einer, der das Mysterium suchte. Äußerst belesen in Philosophie und Literatur und stark beeinflusst von Friedrich Nietzsche war er. Seine Bühnenauftritte gerieten zu magischen Beschwörungen des Seins – wenn er gut drauf war. Gewann seine dionysische Seite die Oberhand, die sich in Alkohol- und Drogenexzessen manifestierte, war er nicht zu gebrauchen.
Morrisons Texte sind tief, sie bringen uns dem Bewusstsein um die Zerbrechlichkeit und dem Mysterium unserer Existenz näher. In Palace of Exile(Palast des Exils)[1] von 1968 lässt er einen imaginierten Anführer eine Ansprache an seine Gefolgschaft richten. Sieben Jahre lang habe er, der Sprecher, im weiträumigen Palast des Exils gelebt. Und nun sei er zurückgekommen, »in das Land der Aufrechten, und der Starken, und der Weisen«.
Er fragt seine Brüder und Schwestern vom blassen Wald, die Kinder der Nacht, ob sie mit der (Hetz-)Jagd laufen wollen. Und dann weist der Anführer seine Schar an, sich zu ihren Zeiten und zu ihren Träumen zurückzuziehen, denn morgen betreten sie gemeinsam die Stadt seiner Geburt. Dafür will er bereit sein.
*
Die Rückkehr zur Stadt der Geburt. Sich seinen Wurzeln stellen. Ein Akt, der tief in den Grund der eigenen Existenz blicken lässt. Wenn man den dafür notwendigen tiefen Blick hat. Vielleicht auch die Vorbereitung auf eine neue Phase. Oder das Ende. Morrison lässt uns mit all diesen Gedanken spielen.
In meinen knapp sechzig Jahren habe ich bereits mehrere Leben gelebt. Im Moment befinde ich mich so ungefähr in meinem vierten – dem des Aktivisten und Philanthropen, der sein Unternehmerdasein langsam zurückfährt. In diesem Buch kehre ich zum Ursprung zurück. Zum ersten Leben. Ich will bereit sein.
Der Seher
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt fängt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.
JOSEPH VON EICHENDORFF,WÜNSCHELRUTE (1835)
Man hat mich Deutschlands erfolgreichsten Crash-Guru aller Zeiten genannt.[2]Kassandra aus Worms. Krisenerklärer. Renommierten Krisenökonomen. Seher. Prediger. Börsenprofessor. Anwalt der Bürgerinnen und Bürger.[3] Davon gefällt mir Seher am besten. Propheten und Seher geben nicht nur Zukunftsprognosen ab. Sie deuten seit jeher auch die Gegenwart. Die An-Schauung: Das ist meine Aufgabe. Ich sehe Dinge, die andere nicht sehen. Und ich sehe Dinge, die vermeintlich alle sehen, die allen bekannt sind, in einem anderen Licht.
Wie gesagt, die An-Schauung ist meine Aufgabe. Dabei greife ich auf altes Wissen zurück, Wissen, das nach und nach in Vergessenheit zu geraten droht. Dass ich dieses Wissen auch nutzen kann, um an der Börse viel Geld zu verdienen, habe ich bewiesen. Dass mir dieses Geld nichts bedeutet, nehmen mir nur wenige ab. Aber so ist es.
Manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie der alte Zauberer Merlin, eine der Hauptfiguren in Die Nebel von Avalon.1 Der Fantasyroman von Marion Zimmer Bradley rund um die Artuslegende war in den frühen 1980er-Jahren ein Megaseller. Zusammen mit den Priesterinnen Viviane und Morgaine versucht Merlin, die alte Welt der Druiden zurückzuholen, die unweigerlich mit der Insel Avalon im Nebel zu versinken droht. Ihr Hoffnungsträger ist der zukünftige König Artus, den sie nach der alten Weise ausbilden und formen wollen.
Immer weniger kennen die Zauberworte, die für die Überfahrt nach Avalon notwendig sind. Immer weiter verschwindet die Insel im Nebel. Immer schwerer wird der Zugang. Immer angestrengter und verzweifelter gestalten sich die Bemühungen von Merlin, Viviane und Morgaine. Am Ende sind alle Anstrengungen vergebens: Avalon ist unwiederbringlich verloren. Eine neue Zeit bricht an.
Auch wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters. Kaum ein Stein wird auf dem anderen bleiben. In meinem Buch Weltsystemcrash aus dem Jahr 2019 beschreibe ich, wie die alte Weltordnung unter dem Druck geopolitischer Verwerfungen, des Abstiegs der Mittelschicht und der Überschuldung der Welt in Folge einer hemmungslosen Geldpolitik der Notenbanken bröckelt.[4] Fake News und Desinformation, Überwachungsstaat und Repression läuten die Geburt einer neuen Zeit ein.
Hätte ich doch genauer hingesehen! Vielleicht hätte ich dann schon erkannt, dass es ein Virus sein wird, das die neue Ära einleitet. Es gab mit SARS, der Vogel- und der Schweinegrippe und mit Ebola etliche Vorboten. Bereits vor einem Jahrzehnt entwickelte die Rockefeller-Stiftung ein Szenario,2 in dem eine in China ausgebrochene Virus-Pandemie zum »Gleichschritt« und zu drastischen Beschränkungen der Freiheit führt: Die Wirtschaft bricht dramatisch ein, die internationale Mobilität von Personen ist stark eingeschränkt, globale Lieferketten sind unterbrochen, Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Nachdem der Westen zunächst einen eher lockeren Ansatz zur Pandemiebekämpfung verfolgt hat, merken die Politiker, dass die autoritäre chinesische Methode besser funktioniert. Der eifern sie nun nach und regieren selbst zunehmend autoritär. Obwohl Gegenwehr aufkommt, begrüßt die Mehrheit der Bevölkerung dieses Vorgehen und die verstärkt autoritäre Herrschaftsform hält sich nach der Pandemie.
Die Welt ist fest im Griff von COVID-19. Es wird Krieg gegen das Coronavirus geführt; die letzten Reserven werden mobilisiert. Auch das Bombardement der Medien mit täglich neuen Infektionszahlen erinnert an Kriegspropaganda. Politiker schränken die Versammlungsfreiheit ein und schalten die Wirtschaft ab. Das »Durchregieren« am Parlament vorbei ist auf dem Vormarsch und wird mit dem »Bevölkerungsschutzgesetz« vom 19. November 2020 neue Normalität.
Klaus Schwab, Initiator des Weltwirtschaftsforums in Davos, und der Ökonom Thierry Malleret legen ein Buch mit dem Titel COVID19 – der große Umbruch vor. Darin schreiben sie, dass wir uns mit mehr Überwachung abfinden sollen und »social distancing« uns wohl erhalten bleiben wird.3 Der Titel der gleichzeitig erschienenen englischen Ausgabe – The Great Reset – scheint zutreffender. Zwar fügen die Autoren beschönigend hinzu, dass wir aufpassen müssen, nicht in eine Dystopie zu geraten, aber aktive Ansätze, das zu verhindern, finden sich nicht. Im Gegenteil. Das Szenario der Rockefeller-Stiftung scheint Wirklichkeit zu werden. Wahrhaftig, die Welt ist im Wandel!
Eigentlich fing es 1989 mit dem Kollaps der Sowjetunion und des kommunistischen Machtblocks sehr vielversprechend an. George Bush rief 1990 in einer Rede kurz nach Ausbruch des ersten Irakkrieges die »neue Weltordnung« aus. Eine breite internationale Koalition bereitete sich darauf vor, der Annexion von Kuweit durch den Irak entgegenzutreten. Alles sah so aus, als ob wir einer neuen, friedlichen Zeit entgegengehen würden. Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sprach gar vom »Ende der Geschichte«. Die wesentlichen politischen Fragen seien gelöst, und die Menschheit könne sich in Frieden weiterentwickeln.4 Aber schon zehn Jahre später befand sich der »Westen«, angeführt von den USA, im »Krieg gegen den Terror«. Seitdem hat uns der Ausnahmezustand nicht mehr losgelassen. Vieles erinnert eher an den »Kampf der Kulturen«, den der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington 1996 vorausgesagt hatte.5
Wenige überblicken das ganze Ausmaß der aktuellen Katastrophe. »… ich fühle mich einsamer als je, nicht etwa wie unter Blinden, sondern wie unter Leuten, die ihre Augen verbunden haben, um den Einsturz des Hauses nicht zu sehen, während sie mit ihren Hämmerchen daran hantieren«, schrieb der Kulturphilosoph Oswald Spengler 1932, ein Jahr vor der »Machtergreifung« Hitlers und sieben Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.6
Das Haus wackelt. Das war abzusehen. Aber viele, ja die meisten, wollten und wollen das nicht sehen. Sie verdrängen unangenehme Fakten oder ordnen sie schnell in Erklärungsmuster ein, die uns von den Medien geliefert werden. Problem erledigt. Zurück zum Tagesgeschäft. Ja, so einfach machen es sich viele Menschen, um nicht nach den tiefer liegenden Ursachen suchen zu müssen. Das Phänomen ist auch als »kognitive Dissonanz« bekannt.7
Ich verschließe meine Augen nicht vor der gegenwärtigen Katastrophe. Ich suche nach Ursachen – und nach Lösungen. Aber ich kenne auch noch das Zauberwort zur alten Welt. Ich sehe die Gegenwart sehr deutlich, gerade weil ich jederzeit in diese andere Welt reisen kann. Dort tanke ich Kraft. In diese Welt möchte ich Sie mitnehmen, in das vergangene, ja oft vielleicht schon verlorene Deutschland. Skizzen sind es, Momentaufnahmen aus einer anderen Zeit, einer Zeit, die in die unsere noch hineinragt.
Das ist nicht nur Nostalgie. Nur wenn wir uns vor Augen führen, wie es einmal war, schärft sich auch unser Blick für die Gegenwart. Und für die Zukunft.
In der Vergangenheit liegen Schätze. Wenn wir sie heben und bewahren, geben sie uns Kraft für die Gegenwart und weisen in die Zukunft. Vor einigen Jahren vertrieb ich mir in einer Flughafenbuchhandlung die Wartezeit und entdeckte das wundervolle Buch Lost Japan – Last Glimpse of Beautiful Japan(Verlorenes Japan – Der letzte Blick auf das schöne Japan).8 Sein Autor Alex Kerr hat darin Blicke auf ein Japan und eine japanische Landschaft festgehalten, die heute nur noch in ganz wenigen Resten existieren: die alten Wälder, die der Axt weichen mussten, die Sitten bei traditionellen Familien in Kyoto, Frauen im traditionellen Kimono und Performancekünste, die heute nur noch von ganz wenigen beherrscht werden, altes Kunsthandwerk.
Kerrs Buch hat mich inspiriert, etwas Ähnliches für Deutschland zu versuchen. Auch unser kulturelles Erbe ist bedroht – der Mittelstand, unsere letzten Handwerksbetriebe, die Volks- und Kirchenfeste, die Vereine, die Kneipen, die Lieder. Bereits wer Volkslieder singt, läuft Gefahr, diffamiert zu werden. So ist es nicht verwunderlich, dass sich das größte Archiv deutscher Volkslieder mit fast vierhunderttausend erfassten Liedern in Kanada befindet und privat von Hubertus Schendel, einem Auswanderer aus Thüringen, betrieben wird.9
Wie könnte ich besser auf unser kulturelles Erbe hinweisen, als von der Zeit zu berichten, in der ich groß geworden bin? Von den Menschen, die mich geprägt haben: meiner Familie, meinen Lehrern, meinen Idolen. Von den Büchern, die ich gelesen, den Liedern, die ich gesungen habe.
Vieles davon liegt kein halbes Jahrhundert zurück und scheint doch zu einer anderen Zeit und Welt zu gehören. Aber genau das war unser Nachkriegsdeutschland, die Bundesrepublik, das »Modell Deutschland«, wie es die SPD im Jahr 1976 auf Wahlplakaten verkünden ließ. Es war die nivellierte Wohlstandsgesellschaft. Zugegeben: Manchmal war sie etwas langweilig und eng. Aber human und zivil. Das Grundvertrauen zwischen den Menschen war eine solide Basis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Umgang – auch zum Beispiel zwischen dem SPD-Bürgermeister, meinem in der CDU aktiven Vater und dem DKP-Spitzenkandidaten, die alle in unserer Straße wohnten. Ich gehöre dem geburtenstärksten Jahrgang der Bundesrepublik an. Wer, wenn nicht ein Angehöriger dieses Jahrgangs könnte über diese Zeit berichten?
Im ersten Kapitel, Der lange Weg zurück, schildere ich im Zeitraffer meine berufliche Laufbahn – wie es mich aus dem sauerländischen Plettenberg in die weite Welt hinauszieht, wie ich fast in die USA ausgewandert wäre und doch wieder in der Provinz, der Eifel, gelandet bin.
Im zweiten Kapitel, Die Sippe, spreche ich über meine Kindheit, meine Eltern, meine Großeltern und die Menschen, die mich zutiefst geprägt haben, von meinen mennonitischen Vorfahren mütterlicherseits und von Flucht und Vertreibung in Vaters Familie.
In Eine andere Welt berichte ich von meinem Dorf und meiner Stadt, den Lehrern und dem Erwachsenwerden.
Im Mittelpunkt von Die Überlieferung stehen Autoren, Bücher, Gedichte und Lieder, die mich besonders geprägt und mein Werden beeinflusst haben.
Die Landschaft schlägt den Bogen zu meiner neuen Heimat Eifel. Hier ragt die Vergangenheit überall in die Gegenwart hinein – seien es Geologie und Erdgeschichte, Höhlen mit prähistorischen Überlieferungen, Funde aus der Kelten- und der Römerzeit und dem Mittelalter. Auch der Zweite Weltkrieg, jene schreckliche Epoche, wird hier so lebendig wie sonst kaum auf deutschem Boden.
Das Volk befasst sich mit deutschen Eigenheiten, ob Wirtschaftsstrukturen oder Sitten und Gebräuche, von denen viele im Verschwinden begriffen sind.
In Der letzte Deutsche richte ich einen letzten Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft, auf Avalon und in die neue Zeit.
*
Mein Essay soll Ihnen Lust machen auf weitere Bücher, auf unsere reiche Tradition, auf Ihre Mitmenschen, auf unsere Landschaften – kurzum: auf das, was deutsch ist. Darauf, Deutschland neu und mit anderen Augen zu betrachten. Dabei serviere ich Ihnen – sehr undeutsch! – Tapas, kein Hauptgericht.[5]
Vielleicht haben meine kleinen Appetithäppchen ein Aha-Erlebnis zur Folge. Vielleicht beginnen Sie, im reißenden Strom der Globalisierungsideologie Strudel und Strömungen zu erkennen. Inseln, auf die man sich flüchten kann. Diese Inseln gibt es. Noch. Orte wie Avalon, wohin Merlin, Viviane und Morgaine sich zurückziehen. Und die dennoch langsam im Nebel verschwinden. Halten wir sie lebendig, solange wir können.
Augsburger Allgemeine Zeitung, Der Seher, 2011
Machen Sie sich zusammen mit mir auf die Suche nach dem verlorenen Deutschland! Lassen Sie sich von meinen Erinnerungen inspirieren, in Ihre eigene Vergangenheit einzutauchen. Entdecken Sie, welche Schätze unsere Erinnerung immer noch zu bieten hat. Vielleicht hilft uns das, die nächsten Jahre halbwegs heil an Geist und Seele zu überstehen.
Der lange Weg zurück
Es redet trunken die Ferne
Wie von künftigem, großem Glück!
JOSEPH VON EICHENDORFF, SCHÖNE FREMDE (1834)
Bald werd’ ich dich verlassen,
Fremd in der Fremde gehn,
Auf buntbewegten Gassen
Des Lebens Schauspiel sehn
(…)
Und mitten in dem Leben
Wird deines Ernsts Gewalt
Mich Einsamen erheben,
So wird mein Herz nicht alt.
JOSEPH VON EICHENDORFF,ABSCHIED (1810)
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.
JOSEPH VON EICHENDORFF, MONDNACHT (UM 1835)
Into the Great Wide Open1
Mehr als fünfzehn Jahre habe ich außerhalb Deutschlands gelebt, die meiste Zeit davon in den USA. Dann bin ich in das Land meiner Väter2 zurückgekehrt.
Bis dahin war es ein weiter Weg. In meinem Tagebuch finde ich im Januar 1981 die Einträge meines sechzehnjährigen Selbst. Ich hatte einen Entschluss gefasst: Ich wollte in die USA auswandern, um dort groß rauszukommen. Schwarz auf weiß steht es da.
Deutschland war mir zu klein. Das, was mich interessierte, die wirklich großen Dinge – wie ich damals fand –, spielte sich in Amerika ab. Da war zum Beispiel die Weltraumfahrt. Die erste Mondlandung hatte ich 1969 als Fünfjähriger zusammen mit dem Rest der Familie verfolgt, gebannt vor dem einzigen Fernseher im Haus – schwarz-weiß, versteht sich –, der bei Onkel und Tante in der Dachwohnung stand.
Später verschlang ich Indianerbücher. Das Leben des »roten Mannes«, wie es etwa Karl May empathisch schilderte, faszinierte mich, sein Schicksal berührte mich zutiefst. Auch das war Amerika. Als ich mich Jahre später entschlossen hatte, in die USA zu gehen, waren die Indianergeschichten weit weggerückt. Aber irgendwo in einem Winkel meines Gehirns hatten sie sich festgesetzt und wirkten fort.
Noch später interessierte mich vor allem die Weltpolitik. Zur Zeit meines Tagebucheintrags las ich den voluminösen ersten Teil der Memoiren Henry Kissingers. Schon damals hegte ich Zweifel, ob Deutschland jemals wieder seinen eigenen Weg finden würde und dürfte. Eingezwängt in die festen Strukturen der NATO, war und ist unser Land nur eingeschränkt souverän. Andere entscheiden darüber, ob es in Deutschland Krieg oder Frieden gibt. Damit wollte ich mich schon als Teenager nicht abfinden. Und mit Carl Schmitt, mit dem mich mein Lehrer im Philosophiekurs am Gymnasium bekanntgemacht hatte, bezweifelte ich, dass es jemals wieder anders sein würde. Zu dieser Zeit wurde auch der Kalte Krieg wieder wärmer, bevor er im »Heißen Herbst« von 1983 seinen letzten Höhepunkt erreichen sollte. Es wurde ungemütlich in Europa, die nukleare Bedrohung wieder real.
Kurz, mit aller Unbedingtheit wollte ich weg. An einer Eliteuniversität wie Harvard, Princeton oder Yale studieren. Promovieren. Professor werden. Vielleicht dann eine Karriere als Politikberater starten. Der einfachen Mittelschicht entkommen, zu der wir zumindest materiell gehörten. Der Enge entfliehen.
Ganz schön große Pläne für den Sohn eines Berufsschullehrers, den es wie viele Millionen anderer nach 1945 in den Westen verschlagen hatte und der noch das Häuschen abbezahlte, das er und die seinen in den 1950er-Jahren als neue Heimstätte für die Sippe mühsam und mit viel Eigenleistung gebaut hatten. Ich wusste, dass wir wenig Geld hatten. Ich wusste, dass ich diesen Weg alleine würde gehen müssen. Dass mir keiner würde helfen können. Aber mein Lebensplan war formuliert.
Etliche Jahre später erfuhr ich, dass es einem gewissen Arnold Schwarzenegger aus der Steiermark ähnlich gegangen war. Auch ihm war sein Heimatland zu klein, auch er hegte in jungen Jahren große Pläne, hatte Visionen von seiner Zukunft. Er wurde in seiner neuen Heimat ein Superstar. Ich nicht. Ich wurde zumindest Professor. Und dann kehrte ich in das Land meiner Väter zurück und wurde, was ich bin. Allerdings erst nach vielen Umwegen.
Im Herbst 1990 schien ich es wirklich geschafft zu haben. Vom vierzigsten Stock des UN Plaza Hotels in Manhattan aus blickte ich auf das Gebäude der Vereinten Nationen vor und das Häusermeer unter mir. Mit noch nicht ganz sechsundzwanzig Jahren hatte ich einen Beratungsauftrag bei den Vereinten Nationen an Land ziehen können und studierte seit einem Jahr mit einem heiß begehrten Promotionsstipendium an der Princeton University in New Jersey. Endlich an einer Eliteuniversität angekommen, wie ich es mir acht Jahre zuvor in den Kopf gesetzt hatte.
Als Repräsentant der deutschen Unternehmensberatung Kienbaum hatte ich einen prestigeträchtigen Auftrag zur Reorganisation der UN-Entwicklungshilfe (United Nations Development Programme) gegen beträchtliche internationale Konkurrenz gewonnen. Von Oktober bis Dezember führten mein Team und ich Interviews bei den Vereinten Nationen in New York, erstellten Analysen und diskutierten Alternativen für die Führungsstruktur der Organisation. Ich lernte führende Beamte der UNO kennen und Leiter von Sonderorganisationen wie der UNESCO.
In den wenigen Monaten, die für das Projekt veranschlagt waren, verdiente ich für meine damaligen Verhältnisse ein Schweinegeld. Richtig investiert und sparsam und zielstrebig angelegt, hätte daraus schnell ein kleines Vermögen werden können. Leider hatte ich damals weder den Charakter noch das Wissen, um etwas daraus zu machen. Im Rausch des ersten Erfolgs versuchte ich mich an allerlei ambitionierten und waghalsigen Projekten, unter anderem an Immobilienspekulationen im gerade wiedervereinigten Berlin, aus denen nichts wurde.
Sechs Jahre später war ich so gut wie pleite. Während meines Höhenflugs hatte ich ein schönes Grundstück in Idaho in der Nähe des bekannten Urlaubsortes Jackson Hole erworben; das musste ich nun verkaufen, um meine Außenstände zu bezahlen und mich so lange über Wasser zu halten, bis die Dissertation fertig war. Denn die wollte ich nach einer quälend langen Zeit, in der ich stattdessen meinen waghalsigen Geschäftsideen nachgegangen war, unbedingt fertigstellen.
*
Bis nach Princeton war es ein weiter Weg gewesen. Um die Zeit herum, als ich den Entschluss fasste, in die USA zu gehen, setzte ich mich auf den Hosenboden, damit meine durchwachsenen Schulnoten besser würden. Mit einem mittelmäßigen Abitur hätte ich meine Pläne vergessen können. Mehrfach fuhr ich auf Sprachreisen nach England und las viele englische und amerikanische Romane. Unbekannte Wörter schrieb ich mir auf. Bis heute habe ich deshalb einen in manchen Bereichen sehr reichen englischen Wortschatz, während ich manche Alltagsbegriffe, vor allem aus der Kindheit, nie gelernt habe.
Die Noten wurden besser. Sehr viel besser. In der Abizeitung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums des Jahrgangs 1983 haben Mitschüler zu jedem der einhundertundzehn Abiturienten etwas gedichtet. Für mich fanden sie recht schmeichelhafte Worte, sprachen mir ein gewisses Naturtalent für alles zu, was ich mir vornahm, dazu Vielseitigkeit und Starqualitäten. Aber sie erwähnten auch meine soziale Ader und dass ich so manchem Mitschüler geholfen hatte, durchs Abi zu kommen.
Nun war ich bereit, durchzustarten, die Welt zu erobern. Und tatsächlich ging es für mich weit weg – jedoch nicht über den großen Teich, sondern in die Lüneburger Heide. Zur Bundeswehr. Keine Chance, zu entkommen oder sich dem zu entziehen. Ich unternahm einen halbherzigen Versuch. Aber mein Hausarzt war Stabsarzt der Marine und Reserveoffizier. Er half mir zwar, nicht bei den Pionieren zu landen, zu denen ich einberufen worden war, doch ein Attest auf Wehrdienstuntauglichkeit hätte er mir sicher nicht ausgestellt. Den längeren Zivildienst wollte ich schon gar nicht machen. So bekamen die Pläne des ehrgeizigen Abiturienten ihren ersten Dämpfer.
Ein glühend heißer Sommer. Und die Grundausbildung war ganz schön hart. Sicher nicht so hart wie bei Eliteeinheiten oder wie früher, aber genug für mich. Die Lüneburger Heide habe ich aus allen Perspektiven, vor allem aber aus der Bodenperspektive kennengelernt. Dabei waren für mich die körperlichen Anstrengungen nicht einmal das Schlimmste, sondern der Kasernenhofton, das »Gehorchenmüssen«, die Gängeleien, die Schikanen. Vor allem die jungen Offiziersanwärter mit Abitur, die Karriere machen wollten, taten sich hier hervor. Die Unteroffiziere dagegen waren in der Regel umgänglicher.
Ich könnte viele Geschichten aus meinen vierzehn langen Monaten beim »Bund« erzählen. Wie ich mir zum Beispiel eine privilegierte Stellung im Geschäftszimmer als Assistent vom Spieß erkämpfte, wie einer aus unserem Zug, ein lieber, aber etwas unterbelichteter Mensch, sich und seinen Ausbilder beim Training mit scharfen Handgranaten fast in die Luft gesprengt hätte oder wie ich an einem Unteroffizierslehrgang teilnehmen konnte. Aber am Ende überwiegt doch der Eindruck einer verlorenen, dumpfen Zeit. Ich war oft niedergeschlagen, vielleicht sogar leicht verzweifelt, steckte ich doch in der Lüneburger Heide fest, während ich eigentlich meinen Lebensplan verwirklichen wollte. Heute gehört die Scharnhorst-Kaserne, in der ich stationiert war, zum Campus der Leuphana Universität Lüneburg. Vielleicht hat Richard David Precht ja sein Büro in meiner ehemaligen Stube.
Am Morgen des 27. Dezember 1983 – ich war gerade vom zu Hause verbrachten Weihnachtsurlaub wieder in der Kaserne angekommen – fragte mich mein Spieß, ob mein Vater gesundheitliche Probleme hätte. Obwohl das nicht der Fall war, ahnte ich, was kommen würde. Und ja, dann eröffnete er mir, dass mein Vater verstorben sei. Er hatte mich am Abend des zweiten Weihnachtstages noch an den Bahnhof in Werdohl gefahren. Den Zettel, auf dem er in seiner schönen Handschrift die Zugverbindungen notiert hatte, besitze ich heute noch.
Zugverbindungen, notiert von meinem Vater († 27.12.1983) am Tag vor seinem Tod
*
Was bleibt, wenn ein Mensch, der einem so nahegestanden hat, plötzlich aus dem Leben gerissen wird? Welche guten Erinnerungen? Welches Bedauern? In den letzten Jahren war mein Verhältnis zum Vater nicht das beste gewesen. Familiär-solidarisch sicher, aber nicht herzlich und offen. Ich sah vor allem den Kleinbürger in ihm. Und die Enge der Verhältnisse. Weniger das große Herz, den Familiensinn, die Willenskraft, den täglichen Heroismus, den er lebte.
Ich habe immer noch das Gefühl, dass mein Vater genau wusste, wie schlecht es mir im Winter 1983 bei der Bundeswehr ging. Dass das auch ihn belastete. Dass er aber nichts tun konnte. Später erfuhr ich, wie er im letzten Jahr des Krieges als junger Rekrut bei der Wehrmacht »langgemacht« wurde. Er musste also ein ziemlich gutes Bild davon haben, wie es mir erging. Gesprochen haben wir nicht darüber.
Immer wieder habe ich es bedauert, dass er nicht verfolgen konnte, welchen Weg ich später gegangen bin. Denn meinen Ehrgeiz habe ich von ihm. Genauso übrigens wie mein großes Herz – eine nicht immer ideale Kombination.
Sicher hätte er sich gefreut. Und er hätte mir – mit der Weisheit seines höheren Lebensalters – vielleicht einige Irrwege ersparen können. Ich erinnere mich an eine Bemerkung von ihm während unserer letzten gemeinsamen Jahre. Die Schule lief mehr als gut. Mein Nachhilfe-Geschäft brummte. Ich spielte in einer Band. »Junge, mach nicht so schnell. Du hast Zeit.« Ich dachte kurz darüber nach – und hakte es dann ab. Er behielt recht. Manchmal wäre »Eile mit Weile« besser gewesen. Ich musste Mitte dreißig werden, bis ich das verinnerlichte. Doch hätte ich es früher gemerkt, wäre ich nicht ich.
*
Ich wollte es selbst fast nicht glauben, aber nach zähen vierzehn Monaten hatte die Bundeswehrzeit ein Ende. Es ging wieder bergauf. Wirtschaft und Politik wollte ich studieren, und zwar in Köln. Das wollte ich unbedingt, denn die Bundesregierung saß damals ja in Bonn. Politik interessierte mich, die Politiknähe habe ich gesucht. Doch die ZVS (die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) hielt den nächsten Schreck für mich bereit und wollte mich nach Passau verfrachten. Die deutsche Bürokratie kann ziemlich gnadenlos sein. Aber wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Ich hängte mich rein und konnte in der Domstadt bleiben. Ich würde mich doch nicht von einem Entscheid der ZVS von meinen Plänen abbringen lassen!
Köln war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte, und eine jener Weggabelungen, die sich, wie noch mehrfach in meinem Leben, als glückliche Fügung herausstellen sollten. In den 1980er-Jahren war es noch das alte Köln, mit einem gemütlichen und weitgehend friedlichen Karneval, der die ganze Stadt erfasste, vielen Einheimischen (»Kölschen«), die ihren Sprach-Singsang pflegten, unzähligen Kneipen und einer doch recht unbeschwerten Lebensart. Köln war eine katholische Stadt mit südländischem Lebensstil, so ganz anders als das Sauerland, wo ich in einem protestantischen Milieu aufgewachsen war. Heute ist vom alten Köln nicht mehr viel übrig. Ja, man pflegt noch eine künstliche rheinische Fröhlichkeit, aber eigentlich könnte man auch in Frankfurt sein oder – Gott bewahre – Düsseldorf, und es wäre nicht viel anders.
Gleich am ersten Abend traf ich in einer Kneipe Jürgen, einen Geschichtsstudenten aus Kiel. Er wurde mein lebenslanger Freund. Kein Jahr später wurden wir beide als Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung angenommen. Wir engagierten uns in der Studentenpolitik bei den Unabhängigen, einer »unpolitischen«, serviceorientierten Gruppe, und schafften es beide ins Studentenparlament der Universität. Zwei Jahre später gingen wir zusammen in die USA, er an die University of Chapel Hill, North Carolina, ich an die American University in Washington, D. C. Jürgen ist heute Geschichtsprofessor in North Carolina. Auf der Feier meines fünfzigsten Geburtstags auf dem Petersberg bei Bonn hielt er eine launige Rede.
Es ging Schlag auf Schlag. Studium in Köln. Praktika in Unternehmen. Dabei kam das Studentenleben nicht zu kurz. Köln genießen. Freiheit. »The future was wide open.«3 Stipendium für die USA. Studium an der American University. Mit knapp zweiundzwanzig Jahren Praktikant im renommierten Institute for International Economics (heute Peterson Institute), das damals von C. Fred Bergsten geleitet wurde. Bergsten war Mitarbeiter für internationale Wirtschaftsfragen im Stab von Henry Kissinger gewesen und scherzte manchmal, dass man als Wirtschaftsberater für Kissinger ungefähr so gefragt war wie ein Sicherheitsberater für den Papst.
Aber zweifelsohne besaß er Kissingers PR-Talent und Geschäftigkeit. Sein Institut mischte in fast allen Fragen der Außenwirtschaft und der internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit. Bergsten und seine Experten waren regelmäßig im Kongress, beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank zu Gast. Sie veranstalteten internationale Konferenzen, bei denen ich Menschen wie den Krisenforscher Charles Kindleberger, den Staatssekretär für Internationales im Bundesfinanzministerium Otto Schlecht und den Wirtschaftsberater von Margaret Thatcher, Sir Alan Walters, kennenlernte. Helmut Kohl durfte ich auf einem Empfang die Hand schütteln, genauso dem damaligen US-Notenbankchef, dem legendären Paul Volker. Ich habe Fotos von beiden Begegnungen. Sie zeigen einen frühreifen, selbstbewussten, aber auch reflektierten Mann von zweiundzwanzig Jahren.
Im Gespräch mit Helmut Kohl, Washington, Herbst 1986
*
Es war eine neue Welt an der American University in Washington, D. C. Petra Kelly, Pazifistin und frühe Grünen-Ikone, hatte hier studiert. Aus den ganzen USA waren die Studenten gekommen, um hier ein »Washington Semester« zu absolvieren, das Vorlesungen zu politischen und ökonomischen Themen sowie ein Praktikum in einer Regierungsbehörde, einem Thinktank, im Kongress oder im Senat beinhaltete.
Unser Austauschprogramm war auf zwei Washington-Semester ausgerichtet. Das war geschicktes Auslandsmarketing der Uni, denn eigentlich war das Washington-Semester oder »Washington Siesta«, wie es unter den Studenten hieß, ein einsemestriges Programm. Ich sah nicht ein, dass ich mich diesen Strukturen fügen sollte. Nach etlichen Diskussionen mit dem Dekan konnte ich in den regulären Studienbetrieb wechseln.
Nach dem politisch ausgerichteten ersten Semester kam ich in den MBA-Kursen zu Finanzierung und Bilanzanalyse zum ersten Mal in Berührung mit der systematischen Untersuchung von Geschäftszahlen und Aktien.
Neben den amerikanischen Studenten und den Stipendiaten tummelten sich an der American University auch sehr viele Kinder reicher Ausländer, vor allem aus Lateinamerika. Das eröffnete mir eine neue Welt. Vor allem die kolumbianische Community hatte es mir angetan. Da gab es sehr hübsche Studentinnen aus besten Kreisen. Als Europäer, zumindest als Deutscher oder Franzose, hatte man schon einen gewissen Bonus …
Meine Mitstipendiaten, ob Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Deutscher Akademischer Austauschdienst oder Studienstiftung des Deutschen Volkes, waren eine interessante und handverlesene Truppe. Einer wurde Chefredakteur der Welt, ein anderer hat einen prestigeträchtigen Lehrstuhl an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität inne, eine Kommilitonin ging zu einer Landesbank, ein weiterer Kommilitone zum WDR, wo er es zum angesehenen Hörfunkmoderator brachte.
Nach dem Austauschjahr kehrten alle zurück in die Heimat. Mit vielen bin ich nach wie vor in Kontakt. Auch ich ging wieder nach Köln. Ich hatte mir zwar ein unmittelbar anschließendes Stipendium direkt von der American University gesichert und hätte in Washington bleiben können. In vielleicht drei Semestern wäre ich mit meinem MBA fertig gewesen und hätte danach mit vierundzwanzig oder fünfundzwanzig Jahren einen Job an der Wall Street oder bei einer Unternehmensberatung finden können. Das wollten damals alle. Aber ich hatte andere Pläne. Ich wollte an eine Eliteuni.
Im Sommer vor meinem Aufbruch in die USA hatte ich eine Interrailtour mit der Bahn durch Frankreich, Spanien und England gemacht. In einem Kino in Barcelona sah ich den ersten Terminator-Film mit Arnold Schwarzenegger, der den Bodybuilder aus der Steiermark zum Superstar machte. Mitte der 1970er-Jahre hatte mir ein Nachbarsjunge einmal Bilder dieses Muskelmannes gezeigt. Die Körperproportionen empfand ich damals als grotesk, die Posen etwas affig. Aber Schwarzenegger schaffte es, Bodybuilding im Mainstream zu etablieren und zu einem Superstar zu werden. Nicht zuletzt durch diesen »Schwarzenegger-Moment« angeregt, begann ich zu überlegen, ob es nicht besser wäre, erst einmal Geld zu verdienen und vielleicht sogar sich selber gewissermaßen als Marke aufzubauen, anstatt in einem Unternehmen, an einer Uni oder in einer Behörde die Karriereleiter mühsam emporzuklettern.
Ich ging zurück nach Köln. Ich rechtfertigte dies vor mir selbst damit, dass ich in Köln mit Professor Karl Kaiser einen Betreuer für meine Diplomarbeit und Förderer hatte, der bestens vernetzt war. Als Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik war er Mitglied der Atlantik-Brücke, der Trilateralen Kommission und etlicher anderer einflussreicher Clubs. Wenn jemand mich nach Princeton, Harvard oder Yale bringen konnte, dann er. Das stimmte zwar, und es funktionierte auch. Aber für meine Entscheidung, zurückzukehren, müssen auch persönliche und emotionale Gründe eine Rolle gespielt haben, besonders das Verhältnis zu meiner Mutter nach Vaters Tod. Aber dazu später.
Nach meiner Rückkehr ging ich nicht direkt zurück an die Universität, sondern sechs Monate zur Frankfurter Sparkasse von 1822. Die war damals Marktführer im Geschäft mit Optionsscheinen. Nach einigen Wochen durfte ich mit aufs Parkett der Frankfurter Börse. Nur wenige Tage später brachen die Kurse ein. Der Schwarze Montag vom 19. Oktober 1987 war der erste Börsenkrach nach dem Zweiten Weltkrieg. Innerhalb eines Tages fiel der Dow-Jones um 22,6 Prozent (508 Punkte), bis heute der größte prozentuale Rückgang innerhalb eines Tages in der Geschichte des bekanntesten und ältesten amerikanischen Börsenindex.
Das war neu und spannend für mich. Aber die nächsten zwei Jahre waren keine gute Zeit. Ich hauste in einer Bude außerhalb von Köln, die nur ein Dachfenster hatte, und hatte verbissen mein Studienziel vor Augen. Nach dem Diplom 1989 konnte ich endlich an der Princeton University anfangen.
Von der Welt …
Zwanzig Jahre lang war ich ein Weltenbummler. Ich arbeitete in New York, in Frankfurt und in Düsseldorf ebenso wie in Daressalam. Ich lebte in Köln, Washington, Frankfurt, Hamburg, Worms, Princeton und Boston und einige Monate im Skiort Aspen in den Rocky Mountains. Lernte die UNO, die Weltbank, die Bertelsmann Stiftung, das Bundeswirtschaftsministerium, die Frankfurter Börse und weitere Unternehmen und Organisationen kennen. Noch kam ich mir vor wie in einem großen Supermarkt. Du willst etwas? Probiere es aus!
Die gut anderthalb Jahrzehnte von Mitte der 1980er- bis Anfang der 2000er-Jahre waren meine Lehr- und Wanderjahre – und wie es so ist: mit etlichen Um- und Irrwegen. Ein Kaleidoskop von Ferienjobs, Praktika, Lehrskripten, ersten Bücher bei angesehenen Verlagen wie Campus und der FAZ-Edition. Auch ziemliche abgefahrene Aktivitäten waren darunter, wie der Versuch, einen mexikanischen Anislikör in Deutschland zu etablieren. Mein Bruder hatte zwischenzeitlich ebenfalls einen Hang zum Weltenbummeln entwickelt, wenn auch ganz anders als ich. Auf der Halbinsel Yucatán hatte er diesen Likör entdeckt und seine Produzenten, zwei Brüder, kontaktiert. Ich flog von Newark nach Cancún, »el pueblo gringo«, um dort mit ihm und den Brüdern über eine Vertriebslizenz zu verhandeln.
Wir bestellten ungefähr tausend Flaschen. Durch die Zoll- und Frachtkosten wurde die Spirituose allerdings erheblich teurer als gedacht. Zusammen mit einem Barmixer priesen wir sie im darauffolgenden Sommer bei der deutschen Auslandsrepräsentanz von Campari in München an, ebenso bei einem schwäbischen Hersteller. Beide Male wurden wir freundlich empfangen, aber es wurde nichts draus. Die Kalkulation ging hinten und vorne nicht auf. Noch härter und frustrierender war der Versuch, direkt an einzelne Läden und Verkaufsstellen zu gehen. Diese Lektion im knallharten Konsumgütermarkt werden mein Bruder und ich unser Leben lang nicht vergessen.
Da war ich mit den kleinen Lehrskripten in Makroökonomik, Allgemeiner Wirtschaftspolitik, Marketing und Organisation, die ich für einen Kommilitonen geschrieben hatte, auf dem Weg zur Bildung einer eigenen Marke deutlich weitergekommen. Und ein netter Nebenverdienst war es, zumal ich eine prozentuale Beteiligung ausgehandelt hatte. Allerdings störte das meinen Verleger auf Dauer gewaltig, denn mit seinen anderen Autoren hatte er Fixhonorare ausgehandelt. Mehrere Jahre lang übte er Druck aus und verhandelte nach, bis ich ganz aus dem Geschäft raus war.
*
Meine Kommilitonen in Princeton waren die Topauswahl Amerikas, wie man sie eben an Elitehochschulen so findet. Humorvoll, eloquent, intelligent – und genauso getrieben wie ich. Das Tempo in einigen Kursen, besonders den mathematisch orientierten VWL-Seminaren, war brutal. Auf einmal schwamm ich nicht mehr ganz vorne mit, sondern irgendwo im Mittelfeld. Und ich war ein oder sogar zwei Jahre älter als viele meiner Kommilitonen. Ich hatte ja schon den Militärdienst und ein Diplomstudium nebst Austauschjahr hinter mir, während viele meiner Mitstudenten direkt vom Bachelorstudium kamen. Auch das war neu für mich, denn bisher war ich immer einer der Jüngsten gewesen.
M.P.A.-Class of ’91 an der Princeton University, irgendwo in Vermont
Als die Masterstudenten meiner Kohorte nach zwei Jahren abgingen, wurde es still. Irgendwie fühlte ich mich zurückgelassen und laborierte etwas lustlos an der Doktorarbeit herum. Der Direktor unseres Doktorandenprogramms war Ben Bernanke, der spätere Chef der US-Notenbank. Mit einigen Entwürfen, mit denen ich das Thema Bankensystem und ökonomische Entwicklung beleuchten wollte, kam ich nicht recht voran. Es trieb mich in die Welt. So zogen sich Promotionsstudium und Doktorarbeit sieben quälende Jahre hin. Mehr als einmal war ich kurz davor, hinzuschmeißen.
Mitte der 1990er-Jahre erwarb ich in den USA einige Immobilien: eine Wohnung in einem Apartmentkomplex, ein Reihenhaus in einer anderen Siedlung und ein wunderschönes Grundstück in den Rocky Mountains. Von Unternehmens- und Organisationsberatung alleine – so mein Kalkül – würde man nicht reich. Dazu müsste man Kapital einsetzen, am besten gehebelt. Für einen Pendler zwischen den Welten – Europa, Afrika, Nordamerika – war das wohl etwas zu ambitioniert. Die Kalkulation ging nicht auf. Ich hatte mich übernommen. Als das Geld knapp wurde und ich meine Dissertation immer noch nicht fertig hatte, musste ich mein schönes Grundstück in den Rockies und auch die anderen Immobilien wieder verkaufen.
Nach der ersten UNO-Studie lernte ich eine weitere Lektion: Price Waterhouse Coopers wurde zum Generalunternehmer ernannt, der die Beratungsaufträge für die UNO vergab. Von nun an bekam die kleinere deutsche Konkurrenzfirma keinen einzigen Auftrag mehr. Es dauerte allerdings einige Jahre, bis ich begriffen hatte, was da im Hintergrund lief.
Für Kienbaum arbeitete ich als Freelancer und Projektleiter für das hessische Umweltministerium. Das ging in die Hose. In Tansania beriet ich die Universität von Daressalam. Dann 1995 ein Jahr als »Leiter Beratungsdienste« beim Centrum für Hochschulentwicklung an der Bertelsmann Stiftung. Damals war ich davon überzeugt, dass Hochschulen »moderne Managementmethoden« benötigten. Heute, nachdem das Studium massiv verschult ist und Professoren nach Punkten für ihre Publikationen evaluiert werden, weiß ich, dass wir auf dem Holzweg waren.
In dieser Zeit erschien im Frankfurter Campus-Verlag mein zweites Buch, Amerika für Geschäftsleute.4 Ich hatte mich intensiv mit der amerikanischen Unternehmenskultur und interkulturellen Unterschieden insgesamt auseinandergesetzt. Bei Bertelsmann in Gütersloh hatte mich zudem der »umgekehrte Kulturschock« kalt erwischt. Und der beruht auf folgender Tatsache: Wenn man in ein fremdes Land geht, ist man auf die andere Kultur neugierig und in gewisser Weise darauf vorbereitet, Neues zu erleben. Hat man sich eingelebt und kehrt irgendwann zurück in die Heimat, ist man vielleicht nicht mehr darauf vorbereitet, dass die Uhren dort anders ticken. So war es bei mir. Gelegentlich eckte ich an mit meiner extravertierten »amerikanischen« Art.
Etwas später – ich war von Kienbaum zu Arthur D. Little gewechselt und hatte endlich die Promotion abgeschlossen – wurde ich Leiter und Coach einer Projektgruppe des Bundesministeriums für Wirtschaft. Das junge Team aus dem Haus arbeitete äußerst engagiert. Das kam auch mir zugute, denn auf diesem Weg lernte ich so ziemlich jede Abteilung, Unterabteilung und jedes Referat im Hause genauer kennen. Der Organisationsplan, den das interne Team entwickelte, war schlank und ambitioniert. Ich erinnere mich ziemlich genau, wie das Gesicht des Leiters der Organisationsabteilung im Haus versteinerte, als er den Plan zum ersten Mal sah. Obwohl der Minister den Ansatz grundsätzlich gut fand, gelang es der Abteilungsleiterebene, das Ganze Schritt für Schritt zu verwässern, bis von den Reformen nichts mehr übrig war.
Eine weitere Lektion gelernt. Ich nahm mir vor, von jetzt an nur noch mit Entscheidern zu arbeiten: Unternehmensinhabern, Chefs, auch Privatpersonen und Privatanlegern. Das Vermögen war mir dabei fast egal: Ich wollte mit Menschen zu tun haben, die entscheiden, nicht mit Menschen in Organisationen, die sich auf vielfältigen und komplexen Wegen abstimmen müssen. Das erwies sich als einer der besten Entschlüsse meines Lebens.
Bei Arthur D. Little bekam ich ein sehr gutes Gehalt, für das ich mich ordentlich reinhängte. Doch mein Boss hatte wohl etwas zu ambitioniert geplant und zu viele Leute eingestellt. Und so hieß es bereits nach knapp einem Jahr: »Max, du musst gehen.« Die Aufträge waren knapp geworden und mein Gehalt sollte eingespart werden. Es war, wie man das aus Filmen kennt: Ich musste meine Sachen packen, mein Chef hinter mir. Allerdings durfte ich mich noch von den Kollegen verabschieden, bevor ich meine Schlüssel abgab. Eine richtige »amerikanische« Kündigung also, mit allem Drum und Dran.