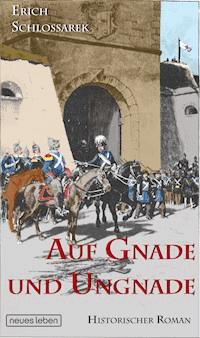
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neues Leben
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Badische Revolution 1849: Das deutsche Volk kämpft um die Durchsetzung seiner von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossenen Grundrechte. Auch der ehrgeizige Oberstleutnant Corvin ist für die demokratischen Ideale entbrannt. Als die Festung Rastatt von preußischen Truppen eingeschlossen wird, übernimmt er mutig die militärische Führung der Verteidiger. Abgeschnitten von der Außenwelt warten die Revolutionäre auf Unterstützung. Doch die beengte Situation zermürbt die Burgbevölkerung zusehends und es kommt zu unüberlegten Ausfällen. Corvins Loyalität wird auf eine harte Probe gestellt, als er in einem der Feinde seinen Jugendfreund Karl erkennt. Weder der ambitionierte Offizier noch seine bildschöne Geliebte Helene, die ihn im fernen Berlin sehnsüchtig erwartet, ahnen, in welch lebensbedrohlicher Gefahr der junge Leutnant schwebt. Ein spannender Historienroman über das Schicksal des Otto von Corvin und seinen Kampf für die Demokratie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
eISBN 978-3-355-50021-0
© 2015 (1988) Verlag Neues Leben, Berlin
Cover: Verlag unter Verwendung einer zeitgenössischen Zeichnung, Quelle: Archiv des Autors
Die Bücher des Verlags Neues Leben
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Der Romanhandlung liegen authentische Ereignisse der badischen Revolution zugrunde. Die biographischen Abschnitte zur Kindheit, Kadettenerziehung usw. beruhen auf den »Erinnerungen aus meinem Leben« von Otto v. Corvin, Buchausgabe Leipzig, 1880. E.Schl.
Historischer Roman
Als Corvin mit seinem Burschen Herrmann an das Ottersdorfer Tor geritten kam, umringte ihn die Wache. Er reichte vom Pferd herab den Passierschein hin. Der wachhabende Offizier, Oberleutnant Frey, gab ihm den Zettel zurück.
»Bedaure, Herr Oberstleutnant, hier fehlt das Siegel. Wir haben Befehl, niemanden ohne ordnungsgemäßen Passierschein aus der Festung zu lassen.«
»Oberst Tiedemann hat ihn eigenhändig unterschrieben«, herrschte Corvin ihn an, »das genügt doch wohl.«
»Aber nicht unterstempelt«, erwiderte Frey in dienstlicher Haltung, »Befehl ist Befehl.«
Die Soldaten benahmen sich weniger korrekt, ließen Verdächtigungen laut werden, sprachen von Durchbrennen, Geldmitschleppen und Spionieren.
Corvin schlug verärgert mit der Reitpeitsche an seinen Stiefel. In der Hand zuckte es, sie diesem sturen Offizier und dessen Leuten von der Bürgerwehr um die Ohren zu hauen und sich gewaltsam einen Durchlaß zu verschaffen.
»Herr Oberstleutnant«, raunte Herrmann ihm zu, »ich glaube, es hat keinen Zweck. Sie verhaften uns sonst noch.«
Herrmann hatte recht, und auch die Wache war im Recht, sosehr ihre Weigerung auch Verdruß bereitete. Das sah Corvin schließlich ein. Ein Befehl muß ohne Ausnahme befolgt werden. Außerdem hatten die Soldaten Grund genug, mißtrauisch zu sein, wie Frey zu ihrer Rechtfertigung erläuterte. Der vorige Kommandant von Rastatt, Hauptmann Greiner, hatte sich bei Nacht und Nebel mit einem selbstgeschriebenen Passierschein davongemacht, und der Kriegskassierer war mit der Stadtschatulle durchgebrannt.
Corvin bestand nicht weiter auf seinem Ansinnen. Er sagte knapp, er werde den fehlenden Stempel besorgen, und ritt mit Herrmann in die Stadt zurück.
Vor vierundzwanzig Stunden, am Nachmittag des 29. Juni 1849, hatte ihn die Niederlage der Revolutionsarmee an der Murg zusammen mit Tausenden Soldaten und Freischärlern, die in die sichere Bastion flohen, nach Rastatt geführt. Zur Dämmerung, wenn die Biwakfeuer des Feindes seine Stellungen markierten, wollte er sich wieder absetzen. Sein Instinkt und seine militärischen Kenntnisse sagten ihm, daß es besser sei, sich in freier Landschaft zu bewegen, als hinter Mauern eingeschlossen zu sein. So wollte er sich dem anderen Teil der Revolutionsarmee anschließen, der sich unter dem Kommando des Generals Sigel in den Schwarzwald zurückgezogen hatte. Es hieß, Ottersdorf, hinter dem Rastatter Oberwald gelegen, sei von den Preußen noch nicht besetzt.
Der Gouverneur und Kommandant der Festung, Oberst Tiedemann, hatte ihm während einer Truppeneinteilung auf dem Markplatz zu Rastatt rasch einen Passierschein mit Bleistift geschrieben. »Beeilen Sie sich, ehe die Preußen den Ring um Rastatt schließen«, hatte er gesagt, »und sorgen Sie dafür, daß Sigel uns bald raushaut.« Leider erwies sich, daß der Zettel nicht genügte.
Mittlerweile war die Abenddämmerung hereingebrochen.
Nur ein rotgelber Widerschein der Sonne erleuchtete noch den westlichen Himmel. Höchste Eile war geboten, wenn Corvin und sein Bursche die Stadt noch vor der Nacht verlassen wollten.
Auf der Suche nach dem Kommandanten irrten sie in den Straßen und Gassen umher, denn das Gouvernementsbüro war nicht besetzt, Tiedemann nicht aufzufinden.
Während Herrmann und Corvin ihn im Schloß, in den Forts und Weinstuben suchten, hatte Tiedemann sich auf den höchsten Punkt, den Ausblick im Schloßturm, zurückgezogen, der eine Rundsicht über die gesamte Festungsanlage und weit in die Landschaft hinein bot.
Tiedemann konnte alle Bewegungen der Preußen beobachten, die zu dieser Stunde noch im Gelände operierten, Geschützstellungen aushoben, Lager befestigten. Auf der Ottersdorfer Landstraße rückte eine Infanteriekolonne mit Feldgeschützen vor, zweifellos, die letzte freie Ortschaft zu besetzen. Die Falle schnappte zu.
Als die Dunkelheit hereinbrach, loderten in allen Himmelsrichtungen Biwakfeuer auf. Hinter dem Rastatter Oberwald stiegen Raketen hoch. So war also der Ring geschlossen, die Festung vollkommen zerniert.
Davon wußte Corvin nichts, als er sich, mißgestimmt über die nutzlose Suche, in sein Quartier zurückbegab, das er für die vergangene Nacht bei Bürgersleuten bezogen hatte. Sie nahmen ihn wieder bereitwillig auf. Er hatte sie großzügig bezahlt, als er vor Stunden das Haus verließ. Herrmann schlief bei den Pferden. Er war ein anhänglicher, verläßlicher Bursche, ein Badenser. Während der Verteidigung Mannheims waren sie zusammengetroffen. Seitdem wich er nicht mehr von Corvins Seite. Er vertraute wohl darauf, unter der Obhut des Oberstleutnants unbeschadet durch alle Gefahren des Krieges zu kommen.
Am nächsten Morgen suchte Corvin den Kommandanten im Gouvernementsbüro auf, das sich im Schloß befand. Tiedemann war von seinen fünf Adjutanten und Ordonnanzoffizieren umgeben. Er saß hinter dem Schreibtisch, den Militärmantel um die Schultern gehängt, und unterschrieb Befehle und Anweisungen. Major Heinsius, sein erster Adjutant, ordnete sie nach Originalen und Abschriften. Von jedem Schriftstück mußten Kopien als historische Dokumente«, wie der Oberst sie bezeichnete, zur Aufbewahrung angefertigt werden.
Corvin setzte sich auf den bereitgestellten Stuhl und wartete ab, bis der Gouverneur seine Offiziere entlassen hatte. Dann trug er sein Anliegen vor. Er wollte nicht lange verweilen und mit dem unterstempelten Schein ohne Verzug das Ottersdorfer Tor passieren. Doch der Oberst erklärte ihm, daß es dafür zu spät sei. Ottersdorf sei inzwischen von den Preußen besetzt, die Festung umzingelt und kein Fluchtweg mehr vorhanden. Er habe befohlen, sämtliche Tore zu verriegeln und niemanden mehr aus der Festung zu lassen.
Corvin war bestürzt. Fatale Geschichte, dachte er, ich könnte längst den sicheren Schwarzwald erreicht haben. Statt dessen sitze ich wegen eines fehlenden Stempels in der Mausefalle. Es war nur eine erste, spontane Regung, die rasch verging. Im Grunde reizte es ihn, nach den turbulenten Kriegsereignissen auch einmal eine Belagerung mitzumachen. Wer weiß ob er in seinem Leben wieder eine Gelegenheit dazu fand. Hätte Tiedemann ihn gestern aufgefordert - »Bleiben Sie, Männer wie Sie kann ich jetzt brauchen!« -, hätte er wahrscheinlich seinen Entschluß, die Stadt zu verlassen, sofort aufgegeben. Aber der Oberst hatte keinen Gedanken an die Verwendung eines fähigen Offiziers verschwendet. Jetzt schien er sich besonnen zu haben.
»Corvin, ich kann doch mit Ihnen rechnen?« fragte er.
»Wie meinen, Herr Oberst?«
»Daß ich Sie mit einem Amt betrauen kann. Wir haben wenig richtige Offiziere.«
Tiedemann spielte auf eine Erscheinung an, die sich hier wie in der ganzen Armee während des Aufstandes breitgemacht hatte. Es wimmelte nur so von höheren Chargen, darunter viele, die, von der Mannschaft gewählt, von irgendeinem Befehlshaber kurzerhand befördert worden waren oder sich in der allgemeinen Verwirrung selbst zum Offizier ohne Kommando ernannt hatten. Meist ehemalige untere und mittlere Dienstgrade. Als erstes kümmerten sich die meisten von ihnen um eine piekfeine Uniform mit dazugehörigen Tressen, Schnüren, goldenen Knöpfen und Portepees. Der individuellen Phantasie waren keine Grenzen gesetzt, den Führungsqualitäten dagegen wohl. Natürlich gab es auch tüchtige Leute darunter. Letztlich war fast jeder in dieser Armee um einige Grade höher geklettert. Auch Corvin.
Die tatsächliche Vakanz im Offizierskorps aber, namentlich auf der höchsten Ebene, schien Tiedemann Sorgen zu bereiten. Oder war es die große Verantwortung, die er sich als Kommandant auf die Schultern geladen hatte und die er nun mit anderen teilen wollte? Immerhin ging es um den letzten, wichtigsten Stützpunkt des badisch-pfälzischen Aufstands, ja der deutschen Revolution überhaupt, die im März achtundvierzig so verheißungsvoll begonnen hatte. Ihm waren plötzlich fünfeinhalbtausend Soldaten unter sein Kommando gegeben, ungerechnet die achttausend Einwohner, die von jeder militärischen Entscheidung mitbetroffen waren.
Corvin konnte Tiedemanns Sorgen nachempfinden, dennoch zögerte er, seiner Aufforderung spontan zuzustimmen, obwohl jetzt der Fall eingetreten war, den er sich immer ausgemalt hatte. Wie oft mußte er gegen das bittere Gefühl ankämpfen, unerwünscht zu sein. Seine adlige, altpreußische Herkunft und seine Vergangenheit als preußischer Leutnant erzeugten Mißtrauen, auch viel Mißgunst unter den Generalstäblen und bürgerlichen Demokraten. Hier in Süddeutschland kam noch ein beinahe angeborenes Vorurteil gegen alles Preußische hinzu. Dagegen war er empfindlich geworden und fühlte einigen Groll gegen die Leute, von denen es abhing, ihm etwas zu tun zu geben.
Er hatte immer wieder bei hohen Politikern und Militärs seine Dienste angeboten, für führende Stellungen natürlich, möglichst im Generalstab, entsprechend seinen Fähigkeiten und seiner Selbsteinschätzung. Er hatte ohne Widerspruch zweitrangige, oft undankbare Posten übernommen, wenn sie ihm nur Gelegenheit gaben, sich in Kampf und Gefahren zu stürzen oder sein militärisches Talent zu entfalten, wie kurz zuvor, als er die Mannheimer Volkswehr zu einer kampfstarken Truppe formiert und Mannheim bis zur Aussichtslosigkeit verteidigt hatte. Die Feldzugstrategie jedoch hatten andere ausgedacht, die Generalität, von der er nicht viel hielt: der Oberbefehlshaber Mieroslawski und Sigel, Struve, Becker oder wie sie noch hießen. Sie hatten seinen Rat in den Wind geschlagen, ihn für aufdringlich und besserwisserisch gehalten und waren, so sah es Corvin, folgerichtig in die Niederlage gelaufen.
Auf die Dauer vertrug sein Stolz solche Verweigerung und Zurückweisung nicht. Er war es leid geworden, sich fortwährend selbst zu bemühen. Er wollte gebeten werden. Jetzt war dieser Augenblick gekommen.
Tiedemann hatte sich noch nicht geäußert, mit welchem Amt er ihn betrauen wollte. Corvin fragte danach.
»Ich würde es begrüßen, wenn Sie die Führung des Stabes übernehmen« , sagte der Oberst.
Corvin stockte der Atem. Er sollte Chef des Generalstabs werden! Ein solcher Posten war nach seinem Geschmack.
Endlich, endlich! frohlockte er innerlich. Er konnte gewiß sein, daß sich Tiedemann nicht allein von dem mangelhaften Offiziersaufgebot oder einem plötzlichen Einfall leiten ließ.
Nein, Tiedemann war ein alter Soldat, der Schneid und Können zu schätzen wußte.
Sie waren sich vor Wochen schon einmal im Hauptquartier zu Bernigau begegnet. Damals war Tiedemann Chef des Generalstabs der Neckararmee gewesen. Er hatte Corvin mit Respekt behandelt, viel nach militärischen Dingen gefragt und konnte aufmerksam zuhören. Corvin hatte einen vorteilhaften Eindruck von ihm mitgenommen.
Was auch immer den Oberst bewegen mochte, er hatte mit seinem Angebot ins Schwarze getroffen. Vergessen war der Entschluß, der Stadt den Rücken zu kehren. Da ohnehin kein Fluchtweg mehr offenstand, wollte Corvin bei dem Kampf um Rastatt kein müßiger Zuschauer sein. Obendrein einen Posten in der Festung einnehmen zu können, den er für den bedeutendsten hielt, versetzte ihn in Hochstimmung.
Bedenken, ob seine militärischen Kenntnisse ausreichen würden, kamen ihm nicht. Er, der Oberstleutnant Otto von Corvin-Wiersbitzki, hätte unter den höheren Offizieren auch keinen zu benennen gewußt, der es mit ihm aufnehmen konnte.
Am selben Tag quartierte sich Corvin im Schloß ein. Es bot nicht nur den Rahmen für die Würde und das Ansehen seines Amtes, sondern dort zu wohnen war auch praktisch, weil sich hier fast der gesamte Führungsstab niedergelassen hatte.
Er bezog zwei Zimmer, die von einer Tochter des ehemaligen Gouverneurs, Generals von Cloßmann, bewohnt gewesen waren. Sie hatte bei Ausbruch der Unruhen mit ihrem Vater eilig vor den aufrührerischen Soldaten fliehen müssen, ohne all ihre Sachen mitnehmen zu können.
Herrmann hatte seinen Spaß, als er die duftigen weiblichen Kleidungsstücke aus den Kommoden und Schränken räumte, um sie anderswo zu verwahren, faltete die Dessous unter Zungenschnalzen, »Jessus!« und »Sapperment!« auseinander, legte sich ein Korsett um seinen kräftigen Leib – »Herr Oberstleutnant, wie steht mir das?« – und hielt sich ein Spitzenhöschen an, verrenkte die Hüften und flötete mit hoher Stimme: »Nicht so stürmisch, Husar, ich bin ein anständiges Fräulein!«
Corvin mußte ihn amüsiert an seine Pflichten erinnern.
Die Räume bekamen ein neues Aussehen. Mit geeigneten Stücken aus dem Schloßmobiliar wurde das Damenboudoir zu einem gemütlichen Herrensalon umgewandelt.
Im Gegensatz zu Corvins Ruhelosigkeit, die ihn in seinem Vaterland und in den Nachbarländern umhergetrieben hatte, und zu seiner frühen Heimatlosigkeit – vielleicht auch gerade deswegen – duldete er nichts Provisorisches, Unwohnliches um sich und war bestrebt, jedes Zimmer, auch wenn er nur einen Tag darin weilte, nach seinem Geschmack behaglich herzurichten.
Mit vorgefundenen Tischdecken, weißen Gardinen zur Ausstaffierung eines Toilettentisches, einigen prachtvollen Rokokomöbeln, darunter ein goldener Armsessel mit heraldischer Stickerei, wahrscheinlich die Handarbeit einer betagten Fürstin, einer rotseidenen Steppdecke für sein Bett, das gewiß lockere Hofgeschichten erzählen könnte, stellte er eine recht komfortable Wohnung her. Seinen Kameraden erschien sie orientalisch üppig, so daß sie ihm den Scherznamen »Der Pascha von Janina« gaben. Verglichen mit dem Quartier des Festungskommandanten, dem es gefiel, spartanisch einfach zu hausen, auf einem Feldbett zu schlafen und sich mit dem Mantel zuzudecken, war dieses geradezu schamlos luxuriös. Corvin fühlte sich aber wohl.
Da die Wohnung geräumig war und, wie der Feldherr von Biedenfeld sagte, »wenigstens comme il faut«, hielt der Kriegsrat fortan seine Sitzungen hier ab. Er bestand aus Tiedemann, Biedenfeld, Böning, Heilig, Mahler, Jakobi und weiteren Korpschefs und Fortkommandanten. Zuweilen blieb der Kreis nur auf fünf bis sechs Männer, die die wichtigsten Ämter einnahmen, beschränkt.
Corvin machte sich ein Vergnügen daraus, seine Gäste mit Wein, Bier und Zigarren zu bewirten, wovon er immer einen reichlichen Vorrat besaß. Er fand, daß die Deutschen Geschäfte weit besser und gemütlicher mit der Zigarre und hinter dem Glas als mit trockenem Munde abmachten.
Die Wohnung hatte allerdings einen Nachteil. Sie war mit den Nebenräumen durch eine Flügeltür verbunden, die nicht abzuschließen ging, weil die Schlüssel fehlten.
Eines Nachts hörte Corvin, noch halb im Tiefschlaf, im Salon leise Schritte, Klirren, eine Tür klappen. Dann herrschte wieder Stille, als wäre soeben ein Geist durch das Zimmer geschlichen. Corvin war zu schläfrig, um der Sache nachzugehen. Anscheinend spukt es hier, dachte er, nicht weiter beunruhigt, so etwas gehört zu einem Schloß.
Geisterspuk war ihm von Kindheit her vertraut. Das Elternhaus in Gumbinnen mit seinen zahlreichen Räumen, gewaltigen Dachböden und Schlupfwinkeln stand in dem Ruf, daß es dort spuke, und die Dienstboten erzählten manche Schauergeschichte. Besonders unter dem Dach sollte es nicht geheuer sein. Man hörte allerlei seltsame Geräusche und greuliche Töne. Einige wollten schreckliche Gestalten gesehen haben, und Maurer, die dort oben arbeiteten, ergriffen einst am hellen Mittag entsetzt die Flucht.
Die Kinderstube lag in der Nähe des Speichers und der Räucherkammer. In einer Nacht kam von dorther ein Gebrüll wie von einem Ochsen, wovon Otto und sein Bruder erwachten und bei der Kinderfrau Schutz suchten. Am anderen Tag stellte sich heraus, daß sich ein Knecht aus dem Hause in der Räucherkammer erhängt hatte und jenes Gebrüll von ihm herrührte. Der Vorfall gab dem Spukruf des Hauses neue Nahrung.
Der Vater wollte eines Nachts einen Knaben in griechischer Kleidung im Zimmer gesehen haben, der geräuschlos die Stühle stellte und zu tanzen anfing.
Den Poltergeistern auf dem Boden machte der Jäger den Garaus. Sie erwiesen sich als Iltisse und Marder, die nach und nach alle Tauben des Bruders erwürgt hatten, in einer Nacht gleich dreißig.
So waren die irrationalen Erscheinungen meist auf natürliche Ursachen zurückgeführt worden, dennoch erschütterte das keineswegs den Spukglauben der Leute im Hause, die meinten, daß neben dem Raubzeug noch eine Menge Gespenster auf dem Boden Platz hätten.
Der Vater gab sich alle Mühe, den Kindern die Furcht auszutreiben. Oft ließ er sie aus entfernten dunklen Zimmern irgendwelche Gegenstände holen. Anfangs erstarrten beide Kinder vor Schreck, wenn sie ein zufälliges unheimliches Knistern und Knacken vernahmen. Otto begann als erster nach der Herkunft der Geräusche zu forschen, überzeugte sich von der Harmlosigkeit und lachte seinen ängstlichen Bruder aus.
Auch jetzt fanden die merkwürdigen Geräusche in Corvins Wohnung eine handgreifliche Erklärung, im wahrsten Sinne des Wortes.
Da sie sich in Abständen wiederholten, ließ Corvin die Tür zu seinem Schlafzimmer einen Spalt offen, legte die Pistole bereit und harrte der Dinge, die ihn aus dem Schlaf erwecken würden . Er brauchte nicht nächtelang zu warten.
Schritte, Klappern ließen ihn aufwachen. Er stürzte, die Pistole in der Hand, ins Wohnzimmer und konnte im Dunkeln gerade noch eine Gestalt am Rock erwischen, die in den Nebenraum flüchten wollte.
Beim Mondlicht am Fenster stellte sich heraus, daß er seinen Wohnungsnachbarn Elsenhans vor sich hatte. Corvin war verblüfft.
»Was machen Sie in meinen Räumen?« fragte er ihn barsch.
Elsenhans war die Entdeckung gar nicht peinlich. Er befreite sich geschickt aus Corvins Griff und erwiderte mit unschuldiger Miene: »Ich habe mir erlaubt – war uns ausgegangen«, und streckte seine Rechte vor, die eine Weinflasche am Hals hielt. Aus seiner Brusttasche lugten zwei Zigarren heraus.
Corvin begriff. Der junge Mann pflegte sich aus dem Zigarren- und Weinvorrat seines Nachbarn zu bedienen. Die unverriegelte Zwischentür machte es ihm leicht.
»Eine merkwürdige Art, sich Genüsse zu verschaffen«, spottete Corvin.
»Sollte ich Sie jedesmal wecken? Das habe ich nicht übers Herz gebracht«, erwiderte Elsenhans treuherzig. »Ich habe alles notiert für die Abrechnung. Sie können sich überzeugen. Da ich Sie nun persönlich fragen kann: Sie haben doch nichts dagegen?«
Corvin mußte lachen. Er entließ ihn mit den »ausgeliehenen« Sachen und einer gutmütigen Ermahnung.
Von jetzt an rückte er die Lehne eines Stuhls unter die Türklinke und blieb vor weiteren heimlichen Besuchen verschont.
Ernst Elsenhans war Redakteur und Herausgeber des »Festungs-Boten«. Er wohnte nebenan mit einem früheren Deputierten zusammen und gehörte dem Kriegsministerium in der Festung an. Er war ein Württemberger, hatte sein Theologiestudium aufgegeben, weil es sich mit seiner religiösen Vorstellung nicht vertrug, nahm an der Revolution regsten Anteil und wirkte in Baden als Schriftsteller. Wegen eines »Pressevergehens« wurde er zur Festungsstrafe verurteilt, die er in Kislau verbüßte, bis der badische Aufstand ihn befreite.
Er war ein junger, gutgewachsener Mann mit breiter Brust und feingeschnittenem, bleichem Gesicht, dem die hohe Stirn und das kurzgeschorene blonde Haar einen bedeutsamen Ausdruck gaben. In seinen Augen leuchtete Begeisterung bis hin zum Fanatismus, wenn er für seine Überzeugung stritt. Seine heftigen politischen Debatten mit Gesinnungsfreunden im Zimmer nebenan hinderten Corvin oft am Einschlafen. Gewöhnlich trug Elsenhans die geschmackvolle Uniform des Kriegsministeriums, jedoch stets offen, um sein feines Hemd, das noch mit Jabot und gefalteten Manschetten versehen war, blicken zu lassen. Er schien sich seiner interessanten Erscheinung bewußt zu sein und gefiel den Damen sehr.
Die Nachbarschaft zu Elsenhans erwies sich auch in anderer Hinsicht für Corvin als lästig. Wenn der Kriegsrat bei Corvin tagte, horchte Elsenhans an der Tür. Jedenfalls fanden sich manche Äußerungen in den Artikeln des »Festungs-Boten« wieder. Häufig waren Tiedemann und seine »lasche Führung« Zielscheibe der publizistischen Attacken, weswegen der Gouverneur ihn nicht leiden konnte. Er nannte ihn stets Eselhans.
Auch Elsenhans hatte zu spät Anstalten gemacht, Rastatt zu verlassen. Jetzt widmete er sich mit Hingabe der Verteidigung der Festung und scharte die Besessensten um sich, wie er selbst einer war. Die Vorahnung des tragischen Unglücks, das ihn in wenigen Wochen als ersten ereilen sollte, stand ihm in seinem schönen, asketischen Gesicht geschrieben.
Corvin hätte von früh bis spätabends auf den Beinen sein müssen, wollte er alle Aufgaben gewissenhaft erledigen. Er war nicht allein zum Chef des Generalstabs, sondern auch zu dem der meisten Dienstdepartements ernannt worden, mit Ausnahme des Kassen- und Proviantwesens. Durch diese Anordnung war ihm beinahe alles aufgebürdet, was es in einer belagerten Festung zu tun gab. Aber das machte ihm nichts aus. Spätestens in acht Tagen ist die Belagerung beendet, sagte er sich.
Hauptsächlich mußten die Truppen zusammengehalten werden, was bei dem Durcheinander nicht einfach war, und feindliche Angriffe abgewehrt werden. Den Kampf sehnte er herbei. Hier könnte er seine Kriegskunst ins rechte Licht setzen, denn er traute den Männern in der Festungsleitung nicht viel zu. Nicht jeder Doktor der Philosophie ist ein Generalstabsoffizier, meinte er, und nicht jeder, der eine Flinte laden und abschießen kann, ein Soldat.
Bald kam er sich unentbehrlich vor als jemand, der Überblick besaß, was er von Tiedemann nicht behaupten konnte, und einen klaren Kopf in dieser von Emotionen angeheizten Atmosphäre bewahrte.
Aus seiner Veranlagung heraus, die Zügel der Phantasie schießen zu lassen, verstieg er sich in seinen Wachträumen zu Vergleichen mit Troja und Theben. Ähnelten ihre bedrängte Lage, ihr trotziges Ausharren hinter den Festungsmauern nicht den Schicksalskämpfen in antiken Tragödien?
Und ihm selbst war - durch Zufall oder Fügung - die Rolle eines Priamos bestimmt, die bedrohte Stadt zu schützen und zu retten. Mit solcher Tat würde er im Kampf für Deutschlands Freiheit die Ruhmesreihe seiner Ahnen fortsetzen, die in der Geschichte, namentlich Preußens, ihren Ehrenplatz hatten.
Johannes Corvin-Wiersbitzki gehörte dazu, der für seine bei Fehrbellin gezeigte Tapferkeit vom Großen Kurfürsten zum Rittmeister befördert worden war; oder der Großvater Georg Ludwig, der mit seinen Kürassieren in der Schlacht bei Kollin die Panduren zusammengehauen und eine Batterie erobert hatte. Der Alte Fritz hatte noch auf dem Schlachtfeld seinen Orden Pour le merite vom Hals abgenommen, ihn dem Großvater überreicht und ihn auf der Stelle zum Oberstleutnant befördert. Später wurde er General. Die Reihe ließe sich zurückverfolgen bis zum römischen Konsul und Diktator Valerius Corvinus, 349 v. u. Z. Ihn hatte einst ein gallischer Goliath zum Zweikampf herausgefordert. Als die Schwerter aufeinanderschlugen, setzte sich ein Rabe (Corvus) auf den Helm des Römers und half ihm mit Schnabel und Krallen, den Gallier zu töten. Von diesem wundersamen Vorfall wurde der Name hergeleitet und der auffliegende Rabe im Wappen der Corvins. Er wurde zum Symbol eines der ältesten Adelsgeschlechter, das manche Kriegshelden, Fürsten, Bischöfe, Statthalter und andere bedeutsame Männer hervorgebracht hatte.
Er, Otto Julius Bernhard, Sproß aus der Linie der Corvin-Wiersbitzkis, mit sechsunddreißig Jahren im besten Mannesalter, fühlte seine Stunde gekommen, den Namen zu neuen Ehren zu bringen.
Er hatte nur Sorge, das Pulver auf der Pfanne trocken zu halten, weil den Preußen die moderne Festung für einen Angriff zu stark war. Hinter den Mauern lauerte eine entschlossene Besatzung, die darauf brannte, sich mit den Preußen schlagen zu können. Dazu gab es jedoch außer einigen Plänkeleien, wie dem Zielen auf vorwitzige preußische Posten oder Patrouillen, keine Gelegenheit.
Corvin wollte die Kampfeslust in nützliche Bahnen lenken. Deshalb faßte er Ausfälle nach Niederbühl und Rheinau ins Auge, in diesen Dörfern zu fouragieren, ehe ihnen die Preußen zuvorkämen.
Die Dörfer lagen einander entgegengesetzt so nahe der Festung, daß von den Lünetten aus die ersten Häuser mit Flintenschüssen zu erreichen waren. Sie hatten für die Verteidigung keine strategische Bedeutung. Die Bewohner waren in die Festung geflüchtet, nur mit der notwendigsten Habe versehen. Es gäbe also an Getreide, Vieh, Heu, Wein allerlei für das Proviantmagazin zu holen.
Corvin arbeitete einen Plan für den Ausfall aus und wollte ihn mit Tiedemann besprechen.
Vor dem Gouvernementsbüro bemerkte er mit Erstaunen einen Doppelposten, der die Tür bewachte.
»Was geht hier vor?« fragte er.
»Der Oberst ist arretiert«, erwiderte ein Soldat. »Er darf sein Zimmer nicht verlassen.«
»Wer hat das angeordnet?«
»Die Kommandeure vom dritten Regiment«, antwortete der Posten.
»Lassen Sie mich zu ihm!« befahl Corvin.
Die Soldaten sahen sich unentschlossen an. Er schob sie einfach beiseite und trat ein.
Er fand den Gouverneur allein, verstört hinter dem Schreibtisch sitzend.
»Corvin, man hat mich abgesetzt«, rief er ihm kläglich zu.
Tiedemann bot ein Bild des Jammers, wie er zusammengesunken, die Arme auf die Tischplatte gelegt, Corvin von unten herauf anstarrte.
Corvin mußte unwillkürlich lachen. Er hielt die Arretierung für einen Scherz.
»Was war denn los?« erkundigte er sich.
»Schufte, Hundsfötter, Verräter alle!« wetterte Tiedemann los.
»Wer?« wollte Corvin wissen.
»Biedenfeld und seine Offiziere. Soll er den Kommandanten machen. Ich habe die Schnauze voll.«
Corvin kannte den Oberst inzwischen. So ernst brauchte man diese seine Absicht nicht zu nehmen.
»Erzählen Sie erst mal, dann werden wir weitersehen«, beruhigte er ihn.
Halb wehleidig, halb erzürnt erzählte Tiedemann, was sich zugetragen hatte.
Der Vorfall paßte zu den kleinlichen Zänkereien, mit denen sich auch Corvin vom ersten Tag an herumschlagen mußte und die viel Unfrieden unter der Besatzung stifteten.
Es ging um die Tuch- und sonstigen Vorräte. Die Volkswehren und Freischaren wollten sich daraus wenigstens notdürftig einkleiden. Die armen Leute hatten meistens zerrissene Schuhe und nur eine Bluse über dem Hemd, die wenig wärmte. Die Nächte waren oft naß und kalt. Die gut ausstaffierten Soldaten, namentlich von Biedenfelds drittem Regiment, meinten jedoch, daß die Vorräte ihnen gehörten, und betrachteten jeden Rock, jeden Mantel, den ein Volkswehrmann erhielt, als einen an ihnen begangenen Raub. Darüber kam es sogar zu Schlägereien. Auch die Offiziere spekulierten auf die Vorräte, mit denen sie ihre Finanzen aufbessern wollten. Um den Streit zu schlichten, stellte Tiedemann persönlich jede Anweisung auf ein paar Hosen aus. Das schuf erneut böses Blut, weil sich die Offiziere nicht bevorzugt sahen. Als sie ihm obendrein Unfähigkeit vorwarfen und ihrem Ärger Luft machten, daß nicht ihr Oberst Biedenfeld Gouverneur geworden war, beschimpfte Tiedemann sie in seiner Hitzigkeit als »Schufte, Hundsfötter und Verräter«.
Die ehrenrührige Beleidigung machte unter den Offizieren des dritten Regiments die Runde und löste Empörung aus.
Sie drangen in das Gouvernementsbüro ein, erklärten den Oberst für abgesetzt, bis ein Kriegsgericht über sein Betragen geurteilt haben würde.
»Warum haben Sie sich das gefallen lassen?« fragte Corvin.
Tiedemann hob resignierend die Schultern.
»Was sollte ich machen? Mich mit dem Säbel gegen fünf Mann verteidigen?«
»Ich hätte es getan«, sagte Corvin. Er stellte sich vor, wie er blankgezogen hätte, in der Rechten den Säbel, in der Linken einen Stuhl für die Abwehr.
Im Duellieren und Fechten stand er seinen Mann. Das hatte er schon als Kadett bewiesen. Als die »Ilias« in der Kadettenanstalt gelesen wurde, verwandelten sich die Jungen sämtlich in Griechen und Trojaner, fertigten sich Helme und Schilde von Pappdeckeln an, die mit dem jeweiligen Familienwappen geschmückt wurden. Auf dem Schulhof kam es zu den hitzigsten Schlachten mit hölzernen Schwertern und zugespitzten Bohnenstangen, die als Speere dienten. Er focht als Grieche und suchte stets den Kampf gegen mehrere gleichzeitig. Das brachte ihm Ansehen ein unter den Jungen. Als die spitzen Lanzen verboten wurde, setzten sich die Schlachten als Reiterkämpfe fort. Die stärkeren Jungen nahmen auf ihren Nacken andere, die sich mit den Beinen festklammerten. So rückten die Scharen gegeneinander. Nachdem einige Armbrüche auch dieses Spiel in Verruf gebracht hatten, rückte man auf Krückenstelzen gegeneinander, was noch gefährlicher war, da jeder den anderen an Höhe der Stelzen zu übertreffen suchte.
Die Spiele, sofern sie nicht zu Verletzungen führten, fanden bei den Ausbildern und Lehrern Billigung. Sie stählten nach ihrer Ansicht den Mut, stärkten Geist und Körper. Dazu gehörte auch das Duellieren, wenn es um die Ehre ging. Mit einem Kindersäbel focht Corvin sein erstes Duell aus. Graf Seyssel d’Aix hatte ihn beleidigt. Hinter einem Akaziengebüsch fuchtelten sie sich so lange mit dem Säbel vor der Nase herum, bis ein paar Tropfen Blut auf der Hand Genugtuung verschafften. Später gehörten Duelle, ob mit Säbel oder Pistolen, zu seinem Image als Leutnant.
Eine Schmach hätte Corvin von Kind an nicht auf sich sitzen lassen. Er konnte Tiedemann nicht verstehen, der doch im griechischen Krieg mit der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet worden war.
»Wem hätte es genützt, wenn man Sie aufgespießt hätte?« bemerkte Tiedemann, mehr zur eigenen Rechtfertigung.
Corvin unterdrückte ein mokantes Lächeln. Der Ehrenkodex eines Edelmannes ließ sich eben nicht mit dem anderer Stände vergleichen. Hieß es nicht, Tiedemann sei als Dragonerleutnant aus der Armee des badischen Großherzogs ausgeschieden, weil er ein Duell nicht mitgemacht hatte?
»Mich hat eine militärische Angelegenheit zu Ihnen geführt«, wechselte Corvin das Thema und erläuterte in kurzen Zügen seinen Plan, einen Ausfall nach Rheinau zu unternehmen.
»Schön und gut«, pflichtete Tiedemann ihm bei, »aber den Befehl kann nur der Kommandant geben. Im Augenblick haben wir keinen. Erst muß diese Frage geklärt sein.«
»Wenn es dann nicht zu spät ist!« Corvin faltete wütend die Skizze zusammen, die er für die Operation entworfen hatte.
»Ich werde mich darum kümmern. Warten Sie hier auf meinen Bescheid.«
Tiedemann war ohnehin zu keinem Entschluß fähig. Corvin sah ein, daß er für ihn handeln mußte, und zwar in einer Weise, daß sich solche Vorfälle nicht wiederholten und die nötige Eintracht in der bunt zusammengewürfelten Garnison wiederhergestellt würde.
Zu diesem Zweck rief er sämtliche Offiziere, die nicht im Dienst waren, zu einer Versammlung im Schloßsaal zusammen. Er rechnete mit Aufsässigkeiten und Tumulten, denn die Offiziere des dritten Regiments hatten in ihren Reihen und unter der Bürgerwehr Stimmung gemacht.
Corvin hielt für alle Fälle die in der Nähe des Schlosses gelegene Flüchtlingslegion in Bereitschaft, zuverlässige Leute, die notfalls den Saal mit Gewalt räumen würden, wenn keine Einigung zustande käme. Er war nicht gewillt, den Forderungen der Gegenpartei nachzugeben. Schwäche zu zeigen, untaugliche Kompromisse zu schließen, könnte eine Kette von Widersetzlichkeiten zur Folge haben, und das würde sich verheerend auf den Geist der Besatzung auswirken.
Um drei Uhr nachmittags füllte sich der Saal, in welchem Prinz Eugen und der Marschall Villars 1714 den spanischen Erbfolgekrieg beendet hatten, mit aufgeregten Offizieren aller Regimenter und Freischaren.
Am Präsidiumstisch vor dem großen Kamin hatten Tiedemann, Corvin, Biedenfeld als Kommandeur des dritten Regiments, Elsenhans als Protokollant und der Kriegsminister Stellvertreter Enno Sander als Präsident Platz genommen.
Corvin beobachtete sorgfältig die Stimmung und bemerkte, daß die rebellischen Offiziere sich nahe dem Ausgang zusammenstellten.
Wollten sie gegebenenfalls das Präsidium stürmen und die Versammlung auflösen? Es galt, auf der Hut zu sein.
Major Weik vom dritten Regiment machte sich als erster zum Sprecher der Gegenpartei. In aufreizender Rede griff er Tiedemanns Berechtigung an, Gouverneur zu sein, da er nicht gewählt sei, sondern von General Mieroslawski eingesetzt.
Er beschuldigte ihn der unehrenhaften Beleidigung und Zurücksetzung badischer Offiziere gegenüber den Freischarführern und verlangte seine Absetzung.
Seine Rede endete in Beifall und Lärm. Säbel rasselten, Aufrührer und Gutgesinnte schrien sich gegenseitig nieder.
Sander läutete unentwegt die Klingel, bis endlich so weit Ruhe eintrat, daß Tiedemann sich Gehör verschaffen konnte.
Er sprach weitschweifig und ohne Faden. Die Teilnehmer hörten ihm mehr aus Anstand als aus Aufmerksamkeit zu.
Am Schluß schnallte er seinen Säbel ab, legte ihn auf den Tisch und erklärte sich bereit abzudanken.
»Kommt nicht in Frage!« rief Corvin mit schneidender Stimme in den Saal. Das Geraune wich einer plötzlichen Stille, die er nutzte, um zu den Versammelten zu sprechen.
Nach anfänglichen, auf den Vorfall bezogenen sachlichen Argumenten steigerte er sich bald in Leidenschaft. Gedanke auf Gedanke stellte sich ein, die sich flugs zu Sätzen formten.
Der Schriftsteller brach in ihm durch. Er schlug alle Saiten an und verschmähte auch Pathos nicht. Er sprach von dem hohen Ziel, das sie verfolgten, von Ruhm und Ehre, Freiheit und Vaterland. Er beschwor Eintracht und brüderliche Liebe, die sie bei ihrem Werk vereinigen müsse, und tadelte ihre kleinlichen Streitereien. Er flocht einen Brief seiner Frau ein, in dem sie ihm geschrieben hatte, er solle sich lieber erschießen als sich den Preußen ergeben.
Er sprach aus dem Innersten seines Herzens, wie ihm – erfüllt von einer wichtigen Mission – in dieser Stunde zumute war. Er geriet nun einmal leicht ins Feuer der Begeisterung.
So heißblütig hatte er den Ausbruch der Revolution in Berlin begrüßt, in Paris im Februar auf den Barrikaden gekämpft, mit Georg Herwegh die »Deutsche Legion« geschaffen, um mit ihr in Süddeutschland einzufallen und dort den Aufruhr zu entfachen. Oft mußte er die hungrigen, verzagt gewordenen Freischärler aufrütteln, als sie von Frankreich aus über den Rhein setzten und in ermüdenden Märschen über die Pässe zogen. So hatte er mit Herwegh an der Spitze die Expedition geleitet, die dann nach dem ersten Gefecht auf deutschem Boden leider ein rasches, wenig rühmliches Ende fand. Ein Bataillon württembergischer Infanterie hatte genügt. Mit erneutem Enthusiasmus hatte er sich der badischen Revolution zur Verfügung gestellt. Von ihr war ein erfolgreicherer Verlauf zu erwarten gewesen. Sie brach zum richtigen Zeitpunkt aus, als die Landesherren ihre Macht zurückzugewinnen suchten, die ihnen in der Märzrevolution 1848 verlorengegangen oder geschmälert worden war. König Wilhelm IV. hatte sie schon ein Halbjahr später mit Hilfe der Armee in Preußen wiederhergestellt. Alle in den Barrikadenkämpfen erworbenen bürgerlichen Rechte und Freiheiten wurden abgeschafft. Auch in Süddeutschland erstarkte die Reaktion. Die großherzogliche Regierung in Baden schickte sich an, Errungenschaften wie das Wahlrecht und die Pressefreiheit rückgängig zu machen. Aber die Konterrevolution stieß auf den Widerstand der demokratischen Kräfte. Überall in Deutschland gärte es. Als in Ungarn, Italien, Sachsen, im Rheinland im Frühjahr neunundvierzig Aufstände ausbrachen, gab das auch der demokratischen Opposition in Baden und der Pfalz Auftrieb. Sie verlangte von der Regierung die Annahme und Durchsetzung der in der Frankfurter Nationalversammlung beschlossenen Reichsverfassung, die zum erstenmal in der deutschen Geschichte dem Volk demokratische Grundrechte garantierte. Die anfängliche Weigerung des Großherzogs spitzte die Auseinandersetzungen zu. Auch unter den Soldaten wuchs die revolutionäre Stimmung. In der Festung Rastatt kam es Anfang Mai wegen der unerträglichen Lebensbedingungen zu einer Militärrebellion. Truppen anderer Garnisonen schlossen sich ihr an und vereinigten sich mit den aufständischen Volkskräften.
Fast die ganze badische Armee hatte sich der rasch wachsenden Revolution zur Verteidigung der Reichsverfassung angeschlossen. Der Großherzog Leopold floh mit seinen Ministern nach Frankfurt am Main. Ein gemäßigt demokratischer Landesausschuß übernahm die provisorische Regierung.
Baden bildete in diesem Frühjahr für ganz Deutschland das Zentrum einer wiederbelebten Revolution.
Nur standen an ihrer Spitze nicht entschlossene Republikaner, sondern Kleinbürger, die bemüht waren, die revolutionäre Volksbewegung in »gesetzlichen Bahnen« zu halten und sie sich nicht weiter ausbreiten zu lassen. So konnten die konterrevolutionären Kräfte ungehindert Gegenmaßnahmen zur Rückeroberung ihrer Macht einleiten. Sie riefen preußische Interventionstruppen zu Hilfe. Damit begann der bewaffnete Kampf in der Pfalz und in Baden.
Nach dem bisherigen enttäuschenden Verlauf machte sich Corvin über den Ausgang der Revolution nur noch geringe Hoffnungen. Die fortwährenden Mißerfolge der demokratischen Bewegung im vergangenen halben Jahr, die lähmenden, endlosen Debatten im Frankfurter Parlament hatten ihn Möglichkeiten und Gegenkräfte nüchterner einschätzen lassen.
Aber das hatte nichts mit dem militärischen Auftrag zu tun, die Festung nicht in die Hände des Feindes fallen zu lassen.
Seine Rede löste einen größeren Tumult als vorher aus, als wäre endlich das befreiende Wort gesprochen worden.
Die Versammelten klatschten wie rasend, rissen ihre Säbel aus der Scheide und streckten sie in die Höhe, umarmten sich in Liebe und Kameradschaft. Die Gegner standen verwirrt, gerührt und waren beschwichtigt, als man ihnen die Hände zur Versöhnung reichte.
Tiedemann fiel Biedenfeld um den Hals und küßte ihn im Überschwang, bot ihm wieder seinen Säbel an: »Bruder, sei du Gouverneur. Dir steht es eher zu.«
Biedenfeld lehnte poltrig, wie seine Art war, ab: »Ich bin ein alter Soldat, kann ein Regiment führen, aber von Schreibereien verstehe ich nichts.«
Arm in Arm schritten die beiden aus dem Saal.
Es blieb alles beim alten.
Corvin beglückwünschte sich innerlich. Den Erfolg schrieb er seiner Beredsamkeit zu. Er staunte selbst darüber, wie die Kraft der Rede Menschen verwandeln kann, wenn sie nur überzeugend genug eingesetzt wird. Er sah voraus, daß er noch manches Mal zu diesem Mittel würde greifen müssen.
Als der Saal sich allmählich leerte, trat Major Heilig auf ihn zu. Er war Kommandeur der Festungsartillerie. Ein baumlanger Mann, der Corvin um einen Kopf überragte. Er gehörte zu jenen Soldaten der Rastatter Garnison, die vor zwei Monaten im Schloßhof den Aufstand ausgelöst hatten, der bald ganz Baden erfaßte. Heilig reichte ihm die Hand.
»Das war ein deutliches Wort zur rechten Zeit«, sagte er und bedankte sich im Namen aller Männer, die treu zur Revolution standen.
Die Anerkennung freute Corvin. Er schätzte Heilig sehr, den er als einen gradlinigen, tapferen und uneigennützigen Menschen kennengelernt hatte. Im Kriegsrat konnte er meist auf ihn zählen, wenn Maßnahmen zur Ordnung und Disziplin zur Sprache kamen.
Über dem Hader war die Zeit vergangen, ein ganzer Tag vertan. Noch spät an diesem Abend – es regnete in Strömen – wurde die Festung alarmiert. Die Preußen waren in Rheinau eingedrungen, um die dort aufgehäuften Vorräte und besonders das Vieh herauszuholen. Die Festungsgeschütze schickten ein paar Salven hinüber, aber das hinderte die Preußen nicht, den größten Teil der Bestände fortzuschaffen.
Die Festung wurde vom zweiten Korps der preußischen Rheinarmee umzingelt. Sein Stabsquartier befand sich in Kuppenheim, eine halbe Stunde Wegs nordöstlich von Rastatt.
Bei den Rückzugsgefechten, die sich vor wenigen Tagen die Revolutionstruppen und eine bedeutende preußische Übermacht hier lieferten, wurde das Dorf in Brand geschossen.
Versengte Dachbalken und Schornsteine, geborstene Mauern boten das düstere Bild einer vom Krieg zerstörten menschlichen Ansiedlung, in der alles friedliche Leben erloschen war. Die Bewohner hatten ihr Heimatdorf, ihre Wiesen und Äcker den Belagerern überlassen müssen, die sich nach allen Seiten über die Gemarkung wie Heuschreckenschwärme ergossen. In kurzer Zeit verwandelte sich die Ebene, durch die sich die Murg gemächlich schlängelte, in ein Heerlager mit Schanzen, Depots, Pferdeunterkünften, Mannschaftszelten und dem dazugehörigen lebhaften Treiben der Soldaten aller Truppenteile, die das Armeekorps zusammengezogen hatte. Landwehr, Husaren, Dragoner, Jäger, Artilleristen richteten sich erfindungsreich unter den primitiven Bedingungen, wie sie ein offenes Feldlager mit sich bringt, auf eine anhaltende Belagerung ein.
Hinter den letzten Häusern des Dorfes, in einem von Sträuchern begrenzten Areal, stand das Stabszelt des kommandierenden Generals, des Grafen von der Gröben. Äußerlich unterschied es sich von den grauen Armeezelten nur durch die aufgepflanzte schwarz-weiße Standarte und den Posten vor dem Eingang. Die Einrichtung bestand aus einem Schreibtisch und ein paar Stühlen. Es diente dem Generalleutnant zu Lagebesprechungen, Audienzen und Befehlsübergaben.
Sein Nachtquartier hatte er in dem nahe gelegenen Schloß Favorite bezogen. Dicht am Zelteingang war unter einer Plane ein schmaler Tisch mit einem Klappstuhl für den Adjutanten aufgestellt, der sich für die Befehle des Grafen bereithielt.
Pünktlich zur befohlenen Zeit, um vierzehn Uhr dreißig, betrat der Kürassierleutnant Karl Friedrich Graf von Schmettow das Stabszelt und meldete sich salutierend zur Stelle.
Er war ein hagerer, hochgewachsener Mann, den die weiße Uniform mit dem metallenen Küraß kaum stattlicher machte. Er hatte ein ovales Gesicht mit farblosem Oberlippenbart, eine hohe Stirn, strähniges, rotblondes Haar. Man hätte ihn jünger als siebenunddreißig Jahre schätzen können, da der Ausdruck seines Gesichts mit den fast melancholischen Augen dem eines träumerischen Kindes glich.
Dagegen ließen die steilen Falten zwischen den Augenbrauen, die fahle Blässe der Haut ihn wesentlich älter erscheinen.
Gröben forderte ihn auf, vor dem Schreibtisch Platz zu nehmen, und setzte sich selbst in seinen Armsessel dahinter.
Schmettow hielt den Kürassierhelm auf dem Schoß und nahm eine aufrechte Haltung ein. Schenkel und Oberkörper bildeten akkurat einen rechten Winkel.
Die Kommandierung ins Stabszelt hatte ihn überrascht, denn er gehörte nicht zu den Offizieren, die vom Generalleutnant unmittelbar Befehle empfingen. Zwar kannte Gröben alle seine Offiziere, tauschte, wenn es sich ergab, auch privatim einige verbindliche Worte mit ihnen aus, er war ein höflicher, konzilianter Chef, bevorzugte jedoch keinen, es sei denn, daß er gegenüber dem Grafen Schmettow einen etwas wohlmeinenderen Ton anschlug, denn er stand einst mit dessen Vater auf vertrautem Fuß. Im allgemeinen wahrte er die Distanz eines Ranghöchsten gegenüber seinen Untergebenen.
Ja, er verbreitete um sich eine gewisse Unnahbarkeit, wie sie von Menschen ausgeht, die innerlich sehr einsam sind.
Er hatte bereits die Sechzig überschritten. Sein schütteres Haar, weit hinter der Stirn ansetzend, fiel in der Mitte gescheitelt über die Ohren und lockte sich an den Enden. Er trug einen Mund- und Backenbart, bei freiem Kinn. Die Augen blickten freundlich und milde, wie überhaupt sein Auftreten weder gebieterisch noch forsch militärisch war. Er wirkte eher wie ein Geheimrat im Waffenrock, dem man das Eiserne Kreuz aus dem Befreiungskrieg gegen Napoleon angeheftet hatte.
Bevor er das Wort an sein Gegenüber richtete, zündete er sich eine Zigarre an, als wollte er damit dem Gespräch einen weniger dienstlichen Charakter geben. Dann erkundigte er sich nach der Unterbringung, Verpflegung, nach der Stimmung der Soldaten. Schmettow gab in kurzen Sätzen Auskunft.
Nichts war zu beklagen, die Stimmung gut, Verpflegung ausreichend, lediglich die Julihitze machte der Mannschaft zu schaffen und das faulige Trinkwasser, das die ersten Ruhrerkrankungen zur Folge hatte.
Gröben blickte besorgt auf die glühende Spitze seiner Zigarre.
»Das kann uns ärger bedrohen als die Festungsgeschütze«, meinte er.
»Ich habe gehört, Seine Hoheit lassen schwere Artillerie heranführen«, erlaubte sich Schmettow zu bemerken, »das wird die Belagerungszeit verkürzen.«
»Die Festung sturmreif schießen? Halten Sie das für das beste Mittel?«
Schmettow glaubte einen ironischen Unterton herauszuhören und wußte nicht, wie er darauf antworten sollte. Der Einsatz der schweren Mörser und Vierundzwanzigpfünder, die von Karlsruhe aus zur Verstärkung der Feldartillerie unterwegs waren, sollte offenbar diesem Ziel dienen. Zumindest schien Seine Hoheit Prinz Wilhelm von Preußen, der den Oberbefehl über die Rheinarmee führte und sein Hauptquartier im Schloß Favorite bei Kuppenheim aufgeschlagen hatte, sich von einem Bombardement viel zu versprechen.
Ob der Generalleutnant anderer Meinung war?
»Es entspräche der Taktik einer Belagerung«, erwiderte Schmettow etwas zaghaft.
Gröben lächelte flüchtig. Seine Stimme klang väterlich, als er einwandte: »So haben Sie es als Kadett gelernt. Überlegen Sie mal die Verluste, ob sie in einem angemessenen Verhältnis zum Erfolg stehen, der uns eo ipso sicher ist. Bei einer Belagerung kommt es darauf an, den Feind zu zermürben. Vor Granaten allein kann er sich in den Kasematten und Reduits schützen. Die haben starke Mauern. Aber wovor er sich nicht schützen kann …« Er brach ab, als hätte er schon zuviel gesagt.
Schmettow empfand den Ausflug in die Militärtheorie wie die Belehrung eines Schülers.
Gröben ging zu einem anderen Thema über. Er bewohnte mit seiner Familie eine Villa in Potsdam, Schmettow hatte in der Potsdamer und Berliner Kadettenanstalt seine Ausbildung erhalten, was Gröben bekannt war. Er fragte nach den Lehrern der Anstalt, nach Schulkameraden und was aus ihnen geworden sei. Schmettow strengte sein Gedächtnis an: von Hartmann, von Blankensee, Friedrich von Sallet, von Schlichten.
Der General wollte wissen, ob er die Verbindung zu den ehemaligen Kameraden aufrechterhalten habe. Schmettow verneinte. Nach dem Leutnantspatent hätten sie sich in alle Winde verstreut, höchstens, daß man sich zufällig in Berlin Unter den Linden oder bei Manöverbällen begegnete.
»Es ist ja auch lange her«, meinte Gröben. Er zog einen Aktendeckel zu sich heran, entnahm ihm ein Zeitungsblatt und reichte es dem Leutnant über den Schreibtisch.
»Schauen Sie sich das mal an, den Aufruf.«
Schmettow warf einen Blick auf den Kopf des Blattes.
»Der Festungs-Bote« stand groß gedruckt im oberen Abschnitt, darunter das Datum: 3. Juli 1849. Er wunderte sich, wie die Zeitung in die Hände des Generals gelangt war.
In dem bezeichneten Artikel hieß es am Schluß: »… Können wir mit unserer zahlreichen Macht, fest aneinandergeschlossen, von einer furchtbaren Artillerie gedeckt, den Feind erwarten. Er wird an unseren Mauern zerschellen. Freiheit oder Tod! So sei Euer Wahlspruch! Er sei der Ruf, der aus den Herzen von sechstausend entschlossenen Männern dem Feind entgegenschallt!«
Etwas ratlos hob Schmettow die Augen. Er wußte nicht, was der General von ihm hören wollte. Daß auf der anderen Seite starke Worte gebraucht wurden, um den Mannschaften Mut einzuflößen, war nichts Besonderes. Das machten sie bei den eigenen Truppen nicht anders.
»Sagen Ihnen die Namen der Verfasser etwas?« fragte Gröben.
Auf sie hatte Schmettow nicht geachtet. Jetzt sah er, daß der Aufruf vom Kommandanten Tiedemann unterzeichnet war und von Oberstleutnant Corvin-Wiersbitzki, Stabschef.
Er starrte auf den Namen. Sein Gesicht rötete sich vor Verwirrung und Verlegenheit. Er wurde schnell rot, wenn ihn etwas aus der Fassung brachte. Dieses kindliche Symptom hatte er zu seinem Ärger immer noch nicht überwunden.
»Corvin meine ich«, hörte er den General sagen.
Die Stille, in der er nach einer unverfänglichen Antwort suchte, wurde jäh von einem hohen surrenden Geräusch, wie von einem Schrapnellsplitter, zerrissen. Eine dicke Schmeißfliege hatte ein Schlupfloch ins Zelt gefunden und flog unüberhörbar von einem Winkel zum anderen, umschwirrte den Kopf des Leutnants.
Fliegen, Mücken, Hornissen, angelockt von den Feldküchen, Abfällen, Latrinen des Lagers, plagten Menschen und Tiere, besonders die Pferde. Die heiße Jahreszeit brütete sie zu Millionen aus. Man konnte sich ihrer kaum erwehren. Dem Leutnant kam diese eine nicht ungelegen, lenkte sie doch die Aufmerksamkeit des Generals ab. Offenbar hatte sie dessen feuchte Vorderglatze – es herrschte eine stickige Schwüle im Zelt – als Landeplatz erkoren, den sie nun immer wieder anflog. Gröben wedelte sie ärgerlich mit der Hand weg.
Schmettow gewann einige Sekunden, seine Gedanken zu sammeln.
»Gewiß kannte ich Corvin, Exzellenz«, sagte er betont gleichmütig. »Er war als Kadett mein Korpskamerad. Auf ihn war ich nicht gekommen.«
Das war eine Lüge. Auf ihn war er zuerst gekommen, als Gröben nach den ehemaligen Kameraden gefragt hatte. Immer wäre er auf ihn zuerst gekommen. Erklärend setzte er hinzu: »Es gibt Namen, die man am besten vergißt.«
Gröben warf ihm hinter den Rauchwolken einen prüfenden Blick zu, dann nickte er unmerklich.
Schmettow spielte auf jene Aristokraten an, die mit der Armee und der Tradition gebrochen hatten, zu denen auch Corvin gehörte. Ihn hatte er jedoch aus einem anderen Grund nicht erwähnt. Mit ihm verbanden sich Erinnerungen, die lange nachgewirkt hatten, über die Kadettenzeit hinaus, ja, ihn zuweilen immer noch heimsuchten, wenn er den Namen hörte. Und sein Träger hatte dafür gesorgt, besonders im Zusammenhang mit den politischen Ereignissen in Deutschland und der Insurrektion in Baden, bei allen, die ihn von früher her kannten, nicht in Vergessenheit zu geraten.
Es wäre Schmettow peinlich gewesen, über ihn noch mehr befragt zu werden. Corvin war für ihn schließlich nicht ein Schulkamerad wie jeder andere gewesen. Ob das der General wußte? Daß er ihn anscheinend absichtsvoll genannt hatte, verunsicherte den Leutnant. Was bezweckte Gröben damit? Überhaupt kam ihm die Konversation sonderbar vor. Die Beziehung zum Vater, dem Oberst Graf von Schmettow, der einmal im gleichen Regiment wie Graf von der Gröben gedient hatte, konnte nicht der Grund sein, soviel Zeit für eine fast intime Plauderei zu opfern. Also welche Absichten verfolgte er?
Gröben stand auf, ging um den Schreibtisch herum auf Schmettow zu, der sich ebenfalls erhoben hatte und Haltung annahm.
»Herr Leutnant, ab sofort sind Sie vorübergehend zu meinem Stab abkommandiert, zur besonderen Verwendung«, sagte Gröben in befehlendem Ton. »Ihr Kommandeur ist bereits unterrichtet. Melden Sie sich bei ihm und halten Sie sich von morgen früh an zur Verfügung.«
Der Befehl verschlug Schmettow vor Überraschung die Sprache. »Jawohl, Exzellenz!« stammelte er und wurde wieder rot.
Gröben fügte keine weitere Erklärung hinzu, reichte ihm die Hand. »Ich bin überzeugt, Sie werden Ihre Sache gut machen.«
»Gehorsamsten Dank, Exzellenz!«
Damit war Leutnant Graf von Schmettow entlassen.
Während er aufgeregt durch das Lager zu seinem Quartier stolperte, über die merkwürdige Abkommandierung und »besondere Verwendung« grübelte, hatte sich der Generalleutnant wieder in seinen Sessel hinter dem Schreibtisch begeben, um die Zigarre zu Ende zu rauchen.
Er nahm das Zeitungsblatt, den »Festungs-Boten«, zur Hand, um es in den Aktendeckel zurückzulegen. Es war von Vertrauensleuten aus der Stadt geschmuggelt worden. Weitere sollten folgen. Sie gaben allerlei Aufschlüsse über Stimmung und Personalien. Gesammelt in dieser Mappe, würden sie auch nach dem Sieg noch gute Dienste leisten.
Sein Blick fiel auf den Namen Corvin-Wiersbitzki. Der Mann war ihm aus den Adelskreisen bekannt. In den Salons war vor Jahren über seine Eskapaden und sein lästerliches, gottloses Buch geredet worden. Bald verlor man kein Wort mehr über ihn, nach ungeschriebenen Regeln existierte er nicht mehr für die Gesellschaft.
Gröben war wieder auf den Namen gestoßen als den des verantwortlichen Kommandeurs, der Ludwigshafen in Brand schießen ließ, nachdem preußische Truppen es besetzt hatten.
Und jetzt trieb er also als Stabschef in der Festung sein Unwesen!
Ein Mann, so meinte Gröben, der im Vergleich zu Biedenfeld, Böning, Tiedemann, die mehr oder weniger zufällig oder aus persönlicher Eitelkeit oder Verärgerung auf die andere Seite geraten waren, unberechenbar war, möglicherweise auch bedenkenloser. Wenn er gegen jene Führer das Übergewicht bekäme, was Gröben ihm zutraute, wäre er der Kopf der Verteidigung. Wie sah es wohl in diesem Kopf aus, und wie standhaft, in dem Falle verblendet, mochte dieser Mann sein?
Die Fliege summte noch immer im Zelt herum. Gröben verfolgte ihre steilen Flüge. Seine Gedanken begannen um den Feldzug zu kreisen. Er wußte, daß er es mit Gegnern zu tun hatte, die sich nicht so schnell ergeben würden, weil zur militärischen Stärke noch ein gewisser Fanatismus hinzukam, so daß der Kampf auch auf dem geistigen Feld zu führen war, wollte man ihn mit den geringsten Verlusten beenden. Dazu müßte man listenreich und Schritt für Schritt vorgehen. Gröben hatte sich einen Plan zurechtgelegt, den er vorläufig für sich behielt. Ihn Seiner Königlichen Hoheit zu unterbreiten war immer noch Zeit, wenn abzusehen war, daß er Erfolg versprach. Wenn es nach dem Prinzen ginge, sollte kurzer Prozeß gemacht werden. Ihn verlangte es, die schwere Artillerie auszuprobieren. Feuer aus allen Rohren und dann mit Hurra durch die Breschen! Koste es, was es wolle! Hauptsache, schneller Sieg und Ruhm für den Feldherrn! – Und der Prinz, den das Volk »Kartätschenprinz« nannte, war eitel genug, sich als großer Feldherr vorzukommen. Dabei hatten seine Armeegeneräle bisher den Feldzug siegreich geführt, und auch er, von der Gröben, gedachte dies zu tun.
Monarchen sollten regieren und die Kriegführung ihren Generalstäblern überlassen, knurrte Gröben vor sich hin. Hier in Rastatt wird die letzte Schlacht geliefert. Die Festung fällt uns wie eine reife Frucht in die Hände, wenn wir nur Zeit und Geduld aufbringen. Man opfert nicht seine Soldaten zu Hunderten oder Tausenden, wenn es auch andere Mittel gibt, und man zerstört nicht leichtfertig eine Reichsfestung, zwanzig Kilometer vor der französischen Grenze, wegen einer Meute Aufrührer.
Gröben seufzte bei dem Gedanken, dies seinem Oberbefehlshaber klarmachen zu müssen, der es nicht erwarten konnte, mit dem »Gesindel« abzurechnen. Er drückte die Zigarre im Aschenbecher aus und klappte die Mappe zu. Am Rand des Schreibtisches ruhte sich die Fliege aus, ermüdet von ihrem Herumirren, und rieb sich die Vorderbeine. Ein trockener Knall beendete ihr lästiges Dasein. Gröben schnippte mit dem Lineal ihren Kadaver vom Aktendeckel.
Eine dünne Spur aus Blut und gelbem Brei blieb zurück, die in der heißen Luft rasch trocknete und einen Fleck auf der blauen Pappe hinterließ.
Am Vormittag des folgenden Tages schwemmte die Murg wohl an ein Dutzend verkorkter Flaschen in die Festung hinein. Manche blieben im Ufergestrüpp hängen, andere wurden von Soldaten herausgefischt und geöffnet. Die Flaschen enthielten ein zusammengerolltes Papier. Auf dem stand geschrieben.
Bewohner Rastatts!
Die Festung ist von meinem Armeekorps umschlossen; zwei andere Armeekorps verfolgen die Freischaren, welche in Flucht und Auflösung sind. Die Ereignisse der letzten Tage müssen Euch belehren, daß Entsatz unmöglich, Widerstand fruchtlos ist und über Eure Stadt nur alle die traurigen Folgen einer Belagerung bringen würde. Noch liegt es in Eurer Hand, sie Euch zu ersparen, wenn Ihr die Tore öffnet. Ich gebe Euch eine Bedenkzeit von vierundzwanzig Stunden.
Laßt Ihr sie ungenützt verstreichen, so beginnt der Angriff, und von Unterhandlungen kann nicht mehr die Rede sein.
(gez.) K. Gr. v. d. Gröben
Kommandierender General des 2. Korps der Rheinarmee
Die Soldaten schütteten sich über den Text vor Lachen aus. In Ermangelung von Belagerungsgeschützen griffen die Preußen mit Papier an, spotteten sie, Papier sei wohlfeiler als Pulver und Blei und ließe sich mit faustdicken Lügen bedrucken. Sie ließen die Zettel zur Belustigung von Hand zu Hand gehen.
Es gab unter den Soldaten und Offizieren auch ein paar Schwarzseher, die über den Inhalt des Schreibens bedenkliche Gesichter machten oder ihm sogar Glauben schenkten.
Doch sie kamen nicht an gegen die Mehrheit, für die die Flaschenpost nichts weiter als »preußische Pfiffe« waren, ängstliche Leute zu erschrecken und Zwietracht zu säen.
Die Botschaft gelangte auch zu den Bürgern, die sie eilig ihrem Bürgermeister Herrn Sallinger übergaben und ihn aufforderten, bei der Festungsleitung wegen einer Übergabe zu sondieren.
Es traf sich, daß Herr Sallinger an den Stabschef Corvin geriet, weil Tiedemann nicht bereit war, ihn zu empfangen. Mit Zivilisten habe er nichts zu schaffen, ließ er ihn abweisen. Er fürchtete wieder Beschwerden über Soldaten, die in Wirtshäusern randalierten oder Zechen nicht bezahlten.
Herr Sallinger war hartnäckig, holte zur Verstärkung zwei Stadtverordnete und drang, wenn schon nicht beim Kommandanten, dann wenigstens bei seinem Stabschef, ohne Voranmeldung in dessen Wohnung ein.
Corvin hatte sich gerade zum Ausritt angekleidet, die Forts und Wälle zu inspizieren, und Herrmann in den Marstall vorausgeschickt. Der Auftritt Sallingers und seiner Begleiter hielt ihn auf. Obendrein wurmte ihn die Dreistigkeit, mit der diese Leute einfach in seine Privaträume eindrangen. Er forderte sie erst gar nicht zum Sitzen auf und fragte kühl nach ihren Wünschen.
Sallinger überreichte ihm die Botschaft Gröbens.
»Die erste Nachricht von draußen – und keine erfreuliche.«
Corvin las sie stirnrunzelnd. Er glaubte kein Wort, was darin über die Freischaren, das heißt Sigels Armee, geschrieben stand. Gröben bluffte nur und wollte offensichtlich die Kapitulanten unter der Einwohnerschaft gegen die Besatzung aufwiegeln.
Betont langsam riß Corvin das Schreiben ein-, zweimal durch und ließ die Schnipsel zu Boden fallen.
»Das ist doch – !« entrüstete sich Sallinger.
»Die einzige Antwort darauf, Herr Bürgermeister«, sagte Corvin.
»Wir sind anderer Meinung, Herr von Corvin«, Sallinger stieß seinen Stock heftig auf den Fußboden, »ich spreche im Namen vieler Bürger!«
Corvin schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab.
»Belanglos, meine Herren. Wir befinden uns im Krieg. Die Bürger, die das Glück oder Unglück haben, in einer Festung zu wohnen, müssen sich darauf gefaßt machen, daß sie bei einer Belagerung keine Stimme haben. Und wir sind durchaus nicht geneigt, Ihnen eine solche einzuräumen. Das merken Sie sich ein für allemal.«
»Ich tue, was mir mein Amt gebietet«, entgegnete Sallinger, »nämlich die Bürger dieser Stadt vor Schaden zu bewahren.«
»Sie haben sich lediglich um Ihren Zivilkram zu kümmern.«
»Wenn wir Bürger nur das getan hätten, Herr von Corvin«, erwiderte Sallinger, »hätte es im vorigen Jahr keine Revolution in Deutschland gegeben. Sie war unsere Idee, nicht die der Militärs, unsere Hoffnung auf demokratische Verhältnisse, auf einen freien Handel und Wandel in einem geeinten Vaterland. Und das gleiche gilt für den Aufstand hier in Baden. Wir waren doch Verbündete, Demokraten und die Armee. Wir haben Sie in der Stadt mit offenen Armen empfangen. Warum ziehen Sie jetzt einen Trennungsstrich zwischen uns?«
»Sie mischen sich in militärische Dinge ein. Davon verstehen Sie nichts.«
»Die Preußen werden unsere Stadt beschießen. Das ist nicht nur eine militärische Angelegenheit.«
»Dann veranlassen Sie, daß die Bürger Schutz suchen in den Kellern und Kasematten. Im übrigen wird unsere Artillerie auch ein Wörtchen mitreden.«
»Und unsere Häuser, unser Hab und Gut?« rief Sallinger erregt.
»Die Preußen werden ja wohl nicht auf Bürgerhäuser zielen«, erwiderte Corvin knapp.
Sallinger wandte sich zu seinen Begleitern um. Sie waren in der Nähe der Tür stehengeblieben und wagten angesichts der frostigen, unnachgiebigen Haltung des Stabschefs nicht, sich einzumischen.
»Und wenn es stimmt, was der General geschrieben hat?« fragte der Bürgermeister.
»Lächerlich!« Corvin winkte verächtlich ab. »Gröben will uns in die Irre führen. Das liegt doch auf der Hand. Er nutzt es einfach aus, daß wir von jeder Nachricht abgeschnitten sind. Seien Sie unbesorgt, die Belagerung wird bald vorüber sein.«
»Wo ist er denn, Ihr General Sigel mit seiner Armee? Warum hört man nichts von ihm?« fragte Sallinger skeptisch.
Diese Frage stellte sich Corvin neuerdings selbst.
»Wie denn?« entgegnete er unwillig. »Leider kann er keine Depeschen schicken.«
»Man hat versichert, die Festung nach acht Tagen zu übergeben, wenn Sigel sie nicht entsetzt«, erklärte Sallinger.
»Wer hat das versichert?« wollte Corvin wissen.
»Ihre Offiziere.«
»Welche?«
Sallinger schwieg.
»Welche?« fragte Corvin noch einmal streng.
»Dragoner vom dritten Regiment«, gestand Sallinger.
Corvin sah mißtrauisch von einem zum anderen. Die »Ergebungsphilister«, wie Elsenhans die kleinmütigen Bürger in seinen Artikeln bezeichnete, bekamen es mit der Angst, daß ihnen schreckliche Tage bevorstünden, und intrigierten bereits.
Noch stellten sie keine Gefahr dar. Bei den Soldaten kamen sie übel an. Die Artilleristen hatten erklärt, sie würden kurzerhand die Geschütze wenden, falls die Bürgerschaft Verrat üben sollte. So machten sich die Kapitulanten an die Offiziere heran, spickten sie womöglich mit Geld, zahlten ihre beträchtlichen Zechen in den Weinstuben und flüsterten ihnen defätistische Parolen ins Ohr.
Dieser Bürgermeister war Corvin nicht geheuer, obwohl man ihm Lauterkeit und Parteinahme für die revolutionäre Bewegung nachsagte. Tatsächlich hatte er für die Aufnahme und Unterbringung der Truppen viel getan, als sie nach der Niederlage an der Murg in die Festung geflohen waren.
Er besaß die Brauerei in der Stadt. Wie er nun mit seiner massigen Figur, um den Kugelbauch die graue Weste mit der goldenen Uhrkette gespannt, den Zylinder in der einen Hand, in der anderen den Stock mit dem Elfenbeingriff, fest wie eine Säule vor Corvin stand, erinnerte er ihn an seinen reichen Schwiegervater, auch ein Fabrikant, der nichts unversucht gelassen hatte, die Heirat seiner Tochter mit dem mittellosen preußischen Leutnant zu verhindern. Dasselbe überhebliche Selbstbewußtsein, gepaart mit Anmaßung, derselbe unverschämte, abschätzende Blick, als würde er ihn – einen Edelmann! – auf seinen Geldwert taxieren. Corvin mußte sich beherrschen, um seine unwillkürliche Abneigung nicht allzu deutlich spüren zu lassen. Aber eine Warnung sollte ihm auf den Weg gegeben werden.
»Wenn ich dahinterkomme, Herr Sallinger, daß Sie die Soldaten und Offiziere aufputschen, lasse ich Sie erschießen«, drohte er.
»Weder ist es meine Absicht, Soldaten aufzuputschen, noch schreckt mich Ihre Drohung«, entgegnete Sallinger ruhig. »Welche Garantie können Sie uns geben, daß die Angaben des Generals Gröben nicht stimmen und daß die Belagerung bald vorüber sein wird? Keine, wie ich sehe!«
»Sigel hat sich ehrenwörtlich verpflichtet –«
Sallinger hob nur skeptisch – wie Corvin meinte, spöttisch – die Augenbraue.
»Herr! Sie zweifeln wohl an der Ehre eines Offiziers!« brauste Corvin auf.
»Wir werden ja sehen. Ein Ehrenwort ist schnell gegeben«, sagte Sallinger.
Corvin griff nach seinem Säbelgehenk, um es sich umzuschnallen. In seinem Innern brodelte es. Seine Fingerknöchel wurden weiß, so fest drückte er die Fäuste um die Scheide. Wie gering dieser Mann ein Ehrenwort maß, brachte ihn in Wut. »Verschwinden Sie, ehe ich mich vergesse!« zischte er.
Sallinger blickte ihm furchtlos ins Gesicht. »Es ist schon genug Unheil über unser friedliches Baden gekommen. Vermehren Sie es nicht noch am Schluß durch sinnlose Zerstörung – aus Ehrgeiz oder Kraftmeierei. Wir werden es nicht zulassen, daß die Fremden und das Militär allein über das Schicksal unserer Stadt bestimmen.«
Corvin fühlte sich unter der Anschuldigung wie betäubt und unfähig, seine Erregung unter Kontrolle zu bringen. Er riß den Säbel aus der Scheide und holte zum Stoß aus. »Raus!« brüllte er.
Sallinger sah, wie sich das Gesicht des Stabschefs fleckig rötete und seine Lippen vor Zorn zitterten. Er wandte sich um, gab seinen Begleitern, die sich erschrocken an die Wand gedrückt hatten, ein Zeichen und schritt zur Tür. »Auf diese Art sollten wir nicht miteinander umgehen«, sagte er im Abgehen, »Sie enttäuschen mich, Herr von Corvin.«
Corvin steckte seinen Säbel wieder in die Scheide. Sein Puls hatte sich schnell beruhigt, seine seelische Verfassung ihr Gleichgewicht wiedergefunden. Er kannte diesen Zustand von Kindheit an. So urplötzlich, wie der Jähzorn über ihn kam und ihn zu Affekthandlungen hinriß, so rasch verging er auch wieder. Als hätte sich für Sekunden eine andere Person neben ihn gestellt, die mit ihm gar nichts zu tun hatte und unbeeinflußt von seinem Willen reagierte.
Diesen Jähzorn hatte er von seinem Vater geerbt. Als Junge hatte er viel darunter zu leiden gehabt, sowohl als Urheber selbstverschuldeter Untaten wie als Opfer der Prügelsucht seines Vaters. Dem galt Gehorsam als Fundament der Erziehung. Wer einmal ordentlich befehlen wollte, sagte er, müsse erst ordentlich zu gehorchen verstehen. Seinen Kindern Gehorsam einzubläuen war daher seine Hauptsorge.
Über Streiche und Aufsässigkeiten gegen andere Personen konnte er lachen, doch Widerspenstigkeiten ihm gegenüber betrachtete er als das schlimmste Verbrechen. Als Züchtigungsinstrument benutzte er eine Hundepeitsche. Oft steigerte er sich beim Schlagen in sinnlosem Zorn. Otto hatte unter den Schlägen einige Male das Bewußtsein verloren.
Sein älterer Bruder Louis verdankte seine Schwächlichkeit wahrscheinlich diesen barbarischen Züchtigungen. Von solcher blinden Wut wurde zeitweilig auch Otto ertfaßt.





























