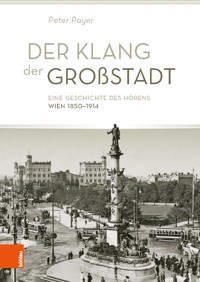19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Trinkbrunnen und Leuchttürmen über die ersten Elektrobusse bis hin zu Leuchtreklamen: In kulturhistorischen Streifzügen durch Wien stellt der Stadtforscher Peter Payer Alltagsfacetten genauso in den Mittelpunkt wie große Events, Warenhäuser und die ersten Feuilletonistinnen Wiens. Er entdeckt bisher Unbekanntes, geht dem "typisch Wienerischen" auf den Grund und erkundet, wie die Weltstadt zu dem geworden ist, was sie heute ist. Ob die Wiederentdeckung der Sommerfrische, Autofreiheit in der Innenstadt oder die Stille während der Corona-Krise: Peter Payer stellt immer neue Perspektiven und bemerkenswerte Skizzen Wiens vor. Er führt seine Leserinnen und Leser durch eine Stadt, die erst durch genaues Hinschauen erfahrbar wird – zu bislang unbeachteten akustischen Rückzugsorten, außergewöhnlicher Architektur und historischen Wienbildern. "Ein Stadtspaziergang mit Peter Payer ist eine Erlebnisreise durch Raum und Zeit." Peter Blau, Ö1
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Peter Payer
AUF NACH WIEN
Kulturhistorische Streifzüge
Mit einem Vorwort vonWojciech Czaja
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Payer, Peter: Auf nach Wien. Kulturhistorische Streifzüge/Peter Payer
Wien: Czernin Verlag, 2021
ISBN: 978-3-7076-0742-0
© 2021 Czernin Verlags GmbH, Wien
Umschlagbild: Fremdenverkehrsstelle der Stadt Wien, 1964
Satz und Umschlaggestaltung: Mirjam Riepl
Druck: EuroPB
ISBN Print: 978-3-7076-0742-0
ISBN E-Book: 978-3-7076-0743-7
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Einmal mehr – für Barbara
INHALT
Vorwort
Einleitung
Typisch wienerisch
Als man Luft in Flaschen füllte
Schaufenster für alle
Die Stadt als Event
Tausend Lampen für Franz Joseph
Nacht ohne Finsternis
Wo Innovation auf Sensation traf
Ein Blick in Vergangenheit und Zukunft
Geräuschloser Fortschritt
In der großen Wiener Stille
Akustische Rückzugsorte
In der Mitte und doch am Rand
Die Entzauberung einer Straße
Maritime Sehnsüchte
Den Durstigen dieser Stadt
Vom »Sehnen ins Kühle«
Mehr Poller müssen her
Autos in die Tiefe!
Modernisierung einer Metropole
Zwischen Drama und Revue
Am Anfang war Betty Paoli
Autonomie in Kugelform
Wenn Pflanzen Paternoster fahren
Der Mist und sein Vesuv
Imperiale Signatur der Stadt
Versuch zu begreifen
Eine Stadt sucht ihre Menschen
Zurück ans Wasser
Bildnachweis
Artikelverzeichnis
Zum Autor
VORWORT
Als die uns bekannte Welt am 16. März 2020 aufhörte sich zu drehen und Wien mit einem Schlag verstummte, habe ich begonnen, als Peter Payer durch diese Stadt hindurchzuspazieren. Plötzlich bekamen die Straßenbeläge einen Charakter, die Hydranten eine Persönlichkeit, die Schaufenster ohne Publikum eine gänsehautpoetische Redseligkeit. Aus irgendeinem Grund habe ich angefangen, alles aufzusaugen – habe Laternen und Scheinwerfer studiert, habe die unterschiedlichen Gerüche am Schwedenplatz, in der Ottakringer Straße und auf der Simmeringer Haide analysiert und habe mich sogar dabei ertappt, wie ich Poller, Mistkübel und Würfeluhren im Kopf abgezählt und visuell abgespeichert habe.
Wie ein Peter Payer also. Ich lese diesen Mann schon seit vielen Jahren mit großer Begeisterung und kippe mit jedem Essay in eine akribisch zusammenrecherchierte Vergangenheit – in eine Vergangenheit, die vor unser aller Lebenstage liegt, dank der Worte dieses Historikers und Wortakrobaten allerdings eine Präsenz und Lebendigkeit entwickelt, als würde sie nur ein paar Sekunden zurück- oder vielleicht ein paar Millimeter entfernt liegen. Und wenn in einem seiner Texte am 1. März 1912 der erste fahrplanmäßige Elektrobus vom Stephansplatz zur Volksoper aufbricht, dabei nach ein paar Fahrminuten vor der Votivkirche fotografiert wird, dann ist es, als würde man mittendrin stehen, einer von insgesamt 18 Passagieren, und den Elektromotor surren hören und unter den eigenen Füßen rattern spüren.
Man lernt viel aus der Lektüre seiner Wien-Betrachtungen. Zum Beispiel, dass die erste Fußbodenheizung Wiens in einer Synagoge eingebaut wurde. Dass das Warenhaus Gerngroß einst Nacht für Nacht einen milchweißen Lichtstrahl in den Wiener Himmel entsandte. Dass so manches Ross diese Stadt noch großartiger findet als unsereiner und sich als Zeichen seiner Liebe sogar in deren historische Bausubstanz verbissen hat. Zwischendurch gibt es – wie könnte es anders sein – ausgeschmückte Statistiken zu Trinkbrunnen, Telefonzellen, Tiefgaragenpionieren.
Peter Payers Texte sprechen mit Zahlen, Daten, Fakten zu uns. Zwischen den Zeilen aber blitzt wie ein permanentes Gewitter eine emotionale, atmosphärische, alle Sinne reizende Komponente hindurch, die dafür sorgt, dass man dieses Buch, einmal aufgeschlagen, erst dann wieder aus der Hand legen kann, wenn man nach 253 Seiten den Wiener Donaukanal durch die Brille einer pandemiegebeutelten Jugend gesehen, verstanden und auf seinem mentalen Stadtplan neu abgespeichert hat.
Der Stadthistoriker Peter Payer ist die perfekte Personalunion aus wissenschaftlichem Maulwurf und literarischer Gazelle. Damit spricht Auf nach Wien, eine vielseitige Zeitmaschine ins Gestern und Heute dieser Stadt, eine Einladung aus, der man sich unmöglich entziehen kann.
WOJCIECH CZAJA
Architektur- und Stadtjournalist
EINLEITUNG
»Nur auf den Wegen, die du täglich gehst,begreifst du, wo du wirklich bist.«
(MONIKA HELD)
Sich mit wachen Sinnen durch eine Stadt zu bewegen und die Eindrücke sodann in schriftlicher Form festzuhalten, kann als ganz spezielle Form der Welt- und Selbstdeutung gesehen werden. In einem gewissen Sinn verbindet sich hierbei immer die Suche nach der Persönlichkeit der Stadt mit der Suche nach der eigenen Persönlichkeit. Es ist ein interaktives Lernen, Erfahren und Begegnen. Und trotz des genuin Fragmentarischen ist es stets aufs Neue spannend und ertragreich.
So ist auch der mittlerweile vierte Band meiner urbanistischen Erkundungen von Wien zu verstehen, der Feuilletons versammelt, die in den vergangenen fünf Jahren erschienen sind – einer Zeit, die an Umbrüchen und Turbulenzen wahrlich einiges zu bieten hatte. Inhaltlich geht es zunächst erneut um bislang wenig beachtete Facetten der Stadt. Oder, wie Joseph Roth formulierte, darum, in sachtem Ton »unerhörte Geschichten« zu erzählen: von Trinkbrunnen, Leuchttürmen, Telefonzellen und Pollern über Wiens erste Elektrobusse bis hin zu Garagen, Warenhäusern und Kinos. Auf vielfältige Weise bilden sich in diesen baulichen und technischen Einzelphänomenen die Megatrends unserer Zeit ab, allen voran die Digitalisierung und der Klimawandel. Beide haben Wien massiv zu prägen begonnen, sie durchdringen den urbanen Alltag auf immer nachhaltigere Weise. Besonders offenkundig wird dies in Fragen der Mobilität, denen im Buch gleich mehrere Beiträge gewidmet sind. Eingebettet in die Grunderfahrung, dass sich – wie ich selbst bemerke – die Beschleunigung und Komplexität des Großstadtverkehrs in den letzten Jahren deutlich erhöht hat, gehört dieser wohl zu den wichtigsten Faktoren der künftigen Stadtentwicklung.
Die anhaltende Verdichtung Wiens hat nicht zu übersehende ökologische und soziale Folgen, gleichzeitig wird der öffentliche Raum zunehmend technisiert. Wahrnehmungs- und Nutzungsformen ändern sich grundlegend, wie sich an teils heftigen Diskussionen über E-Scooter, die Praterstraße oder den Donaukanal zeigt. Die Genese von Nachhaltigkeitsdebatten wiederum spiegelt sich in der historischen Betrachtung des legendären Rinterzelts wider sowie in alten und neuen Visionen zum »Vertical Farming«.
Neben diesen thematischen Schwerpunkten soll auch an vergessene Persönlichkeiten aus dem Bereich der Journalistik erinnert werden, an Menschen, die uns bis heute faszinierende Einblicke in den städtischen Alltag ihrer Zeit ermöglichen. Zu den zeitlebens bekanntesten gehörte Ludwig Hirschfeld, Feuilletonist der »Neuen Freien Presse« und einer der klügsten und zugleich amüsantesten Vertreter seiner Zunft. Nicht minder bedeutend waren auch jene immer zahlreicher werdenden Frauen, die das Feuilleton für sich eroberten. Von der Pionierin Betty Paoli über Alice Schalek bis zu Ann Tizia Leitich und Hermine Cloeter. Allesamt Journalistinnen, die uns Hinweise auf die weibliche Sicht und Analyse des Wiener Stadtgeschehens geben.
Dass sich gerade das aktuelle Geschehen immer tiefer in die Stadtgeschichte einschreibt, verdeutlichen schließlich zwei Reportagen aus dem Jahr 2020, die den dramatischen Terroranschlag im jüdischen Viertel der Innenstadt sowie den Ausbruch und Verlauf der Corona-Pandemie behandeln. Beide Ereignisse gehören zweifellos zu den einprägsamsten der jüngeren Zeit. Ihre wirklichen Folgen, innerlich wie äußerlich, werden wir wahrscheinlich erst dann in ihrem vollen Umfang begreifen, wenn sich die Stadt wieder auf stabilem Terrain befindet und sämtliche isolierenden Beschränkungen wegfallen.
Der Titel des Buches, »Auf nach Wien«, ist auch paradigmatisch als Post-Corona-Parole zu verstehen, als Signal für den auch von mir ersehnten Aufbruch, als Freude auf das Wiedersehen mit einer »freien Stadt«, in der man ungestört seiner Neugier frönen und Menschen und Orten begegnen kann.
Die vorliegenden nicht ganz dreißig Essays erschienen von 2017 bis 2021 in den Feuilletonbeilagen der Wiener Tageszeitungen »Die Presse« und »Wiener Zeitung«, vereinzelt auch in der »Zeit« und in diversen Fachpublikationen. Sämtliche Beiträge wurden überarbeitet und aktualisiert.
Für die bewährte und neuen Themen stets aufgeschlossene Zusammenarbeit bedanke ich mich herzlich bei den Zeitungsredakteuren Wolfgang Freitag und Gerald Schmickl; ebenso beim Team des Czernin Verlags, namentlich Hannah Wustinger, Mirjam Riepl und Benedikt Föger, deren Engagement auch diesmal einen wohltuend-professionellen Rückhalt bildete. Freundschaftlicher Dank gilt zudem Wojciech Czaja, Urbanist und Architekturpublizist, der sich trotz vollen Terminkalenders zur Abfassung des Vorworts bereit erklärte. Vielleicht verbindet uns alle eine Einsicht und Haltung gegenüber Wien, die der Feuilletonist Raoul Auernheimer einmal so formulierte: »Es gibt wenige Städte, die mehr Glück erzeugen als sie verbrauchen – und Wien gehört zu diesen ganz wenigen.«
PETER PAYER
Wien und Küb, Sommer 2021
Vor der Hofoper, Foto: Emanuel Wähner, um 1881
TYPISCH WIENERISCH
Die wiederkehrende Diskussion über die Verbannung der Fiaker aus der Wiener Innenstadt verdeutlicht: Was als typisch wienerisch empfunden wird, scheint nahezu unveränderbar – um nicht zu sagen: heilig. Tief verankert im kollektiven Gedächtnis der Stadt ist daran so gut wie nicht zu rütteln. Doch allzu gerne vergessen wir, dass auch die traditionsreichsten Wienbilder historisch gewachsen sind und eine Entwicklungsgeschichte haben, die sie – mit Bedeutung hoch aufgeladen – erst zu dem machte, was sie heute für uns sind. Ob der Steffl, das Riesenrad oder eben die Fiaker, sie alle fungierten über die Zeit hinweg als wichtige soziokulturelle Projektionsflächen und trugen so das Ihre zur sich akkumulierenden Identität der Stadt bei.
Ihre kritische Hinterfragung, bisweilen auch Erweiterung, ist aus historischer Sicht ebenso erkenntnisreich wie gesellschaftlich notwendig. Hat man, wie ich, regelmäßig mit Texten und Quellen über Wien um 1900 zu tun, stößt man mitunter auf recht kuriose Nachrichten aus der Vergangenheit, die einem das Wesen der Zeit und der Stadt geradezu auf den Punkt zu bringen scheinen. Nicht nur, dass die reichhaltige Publizistik jener Jahre eine Fülle an stilistisch fein geschliffenen Miniaturen hervorbrachte, auch so manche materiellen Zeugnisse vermitteln bis heute ein aufschlussreiches Bild des Alltags jener Jahre. Es folgen drei quintessenzielle Fundstücke, die das zum Klischee geronnene Image der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien auf ihre Weise widerspiegeln.
»Ameisen im Apfelstrudel«
Unter diesem Titel berichtete die konservative »Reichspost« am 21. November 1913 über einen aufsehenerregenden Zwischenfall, der auf gerichtlicher Ebene gar bis zur Staatsanwaltschaft ging. Was war geschehen?
Konditorei Lehmann, 1. Bezirk, Singerstraße 3, 1906
Ein Kunde eines Zuckerbäckermeisters in Wien-Fünfhaus hatte in einem Apfelstrudel Ameisen entdeckt. Friedrich Spangenmacher, so der Name des Betriebsinhabers, wurde unverzüglich wegen Übertretung des Lebensmittelgesetzes angezeigt und vor das örtliche Bezirksgericht zitiert. Die Zeitung berichtete über die Details: »In der Verhandlung hatte der Angeklagte angegeben, daß er alles aufbiete, um seinen Betrieb rein zu halten. Die einvernommenen Angestellten erklärten als Zeugen, daß der Meister mit unnachsichtlicher Strenge auf die von ihm angeordnete Reinlichkeit des Betriebes gesehen habe. Ferner wurde nachgewiesen, daß unmittelbar vor dem verhängnisvollen Verkaufe jenes Apfelstrudels die alljährlich zweimal erfolgte Revision durch einen Ungeziefervertilger gerade stattgefunden hatte. Spangenmacher wurde auf Grund dieses Ergebnisses des Beweisverfahrens freigesprochen.« Zwar legte die Staatsanwaltschaft Berufung gegen dieses Urteil ein, jedoch wurde diese letztlich zurückgezogen. Der Freispruch erlangte Rechtskraft.
Dass es ausgerechnet diese Meldung in den Chronikteil einer Tageszeitung geschafft hatte, ist wohl nicht nur der hygienischen Übertretung geschuldet. Es war die Verunreinigung einer der köstlichsten Leibspeisen der Wiener, die die Empörung vervielfachte, galt doch der Apfelstrudel in besonderem Maße als Inbegriff einer Wiener »Schmauserei«. In der sich im Lauf des 19. Jahrhunderts herausbildenden, multinational und bürgerlich geprägten »Wiener Küche« spielte er eine zentrale Rolle und degradierte die anderen Mehlspeisen beinahe zu Statisten. So war nicht nur der renommierte Feuilletonist Paul Busson der Meinung, dass insbesondere an Sonntagen »der ausgezogene Apfelstrudel den Weihetag verherrlicht«. Zweifellos gehörte er zu den herausragenden »Pointen der Wiener Küche«, wie Habs und Rosner in ihrem vielgerühmten »Appetit-Lexikon« über Mehlspeisen vermerkten.
Und dann das: Ameisen und Apfelstrudel – ein größerer Gegensatz lässt sich wohl in der als »Stadt der Phäaken« apostrophierten Donaumetropole schwer denken. Längst waren die Leidenschaft für das Genießen und eine damit verbundene spezifische »Geschmackslandschaft« zum Markenzeichen Wiens geworden, ein vielschichtiger und spannender Prozess, den der Kulturwissenschaftler Lutz Musner in einer Studie eingehend darlegte. Spätestens seit »Wien um 1900« avancierte der Apfelstrudel neben der Sachertorte und dem Wiener Schnitzel zum fixen Bestandteil jener kulinarischen Trinität, die das Eigen- und Fremdbild der Stadt bis heute bestimmt.
»Mascherln der Straße«
Ein anderer, nicht weniger sinnlicher Aspekt spielte bei der großzügig angelegten Ringstraße eine Rolle: die visuelle Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes. Ab den 1850er-Jahren wurde an der Riesenbaustelle Ringstraße gearbeitet, die nach der Jahrhundertwende keineswegs vollendet war. Allerdings konnte man bereits eine große Zahl an »Sehenswürdigkeiten« bestaunen, wie Raoul Auernheimer, bekannter Feuilletonist der »Neuen Freien Presse«, feststellte. Aufmerksam registrierte er die Veränderungen der einstigen Kleinstadt, die so rasch »Carriere gemacht hat«. Auf der Suche nach der neuen, nunmehr deutlich großstädtischeren Physiognomie erkannte er in Wien, im Unterschied zu Berlin oder Paris, eine gesteigerte Vorliebe für das Schauen. Auf der Straße blicke man sich hier merkbar öfter um, man lächle und habe eine Vorliebe, so Auernheimer, für das »Mascherl«. Letzteres war für ihn, wie er im April 1907 schrieb, gleichsam das Signet der Stadt, Inbegriff des Hangs zum Schönen und zum Verschönern, egal ob bei der Toilette der Frauen oder den besonders ins Auge springenden Blumenkörben an den Lichtmasten: »Wien ist, außer Barcelona, hab’ ich mir sagen lassen, die einzige Stadt, in der die Beleuchtungsmasten mit Blumenkörben geschmückt sind. Bei Nacht wird es mit Licht beleuchtet, bei Tag mit Blumen. Und diese bunten, runden Körbe sind Gärten, winzige in die Luft gehängte Gärten, die sich hundertfach wiederholen, wenn man die Ringstraße hinunterblickt. Diese Körbe sind die Mascherln der Straße.«
Blumenschmuck am Schwarzenbergplatz, Foto: Martin Gerlach, um 1910
Auernheimer bezog sich hier auf die hohen Masten der elektrischen Bogenlampen, die aufgrund ihrer schneckenförmigen Ausleger »Bischofsstäbe« genannt wurden und an und für sich schon ästhetisch anspruchsvoll gestaltet waren. Sie hatten nun zusätzlich im unteren Bereich einen floralen Schmuck erhalten. Dieser war erstmals im November 1905 anlässlich des Besuchs des spanischen Königs Alfons XIII. an den Lampen der Ringstraße und am Schwarzenbergplatz angebracht worden. Da die Blumenkörbe auch bei den Wienern großen Anklang fanden, wurden sie beibehalten und in den folgenden Jahren beträchtlich vermehrt.
Wie sehr sie der Bevölkerung binnen kurzer Zeit ans Herz gewachsen waren, lässt sich daran erkennen, dass ihre Anbringung selbst nach den Verwüstungen des Ersten Weltkriegs eine ungebrochene Fortsetzung erfuhr. Voll Stolz vermeldete man im Städtewerk »Das Neue Wien«, dass die Blumenkörbe an den Lichtmasten nunmehr wieder gefüllt und vermehrt würden. Ihre Zahl sei im Jahr 1926 auf insgesamt 83 gestiegen. Hoffnungsfroh blickte das »Rote Wien« den neuen Zeiten entgegen. Die Stadt mit der »ewigen Schaulust« (Stefan Zweig) hatte im Straßenschmuck ihren unverwechselbaren Ausdruck gefunden.
Eine Tradition, die bis heute anhält. So kann man sich in der Währinger Straße vor dem Café Weimar nach wie vor an einem Bogenlampenmast aus der Gründerzeit in originaler Farbgebung samt Blumenkorb erfreuen, eine Privatinitiative des Cafetiers zum hundertjährigen Jubiläum seines Lokals. Und letztlich sind auch das in Mode gekommene »urban gardening« und die davon inspirierten blumengeschmückten Blechdosen an diversen Verkehrsmasten in diese Richtung zu interpretieren. Ein kleiner Stadtgarten in luftiger Höhe zur Freude und Repräsentation der Bevölkerung.
Bissspuren in der Durchfahrt zur Hofburg, Foto: Peter Payer, 2018
Höfische Bisse
Den dritten und letzten, im wahrsten Sinne eindrucksvollsten Hinweis auf eine Wiener Begebenheit verdanke ich dem Kunsthistoriker und Denkmalexperten Andreas Lehne. In einem seiner Bücher beschreibt er ein Detail der Wiener Hofburg, an dem wohl nicht nur ich schon viele Male vorüberging, ohne es zu bemerken: Die Bissspuren der Hofpferde an einem Holzbalken in der Durchfahrtshalle des Leopoldinischen Traktes.
In dem zwischen Innerem Burghof und Heldenplatz gelegenen Raum waren über Jahrzehnte die vom Hof benötigten Reitpferde angebunden. Beständig knabberten die Rösser an jenem Querbalken, der dort die Fahrspuren trennt. Eine mehr oder weniger bewusste Geste des tierischen Zeitvertreibs. Die Zähne gruben sich mit der Zeit immer tiefer ein, hinterließen markante Furchen und Rillen. Und sie hätten das Holz, so Lehne, wohl durchgebissen, wären nicht die Gründung der Republik und die Erfindung des Automobils dazwischengekommen.
Derartige kleine und größere Möblierungselemente des Straßenraumes aus dem Fin-de-Siècle sind gerade in Wien erstaunlich zahlreich erhalten. Insbesondere in der Ringstraßenzone, aber nicht nur dort; denken wir etwa an die alten, im historistischen Stil designten Pissoirs und Bedürfnisanstalten, an diverse Beleuchtungskörper und Umfriedungen bis hin zu Kanaldeckeln und Pollern. Dass jedoch ausgerechnet die relativ anfälligen Holzbalken die Zeit überdauerten und von sämtlichen Umbauten, Krieg und Devastierung verschont wurden, grenzt beinahe an ein Wunder. Und so sind sie gerade in ihrer Unmittelbarkeit Denkmäler der besonderen Art als die letzten im öffentlichen Raum präsenten Gebrauchsspuren, die vom Alltagsleben des Wiener Hofes geblieben sind.
Anhand der kleinen hölzernen Berge und Täler lässt sich der Verlauf der Zeit in bequemer Handhöhe ertasten und die imperiale Vergangenheit der Stadt, in der Pferde noch ein wichtiges Verkehrsmittel waren, auf einzigartige Weise erspüren. Jedenfalls ein erfühlbarer Ort mit besonderer Aura, der uns weit in die Vergangenheit zurückzuführen vermag und der gemeinsam mit dem nostalgisch verbrämten Klang der Fiakerpferde auf dem Kopfsteinpflaster als Signum jener Stadt fungiert, der so gerne ein ausdauernder Blick zurück nachgesagt wird. Womit wir wieder beim Klischee wären.
Werbeplakat in Wien, 2019
ALS MAN LUFT IN FLASCHEN FÜLLTE
»Die Sommerfrische ist zurück!« Euphorisch verkünden die Medien das Comeback einer Urlaubsform, die lange Zeit als überholt und verstaubt galt. Einschlägige Destinationen vom Semmering bis zum Salzkammergut werden als kulturell hoch aufgeladene Orte mit »Retro-Touch und Hipsterkomfort« gepriesen; investmentfreudige Privatinitiativen versuchen leer stehende Villen und Hotels wiederzubeleben. Das Label »Sommerfrische« scheint im heutigen Tourismus eindeutig wieder an Zugkraft zu gewinnen. Marketingtechnisch ist es ja ein überaus gelungener Begriff, mit der Kombination von zwei so positiv besetzten Ausdrücken wie Sommer und Frische. Sogar kleine Sommerfrische-Museen sind bereits entstanden, die die lokale Geschichte aufarbeiten, etwa in Schönberg am Kamp oder in Küb am Semmering. Und immer öfter hört und liest man von Freunden und Bekannten aus der Stadt: Ich bin auf Sommerfrische.
Doch was verbirgt sich hinter dem offenkundigen Boom? Liegt die erneute Zugkraft der Sommerfrische angesichts wiederkehrender Hitzewellen an ihrem Versprechen einer sinnlich anders erlebbaren Gegenwelt? Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie eng Sommerfrische und umfassender »Sinneswechsel« seit jeher konnotiert sind.
Es war Ende des 19. Jahrhunderts, als die Sommerfrische-Bewegung deutlich an gesellschaftlicher Breite gewann. Angehörige des aufsteigenden Großbürgertums, aber zunehmend auch die gehobene Mittelschicht wurden zu prominenten Trägern dieser Übersiedelung auf Zeit. Sie alle bekundeten damit ihre soziale Stellung: gesellschaftliche Distinktion durch Teilhabe an der Sommerfrische. Bürgerliche Familien konnten, mussten und wollten es sich leisten, vier Monate im Jahr mitsamt Familie und Dienstboten der Stadt zu entfliehen.
Die Großstädte wurden im Sommer merkbar leerer. Allein in Wien schätzte man um 1900 die Anzahl der Stadtflüchtigen in der »Saison« auf 100.000 bis 150.000 Personen. Eine »Urbanisierung« im weitesten Sinne hatte eingesetzt; eine Großstadt wie Wien mit ihren mittlerweile fast zwei Millionen Einwohnern reichte, so gesehen, viele Hunderte Kilometer weit ins Land hinein, hatte ihre Ausleger im Hochgebirge und an den Seen und verbreitete dort ihre Kultur und ihren Lebensstil.
Ansichtskarte, 1913
Ein zentraler, von vielen Städtern erwünschter Gegensatz war dabei das Eintauchen in eine andere Sinneswelt. Es war die Sehnsucht nach einer Erholung von der Vielzahl urbaner Impressionen, nach einer Wiederbelebung der abgestumpften Sinne und einer häufig empfundenen Überreizung auf allen Ebenen, visuell, olfaktorisch und besonders akustisch.
Die moderne Großstadt und die bürgerliche Gesellschaft, deren reibungsloses Funktionieren kontrollierten Abläufen, diszipliniertem Verhalten und strikten Affektregulierungen zu verdanken war, benötigte eine Projektionsfläche, einen Sehnsuchts- und Ruheort, wie ihn die Sommerfrische gleichsam auf utopische, fast schlaraffenlandähnliche Weise darstellte. Nicht zufällig kam damals etwa für das Salzkammergut der romantisch geprägte Begriff der »Seelenlandschaft« auf.
In der Sommerfrische konnte man zumindest temporär andere Sinneseindrücke genießen und die gesundheitsfördernde Wirkung einer Orts- und Zeitveränderung spüren. Schon die Reise dorthin war – mit jedem Kilometer, den man sich von der Stadt entfernte – erlebte Entspannung. Peter Altenberg brachte dies auf seiner Fahrt mit der Südbahn hinaus ins Gebirge so zum Ausdruck: »Meidling, Liesing, Guntramsdorf, Mödling, Baden, näher, näher, immer näher, die Luft immer frischer, gebirgiger, endlich Payerbach.« Stieg man aus dem Zug aus, war man eigentlich schon ein anderer.
Der Luftwechsel war stets einer der unmittelbarsten Eindrücke, der sich gleich nach der Ankunft offenbarte. »Luftkurort« oder gar – wie etwa im Fall des Semmering – »Höhenluftkurort« waren Attribute, die jeden Sommerfrischeort zusätzlich adelten. Geradezu euphorische Beschreibungen tauchten dann auch auf, vom hier herrschenden »würzigen Hauch der Bergwälder«, dem »harzduftenden Atem der Tannenforste« oder generell von Naturgerüchen, die »köstlich und heilkräftig« seien, eine auch für die Nase ideale Abwechslung zur stickigen Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
Die Sommerfrischeorte kehrten ihre atmosphärischen Vorzüge werbemäßig gebührend hervor. In Bad Ischl etwa waren die Häuser direkt am Fluss aufgrund des in der Luft liegenden Salzgeruchs bei den Gästen besonders beliebt. Die wohltuende, jodangereicherte Luft wurde sogar zum Exportprodukt und als »Ischler Luft« in Flaschen gefüllt und verschickt.
Vom Geruch der Gegend um Reichenau an der Rax wiederum schwärmte erneut Peter Altenberg. Seit Kindheitstagen hielt er sich regelmäßig am Thalhof auf, der dortige feuchtkühle Duft nach »Nadelwald und Bergwiese« war tief in ihn eingeschrieben. Aber auch in anderen Sommerfrischen registrierte der sensible Dichter markante Düfte, etwa in Bad Vöslau, wo er den Duft nach Tannenharz und Lindenblüten und die Millefleursgerüche der Hausgärten pries, oder an den Salzkammergut-Seen, wo Altenberg die Landungsstege der Dampfschiffe liebte, die rochen »wie von jahrelang eingesogenem Sonnenbrande«.
Doch Vorsicht! Wie beim Thema Sommerfrische generell, sollten wir uns vor einer allzu großen retrospektiven Idyllisierung hüten. Realiter gab es durchaus so etwas wie Geruchskollisionen, wenn sich etwa am Semmering mit der steigenden Zahl an Zugfahrten Sommerfrischler über den Rauch und Ruß der Eisenbahn beschwerten. Ein ähnlich dramatisches olfaktorisches Aufeinanderprallen von Natur und Kultur registrierte dort auch der Journalist und Schriftsteller Franz Servaes, der sich auf seinen Waldspaziergängen über die Parfums der feinen Damen empörte, die »den herrlichen Wohlgeruch des Laubmeeres mit ihren künstlichen Düften unpassend durchräuchern«. Die Städter kämpften um die Ungetrübtheit ihrer Naturgeruchsidyllen.
Ansichtskarte, um 1900
Auch die akustischen Projektionen auf die Sommerfrische, auf den dort herrschenden Frieden für die Ohren, waren stark und mächtig und – erneut – nicht frei von Klischees. Der steigenden Zahl an »Strebern nach Ruhe« trugen die Sommerfrischeorte bereitwillig Rechnung. So bewarb sich der Semmering mit seiner »ernsten Ruhe des Hochgebirges« als das »wunderbare Stahlbad für den erschöpften Großstädter«. Der kleine Ort Prein an der Rax galt als ruhigster Ort in der Umgebung von Reichenau. In Zell am See lockte der Gebirgssee mit seiner »stillen Pracht«.
Die Stille – besser gesagt: die Geräusche der Natur, denn ganz still war es naturgemäß nie –, die so ganz anders anmutete als die täglich in der Stadt gehörte »Lärmsymphonie«, korrespondierte mit der Naturästhetik jener Zeit, die das Kleinräumige, Niedliche, Friedvolle und Milde bevorzugte. Die Berge umrahmten das harmonische Bild des ruhigen Verweilens auf Aussichtswarten, Ruhebänken, Veranden und Balkonen. Allesamt Plätze zum Hineinhorchen in die Stille. Die in der Sommerfrische zunehmend perfektionierte Inszenierung der Natur hatte somit eine zentrale akustische Komponente, die zur stillen Betrachtung der Umgebung anleitete, zur bewussten Wahrnehmung des Waldesrauschens, der tosenden Wasserfälle oder der Wellen, die leise ans Seeufer plätscherten.
Derartige Lautsphären schätzten insbesondere Schriftsteller und Musiker, die uns in ihren Werken und Korrespondenzen zahlreiche Belege für die vor Ort verspürte akustische Erholung überlieferten. Bekannt ist erneut Peter Altenberg, der von Gmunden am Traunsee als seiner »Ruhe-Idylle« schwärmte; Raoul Auernheimer, der sich in einem Brief an Arthur Schnitzler geradezu euphorisch über die »köstliche Luft und noch köstlichere Stille«, die am Semmering herrsche, äußerte, oder Anton Wildgans, der in Mönichkirchen am Wechsel ganz beglückt über sein »Mansardenzimmer, das über allem Lärm in wunderbarer Friedlichkeit thront«, war. Und Jakob Wassermann, seit 1904 in Altaussee auf Sommerfrische, hielt in seinen Tagebucheintragungen fest: »Die Städter haben eine närrische Vorliebe für das, was sie Ruhe nennen.«
Nun waren Künstler und Intellektuelle in ihrer auditiven Sensibilität und Durchlässigkeit gewiss Ausnahmeerscheinungen, jedenfalls aber waren die Ohren der Stadtbewohner in der Sommerfrische mit einem akustisch völlig anderen Ambiente als in der Stadt konfrontiert. Allerdings war von Ruhe bisweilen nicht viel zu bemerken. Die Geräusche der Landarbeit, vor allem der Tiere am Bauernhof, forderten so manche großstädtischen Ohren heraus. In einem launigen Artikel beschrieb der Feuilletonist Eduard Pötzl die ihn quälenden »Landplagen«: von der Grille, die pausenlos zirpt, dem Nachbarhund, dessen Geheul nicht enden will, bis hin zur lautstark muhenden Kuh und dem frühmorgens krähenden Hahn. Und er war nicht der Einzige, der sich darüber beschwerte.
So war es paradoxerweise oft genau umgekehrt: Stellte man – etwas vereinfacht – Stadt und Land im Sommer akustisch gegenüber, war eine deutliche Lärmumkehr zu erkennen. Die Sommerfrische erwies sich mit ihren vielen Gästen und den ungewohnten Lauten der Natur mitunter als unruhiger als die still und entleert zurückgelassene Großstadt. Zufrieden stellte ein Daheimgebliebener über Wien fest: »Aber eines Vortheiles genießen wir wenigstens in der sommerlich todten Stadt: Sie ist ruhiger geworden. Wo man sonst vom tausendstimmigen Straßenlärm halb taub wurde, ist es nun still und stumm.«
Karikatur, 1928
War der Erholungswert der Sommerfrische – wie vielfach bei heutigen Urlaubsreisen auch – also schon damals nur Fiktion? Die zahlreichen, oft satirisch untermalten Reportagen über nicht eingelöste Erwartungen legen diese Interpretation zumindest nahe. Kritiker wie Pötzl argumentierten ebenfalls in diese Richtung und meinten süffisant, dass sich die Sommerfrischen letztlich »von einem Wiener Kaffeehaus nur durch die schlechtere Bedienung und die höheren Preise unterscheiden«.