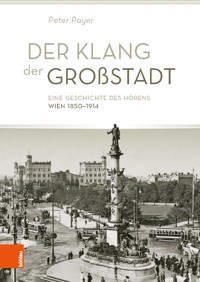
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Welche Geräusche prägten einst den Alltag der Großstadt? Wie wurde die zunehmende Vielfalt der urbanen Lautsphäre von den Menschen wahrgenommen und beurteilt? Am Beispiel der Stadt Wien wird erstmals die auditive Kultur einer der wichtigsten europäischen Metropolen der Zeit um 1900 vorgestellt. Im Zentrum steht jene historische Periode, in der Wien sich zur modernen Großstadt entwickelte. Die ungeheure Dynamik dieser Zeit veränderte nicht nur das Stadtbild nachhaltig, sie ließ auch eine neuen Hör-Diskurs entstehen. Immer intensiver wandte sich die öffentliche und private Aufmerksamkeit dem Lärm zu. Und dies durchaus mit Ambivalenz. Denn der Lärm stellt sich als komplexes Phänomen dar, an dem – paradigmatisch und bis heute – Fragen der Stadtentwicklung, der Kultur- und Zivilisationskritik, aber auch ökonomische Konflikte abgehandelt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Payer Der Klang der Großstadt
Eine Geschichte des Hörens. Wien 1850–1914
BÖHLAU VERLAG WIEN · KÖLN · WEIMAR
Gefördert von der Kulturabteilung der Stadt Wien, Wissenschafts- und Forschungsförderung
Der Autor dankt folgenden Institutionen für die Förderung der Arbeit an diesem Buch:
Magistrat der Stadt Wien (Magistratsabteilung 7-Kultur/Referat Wissenschafts- und Forschungsförderung,
Magistratsabteilung 22-Umweltschutz/Referat Lärmschutz),
Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien,
Österreichische Forschungsgemeinschaft,
Kulturhauptstadt Linz 2009,
Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften,
Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Österreichische Akademie der Wissenschaften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG, Wien, Kölblgasse 8–10, A-1030 Wien
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: »Praterstern, um 1910«; © WienMuseum
Korrektorat: Volker Manz, Kenzingen
Einbandgestaltung: hawemannundmosch, Berlin
Satz: Michael Rauscher, WienEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-23153-0
Für Hannes, meinen Zwillingsbruder
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Annäherung
Vergangenes Hören
Der Gehörsinn und seine Stellung in der Hierarchie der Sinne
Der Wandel zur »Lo-fi-Lautsphäre«
Die wissenschaftliche Erforschung des Hörens
Zur Phänomenologie des Lärms
Hörraum Wien
Rahmenbedingungen
Veränderungen der urbanen Lautsphäre
Die »Brandung der Großstadt«
Akustischer Tagesablauf: Verlust der Stille
Säkularisierte Stimmen: Das Läuten der Kirchenglocken
Die Geräusche der Straßenbahn: Signum des Urbanen
Klangkollisionen: Tier versus Maschine
Das Verschwinden von »Kaufrufen« und Straßenmusik
Versuch einer akustischen Topografie
Zentrum
Innenbezirke
Industrieareale
Agrarische Gebiete
Naturnahe Waldlandschaften
Parkanlagen, Friedhöfe
Heurigenorte
Vergnügungszentren
Märkte
Bahnhofsvorplätze
Militärgebiete
Konfrontationen
Lärm und Großstadtkritik
Hygiene der Straße
Nervengift
Akustische Erziehung
Kampf und Flucht
Lärmschutzbewegung
Vorläufer
Theodor Lessings »Antilärmverein« in Wien
»Wiener Lärm«
Motorgeknatter und Hupensignale
Fahrradgeklingel
Peitschenknallen und Kutschergeschrei
Straßenbahngeläute und Lokomotivpfiffe
Gekreisch von Straßen- und Stadtbahn
Klappern von Eisenstangen und Rollbalken
Wagengerassel und Pferdegetrappel
Baustellenlärm
Kindergeschrei und Hundegebell
Kaufrufe und Marktgeräusche
Gesang und Gejohle
»Werkelmannplage«
Grammophonmusik
Klaviergeklimper
Klopfkanonaden
Städtevergleich
Gegenmaßnahmen
»Geräuschloses Pflaster«
Elektroauto und Elektrobus
Gummireifen, Korkstein, Doppeltüren
Antiphon und Ohropax
Gesetzliche Regelungen
Städtebau und Stadtplanung
Öffentliche Ruhehallen
Telefonzellen
Die Sommerfrische als akustisch motivierte Fluchtbewegung
Apologien
Der künstlerisch-ästhetische Diskurs
Ausblick
Konjunkturen der Lärmdebatte und Renaissance des Hörens
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Register
Zum Autor
»Mein Ohr steht auf der Straße wie ein Eingang.«
Robert Musil
Vorwort
Vorneweg ein Aviso: Die Lektüre dieses Buches erfordert ein Ablegen vertrauter Hörgewohnheiten, eine Bereitschaft, sich auf neue Hörerlebnisse einzulassen. Dabei kann es zu einer vorübergehenden Stimulierung Ihrer akustischen Fantasie kommen, bis hin zu einer gesteigerten, möglicherweise nicht immer angenehmen Sensibilität gegenüber akustischen Reizen. Ich selbst befand mich bisweilen in der paradoxen Situation, beim Schreiben über Lärm gleich mehreren störenden Geräuschen ausgesetzt zu sein, die ich zuvor keineswegs derart intensiv wahrgenommen hatte. Das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz wird gerade bei der Erforschung dieses Themas zu einer der wichtigsten Voraussetzungen. Der »belauschte Lärm« (Ulrich Holbein) gibt – so scheint es – seine Geheimnisse nicht ohne Opfer preis.
Dass nicht nur die individuelle, sondern auch die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für unsere akustische Umgebung Veränderungen unterliegt, soll mit dem vorliegenden Buch gezeigt und insbesondere anhand des komplexen Verhältnisses von Stadt und Lärm näher untersucht werden. Meine Beschäftigung damit begann bereits im Jahr 2000 und wurde seither sukzessive vertieft und erweitert. Sie versteht sich als Fortsetzung meiner bisherigen Arbeiten im Schnittbereich von Sinnes- und Stadtgeschichte – exemplarisch dargestellt anhand der Großstadtwerdung Wiens.
Die flüchtige Welt der akustischen Erscheinungen erweist sich allerdings als nicht gerade leicht zu fassender Forschungsgegenstand. Nur allzu gut haben wir uns mittlerweile an die weitgehende Lautlosigkeit der Geschichte gewöhnt. Zudem haben sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die Geräusche unserer urbanen Umwelt und parallel dazu unsere Hörgewohnheiten auf zum Teil dramatische, jedenfalls nachhaltige Weise zu wandeln begonnen.
Kurzum: Wir alle sind erst dabei zu lernen, was die Geschichte der auralen Kultur uns über die Gesellschaft und ihre Entwicklung zu sagen hat. Und dies auch im Bewusstsein der Gefahr, dass es sich dabei um die künstliche Isolierung eines Sinns handelt und dabei die stets vorhandene Interdependenz aller Sinne aus analytischen Gründen weitgehend außer Acht gelassen werden muss. Ziel und Hoffnung der folgenden Seiten ist es, eine bewusstere Beschäftigung mit unserer akustischen Umwelt zu stimulieren – für vergangene Zeiten genauso wie für die aktuelle Befindlichkeit.
Für zur Verfügung gestellte Materialien, wertvolle Hinweise und Anregungen bedanke ich mich herzlich bei Wolfram Aichinger, Peter Androsch, Christoph Bernhardt, Karin Bijsterveld, Julia Danielczyk, Helga Dirlinger, Peter Donhauser, Anne Ebert, Ernst Gerhard Eder, Julia Encke, Brigitte Felderer, Gerhard Fürnweger, Gerhard Geissler, John Goodyear, Marcus Gräser, Sibylle Grün, Hans Christian Heintschel, Mirko Herzog, Thomas Hofmann, Christian Klösch, Heinrich Kren, Helmut Lackner, Matthias Lenzt, Lutz Muster, Lisa Noggler-Gürtler, Martina Nußbaumer, Hannes Payer, Gerd Pichler, Susanne Pils, Ingrid Prucha, Alexander Reisenleitner, Petra Schneider, August Schick, Gabriele Schuster-Klackl, Christian Stadelmann, Hannes Steil, Georg Vasold, Hubert Weitensfelder, Verena Winiwarter, Susana Zapke und Chris Zintzen-Bader.
Ein ganz besonderer Dank gebührt schließlich meiner Familie, Barbara und Lena, als stets präsente Begleiterinnen auf meinem Weg des Forschens und Schreibens. Sie sind der Resonanzboden, der auch dieses Buch zum Erklingen brachte. Möge das Ergebnis wohlwollend Gehör finden!
Peter Payer
Wien und Küb, Frühjahr 2018
Einleitung
An einem schönen Sommertag des Jahres 1907 unternahm der renommierte Dramaturg und spätere Direktor des Wiener Burgtheaters Alfred Freiherr von Berger (1853–1912) ein ebenso bemerkenswertes wie simples Experiment. Er begab sich in den Garten seines Hauses in Unter St. Veit, einem Wiener Stadtteil, der – wie er betonte – gemeinhin als ruhig galt,1 und begann die ihn umgebende »Stille« akustisch zu analysieren. Minutiös registrierte er die Geräusche der Großstadt, ganz so, »wie man gelegentlich das Trinkwasser, das man täglich genießt, chemisch und bakteriologisch untersuchen lässt«. Dabei nahm Berger folgende »Hauptgeräusche als teils gleichzeitig, teils in rascher Aufeinanderfolge sich ereignend« wahr:
Drei Musikkapellen, eine sehr nahe, eine etwas weiter, eine ganz fern; zwei bellende Hunde, einer in tiefer, einer in hoher Stimmlage; einen winselnden Hund; Wagengerassel; Glockengeläute; das Schwirren und Tuten zweier Automobile; das Zwitschern vieler Spatzen; zwei Klaviere; eine singende Dame; ein Mikrophon, das abwechselnd ein Orchesterstück und ein gesungenes englisches Lied vorführte; den Schrei eines Pfaus; das entfernte Gebrüll der wilden Tiere in der Schönbrunner Menagerie; die Sirenen aus mindestens drei verschieden entfernten Fabriken; das heulende Wimmern eines elektrischen Motorwagens; das Rädergerassel und Bremsengekreisch eines Stadtbahnzuges; das Pfeifen und Pusten der Rangierlokomotiven der Westbahn; das Metallgeräusch der aneinanderstoßenden Puffer; das Rauschen des Windes in den Bäumen; einen Papagei; das wüste Geschrei der die Gäule eines Lastwagens antreibenden Kutscher; das Dengeln einer Sense; Trompetensignale aus einer Kaserne; Ausklopfen von Teppichen und Möbeln; das Pfeifen eines Vorübergehenden; das Zischen des Wasserstrahls, mit dem der Nachbargarten begossen wird; eine Drehorgel; die Glockenschläge und das dumpfe Rollen der Dampftramway.2
Das Erlauschen einer derartigen Vielzahl an unterschiedlichen akustischen Eindrücken kann als unmittelbarer Ausdruck der zunehmenden Dichte und Komplexität großstädtischen Lebens gelesen werden. Das Nebeneinander von modernen und vormodernen Arbeits- und Lebensrhythmen zeichnet sich ebenso deutlich ab wie die sukzessive Ausbreitung einer zunehmend technisierten Stadtzivilisation in ihr immer weniger naturbelassenes Umland. Ein typischer »Großstadtwirbel« war entstanden, wie der Journalist und Schriftsteller Felix Salten (1869–1945) die neue urbane Geräuschkulisse nannte.3 Die penibel durchgeführte Hörprobe verweist aber auch paradigmatisch auf die gestiegene Aufmerksamkeit, die die Großstadtmenschen zur Jahrhundertwende ihrer akustischen Umgebung entgegenbrachten. Die rasanten sozialen, technischen und wirtschaftlichen Veränderungen, denen Wien im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ausgesetzt war, hatten eine Fülle an neuen Geräuschen entstehen lassen, die von der Bevölkerung erst adaptiert werden mussten. Neue Modalitäten der Aufmerksamkeit bildeten sich heraus, die gesamte auditive Kultur der Stadt veränderte sich.
Bergers Sensibilität für Fragen der akustischen Reizung spiegelt den zeitgenössischen Lärm-Diskurs wider, der – zumindest in bürgerlich-liberalen Kreisen – relativ heftig geführt wurde. In Europa wie in Amerika waren Lärmschutzbewegungen entstanden, die auf die gesundheitlichen Folgen des Lärms aufmerksam machten. Medizinische Fachblätter und führende Tageszeitungen brachten ausführliche Berichte über die neuen akustischen Verhältnisse in den Großstädten. Ärzte und Psychiater sahen sich mit den Auswirkungen der Lärmüberflutung ebenso konfrontiert wie städtische Gesundheitsbeamte und Hygieneinspektoren, die eine deutliche Zunahme an diesbezüglichen Beschwerden registrierten. Ingenieure, Architekten und Städtebauer suchten nach Möglichkeiten der Lärmreduktion, in Vorträgen und auf Tagungen über Hygiene und Gesundheitspflege wurde der Lärm bzw. dessen Vermeidung zum wichtigen Thema.
Die vorliegende Arbeit will die gesellschaftlichen Hintergründe dieser Entwicklung erhellen und am Beispiel der Stadt Wien untersuchen, wie sich die Geräuschkulisse des öffentlichen Raumes und parallel dazu die akustische Wahrnehmung der Bevölkerung veränderte. Das Hauptinteresse richtet sich dabei auf jene unerwünschten Geräusche, die unter dem Begriff »Lärm« zusammengefasst werden. Der Untersuchungszeitraum von 1850 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs umfasst jene historische Periode, in der Wien sich zur modernen Großstadt und letztlich viertgrößten Metropole Europas mit über zwei Millionen Einwohnern entwickelte. Die ungeheure Dynamik dieser Jahrzehnte, die mit der Demolierung der Basteien ihren visuell wie akustisch eindrucksvollen Anfang nahm, veränderte nicht nur das Stadtbild nachhaltig, sie ließ auch eine neue Gesundheitsorientierung entstehen, die nicht ohne Auswirkungen auf die Rezeption des Lärms bleiben sollte. Die Modernisierung und Großstadtwerdung Wiens verlangte neue Strategien im Umgang mit dem Lärm, die – so meine These – im Wesentlichen bis heute aktuell sind. Wohl hat es bereits früher einzelne Klagen über Lärm und auch Maßnahmen zu seiner Verminderung gegeben,4 erstmalig wurde nun jedoch der Lärm von einem individuellen zu einem gesellschaftlichen Problem, das von führenden sozialen Klassen und hier insbesondere dem Bürgertum auf breiter Basis diskutiert wurde.
Die Geschichtswissenschaft betritt bei der Erforschung des Lärms noch immer Neuland. Als Pioniere auf diesem Gebiet können die US-amerikanischen Umwelthistoriker Raymond W. Smilor und Lawrence Baron angesehen werden, die sich um 1980 erstmals mit historischen Formen des Kampfes gegen den Lärm beschäftigten5 und deren Forschungen inzwischen von Kollegen wie Warren Bareiss oder Peter A. Coates fortgeschrieben wurden.6
Abb. 1: »Biedermeiers Klage«, Karikatur, 1891
Im deutschen Sprachraum war es zu jener Zeit lediglich die Medizingeschichte, die sich dieses Themas annahm (Siegfried Krömer, Erich Neisius).7 Die deutsche historische Umweltforschung konzentrierte sich lange Zeit auf die klassischen Problemfelder der Luft- und Gewässerverunreinigung. Erst seit Mitte der 1990er-Jahre entstanden erste größere Publikationen. So analysierte der Sozialhistoriker Klaus Saul in einer grundlegenden Studie den Kampf gegen die »Lärmpest« im Deutschen Kaiserreich,8 Hans-Joachim Braun gab einen kurzen Überblick über die Lärmbekämpfung in der Zwischenkriegszeit.9 Matthias Lentz, Richard Birkefeld und Martina Jung, Michael Toyka-Seid sowie jüngst John Goodyear und vor allem Daniel Morat stellten Zusammenhänge zwischen Stadtentwicklung und Lärm in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen.10 Sie alle ermöglichen interessante Vergleiche von Wien mit deutschen Städten, insbesondere mit Berlin, und auch zu einigen französischen Städten liegen mittlerweile relevante Studien von Olivier Balay, Olivier Faure und Jean-Pierre Gutton vor.11
Einen wertvollen Vergleich bieten auch die Arbeiten der niederländischen Technikhistorikerin Karin Bijsterveld, die sich seit einigen Jahren intensiv mit symbolischen Aspekten des Sounds beschäftigt, mit dessen Bedeutung für die zentrale Narration und Identität von Städten sowie mit der europäischen und nordamerikanischen Lärmschutzbewegung.12 Letzterer widmete sich auch Emily Thompson in ihrem Buch »The Soundscape of Modernity«, einer vor allem technisch-architektonische Aspekte behandelnden Studie zur amerikanischen Hör-Kultur zwischen 1900 und 1933.13 Eine kurze, an den »cultural studies« orientierte Geschichte des Lärms, seiner Definition, Wahrnehmung und Bedeutung für die verschiedenen Gesellschaftsschichten präsentierte schließlich Peter Bailey, der vehement für eine stärkere Beachtung dieser »sozialen Energie« plädiert, denn
noise is a specific historic phenomenon that can signify more than outrage. It is an expressive and communicative resource that registers collective and individual identities, including those of nation, race and ethnicity (…); it is a ready form of social energy, with the power to appropriate, reconfigure or transgress boundaries; it converts space into territory, often against the social odds.14
Diese Anregung aufgreifend, werden im Folgenden nicht – wie bisher zumeist – die sozialen Bewegungen gegen den Lärm im Mittelpunkt stehen, vielmehr soll eine breite kulturwissenschaftliche, die akustische Produktion mit der Rezeption verknüpfende Analyse geboten werden. Neben den oben genannten Autoren wird dabei von einer Akustikforschung ausgegangen, wie sie bereits Ende der 1960er-Jahre vom kanadischen Komponisten Murray R. Schafer in seinem Soundscape-Projekt über die Veränderung von Klanglandschaften entwickelt15 wurde – ein Ansatz, der in Europa zunächst vor allem aufseiten der Sozialgeschichte und der historischen Anthropologie vorangetrieben wurde (Alain Corbin, Max Ackermann, Dietmar Kampfer, Christoph Wulf, Monika Dommann).16 Im anglo-amerikanischen Sprachraum entstanden parallel dazu zahlreiche kulturwissenschaftlich fundierte »Sound Studies«17, denen mittlerweile auch im deutschen Sprachraum einschlägige Publikationen folgten.18 Als durchaus wegweisend kann die im Jahr 2013 erschienene, von Gerhard Paul und Ralph Schock initiierte Großstudie zur Soundgeschichte des 20. Jahrhunderts gelten. Der darin von den Herausgebern formulierte Grundsatz liegt auch dem vorliegenden Werk zugrunde: »Töne, Klänge und Geräusche sind uns (…) nicht nur Quellen für etwas; vielmehr sehen wir in ihnen eigenständige Themen der Betrachtung.«19
Gleichsam als Ergänzung dazu sollen nunmehr erstmals Sound- und Stadtgeschichte umfassend verschränkt werden. Am Beispiel der Großstadt Wien wird gezeigt, wie sich die urbane Geräusch- bzw. Lärmkulisse veränderte, wie diese Veränderungen von der Bevölkerung wahrgenommen und bewertet wurden und welche Auswirkungen sie auf die Stadtentwicklung und die Gestaltung des öffentlichen Raumes hatten. Eine zentrale, auch zivilisationshistorisch bedeutsame Frage, die es dabei zu beantworten gilt, ist jene nach der Art der akustischen Sensibilitätsveränderung: Haben sich die Toleranzschwellen tendenziell eher mehr in Richtung Abstumpfung und Gewöhnung verschoben, wie dies etwa Corbin vermutet?20 Oder ist im Gegenteil eine gesteigerte Empfindlichkeit und Reizbarkeit gegenüber Lärm zu verzeichnen?
Entsprechend der Komplexität des Phänomens Lärm wird eine möglichst vielfältige, interdisziplinär orientierte Quellengrundlage herangezogen, die uns zumindest indirekt Aufschluss über die affektive Dimension des Auralen erlaubt: Beiträge in Tageszeitungen und Fachzeitschriften, Stadtschilderungen und Reiseberichte, Autobiografien und andere Selbstzeugnisse aufmerksamer »Ohrenzeugen«, Anstands- und Benimmbücher, Verwaltungsberichte, Gesetzestexte sowie Hand- und Lehrbücher der Psychologie, Medizin, Hygiene, Physik, Architektur und des Städtebaus.
Besonderes Augenmerk gilt dabei den Stadtbeobachtungen und Erfahrungsberichten der Journalisten. Rolf Lindner hat darauf hingewiesen, dass gerade deren Erzeugnisse eine überaus ergiebige Quelle für urbanistische Fragestellungen darstellen: Keine andere zeitgenössische Berufsgruppe verfügt über ein vergleichbares Spektrum an Anschauungswissen über die Großstadt; keine andere Gruppe ist sich des ungleichzeitigen Nebeneinanders von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft derart bewusst; und keine andere Gruppe ist gleichsam schon von Berufs wegen in die Großstadt als Urbanitätslabor eingebunden. Journalisten sind, so Lindner, ein exemplarisches Produkt dieses Labors, als Reflektoren ebenso wie als Protagonisten.21
Ergänzt um die Analyse von Quellenbeständen aus dem Stadtarchiv Hannover, wo sich u. a. zahlreiche Wien betreffende Dokumente der frühen Antilärmbewegung befinden, galt es, den Versuch einer Stadtgeschichte aus akustischer Perspektive zu unternehmen und die vielschichtigen Transformationsprozesse der Moderne und ihre Auswirkungen auf den Alltag aus einer neuen Sicht zu analysieren. Nicht zuletzt soll damit auch die österreichische Stadtgeschichtsforschung, die sich im letzten Jahrzehnt in eine breite, kulturwissenschaftlich und interdisziplinär orientierte Richtung entwickelt hat, um eine wesentliche Facette bereichert werden.22 Wobei gerade die »Musikstadt Wien« ein überaus lohnendes Objekt für eine historische Untersuchung von »noise scapes« darstellt, wie bereits Roman Horak und Siegfried Mattl feststellten.23
Am Beginn stehen zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen zur Problematik der Erforschung vergangener Hörgewohnheiten. Dabei soll deutlich gemacht werden, dass es in diesem Bereich der Sinnesgeschichte stets nur um eine – kontextbezogene – Annäherung, nie aber um eine objektive Rekonstruktion gehen kann. Gerade die Frage, ab wann ein Geräusch als Lärm wahrgenommen wird, setzt spezielle soziale und psychische Dispositionen voraus. Des Weiteren werden die beträchtlichen Umwälzungen der Lautsphäre im 19. Jahrhundert dargelegt, ebenso wie das leidenschaftliche Interesse der Zeit an Fragen des Hörens, das sich nicht zuletzt in der Entstehung der Akustik als eigener Wissenschaft widerspiegelt.
Abb. 2: Musikstadt Wien: Ansichtskarte, um 1900
Im Anschluss daran werden die Grundzüge des Wandels der Wiener Geräuschkulisse skizziert. Welche Geräusche verschwanden allmählich gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus der Stadt, welche neuen kamen hinzu, wie breiteten sich diese aus? Was waren die physisch-materiellen Voraussetzungen für diese Veränderungen? Die Großstadtwerdung Wiens wird insbesondere in ihren baulichen und infrastrukturellen Aspekten beleuchtet; deren Auswirkungen auf die akustischen Verhältnisse werden dargelegt, sodass damit auch einige wichtige quantitative Eckdaten vorliegen.
Vor diesem Hintergrund wird in einem zentralen Kapitel der soziale Aspekt der Lärmfrage untersucht. Zu einem unüberhörbaren Kennzeichen großstädtischen Lebens geworden, wird die Auseinandersetzung mit dem Lärm als gesellschaftlich-kulturelle Konstruktion begriffen, als Teil jenes mächtigen Diskurses, in dem sich Momente der Kultur- und Zivilisationskritik mit jenen des Klassenkampfes und der vielfach empfundenen Überreizung der Sinne trafen. Bürgerliche Hygiene- und Gesundheitsbewegungen sowie die Entdeckung der »Nervosität« als der Krankheit des modernen Stadtmenschen ließen eine auditive Wahrnehmungskultur entstehen, in der Ruhe zur obersten Bürgerpflicht erhoben wurde. Am Beispiel des Verschwindens von Straßenhändlern und Straßenmusikern wird gezeigt, wie das Verhalten im öffentlichen Raum reglementiert und diszipliniert wurde, bis sich schließlich weite Bereiche der Stadt gleichermaßen akustisch wie sozial gereinigt präsentierten. Den gereizten Nerven des Großstädters, der dem Lärm und der Hektik in seiner Sommerfrische – im Reisegepäck stets eine beträchtliche Portion Zivilisationskritik – zu entkommen suchte, werden die Apologeten der modernen Zeit (Künstler, Literaten, Musiker) gegenübergestellt, denen der Lärm zum Inbegriff der Urbanität geworden war.
In einem weiteren Kapitel werden die Auswirkungen der internationalen, insbesondere der deutschen Lärmschutzbewegung auf Wien analysiert, wobei deren Initiator, dem Publizisten und Kulturphilosophen Theodor Lessing (1872–1933), besondere Aufmerksamkeit gilt. Er entfaltete auch in Wien eine breite Agitationstätigkeit und fand in den beiden Schriftstellern Hugo von Hofmannsthal und Alfred Hermann Fried prominente Befürworter seines Kampfes. Die hier getroffenen Maßnahmen zur Verminderung der Lärmbelästigung werden beschrieben und ihre Auswirkungen auf die (sozial)räumliche Entwicklung der Stadt untersucht. Mehrmals aufgegriffen wird das Verhältnis von Musik und Lärm, eingedenk der Tatsache, dass gerade Musiker und Komponisten zu den sensibelsten »Ohrenzeugen« ihrer Zeit gehören. Abschließend wird ein Ausblick auf das 20. und frühe 21. Jahrhundert unternommen, indem die entstandenen akustischen Sensibilitäten auf ihre Nachhaltigkeit untersucht und wichtige neue Entwicklungstendenzen dargelegt werden.
Dass die akustische Umweltverschmutzung ein virulentes Problem darstellt, steht außer Zweifel. Lärm ist zu einer der wichtigsten Krankheitsursachen unserer Zeit geworden, zu einem der häufigsten Auslöser für Stress, Schlaflosigkeit und Bluthochdruck und zum – nach dem Rauchen – zweitgrößten Risikofaktor für Herzinfarkt. In ganz Europa sind heute geschätzte 125 Millionen Menschen andauerndem Verkehrslärm ausgesetzt.24 Besonders dramatisch stellt sich die Situation in den Ballungsräumen dar, wo der Kfz-Verkehr längst zum allerorts wahrnehmbaren »Grundrauschen« gehört.
Jede größere Stadt hat mittlerweile ein eigenes Amt für Lärmbekämpfung eingerichtet; Lärmkataster werden erstellt und eigene Lärmschutzzonen verordnet; verschiedenste technische Maßnahmen werden erprobt, bis hin zur Einführung von so verheißungsvoll klingenden Neuerungen wie »Flüsterasphalt«. Experten warnen vor der »Verlärmung« ganzer Stadtteile und der Ausbreitung von »Lärmghettos«, Gebieten also, in denen der Lärm eine derartige Dominanz erreicht, dass er zum hemmenden sozioökonomischen Entwicklungsfaktor wird. Nicht zuletzt verdeutlicht auch die steigende Anzahl der Menschen, die am Wochenende der Stadt entfliehen, die Dringlichkeit des Problems.
Neben den gesundheitlichen Faktoren wird zunehmend auch die ökonomische Dimension des Lärms deutlich: Im Jahr 2003 berechnete der »Verkehrsclub Österreich«, dass der Wertverlust von Häusern, Wohnungen und Grundstücken durch Lärmbelastung allein in Österreich rund 1,14 Milliarden Euro pro Jahr beträgt. Pro Dezibel Lärmbelastung sinkt der Wert von Immobilien um ein Prozent.25
Auf internationaler Ebene ist seit Ende der 1990er-Jahre eine verstärkte Sensibilisierung für Fragen der Lärmbelästigung festzustellen. So verabschiedete die EU im November 1996 die Richtlinie »Future Noise Policy«. Seit 1998 wird jährlich ein internationaler »Tag gegen Lärm« (Noise Awareness Day) ausgerufen – ein Vorhaben, das zumindest einmal im Jahr die mediale Aufmerksamkeit für Lärm zu bündeln versucht. Bisheriger Höhepunkt waren zweifellos die Aktivitäten der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Als »Europäische Kulturhauptstadt« des Jahres 2009 stellte sie mit ihrem Projekt »Hörstadt« erstmals die Akustik der Stadt in den Mittelpunkt zahlreicher kultureller und politischer Veranstaltungen – mit großem Erfolg und auch international positivem Feedback. Im Jahr 2013 schließlich wurden in Umsetzung einer EU-weiten Richtlinie und als weitere Innovation strategische Umgebungslärmkarten veröffentlicht, die österreichweit der Bewertung und Bekämpfung von Lärm dienen.
Wie konstatierte die Hamburger Wochenzeitschrift »Die Zeit« unmissverständlich: »Der Lärm kriecht in die letzten Winkel, zerstört Oasen der Ruhe, verkürzt Schlaf und Regenerationszeiten. Gleichsam gottgegeben wird er von vielen als eine unabänderliche Begleitmusik der modernen Industriegesellschaft hingenommen. Früher waren Schwefeldioxid oder Ruß nicht hinwegzudenken, heute ist es Lärm. (…) Die Gesellschaft ist auf dem besten Wege, vor einem Phänomen zu kapitulieren, das sie selbst geschaffen und zum Teil auch selbst gewollt hat. Ein Leben ohne Lärm gibt es nicht mehr: Er ist überall.«26
Annäherung
Vergangenes Hören
Mit dem allgemeinen Trend zur Sinnlichkeit, der seit den 1990er-Jahren immer mehr Bereiche unserer »Erlebnisgesellschaft« (Gerhard Schulze) erfasst – von Theatern und Museen bis hin zu Shopping- und Wellness-Zentren –, begann auch aufseiten der historischen Wissenschaften eine intensivierte Auseinandersetzung mit der Geschichte der Sinne. Autoren wie Diane Ackerman, David Howes, Constance Classen, Robert Jütte oder Waltraud Naumann-Beyer legten umfassende Überblicksstudien über europäische und außereuropäische Kulturen vor, zahlreiche Monografien untersuchen die sich wandelnden Gebrauchsweisen des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und Tastens, Ausstellungen und Symposien vermitteln das Thema einer breiten Öffentlichkeit.27 Angesichts der Erkenntnis, dass Sinneserfahrungen zu den frühesten und elementarsten Welterfahrungen des Menschen gehören, findet mittlerweile eine mehr ganzheitlich orientierte Forschung statt, die deutlich weniger von der verbreiteten Dominanz des Sehsinns geprägt ist. Die visuellen Vergangenheitsbilder werden um akustische, olfaktorische, geschmackliche und haptische Bilder ergänzt und erweitert, die neue Aufschlüsse über historische Lebenswelten, Wertvorstellungen oder auch soziale und kulturelle Verbindungs- und Grenzlinien versprechen. Die Gesamtheit der von einer Gesellschaft gemachten Sinneserfahrung wird als konstitutiv für die Herausbildung homogener Gefühlslagen und sozialer Verhaltensformen erkannt.28
Ausgegangen wird dabei von einer grundsätzlichen Historizität menschlicher Sinneswahrnehmungen. Sie werden nicht mehr ausschließlich als biologisch determiniert begriffen, sondern zu einem wesentlichen Teil auch als Produkt unterschiedlicher gesellschaftlicher Verhältnisse – eine Einsicht, die bereits Walter Benjamin (1892–1940) in seinem berühmten Aufsatz über »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« formulierte:
Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der gesamten Daseinsweise der menschlichen Kollektiva auch die Art und Weise ihrer Sinneswahrnehmung. Die Art und Weise, in der die menschliche Sinneswahrnehmung sich organisiert – das Medium, in dem sie erfolgt –, ist nicht nur natürlich, sondern auch geschichtlich bedingt.29
Der aktuelle historische Forschungsstand ist allerdings durchaus unterschiedlich, wie Robert Jütte in seiner grundlegenden »Geschichte der Sinne« betont. So überwiegen bislang eindeutig historische Studien über den Seh, Gehör- und Geruchssinn, während der Tast- und der Geschmackssinn eher selten die Aufmerksamkeit der Historiker gefunden haben.30
Für die in den letzten Jahren deutlich zunehmende Beschäftigung mit der Genese des Hörens, die mittlerweile als »Acoustic Turn« bzw. »Aural Turn« bezeichnet wird,31 erweist sich rückblickend das 19. Jahrhundert als besonders ergiebig. Das Wissen über die Funktionsweise des Ohres nahm in dieser Epoche rapide zu, während gleichzeitig die bisherigen Hörgewohnheiten im Zuge der industriellen Revolution und der damit einhergehenden Urbanisierung zutiefst irritiert und erschüttert wurden. Es war vor allem die Großstadt, dieses große Labor der Moderne, in der die gewohnten Formen der Aufmerksamkeit auf den Prüfstand kamen. Hier begannen sich die tradierten Wahrnehmungsmuster am frühesten aufzulösen und umzuformen. Die von Gottfried Korff benannte »innere« Urbanisierung, also das »Handeln, Denken und Fühlen im Urbanisierungsprozess«, modifizierte die psychosoziale Befindlichkeit des modernen Stadtmenschen nachhaltig.32 Ein neues Regime der Sinne entstand.33
Der Literaturwissenschaftler Heinz Brüggemann hat die in zahlreichen zeitgenössischen Texten beschriebenen Wahrnehmungskollisionen in den Metropolen untersucht und dabei u. a. auf den Schock hingewiesen, den der ohrenbetäubende Lärm bei vielen Stadtbesuchern auslöste. Erst allmählich bildete sich ein neues, der urbanen Situation angepasstes Wahrnehmungsvermögen heraus, das seinen Niederschlag schließlich auch in neuen literarischen Darstellungsformen fand.34
Deutlicher und rascher als an anderen Orten der Gesellschaft manifestierten sich in der Großstadt die Entwicklungstendenzen, aber auch die Probleme einer Zivilisation, deren kollektive Affekte und Mentalitäten sich erkennbar zu verschieben begannen. Die Analyse dieses Prozesses aus akustischer Sicht birgt ein beträchtliches, noch weitgehend unerforschtes Erkenntnispotenzial, betont der Kulturwissenschaftler Christoph Wulf: »Das Klappern von Pferdehufen und das Scheppern von Milchkannen gehören für die Städter unserer Tage zu einer vergangenen Welt. Mit der industriellen, der elektromechanischen und der elektronischen Revolution entstehen bis dahin unbekannte Geräusche (…), deren Analyse im Zusammenhang mit einer historischanthropologischen Erforschung des Zivilisationsprozesses interessante Erkenntnisse verspricht.«35
Auf einer etwas konkreteren Ebene ist zu erwarten, dass sich in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Ausbreitung der neuen Geräusche zentrale Konflikte und Bruchlinien des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts widerspiegeln: die soziale Kluft zwischen Bürgertum und Arbeiterklasse, der damit verbundene Kampf um politische und symbolische Macht, der Diskurs über zunehmende Verfeinerung oder Abstumpfung der Sinne, über Fortschrittsoptimismus und Technikeuphorie versus Kulturpessimismus und Zivilisationskritik, aber auch über die vielfältigen Reize der anonymen Großstadt versus die Sehnsucht nach überschaubarer ländlicher Idylle.
Abb. 3: Großstadt-Feeling: Wien-Praterstern, um 1910
Dabei stellt die Erforschung der Historizität der akustischen Wahrnehmung ein Vorhaben dar, das es von mehreren wissenschaftlichen Disziplinen aus durchzuführen gilt. Bereits Theodor Lessing wies in seiner 1908 erschienenen Kampfschrift gegen den Lärm auf die verschiedenen Zugangsweisen zu dieser Thematik hin, für die sich, wie er meinte, neben der Physiologie und der Psychologie notwendigerweise auch die Tonpsychologie, die Musikwissenschaft, die Otologie (Ohrenheilkunde), die Psychophysik, die Hygiene, die Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie die Philosophie interessieren.36 Auch Lessings Zeitgenossen Walter Benjamin, Siegfried Kracauer oder Georg Simmel machten die offensichtlichen Veränderungen der Wahrnehmung im Kontext der modernen Großstadt zum Gegenstand ihrer Untersuchungen. Die Bemühungen dieser Pioniere der kulturwissenschaftlichen Stadtforschung können als ein frühes Phänomen der reflexiven Moderne (Ulrich Beck) verstanden werden, die sich über die Bedingungen und Risiken ihrer eigenen Herkunft, Ausdifferenzierung und Dynamik ein Bewusstsein zu verschaffen suchte. Die eine konkrete Stadt konstituierenden Töne, Bilder oder Zeichen werden dabei als Artikulationen ihrer Repräsentation verstanden, die uns über soziale Schichtungen, Macht- und Geschlechterverhältnisse oder ökonomische Ungleichheiten Aufschluss geben. Und nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang auch Auskunft darüber zu erwarten, welche Bedeutung der akustischen Wahrnehmungskultur in der urbanen Lebenswelt für die Herausbildung von Identität und kulturellem Zusammenhalt zukommt.37
Der geschilderten Fülle an interessanten Fragestellungen an die Wahrnehmung der akustischen Welt von gestern steht aufseiten des überlieferten Quellenkorpus eine relativ schwierige Situation gegenüber. So ist zunächst und vor allem zu bedenken, dass jedes akustische Ereignis unmittelbarste Gegenwart ist, also ein extrem flüchtiges Phänomen, das bis zur Erfindung von technischen Aufnahmegeräten keine Spuren hinterließ. Oder, um es mit den Worten von David Lowenthal, einem frühen Erforscher der Geschichte der Umweltwahrnehmung, zu sagen: »Nichts von dem, was unser menschliches Ohr vernimmt, ist alt.«38 Zwar gibt es eine lange Tradition der Beschreibung und Weitergabe bestimmter Töne mithilfe der menschlichen Sprache und des bis ins Mittelalter zurückreichenden Systems der Notenschrift, die Entwicklung von Techniken zur Konservierung und Reproduktion von Schallwellen erfolgte allerdings erst im 19. Jahrhundert. Es war der französische Forscher Edouard-Leon Scott de Martinville (1817–1879), der im Jahr 1860 die erste Tonaufzeichnung auf einem von ihm entwickelten »Phonautographen« durchführte.39 1877 konstruierte der Multi-Erfinder Thomas Alva Edison (1847–1931) einen »Phonographen«, mit dem Töne aufgezeichnet und wiedergegeben werden konnten. Danach folgten noch Jahrzehnte der technischen Weiterentwicklung, bis um 1900 ausgereiftere Aufnahme- und Wiedergabeapparate in größerer Zahl zur Verfügung standen.40 (Eine der ältesten erhaltenen Tonaufnahmen stammt übrigens von Kaiser Franz Joseph, aufgenommen im August 1903 in Bad Ischl. Sie befindet sich im Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem 1899 gegründeten, ältesten Schallarchiv der Welt.)
Die Möglichkeit, Töne zu konservieren und anschließend wiederzuerwecken, ist – Lowenthal zufolge – auch ein häufiges Thema in der fantastischen Literatur. Zumeist wird dabei auf die treffende Metapher vom Einfrieren vergangener Töne und von ihrem späteren Auftauen zurückgegriffen. So staunt bereits Rabelais’ Figur Pantagruel auf einer Segelfahrt am Rande des Eismeers über einen großen Lärm, ohne dass irgendetwas zu sehen wäre: Kanonendonner, Kugelpfeifen, Ächzen und Geschrei, Geklirr von Streitäxten und Pferdewiehern – die Geräusche einer großen Schlacht, die im vorigen Winter hier stattfand, waren in der eisigen Luft erstarrt und tauten erst jetzt zu Hörbarkeit auf. Und auch der Baron von Münchhausen erzählt von einem Winter, der so kalt war, dass die Töne im Horn eines Jägers einfroren und erst im Tauwetter des Frühlings wieder zu vernehmen waren.41
Generell gilt somit: Bei der historischen Analyse akustischer Phänomene ist man in der Regel auf indirekte Quellen angewiesen, wobei sich neben normativen Texten (Gesetze und Verordnungen, Anstands- und Benimmbücher, Gesundheitsratgeber etc.) vor allem medizinische, hygienische und philosophisch-ästhetische Abhandlungen, literarische Beschreibungen (v. a. Stadtschilderungen und Reiseberichte) sowie sogenannte Ego-Dokumente (Briefe, Tagebücher, Autobiografien) als besonders ergiebig erweisen. Sie alle liefern zwar nur bruchstückhafte, kaum quantifizierbare Informationen, stellen letztlich aber wertvolle Hinweise dar, die zumindest Annäherungen an eine vergangene Kultur des Hörens ermöglichen. Bei der konkreten Interpretation der Quellen sind nach Alain Corbin »strenge Vorsichtsmaßnahmen« zu beachten:42 Die Aufstellung eines Inventars vergangener Geräusche allein, wie dies etwa Guy Thuillier für ein französisches Dorf im Nivernais Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte,43 scheint wenig zielführend, gibt sie doch noch keinen Aufschluss über den damaligen Gebrauch des Gehörsinns, der sich jedenfalls ganz wesentlich von unserem heutigen Gebrauch unterscheidet. Unverzichtbar ist es, mit zu berücksichtigen, welche kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung dem Hören zu bestimmten Zeiten im Vergleich mit den übrigen Sinnen zukommt, wie sich das Hören in die geltenden Vorstellungen über die Rangordnung der Sinne einfügt und welcher wissenschaftliche Kenntnisstand über die Funktionsweise des Hörens existiert. Weiters ist zu bedenken, dass die überlieferten Quellen oft gerade nicht von den alltäglichen Geräuschen sprechen, die bereits zur Gewohnheit geworden sind. Es gilt, die Normen aufzuspüren und geltende Toleranzschwellen auszuloten, nach denen die Trennung zwischen dem Gesagten und Ungesagten festgelegt wurde, wobei das Ungesagte keineswegs immer auch das Unbemerkte bedeuten muss.
Nachdrücklich ist bei der Erkundung der komplexen Welt des Akustischen an die Worte des französischen Historikers und Erforschers der europäischen Mentalitäten, Georges Duby (1919–1996), zu erinnern: »Und vor allem muss man in Rechnung stellen, was niemals geschrieben wurde, das Nichtgesagte aufspüren, das Schweigen ausdeuten und noch anderen, flüchtig-geheimen Spuren nachgehen, die Bedeutung von Zeichen im weitesten Sinn entdecken, die geringfügigsten Hinweise aufnehmen.«44
Einen von der Umweltschutzbewegung her kommenden Zugang beschreitet Murray R. Schafer (geb. 1933), Begründer des »Akustikdesigns« und der »Klangökologie« (Lehre von den Wechselwirkungen zwischen Mensch und akustischer Umwelt)45. Wenngleich sein Ansatz – am ausführlichsten dargelegt in seiner kulturhistorischen Studie »Klang und Krach« – aus heutiger Sicht als allzu konservativ und modernitätsskeptisch bezeichnet werden muss,46 so führte er doch ein begriffliches Instrumentarium in die Klangforschung ein, das sich für die historische Analyse als recht brauchbar erweist. So prägte er u. a. den Begriff der »Lautsphäre« als einer Schallumwelt, die die spezifischen Geräusche eines Ortes charakterisiert, wobei er generell zwischen drei Arten von Geräuschen unterscheidet: Grundtöne, die von Geografie, Klima und Fauna bestimmt werden und als ständig präsentes Hintergrundgeräusch vielfach nicht mehr bewusst wahrgenommen werden; Signallaute, die klar konturierte Übermittler bestimmter Botschaften, insbesondere auch Warnzeichen darstellen (Glockenläuten, Sirenenton); Orientierungslaute, die als charakteristische Geräusche besondere Beachtung finden und Erkennbarkeit vermitteln.47
Schafers Beschreibung der Veränderungen der einzelnen Lautsphären (er unterscheidet eine natürliche, ländliche, städtische, vor- und nachindustrielle Lautsphäre) berücksichtigt allerdings, wie der Schweizer Sozialpsychologe Alexander M. Lorenz zu Recht anmerkt, zu wenig den sozialhistorischen Kontext und lässt die Rezeptionsseite weitgehend außer Acht.48 Daran anknüpfend kann festgestellt werden, dass eine fundierte Analyse des historischen Umgangs mit Geräuschen idealerweise aus zwei Richtungen erfolgt: Zum einen gilt es, die jeweils herrschenden akustischen Rahmenbedingungen abzustecken. Der Historiker nimmt dabei die Rolle eines »Ohrenzeugen« ein, der – in Anlehnung an eine Formulierung Elias Canettis49 – hört, was es zu hören gibt, alles gut einsteckt und nichts vergisst. Dieser Rekonstruktionsversuch muss nicht immer anhand von Zeitzeugenberichten geschehen. So kann man sich beispielsweise der Ausbreitung des Straßenbahngeräusches in der Stadt auch über die zunehmende Verdichtung des Streckennetzes annähern. Zum anderen ist anhand der oben beschriebenen Quellen jenen Diskursen nachzugehen, die zu bestimmten Zeiten über das Hören auftauchen. Die daraus ableitbaren Wahrnehmungs- und Sensibilitätsveränderungen, nach Lucien Febvre eines der lohnendsten Felder der Geschichtsforschung,50 sind sodann kritisch zu interpretieren. Wobei stets auch mitbedacht werden muss, dass sich akustische Eindrücke mit den Mitteln der Sprache von vornherein nur näherungsweise beschreiben lassen.
Der Gehörsinn und seine Stellung in der Hierarchie der Sinne
»Mit der Zeit ward das Gehör mein liebster Sinn.«Sören Kierkegaard, 1843
Aus anthropologischer Sicht weist der Gehörsinn zahlreiche Besonderheiten auf, die ihn von den anderen Sinnen unterscheiden.51 So ist das mit rund 18.000 Sinneszellen ausgestattete Ohr das weitaus sensibelste aller Sinnesorgane. Der menschliche Hörbereich reicht bei jungen Erwachsenen von 16 bis 20.000 Schwingungen pro Sekunde (Hertz), beträgt also mehr als zehn Oktaven. Insgesamt können damit je nach Lautstärke und Frequenz bis zu 300.000 Töne unterschieden werden, womit das akustische Wahrnehmungsfeld um ein Vielfaches größer ist als beispielsweise das visuelle, das lediglich eine Oktave beträgt.52
In der menschlichen Entwicklung stellt das Ohr jenes Sinnesorgan dar, das als erstes voll ausgebildet und funktionsfähig ist. Bereits viereinhalb Monate nach der Befruchtung der weiblichen Eizelle hat das innere Hörorgan, die Cochlea (Schnecke), ihre endgültige Größe erreicht, während alle anderen Teile des Körpers noch bis zum 17. oder 18. Lebensjahr wachsen. Der Fötus hört die Stimme der Mutter, ihr Atmen, ihren Blutkreislauf, ihre Darmtätigkeit. Von ferne hört er die Stimme anderer Personen, vernimmt er angenehme und unangenehme Geräusche, auf die er zu reagieren in der Lage ist. Über den Gehörsinn treten wir als Erstes mit unserer Umwelt in Kontakt; über ihn werden wir angesprochen, bevor wir geboren werden; mit ihm hören wir andere, bevor wir sie sehen, riechen oder berühren.
Und dies andauernd und ununterbrochen. Denn im Gegensatz zu anderen Sinnesorganen ist das Ohr jederzeit empfänglich und nicht willkürlich verschließbar. Eine ständig aktivierte Alarmanlage: Akustisch sind wir immer wach, auch während des Schlafes, und selbst wenn wir die Ohren mit künstlichen Hilfsmitteln verstopfen, ist noch das Rauschen unseres Blutes vernehmbar. Erst mit dem Tod endet auch die Fähigkeit zu hören, wobei das Ohr zumeist jener Sinn ist, der als letzter verlöscht. Die Wahrnehmung von Geräuschen und Tönen begleitet den Menschen somit über die längste Zeitspanne seines Lebens hinweg.
Der Soziologe und Philosoph Georg Simmel (1858–1918) spricht in diesem Zusammenhang vom Ohr als dem »schlechthin egoistischen Organ, das nur nimmt, aber nicht gibt«, diesen Egoismus allerdings damit büße, dass es dazu verurteilt sei, alles zu nehmen, was in seine Nähe kommt. Erst mit dem Mund, mit der Sprache, zusammen erzeuge das Ohr den innerlich einheitlichen Akt des Nehmens und Gebens.53 Damit wird der Gehörsinn zu dem sozialen Sinn. Wir hören einander zu, lernen dadurch selber sprechen und letztlich auch verstehen. Wir vernehmen Wörter und lernen ihre Bedeutungen. Wir sind der Stimme und ihrem Ausdruck zutiefst affektiv verbunden, nehmen im Zuhören bewusst oder unbewusst etwas vom innersten Wesen des Gegenübers wahr. Schon für Johann Gottfried Herder (1744–1803), der sich in seiner berühmten, 1772 veröffentlichten »Abhandlung über den Ursprung der Sprache« intensiv mit dem Wesen und der Wirkung des Hörens auseinandersetzte, war das Ohr die eigentliche Tür zur Seele:
Das Gehör allein, ist der Innigste, der Tiefste der Sinne. Nicht so deutlich, wie das Auge ist es auch nicht so kalt; nicht so gründlich wie das Gefühl ist es auch nicht so grob; aber es ist so der Empfindung am nächsten, wie das Auge den Ideen und das Gefühl der Einbildungskraft. Die Natur selbst hat diese Nahheit bestätigt, da sie keinen Weg zur Seele besser wußte, als das Ohr und – Sprache.54
Etwas griffiger formulierte einige Jahrzehnte später der deutsche Arzt Dr. Johann Trampel in seinem populären Ratgeber zur richtigen Pflege der Ohren: »Durch das Auge vernehmen wir nur die äußere Gestalt des Menschen, durch das Ohr seine innere Stimme.«55 Da der Gehörsinn rückbezüglich ist, hört der Sprechende sich selbst, wodurch es dem Menschen überhaupt erst ermöglicht wird, nach-denklich zu sein. Die elementaren Vorgänge der Selbstwahrnehmung und Selbstvergewisserung werden in entscheidendem Maße von der Fähigkeit zu hören bestimmt, wodurch diese eine zentrale Rolle für die Herausbildung von Subjektivität und Sozialität spielt.
Die jeweils spezifische Art der Aneignung und Sondierung der sozialen wie der übrigen Umwelt spiegelt sich wider in den verschiedenen Ausdrücken, die im Deutschen für die Wahrnehmung akustischer Ereignisse existieren: horchen, lauschen, vernehmen, hören (inklusive der Spezifikationen zuhören, anhören, abhören, hinhören, herhören, weghören, umhören, überhören, verhören, hineinhören, heraushören). All diese Worte bringen unterschiedliche Formen der auralen Aufmerksamkeit zum Ausdruck, eine mehr oder weniger starke Gerichtetheit und Intentionalität.56 Auch die Zahl der auf das Hören bezogenen Worte und Metaphern ist groß: hörig sein, gehorsam, gehorchen, gehören, Angehöriger, jemand erhören, aufhören, Verhör, vom Hörensagen, Hören und Sehen vergehen, etwas nur mit halbem Ohr hören, das Gras wachsen hören, etwas läuten hören, hör mal!, etwas lässt sich hören, von sich hören lassen, etwas von jemandem zu hören kriegen etc.
Entsprechend den einzelnen Arten des Hörens unterscheidet der Architekt und Geograf Pascal Amphoux, der die komplexe Wahrnehmung gegenwärtiger städtischer Klangwelten erforscht, ein dreiteiliges Modell: das Klang-Milieu, die »Mitte« unseres Daseins, in der das absichtslose, rein orientierende Hören dominiert; die Klang-Umwelt, in der ein Austausch, ein Zu- und Hinhören stattfindet; sowie die Klang-Landschaft als Sphäre des Horchens, des verstehenden, auch ästhetisch bewertenden Hörens.57
Über die mehr oder weniger bewusste Wahrnehmung unserer akustischen Umgebung wachsen wir in eine Kultur hinein, entwickeln wir ein Gefühl von Vertrautheit und Beheimatung. Dies trifft auch auf die räumliche Verortung zu. Hören ist die akustische Mitteilung von Bewegung – in der Zeit genauso wie im Raum, dessen Dreidimensionalität auf diese Weise erfahr- und erlebbar wird. Welch wichtige Funktion den Ohren für die Entwicklung von Raumgefühl und Raumbewusstsein zukommt,58 wird deutlich, wenn wir unsere Augen einmal bewusst schließen oder uns in völliger Dunkelheit bewegen.59 Sofort wird man sich der Fähigkeit unserer Ohren bewusst, mehrere Schallquellen gleichzeitig zu orten, Richtungen und Entfernungen zu schätzen, Reflexionsvermischungen zu interpretieren. Parallel dazu entsteht ein akustisches Bild des Raumes, in dem die Schallereignisse stattfinden, werden Informationen über die Ausdehnung und materielle Beschaffenheit der Umgebung vermittelt.60 Dabei kann das Ohr – im Unterschied zum Auge – auch Dinge erfassen, die sich hinter dem Kopf befinden, oder auch »um die Ecke hören« – und dies bei Tag und Nacht. Roland Barthes hat in einem Essay über das Zuhören auf diesen wichtigen Aspekt, der auch für unsere Themenstellung von Bedeutung ist, hingewiesen:
Das Zuhören, das auf dem Hören aufbaut, ist durch das Erfassen von Entfernungsgraden und die regelmäßige Rückkehr der Schallerregung vom anthropologischen Standpunkt aus der eigentliche Sinn für Raum und Zeit. Beim Säugetier wird das Territorium durch Gerüche und Laute abgesteckt; beim Menschen ist – was oft unterschätzt wird – die Aneignung des Raumes ebenfalls schallbedingt: Der häusliche Raum, der Wohnraum (ungefähres Gegenstück zum tierischen Territorium) ist ein Raum vertrauter, wiedererkannter Geräusche, die zusammen eine Art häusliche Symphonie bilden.61
Barthes verweist auf Franz Kafka (1883–1924), der – für Geräusche überaus sensibel – in einer kurzen Erzählung seine häusliche Lautkulisse beschrieb, unter der er bisweilen zutiefst litt:
Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen, durch ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte der zwischen ihnen Laufenden erspart, noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche höre ich, (…) aus dem Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt. (…) Die Wohnungstür wird aufgeklinkt und lärmt wie aus katarrhalischem Hals, öffnet sich dann weiterhin mit dem kurzen Singen einer Frauenstimme und schließt sich mit einem dumpfen männlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten anhört.62
Eine ähnliche Funktion kommt den Geräuschen im öffentlichen Raum der Stadt zu, seien sie nun negativ oder positiv konnotiert. Auch die äußere, sämtliche Wohnungen und Gebäude umgebende akustische Hülle ist wesentlich an der Entstehung eines Gefühls der Vertrautheit und Wiedererkennung beteiligt. Die Orientierung in der Stadt erfolgt zu einem nicht unwesentlichen Teil über das Gehör, teils bewusst in der konkreten Reaktion auf akustische Signale, teils unbewusst im Empfinden einer Umgebung als angenehm oder unangenehm.63 Auch das Ausmaß der Identifikation der Bewohner mit ihrer Stadt wird durch das Hören entscheidend (mit)geprägt, womit es für die real-topografische, aber auch die sinnlich-emotionale Verortung im urbanen Raum-Zeit-Gefüge konstitutiv ist.
Gerne wird der akustischen die visuelle Wahrnehmung gegenübergestellt, ein Vergleich, der sich insbesondere für die nach den Möglichkeiten der Erkenntnis fragende Philosophie als besonders instruktiv erwies (und in dem auch auf die Wichtigkeit der gegenseitigen Ergänzung beider Sinne hingewiesen wird). So bezeichnete etwa Arthur Schopenhauer (1788–1860) »das Gesicht als Sinn des Verstandes, welcher anschaut, das Gehör als Sinn der Vernunft, welche denkt und vernimmt«64. Und noch ein Unterschied war für Schopenhauer – auch er übrigens ein überaus lärmgeplagter Zeitgenosse – von zentraler Bedeutung:
Das Gesicht ist ein aktiver, das Gehör ein passiver Sinn. Daher wirken Töne störend und feindlich auf unsern Geist ein, und zwar um so mehr, je thätiger und entwickelter dieser ist: Sie zerreißen alle Gedanken, zerrütten momentan die Denkkraft. Hingegen gibt es keine analoge Störung durch das Auge, keine unmittelbare Einwirkung des Gesehenen, als solchen, auf die denkende Thätigkeit (…); sondern die bunteste Mannigfaltigkeit von Dingen, vor unsern Augen, lässt ein ganz ungehindertes, ruhiges Denken zu. Demzufolge lebt der denkende Geist mit dem Auge in ewigem Frieden, mit dem Ohr in ewigem Krieg.65
Wolfgang Welsch, ein Philosoph unserer Tage, fasst die typologischen Unterschiede zwischen Sehen und Hören folgendermaßen zusammen:66
Bleibendes – Verschwindendes: Sehen hat mit Beständigem, dauerhaft Seiendem zu tun, Hören hingegen mit Flüchtigem, Vergänglichem, Ereignishaftem. Während das Auge die Tendenz hat, die Dinge statisch und unveränderlich wahrzunehmen, kann das Ohr die Dynamik zeitlicher Genese erfassen. Unsere Sensibilität für die Welt des Hörbaren ist dadurch völlig anders geprägt, auch was die Auswirkung akustischer Ereignisse wie Lärm betrifft. Sichtbares ist dauerhaft, während Hörbares vorübergehend ist und im wörtlichen Sinn eine verschwindende Größe darstellt. Nicht zuletzt aus diesem Grund besitzt das Sehen eher eine Affinität zu Erkenntnis und Wissenschaft, das Hören hingegen zu Glaube und Religion.
Distanzierung – Eindringlichkeit: Hören wie Sehen sind Fernsinne, aber das Sehen ist der eigentliche Sinn für Distanz. Im Sehen halten wir Abstand zu den Dingen, halten sie an ihrem Ort fest und können sie dadurch objektivieren. Das Hören lässt die Dinge ein, ist unser Sinn für Verbundenheit mit der Welt, gekennzeichnet von Unmittelbarkeit und Eindringlichkeit.
Affektlosigkeit – Passibilität: Sehend halten wir die Welt fern und sind damit, wie bereits Immanuel Kant feststellte, körperlich »am wenigsten affiziert«67. Das Hören hält nichts fern, lässt alles ein, berührt uns zutiefst in unserem Innersten. Der Hörende ist verletzlich, ausgesetzt und durch die Unmöglichkeit des Verschließens der Ohren ständig den Geräuschen seiner Umgebung ausgeliefert. Hören ist ein Sinn extremer Passibilität, dem akustischen Andrang kann man nicht entrinnen.
Individualität – Sozietät: Sehen ist Ausdruck der Individualität, der souveränen Weltbetrachtung. Hören hingegen ist, wie bereits erwähnt, weit mehr mit unserer sozialen Existenz verbunden, mit der Entwicklung und dem Gebrauch der Sprache, dem (An)Erkennen des Anderen.68
Im Verlauf des abendländischen Zivilisationsprozesses wurde die ursprüngliche Dominanz des Gehörsinns sukzessive zurückgedrängt zugunsten des Sehsinns. Untersuchungen zeigen, dass der heutige Mensch die für ihn relevanten Informationen zu 80 Prozent durch das Auge und zu rund 13 Prozent durch das Ohr aufnimmt, während sich die übrigen Sinne den Rest teilen. Die »Hypertrophie« des Auges ist zu einem viel zitierten Kennzeichen unserer Kultur geworden.
Abb. 4: Scherzkarte, um 1900
Es war vor allem die Schrift, die zum Vehikel der Durchsetzung des Sehens gegenüber dem Hören wurde. Ihre Verbreitung förderte logozentrische Denkformen und Abstraktionsprozesse mit deutlichen Affinitäten zum Sehen. Schon die vorsokratischen Denker zogen das Sehen dem Hören vor. »Augen sind genauere Zeugen als Ohren«, heißt es etwa bei Heraklit,69 und auch im berühmten »Höhlengleichnis« von Platon wird das Sehen als das Medium der Erkenntnis propagiert. Selbst ein Mythos wie »Narziß und Echo« lässt sich als Ausdruck der Spannung zwischen Hören und Sehen begreifen, die allmählich zugunsten des Sehens aufgelöst wird. Mit dem Verschwinden der alten Mythen und der Durchsetzung der Rationalität als neuer Macht geriet das Hören aufgrund seiner engen Verbindung mit dem Gehorchen in Misskredit. An die Stelle des gehorchenden Subjekts trat der selbstbestimmte Mensch, für den das aktive Sehen weit wichtiger wurde als das passive Hören.70
Wie stellt sich nun im 19. Jahrhundert die Hierarchie der Sinne konkret dar?71 Hier ist zunächst einmal anzumerken, dass die uns heute geläufige Zahl der Sinne bereits seit der Antike existiert. Es war Aristoteles (384–322 v. Chr.), der erstmals fünf Sinne unterschied und damit erstmals auch den Tastsinn als eigenen Sinn auffasste, im Unterschied etwa zu Platon (428–348 v. Chr.), der nur vier Sinne kannte. In seiner Schrift »Über die Seele« stellte Aristoteles jeden Sinn einzeln dar und erklärte, dass es keinen weiteren Sinn geben könne (z. B. für die Wahrnehmung der Bewegung, wie immer wieder behauptet wurde), da mit den beschriebenen fünf alles Wahrnehmbare ausreichend aufgenommen werden könne, ohne dass irgendein Mangel bestehe. Damit waren Art und Zahl der Sinne auch die folgenden Jahrhunderte über gültig festgeschrieben. Die kanonische Zahl Fünf, eine magische und heilige Zahl, die sich auch in anderen Kulturen wiederfindet, blieb bis heute bestehen. Sämtliche Bestrebungen, ihre Zahl auf mehr als fünf zu erhöhen, erwiesen sich letztlich als wenig erfolgreich: Dabei handelte es sich zumeist um Varianten des Tastsinns bzw. um den berühmten »sechsten« Sinn (als Sinn für das Übernatürliche, bei manchen Autoren auch für die Schönheit oder für den Geschlechtstrieb).
Daneben gab es auch immer wieder Versuche, die Sinne nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren. Es entstanden Einteilungen in eher spirituelle Sinne (Sehen und Hören) und eher körperliche Sinne (Geschmack, Geruch, Tasten), in besondere Sinne (denen ein eigenes Organ zugewiesen ist) und allgemeine Sinne (wie den Tastsinn, der über den ganzen Körper verteilt ist), in unmittelbare Sinne (bei denen die Gegenstände direkt an die jeweiligen Organe herangeführt werden) und mittelbare Sinne (die über ein Medium – Luft oder Wasser – mit dem Objekt in Kontakt treten), in Sinne mit doppelten Organen (jeweils zwei Körperöffnungen bei Geruch, Gesicht und Gehör) und Sinne mit einfachen Organen, oder in Sinne, die mehr der Nützlichkeit dienen (Tastsinn und Geschmack als bei der Nahrungsaufnahme unverzichtbar), und jene zur bloßen Annehmlichkeit.
Der Vergleich der Funktionsweisen bzw. Fähigkeiten der einzelnen Sinne und deren unterschiedliche gesellschaftliche Bewertung führten schließlich zu einer ausgeprägten Hierarchisierung der Sinne. Diese lässt sich als kulturelles Konstrukt begreifen, aber auch als Ergebnis der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschengeschlechts (aufrechte Körperhaltung, Leistungssteigerung des Gehirns) und der technologischen Veränderungen im Laufe des Zivilisationsprozesses (Übergang von der Oralität zur Literalität, Ausbreitung der Literalität als Folge der Erfindung des Buchdrucks).
Die »klassische« Rangordnung, wie sie mit Aristoteles beginnt, wird von den sogenannten »höheren« zu den »niederen« Sinnen gereiht: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Getast. Diese Einteilung war im Laufe der Jahrhunderte nicht unumstritten, denn auch der Gehörsinn und der Tastsinn wurden bisweilen als höchster Sinn angesehen. Die Vorrangstellung des Gesichtssinnes setzte sich letztlich durch, wobei dies in der philosophischen Tradition u. a. damit begründet wurde, dass dem Sehen mit der Entwicklung des aufrechten Ganges eine zentrale Rolle zukomme, die Augen vergleichsweise am meisten Gegenstände erfassen könnten, selbst in den größten Entfernungen, und die Wahrnehmung über den Gesichtssinn eindeutig den höchsten Erkenntniswert besitze, da sie die objektivste sei.
Der Gehörsinn nimmt als zweiter höherer Sinn ebenfalls eine bedeutende Stellung ein, von manchen Philosophen und insbesondere Theologen wird er – wie erwähnt – sogar über den Gesichtssinn gestellt, was in erster Linie mit seiner zentralen Rolle in der Welt des Glaubens und der religiösen Praxis begründet wird. Er gilt als Sinn der Vermittlung und des Erkennens der göttlichen Wahrheit. Schon bei Paulus hieß es: »Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber aus dem Wort Christi.«72 In den mittelalterlichen Klosterbauten gab es einen eigenen Hör- bzw. Zuhörraum (Auditorium; auch Parlatorium, d. h. Sprechraum der Mönche);73 und auch das frühchristliche Symbol für Gott-Vater war bezeichnenderweise ein akustisches, nämlich die vom Himmel herabdröhnende Donnerstimme.74 Die Vorstellung von der Empfängnis Gottes durch das Ohr spiegelt sich wider in der Architektur der Kirchenbauten, die dezidiert auf eine Verstärkung des spirituellen Hörerlebnisses ausgerichtet sind. So weisen etwa romanische und gotische Kirchen eine ganz spezifische Akustik auf: Steinerne Böden, Decken, Wände und Säulen reflektieren die Schallwellen besonders stark, wodurch sich eine lange Nachhallzeit gerade bei tieferen, dunkleren Tönen ergibt. Dies führt zu einer Klangverschmelzung und in weiterer Folge zu einer Veränderung des Zeitgefühls. Der Eindruck feierlicher Würde entsteht, das Gefühl des »Aus-der-Welt-Seins« verstärkt sich.75
Die eminente sakrale Komponente des Hörens und deren Wandel, ja Auflösung im Zuge der Säkularisierung stellt denn auch einen wesentlichen mentalen Hintergrund dar für die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den veränderten Umgebungsgeräuschen. Auf der Ebene des Lärms bedeutet dies, dass der – später noch genauer erläuterte – »heilige Lärm« in zunehmendem Maße vom »profanen Lärm«, der sich insbesondere im städtischen Milieu ausbreitete, Konkurrenz erhielt und verdrängt wurde. Hinzuweisen ist schließlich auch darauf, dass der Kultivierung des Gehörsinns eine eigene Gattung künstlerischer Produktion gewidmet ist, was dessen zentrale kulturelle Leitfunktion weiter unterstreicht.
Doch zurück zur Hierarchie der Sinne. Zwischen den Fernsinnen Sehen und Hören und den beiden Nahsinnen Schmecken und Fühlen nimmt der Geruchssinn eine Mittelstellung ein, die seit der Antike wenig umstritten ist. Dem entspricht auch der Grad der Wahrnehmung, die im Vergleich zu Ersteren als gröber, zu Letzteren als feiner eingestuft wird.
Am unteren Ende der Skala stehen der Geschmackssinn, der sich zunehmend als ästhetische Kategorie etabliert, und der Tastsinn. Letzterer wurde vereinzelt noch bis in die frühe Neuzeit als oberster und wichtigster Sinn eingestuft, da er den ganzen Körper und somit auch jedes einzelne Sinnesorgan betreffe und eine herausragende Rolle im Erkenntnisprozess spiele, wie überhaupt die haptische Erfassung der Welt schon bei der Nahrungsaufnahme für das Überleben des Menschen von zentraler Bedeutung sei. Diese führende Stellung kehrte sich erst in ihr völliges Gegenteil, als der Tastsinn in der jüdisch-christlichen Tradition zunehmend mit sündhaftem Tun (Wollust, ungezügeltem Geschlechtstrieb) in Verbindung gebracht wurde.
Das Zeitalter der »Aufklärung« beschleunigte die Aufspaltung der einzelnen Sinne. Ihre sowohl im philosophisch-naturwissenschaftlichen als auch im künstlerisch-ästhetischen Diskurs immer wieder beschworene Einheit (Synästhesie) wurde endgültig zerstört; analog zur voranschreitenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung kristallisierte sich die Trennung und Isolierung der Sinne immer deutlicher heraus. Sie wurden zu »Instrumenten« der Wahrnehmung, zu »Werkzeugen« der Weltaneignung. Die auf Naturbeherrschung abzielende Wissenschaft feierte den Triumph des Auges, das sich, wie Michel Foucault in seinen Arbeiten nachwies, endgültig als Hüter und Quelle der Wahrheit etablierte. »Aufklärung« bedeutete per se, die Augen zu öffnen. Der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter Utz, der den damaligen Sinnesdiskurs anhand ausgewählter literarischer Werke untersuchte, weist auf Schillers »Wilhelm Tell« hin, in dem die Apfelschuss-Szene zum paradigmatischen Bild wird, das die Vorherrschaft des Auges, aber auch die Kritik daran und die damit verbundenen Gefahren auf den Punkt bringt. Auf der Bühne regiert die Augen-Kunst. »Am Auge des Schützen Tell«, so Utz, »hängt Leben und Tod. Vor aller Augen muß sein Auge leisten, was alle zusammen nicht vermöchten.«76
Die Hierarchie der Sinne war an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert im Wesentlichen fixiert, lediglich die Bedeutung der niederen Sinne wurde bisweilen unterschiedlich eingestuft. Die privilegierte Stellung der höheren, oft auch als »edel« bezeichneten Sinne blieb unangefochten. Auch für Immanuel Kant (1724–1804), der sich in seiner 1798 erschienenen »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht« ausführlich mit der Rangordnung der Sinne beschäftigte, galt der Sinn des Gesichts als der edelste unter den Sinnen. Jener des Gehörs sei allerdings aufgrund seiner eminenten sozialen Bedeutung am wenigsten zu ersetzen:
Welcher Mangel oder Verlust eines Sinnes ist wichtiger, der des Gehörs oder des Gesichts? – Der erstere ist, wenn er angeboren wäre, unter allen am wenigsten ersetzlich; ist er aber nur später, nachdem der Gebrauch der Augen (…) schon kultiviert worden, erfolgt, so kann ein solcher Verlust (…) noch wohl notdürftig durchs Gesicht ersetzt werden. Aber ein im Alter Taubgewordener vermißt dieses Mittel des Umgangs gar sehr; (…) so wird man schwerlich einen, der sein Gehör verloren hat, in Gesellschaft anders als verdrießlich, mißtrauisch und unzufrieden antreffen. Er sieht in den Mienen der Tischgenossen allerlei Ausdrücke von Affekt oder wenigstens Interesse und zerarbeitet sich vergeblich, ihre Bedeutung zu erraten, und ist also selbst mitten in der Gesellschaft zur Einsamkeit verdammt.77
Ein sensorielles Modell hatte sich etabliert, das die Folie abgab zur gesellschaftlichen Deutung und Interpretation sinnlicher Wahrnehmungen – auch in Form von Kritik, die sich vor allem aufseiten der Kunst immer wieder an einer derart rigorosen Fragmentierung und Hierarchisierung der Sinne entzündete. Deutlich lässt sich beispielsweise in der Literatur eine Häufung synästhetischer Formen feststellen, mit der auf die isolierte Dominanz des Auges und die manifeste Verhärtung der Sinnesgrenzen reagiert wird. Schon die Werke eines Novalis, E. T. A. Hoffmann oder Clemens Brentano sind, wie Utz anschaulich belegt, geprägt von der romantischen Sehnsucht nach einer Wiederherstellung der verlorenen Totalität. In Novalis’ »Heinrich von Ofterdingen« heißt es programmatisch: »Alle Sinne sind am Ende Ein Sinn. Ein Sinn führt wie Eine Welt allmählich zu allen Welten.«78 Wie nahe etwa Gehör und Gefühl ursprünglich beieinanderliegen, zeigt sich deutlich, so wird argumentiert, in der sprachlichen Beschreibung von Klängen als »hart«, »rau«, »weich« oder »glatt«. Und auch zwischen Auge und Ohr wird eine enge Verbundenheit postuliert, wie sie Brentano in seinem berühmten Gedicht »Abendständchen« ausdrückt, das mit der imperativischen Aufforderung einsetzt, zu »hören«:
Hör, es klagt die Flöte wieder,
Und die kühlen Brunnen rauschen.
Golden wehn die Töne nieder,
Stille, stille, laß uns lauschen!
Holdes Bitten, mild Verlangen,
Wie es süß zum Herzen spricht!
Durch die Nacht, die mich umfangen,
Blickt zu mir der Töne Licht.79
Der literarische Diskurs über die Sinne setzt sich das ganze 19. Jahrhundert über fort. Er findet sich in Charles Baudelaires berühmtem Gedichtzyklus »Les Fleur du Mal« (mit dem Sonett »Correspondances«, einem Schlüsselwerk für die ästhetischen Anschauungen des Dichters) ebenso wie später bei Rainer Maria Rilke, in dessen Kunst dem Hören eine zentrale Bedeutung zukommt.80
Auch in anderen Bereichen zeichnete sich ein ähnlicher Paradigmenwechsel in der Sinneshierarchie ab, wie beispielsweise in der neu entstehenden Psychoanalyse. Bewusst wechselte Sigmund Freud (1856–1939) den Wahrnehmungsraum. Statt des Visuellen rückte er das Auditive in den Mittelpunkt, das Sprechen und Zuhören.
Die Sehnsucht nach einer anderen Ordnung der Sinne offenbart nur allzu deutlich die Defizite von Fortschritt und Modernisierung. Und sie spiegelt sich demzufolge auch wider in einer massiven Kritik an der großstädtischen Geräuschkulisse, dem – wie viele meinten – wohl sinnfälligsten Ausdruck für die herrschende Missachtung und Vernachlässigung eines der wichtigsten Sinnesorgane.
Der Wandel zur »Lo-fi-Lautsphäre«
»Das Geräusch des neunzehnten Jahrhunderts, das wir zuerst hören, wenn wir uns seelisch darauf konzentrieren, ist (…) das Donnern eines Eisenbahnzuges, der das Granitmassiv eines Schneegebirges im Tunnel durchquert, das Pfeifen von Dampfmaschinen, das Singen des Windes in Telegraphendrähten und der sonderbare heulende Laut, mit dem der elektrische Straßenbahnwagen an seiner Leitung hängend daherkommt.« Wilhelm Bölsche, »Hinter der Weltstadt«, 1901
Die auralen Eindrücke des Berliner Schriftstellers Wilhelm Bölsche (1861–1939) fokussieren paradigmatisch die einschneidenden akustischen Veränderungen, denen die europäische Zivilisation im Gefolge von Industrialisierung und Technisierung unterworfen war. Das hereinbrechende Maschinenzeitalter verdrängte die bis dahin dominierenden natürlichen Laute und ersetzte diese durch künstliche, maschinell erzeugte Geräusche. Nach einer Schätzung Schafers setzte sich die neu entstehende Lautsphäre nur noch zu rund 30 Prozent aus Natur- und Menschenlauten und zu 70 Prozent aus Werkzeug- und Maschinengeräuschen zusammen, während das Verhältnis in der vorindustriellen Epoche noch 90 zu 10 Prozent betragen hatte.81 Es waren insbesondere die akustischen Emanationen der Fabriken und der neuen Verkehrsmittel Eisenbahn, Straßenbahn und Automobil, die sowohl in der Stadt als auch auf dem Land eine für alle wahrnehmbare neue Geräuschkulisse entstehen ließen. Der stampfende, ununterbrochene Laut der Dampfmaschine wurde zum unüberhörbaren Symbol der neuen Zeit. Lokomotiven verbreiteten, schnaufend und zischend, die Botschaft vom Sieg des Kapitals. Anstelle der Kirchenglocken und Posthörner, die bisher den Rhythmus des Lebens bestimmt hatten, gaben nun die Dampfpfeifen den Takt an. Die neuen Klänge dehnten sich in bislang unberührte Gegenden aus, zum Leidwesen nicht weniger ruhesuchender Naturfreunde, die ihre romantischen Idealvorstellungen von ländlicher Idylle aufs Äußerste gefährdet sahen82:
Wir stehen auf der Anhöhe und schauen ins Tal. Rings tiefe Stille; auf dem Felde nebenan arbeiten einige Leute, man hört sie kaum. Das verworrene Geräusch des Dorfes drunten dringt nur gedämpft herauf. Da, plötzlich, durchschneidet gellend ein widerwärtiger Laut den Naturfrieden. Die Dampfpfeife der Fabrik dort am Flusse hat das Signal zur Frühstückspause gegeben.83
Die hier beschriebene rurale »Hi-fi-Lautsphäre«, in der die einzelnen Laute wegen des umgebenden niedrigen Geräuschpegels noch relativ deutlich zu unterscheiden sind, wurde, so Schafer, mit der voranschreitenden Urbanisierung immer weiter zurückgedrängt. Eine typisch städtische »Lo-fi-Lautsphäre« breitete sich aus, in der die einzelnen akustischen Signale in einer überdichten, sich ständig überlagernden Lautanhäufung untergingen: Der klare Laut wurde vom ausufernden Breitbandgeräusch verdeckt, die »akustische Perspektive« verschwand. Im Zentrum der Stadt gab es keine Entfernung mehr, nur Gegenwart. Alle Geräusche waren in gleicher Weise gedämpft, und um die gewöhnlichsten Laute hörbar zu machen, mussten sie zunehmend verstärkt werden.84 Der renommierte Wiener Musikkritiker Richard Batka (1868–1922) beschrieb die neue Lautkulisse denn auch treffend als fortwährendes »Tohuwabohu«:
Stelle dich einmal gegen Mittag an eine belebte Straßenkreuzung der Großstadt: da poltert, kollert, knarrt, läutet, pfeift, schreit, tollt es oft durcheinander, daß man den Lärm als körperlichen Schmerz empfindet. Und weil sich jeder einzelne über die andern zu Gehör bringen will, lizitieren einander die Krawallmacher immer mehr in ein Tohuwabohu hinauf, ohne doch ihren eigentlichen Zweck zu erreichen.85
Ähnlich charakterisierten auch andere Zeitgenossen die neue metropolitane Geräuschkulisse als »schauerliche Schallsinfonie« und »wirren Lärmsalat«.86 Während die vergleichsweise ruhigere Umgebung der »Hi-fi-Lautsphäre« es gestattete, weit in die Ferne zu lauschen, verkümmerte die Fähigkeit des Weithörens in der Stadt allmählich. Erst mit räumlichem Abstand und der Wahrnehmung des urbanen Geräuschgemenges aus der Entfernung konnte man wieder an Differenzierungsvermögen gewinnen. Die im Zuge der »industriellen Verstädterung« rapide wachsenden Großstädte bemächtigten sich akustisch des Raumes, immer mehr Menschen lebten in urbanen Geräuschkulissen. Während es zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa erst 16 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern gegeben hatte, waren es zur Jahrhundertmitte bereits 43 und 1910 schon 156. Europaweit stieg der Anteil der Bevölkerung in Städten mit über 5.000 Einwohnern von 19 auf 36 Prozent.87
Wenngleich die Stadt von jeher ein Hort der Hektik und Betriebsamkeit, der lauten Menschenansammlungen und ständig wiederkehrenden Verkehrsgeräusche war, so erlangte der Lärm doch nunmehr eine neue Dimension und Qualität. Er wurde zum Inbegriff des urbanen Lebens, zur Signatur der modernen Zeit und dauerhaften Begleitmusik einer zunehmend technisierten Zivilisation: »Der Lärm ist eine Begleiterscheinung unseres Lebens geworden, unzertrennlich wie der Schatten, den unser Körper im Sonnenstrahl wirft«, formulierte ein Zeitgenosse prosaisch.88
Dementsprechend stiegen auch die Klagen über die »Lärmplage« in signifikanter Weise, sodass der Lärm in der Hierarchie der städtischen Umweltbelastungen hinter den (unangefochten an der Spitze stehenden) Gerüchen schon bald den zweiten Platz einnahm.89 Dabei stellte er charakteristischerweise eine Querschnittsmaterie dar, die sich in allen Lebensbereichen manifestierte: vom Wohnalltag über den öffentlichen Raum bis hin zur Arbeitswelt.90 »Kein Zeitalter seit Erschaffung der Welt hat soviel und so ungeheuerlichen Lärm gemacht wie das unsrige«, empörte sich 1879 die weitgereiste Schriftstellerin und Journalistin Emmy von Dincklage (1825–1891):
(…) weshalb erlaubt man, daß ein elendes Fuhrwerk, etwa ein Hundewagen, mit einigen geleerten Blechkannen der Milchverkäufer zehn Minuten lang alles Reden und Hören, alles Denken und Studieren, alles Ruhen und Musizieren einer ganzen Straße übertönt, unser Trommelfell unnatürlich erschüttert, uns in unliebsame Nervenerregungen und zornige Aufwallung versetzt, die Gesunden verdrießlich und die Kranken noch kranker macht, weshalb ist das ganz in Ordnung? Und der Hundewagen steht nicht allein da, ihm folgen alle möglichen Karren, schellene Tramway-Fuhrwerke, knarrende Kohlenwagen, Rollwagen und zahlreiche Vehikel, die alle eigens construiert scheinen, um möglichst viel und durchdringenden Spektakel zu machen!91
Die Intensivierung des Verkehrs, die generelle Vervielfachung und Verdichtung der Aktivitäten im öffentlichen Raum verstärkten den akustischen Gegensatz zwischen Stadt und Land. Bis in die Nacht hinein waren die Geräusche der Großstadt zu hören, deren Zusammensetzung und damit Wirkung sich zudem entscheidend veränderte. Denn die maschinell erzeugten Laute waren monoton und kontinuierlich, ohne Individualität und die in der Natur üblicherweise ausgeprägten Phasen des Entstehens, Anschwellens und Verklingens. Schafer spricht in diesem Zusammenhang von flach verlaufenden Schallwellen oder Wanderwellen.92 Die anhaltenden, mehr oder weniger abrupt beginnenden und endenden Laute, von der industriellen Revolution eingeführt und der Elektrotechnik ausgeweitet, verkörpert im Rhythmus der Dampfmaschinen wie im Brummen der Motoren, wurden zum dauerhaften Grundton der Zivilisation.
Parallel dazu kam es auch zu einer generellen Erhöhung der Lautstärke. Dies lässt sich in der Stadt anhand jener Signaltöne nachvollziehen, die eingesetzt wurden, um vor Gefahren zu warnen. So wurde etwa in Wien der Ausbruch eines Brandes seit dem 16. Jahrhundert durch einen Wächter im Stephansturm kundgetan, der aus voller Kehle – verstärkt durch ein Sprachrohr – »Feuer!!!« brüllte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts hob sich dieses Signal nicht mehr deutlich genug ab vom übrigen akustischen Milieu im Herzen der Stadt, sodass man es schließlich 1855 abschaffte und – natürlich auch aus Gründen der schnelleren Nachrichtenübermittlung – eine direkte telegrafische Verbindung von der Türmerstube zur Zentral-Löschanstalt am Hof einrichtete. Der Feuerwächter versah übrigens noch bis Ende 1955 seinen Dienst im Turm zu St. Stephan. Auch die Einsatzfahrzeuge mussten sukzessive ihre Signalstärken erhöhen. Die bislang üblichen Trompeten- und Glockensignale wurden allmählich vom jaulenden Klang der Sirene abgelöst.93
Das eindrucksvollste Indiz für die Erhöhung des Geräuschpegels in der Stadt ist wohl die Verminderung der akustischen Reichweite der Kirchenglocken. Sie stellten





























