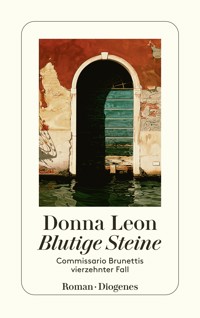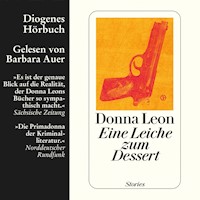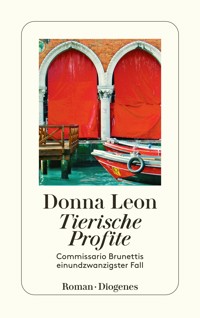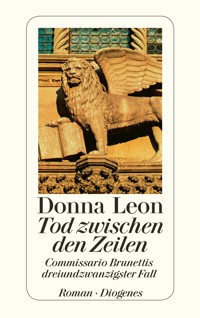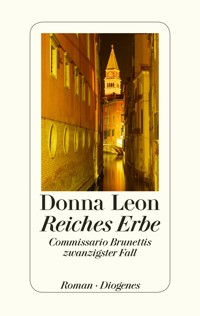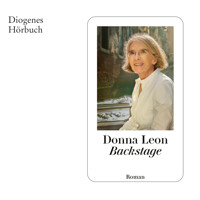10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Venedig kann sehr heiß sein: Im Sommer fliehen die Venezianer aus der stickigen Lagunenstadt. Doch aus Ferien in den kühlen Bergen wird für Commissario Brunetti nichts. Dafür sorgen eine Leiche und dubiose Machenschaften am Tribunale.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Donna Leon
Auf Treuund Glauben
Comissario Brunettisneunzehnter Fall
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Werner Schmitz
Titel des Originals:
›A Question of Belief‹
Die deutsche Erstausgabe erschien
2011 im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Mozart, Don Giovanni,
in der Übersetzung von Hermann Levi,
Theodor Ackermann Verlag, München 1910
Umschlagfoto:
Copyright © Enrico Camporese
Für Joyce DiDonato
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24204 (1.Auflage)
ISBN 978 3 257 06200 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] L’empio crede con tal frode, Di nasconder l’empietà.
Hoffe nimmer uns zu täuschen
[7] 1
Brunetti hielt es nur noch mit letzter Willenskraft am Schreibtisch aus, als Ispettore Vianello bei ihm eintrat. Der Commissario hatte sich einen Bericht über Waffenschmuggel im Veneto zu Gemüte geführt, in dem Venedig nicht ein einziges Mal vorkam, sich dann ein Schreiben vorgenommen, dem zufolge zwei neue Rekruten an die Squadra Mobile überstellt werden sollten, bevor ihm klar wurde, dass sein Name gar nicht auf dem Verteiler stand; und schließlich hatte er noch einen ministeriellen Bescheid zur Neuregelung von Frühpensionierungen überflogen. Mehr war angesichts der Dicke des Dokuments nicht drin gewesen. Das Opus lag vor ihm, während Brunetti aus dem Fenster starrte und hoffte, es würde jemand hereinkommen und ihm einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf schütten, oder es würde regnen, oder er fände Einlass in den Himmel und entginge so der stickigen Hitze in seinem Büro und überhaupt dem Elend des Augusts in Venedig.
Und so erschien ihm Vianello, der mit der aktuellen Gazzetta dello Sport unterm Arm bei ihm auftauchte, als die Erlösung. »Was ist das denn?«, fragte Brunetti pikiert und zeigte auf die rosafarbene Zeitung. Natürlich kannte er das Blatt, nur war ihm schleierhaft, wie Vianello damit herumlaufen konnte.
Der Inspektor warf einen zerstreuten Blick auf die Zeitung. »Die hat jemand auf der Treppe verloren. Ich wollte sie nachher unten im Bereitschaftsraum abgeben.«
[8] »Ich dachte schon, die gehört dir«, sagte Brunetti grinsend.
»So schlecht ist die auch wieder nicht.« Vianello nahm Platz und warf die Zeitung auf Brunettis Schreibtisch. »Als ich das letzte Mal hineingesehen habe, war ein langer Artikel über die Polomannschaften bei Verona drin.«
»Polo?«
»Offenbar haben wir sieben Polomannschaften in diesem Land, oder auch allein schon in der Gegend von Verona.«
»Mit Ponys und weißer Kleidung und Polohelmen?«, fragte Brunetti belustigt.
Vianello nickte eifrig. »Da waren Fotos dabei. Marchese hier und Conte da, dicke Villen und Palazzi.«
»Bist du sicher, dass dir die Hitze nicht zu Kopf gestiegen ist? Verwechselst du das nicht mit etwas, das du, was weiß ich, in Chi gelesen hast?«
»Chi lese ich schon gar nicht«, verwahrte sich Vianello.
»Kein Mensch liest Chi«, stimmte Brunetti zu, dem noch nie ein bekennender Chi-Leser begegnet war. »Der Klatsch wird durch Moskitos übertragen und sickert einem ins Gehirn, wenn man gestochen wird.«
»Und mir soll die Hitze zu Kopf gestiegen sein«, meinte Vianello nur.
Die beiden schwiegen, in Schlaffheit vereint, keiner brachte auch nur die Energie auf, wenigstens über die Hitze zu stöhnen. Vianello beugte sich vor, bog einen Arm nach hinten und zupfte an seinem Baumwollhemd, das ihm am Rücken klebte. »Auf dem Festland ist es noch schlimmer«, sagte er schließlich. »In Mestre hatten sie gestern 41Grad in den Büros nach vorne raus.«
[9] »Ich dachte, die haben eine Klimaanlage?«
»Rom hat sie angewiesen, die nicht einzuschalten, damit es nicht wieder zu einer Überlastung des Netzes kommt wie vor drei Jahren.« Vianello hob die Achseln. »Hier sind wir jedenfalls besser dran als die Kollegen in ihrem Kasten aus Glas und Beton.« Er sah nach den offenen Fenstern, durch die das Licht des Vormittags strömte. Die Vorhänge bewegten sich lustlos, aber immerhin.
»Und die stellen die Klimaanlage wirklich nicht an?«, fragte Brunetti.
»Haben sie jedenfalls behauptet.«
»Würde ich nicht glauben.«
»Ich auch nicht.«
Wieder schwiegen sie, bis Vianello sagte: »Ich wollte dich was fragen.«
Brunetti sah ihn an und nickte: Das war einfacher, als etwas zu sagen.
Vianello strich mit einer Hand über die Zeitung und lehnte sich zurück. »Hast du eigentlich schon mal«, fing er an und unterbrach sich, als suche er nach dem richtigen Wort, »dein Horoskop gelesen?«
Brunetti überlegte kurz. »Nicht bewusst.« Auf Vianellos fragenden Blick hin fügte er hinzu: »Das heißt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eigens die Zeitung danach durchgeblättert hätte. Aber wenn sie jemand auf dieser Seite offen liegen lässt, werfe ich schon mal einen Blick darauf.« Vergeblich wartete er auf eine Erklärung. »Warum?«, hakte er schließlich nach.
Vianello rutschte auf seinem Stuhl herum, stand auf, strich seine Hose glatt und setzte sich wieder. »Es geht um [10] meine Tante, die Schwester meiner Mutter. Die letzte, die noch lebt. Anita. Sie liest neuerdings täglich ihr Horoskop. Ob die Voraussage eintrifft oder nicht, ist ihr gleichgültig, da steht ja eh nie was Genaues, oder? ›Sie werden eine Reise unternehmen.‹ Wenn sie am nächsten Tag zum Rialto-Markt geht, um Gemüse einzukaufen: Da hat sie ihre Reise.«
Vianello erwähnte seine Tante nicht zum ersten Mal: Sie war die Lieblingsschwester seiner verstorbenen Mutter und seine Lieblingstante, offenbar, weil sie von allen in der Familie den stärksten Willen besaß. In den fünfziger Jahren hatte sie einen Elektrikerlehrling geheiratet, der wenige Wochen nach der Hochzeit auf der Suche nach Arbeit in Richtung Turin verschwunden war. Sie wartete fast zwei Jahre lang, bis sie ihn wiedersah. Zio Franco hatte Glück gehabt und schließlich bei Fiat Arbeit gefunden, wo man ihm ermöglicht hatte, die Meisterprüfung abzulegen.
Zia Anita zog nach Turin, und sie lebten dort sechs Jahre. Nach der Geburt ihres ersten Sohns zogen sie nach Mestre, wo Zio Franco seinen eigenen Betrieb aufmachte. Die Familie wuchs, der Betrieb wuchs: Beides gedieh prächtig. Erst Ende der Siebziger hängte Zio Franco sein Geschäft an den Nagel und zog zur Überraschung seiner Kinder, die alle auf der terraferma aufgewachsen waren, nach Venedig zurück. Gefragt, warum keins ihrer Kinder mit ihnen nach Venedig wollte, hatte Zia Anita geantwortet: »Die haben Benzin im Blut, kein Salzwasser.«
Brunetti wollte sich gern anhören, was Vianello ihm von seiner Tante zu erzählen hatte. Es würde ihn davon abhalten, alle paar Minuten ans Fenster zu treten, um nachzusehen, ob… Ob was? Ob es angefangen hatte zu schneien?
[11] »Seit neuestem sieht sie sich die im Fernsehen an«, sagte Vianello.
»Horoskope?«, fragte Brunetti verblüfft. Er sah nur unregelmäßig fern, gezwungenermaßen, wenn jemand anders in der Familie den Kasten anmachte, und hatte keine Ahnung, was es dort alles zu sehen gab.
»Ja. Oder vielmehr diese Kartenleger und Wahrsager, die behaupten, sie können deine Probleme lösen.«
»Kartenleger?«, konnte er nur wiederholen. »Im Fernsehen?«
»Ja. Da rufen Leute an, und dann liest jemand die Karten für sie und erklärt ihnen, wovor sie sich hüten sollen, oder verspricht ihnen Beistand, wenn sie krank sind. So habe ich es jedenfalls von meinen Cousins gehört.«
»Pass auf, dass du nicht die Treppe runterfällst? Hüte dich vor einem großen dunkelhaarigen Fremden?«, fragte Brunetti.
Vianello zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Ich habe es selbst nie gesehen. Kommt mir lächerlich vor.«
»Nein, nicht lächerlich, Lorenzo«, erklärte Brunetti. »Seltsam, mag sein, aber nicht lächerlich.« Und nach kurzem Nachdenken: »Vielleicht auch gar nicht mal so seltsam.«
»Warum?«
»Weil sie eine alte Frau ist«, sagte Brunetti. »Wir neigen zu der Annahme – wenn Paolo oder Nadia jetzt hier wären, würden sie sagen, ich sei voreingenommen –, dass alte Frauen leichtgläubig sind.«
»Hat man sie aus diesem Grund nicht auch als Hexen verteufelt?«, fragte Vianello.
Brunetti hatte zwar einmal große Teile des [12] Hexenhammers gelesen, aber trotzdem nie begriffen, warum damals ausgerechnet alte Frauen verbrannt worden waren. Vielleicht, weil viele Männer dumm und böse sind, oder aber alte Frauen schwach und ohne Fürsprecher.
Vianello wandte seine Aufmerksamkeit dem Fenster und dem Licht zu. Brunetti spürte, der Ispettore wollte sich nicht drängen lassen; früher oder später würde er von allein mit seinem Anliegen herausrücken. Fürs Erste ließ Brunetti ihn das Licht studieren und nutzte die Gelegenheit, seinen Freund zu beobachten. Vianello vertrug Hitze ohnedies nicht gut, schien aber in diesem Sommer noch mehr darunter zu leiden als sonst. Sein verschwitztes Haar war dünner, als Brunetti es in Erinnerung hatte. Und sein Gesicht wirkte aufgequollen, besonders um die Augen.
Vianello riss Brunetti aus seinen Betrachtungen: »Meinst du, alte Frauen sind wirklich gutgläubiger?«
Brunetti dachte darüber nach. »Ich weiß es nicht. Du meinst, gutgläubiger als unsereiner?«
Vianello nickte und wandte sich wieder dem Fenster zu, als wollte er die Vorhänge zwingen, sich ein wenig mehr zu bewegen.
»Nach dem, was du mir im Lauf der Jahre von ihr erzählt hast, scheint sie mir gar nicht der Typ für so etwas zu sein«, sagte Brunetti schließlich.
»Stimmt schon. Deswegen ist es ja so beunruhigend. Sie war immer der klügste Kopf der Familie. Mein Onkel Franco ist ein guter Mensch, und er war ein sehr fleißiger Arbeiter, aber er wäre nie von sich aus auf die Idee gekommen, seinen eigenen Betrieb aufzumachen. Mal davon abgesehen, dass er gar nicht die Fähigkeiten dazu besaß. Das ging [13] alles von ihr aus; sie hat ihm auch die Bücher geführt, bis er in den Ruhestand ging und sie wieder hierhergezogen sind.«
»Hört sich nicht nach einer Frau an, die morgens als Erstes nachschaut, was es im Haus des Wassermanns Neues gibt«, bemerkte Brunetti.
»Genau das begreife ich nicht«, sagte Vianello und hob ratlos die Hände. »Manche Leute haben ihre Rituale. Was weiß ich, zum Beispiel, dass sie erst das Haus verlassen, wenn sie wissen, wie viel Grad es draußen sind oder welche berühmten Leute an diesem Tag Geburtstag haben. Manche von ihnen hielt man immer für völlig normal, und eines Tages erfährt man, dass sie nur in Urlaub fahren, wenn ihr Horoskop ihnen sagt, es spreche nichts dagegen, eine Reise zu machen.« Vianello zuckte die Schultern. »Kann mir keinen Reim darauf machen.«
»Ich weiß immer noch nicht, was du von mir wissen möchtest, Lorenzo«, sagte Brunetti.
»Das weiß ich auch nicht«, gab Vianello grinsend zu. »Die letzten Male, als ich sie besucht habe – ich bemühe mich, mindestens einmal die Woche bei ihr reinzuschauen –, lagen da überall diese verrückten Zeitschriften herum: Dein Horoskop. Die Weisheit der Alten. Solche Sachen.«
»Hast du sie darauf angesprochen?«
Vianello winkte ab. »Ich wusste nicht, wie.« Er sah Brunetti an und fuhr fort: »Außerdem wäre es ihr wohl nicht recht gewesen.«
»Wieso glaubst du das?«
Vianello zog ein Taschentuch heraus und fuhr sich über die Stirn: »Sie hat mitbekommen, dass ich mir die Zeitschriften angesehen habe – dass sie mir aufgefallen waren. Aber sie [14] hat nichts gesagt. Keine scherzhafte Bemerkung, keine Ausrede, wie die, dass eins ihrer Kinder sie dort liegen gelassen habe oder dass eine ihrer Freundinnen sie bei ihr vergessen habe. Das hätte man nachvollziehen können. Wären das Zeitschriften übers Jagen oder Angeln oder über Motorräder gewesen, hätte sich auch jeder gewundert. Aber sie tat – ich weiß auch nicht – geradezu heimlichtuerisch. Das ist ja das Beunruhigende.« Er sah Brunetti fragend an. »Du hättest etwas gesagt, oder?«
»Du meinst, zu ihr?«
»Ja. Wenn sie deine Tante wäre.«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und dein Onkel? Kannst du den nicht fragen?«
»Möglich wäre es schon, aber Zio Franco ist ein typischer Vertreter seiner Generation: Wenn du etwas ansprechen willst, machen sie bloß Witze, klopfen dir auf den Rücken und bieten dir was zu trinken an. Er ist der beste Mensch der Welt, interessiert sich aber im Grunde für gar nichts.«
»Auch nicht für sie?«
Vianello überlegte. »Vermutlich nicht.« Wieder schwieg er. »Jedenfalls nicht so, dass irgendwer es mitbekommen würde. Die Männer seiner Generation haben sich nie für ihre Familien interessiert, finde ich.«
Brunetti schüttelte den Kopf, was Zustimmung und Bedauern zugleich ausdrücken sollte. Nein, sie interessierten sich wirklich für nichts, weder für ihre Frauen noch für ihre Kinder, höchstens für ihre Freunde und Kollegen. Er hatte über diesen Unterschied schon oft nachgedacht. Hing das mit mangelndem Feingefühl zusammen? Eher war es wohl eine Frage der Erziehung: Auf jeden Fall kannte er viele [15] Männer, die es immer noch für ein Zeichen von Schwäche hielten, an so zarten Dingen wie Gefühlen auch nur das geringste Interesse zu bekunden.
Er konnte sich nicht erinnern, wann er sich das erste Mal gefragt hatte, ob sein Vater seine Mutter liebe, oder ihn und seinen Bruder. Brunetti hatte das immer angenommen, wie Kinder es eben tun. Aber was hatte es damals doch für seltsame Gefühlsäußerungen gegeben: tagelanges Schweigen; gelegentliche Wutausbrüche; und nur ein paar wenige Augenblicke, in denen der Vater ihnen offen seine Zuneigung bekundete.
Brunettis Vater war sicher kein Mann gewesen, dem man sich anvertraute. Ein Mann seiner Zeit, ein einfacher Mann ohne viel Kultur. Ob der Schein trog? Er versuchte sich zu erinnern, wie die Väter seiner Freunde sich benommen hatten, aber es fiel ihm nichts ein.
»Meinst du, wir lieben unsere Kinder mehr?«, fragte er Vianello.
»Mehr als wer? Und wer ist wir?«, fragte der Inspektor.
»Männer. Unsere Generation. Mehr, als unsere Väter es getan haben.«
»Ich weiß nicht. Wirklich.« Vianello drehte sich um, zupfte mehrmals an seinem Hemd und fuhr sich mit dem Taschentuch über den Nacken. »Vielleicht haben wir nur andere Benimmregeln. Oder man hat andere Erwartungen an uns.« Er lehnte sich zurück. »Ich weiß es nicht.«
»Was ist nun mit deiner Tante?«, fragte Brunetti. »Warum hast du davon angefangen?«
»Vielleicht will ich nur wissen, wie sich das anhört, wenn ich es ausspreche, vielleicht hilft es mir irgendwie, zu [16] entscheiden, ob ich mir Sorgen um sie machen muss oder nicht.«
»Ich würde mir erst Sorgen machen, wenn sie anfängt, dir aus der Hand zu lesen, Lorenzo«, versuchte Brunetti ihn aufzuheitern.
Vianello sah ihn bekümmert an. »Wird nicht mehr lange dauern, fürchte ich.« Es klang nicht wie ein Scherz. »Was meinst du, können wir bei dieser Hitze einen Kaffee vertragen?«
»Warum nicht?«
[17] 2
Hinter der Theke der Bar am Ponte dei Greci stand Bambola, der Senegalese, der Sergio seit einem Jahr zur Hand ging. Brunetti und Vianello waren es gewohnt, dass Sergio persönlich dort stand, untersetzt und ungerührt – er, der im Lauf der Zeit so viele Polizeigeheimnisse mitgehört – und für sich behalten – hatte, dass ein Erpresser jahrzehntelang davon hätte leben können. Die Mitarbeiter der Questura nahmen Sergio kaum noch wahr, so vertraut war ihnen sein alltäglicher Anblick.
Von Bambola konnte man das nicht gerade behaupten. Der Afrikaner trug eine lange beige Dschellaba und einen weißen Turban. Groß und schlank, das dunkle Gesicht strahlend vor Gesundheit, glich Bambola eher einem Leuchtturm, so sehr reflektierte sein Turban das Licht, das durch die großen, auf den Canale hinausgehenden Fenster hereinschien. Er trug nie eine Schürze, und doch waren seine Dschellabas immer makellos.
Brunetti wunderte sich, wie viel heller als sonst es in der Bar war, und sah sich um, ob Bambola etwa an einem so gleißenden Tag wie diesem das Licht angemacht hatte. Aber es waren die Fenster. Nicht nur waren sie sauberer, als er sie jemals gesehen hatte, sondern auch die Plakate und Aufkleber, die für Eis, Limonade und diverse Biersorten warben, waren allesamt entfernt worden, eine Neuerung, die doppelt so viel Licht wie vorher in den Raum strömen ließ. Auf dem Fensterbrett lagen keine alten Zeitschriften und Zeitungen [18] mehr, und auch die schmuddligen Speisekarten, die dort jahrelang gelegen hatten, waren verschwunden. Stattdessen war die Fensterbank mit einem weißen Tuch bedeckt, auf dem eine dunkelblaue Vase mit rosa Strohblumen stand.
Brunetti fiel auf, dass der ramponierte Plastikkasten, in dem seit Menschengedenken Kuchen und Brioches feilgeboten wurden, durch eine dreigeschossige Glasvitrine ersetzt worden war. Das Angebot hatte zu seiner Erleichterung aber nicht gewechselt: Sergio mochte kein Ausbund an Sauberkeit sein, aber von Kuchen und von tramezzini verstand er was.
»Altstadtsanierung?«, flachste er Bambola an.
Zur Antwort blitzte unter dem strahlend weißen Turban wie ein zweiter kleiner Spot eine Reihe blitzblanker Zähne auf. »Sì, Commissario«, sagte Bambola. »Sergio liegt mit einer Sommergrippe im Bett, er hat mich gebeten, für ihn einzuspringen.« Er nahm einen Lappen, mindestens so weiß wie sein Turban, wischte damit über die Bar und fragte, was er ihnen bringen dürfe.
»Zwei Kaffee, bitte«, sagte Brunetti.
Der Senegalese wandte sich der Maschine zu, und Brunetti machte sich unwillkürlich auf das vertraute Scheppern und Hämmern gefasst, mit dem Sergio das verbrauchte Kaffeepulver aus dem Siebträger schlug, ihn mit frischem Pulver füllte und wieder in die Maschine einsetzte. Die Geräusche kamen, aber gedämpft, und als er zu der Maschine hinübersah, war der Holzbalken, auf dem Sergio seit Jahrzehnten das Sieb ausgeklopft hatte, mit einem Gummipolster versehen, das den Lärm dämpfte. Und zum ersten Mal, seit Brunetti in diese Bar kam, war der bisher von Schmutz [19] und Kaffeeflecken bedeckte Name des Herstellers der Maschine, »Gaggia«, zu sehen.
»Ob Sergio den Laden wiedererkennt, wenn er zurückkommt?«, fragte Vianello den Barmann.
»Ich denke doch, Ispettore. Hoffentlich gefällt es ihm.«
»Die Vitrine?«, fragte Vianello und wies mit dem Kinn nach der Auslage.
»Hat mir ein Freund besorgt«, erklärte Bambola und wischte liebevoll mit einem Handtuch darüber. »Die hält die Sachen sogar warm.«
Brunetti und Vianello warfen sich keine vielsagenden Blicke zu, aber das Schweigen, mit dem sie auf die Erklärung des Barmanns reagierten, sprach Bände. »Hat er mir gekauft, Ispettore«, sagte Bambola mit belegter Stimme und mit sorgfältiger Betonung auf dem letzten Wort. »Ich kann Ihnen die Quittung zeigen.«
»Er hat Ihnen einen guten Dienst erwiesen«, sagte Vianello lächelnd. »Viel besser als das alte Plastikding mit dem Sprung an der Seite.«
»Sergio dachte, das merkt keiner«, sagte Bambola wieder munter.
»Ha!«, machte Vianello. »Hier möchte man doch gleich zugreifen.« Und schon ließ er seinen Worten Taten folgen: Er klappte die Vitrine auf, nahm eine Serviette und angelte eine mit Creme gefüllte Brioche aus dem oberen Fach. Als er hineinbiss, stäubte ihm Puderzucker auf Kinn und Hemd. »Aber die müssen bleiben, Bambola«, sagte er und schleckte sich den Zuckerbart weg.
Der Barmann stellte zwei Kaffee auf den Tresen, daneben für Vianello einen kleinen Keramikteller.
[20] »Keine Pappteller. Gut«, bemerkte Vianello und legte die angebissene Brioche ab.
»Das wäre unvernünftig, Ispettore«, sagte Bambola. »Ökologischer Wahnsinn. So viel Pappe für Teller, die man ein einziges Mal benutzt und dann wegwirft.«
»Oder recycelt«, meinte Brunetti.
Bambola ging mit einem Achselzucken darüber hinweg – die übliche Reaktion. Niemand in der Stadt wusste, was mit dem Müll geschah, den sie alle so sorgfältig trennten: Brunetti blieb nur die Hoffnung.
»Das beschäftigt Sie?«, fragte Vianello. Um Verwirrung zu vermeiden, stellte er klar: »Recycling?«
»Ja«, sagte Bambola.
»Warum?«, fragte Vianello. Bevor der Barmann antworten konnte, kamen zwei Männer herein und bestellten Kaffee und Mineralwasser. Sie verzogen sich ans andere Ende des Tresens.
Als sie versorgt waren und Bambola zurückkam, hakte Vianello noch einmal nach. »Interessiert Sie das, weil Sergio damit Geld sparen kann? Wenn er keine Pappteller benutzt?«
Bambola nahm ihre Tassen und Untertassen, tauchte sie kurz ins Waschbecken und stellte sie in die Spülmaschine.
»Ich bin Ingenieur, Ispettore«, erklärte er schließlich. »Also interessiert mich das schon von Berufs wegen. Der Kreislauf von Konsum und Produktion.«
»Ich dachte mir, dass Sie studiert haben«, sagte Vianello. »Aber ich wusste nicht, wie ich Sie danach fragen sollte.« Er wartete, um zu sehen, wie Bambola das aufnahm, und fragte dann: »Worauf haben Sie sich spezialisiert?«
[21] »Hydraulik. Wasseraufbereitung. Solche Sachen.«
»Verstehe.« Vianello nahm Kleingeld aus seiner Tasche und zahlte für sie beide.
»Wenn Sie Sergio sehen«, sagte Brunetti beim Hinausgehen, »grüßen Sie ihn bitte, und wünschen Sie ihm gute Besserung.«
»Mach ich, Commissario«, sagte Bambola und wandte sich den beiden Männern am Ende des Tresens zu.
Brunetti hatte erwartet, Vianello werde noch einmal von seiner Tante anfangen, aber das Bedürfnis, über sie zu reden, war anscheinend in der Questura zurückgeblieben, und Brunetti, der dieses Gespräch ohnehin nicht unbedingt fortsetzen wollte, rührte nicht daran.
Draußen traf sie die Sonne wie ein Peitschenschlag, und sie blieben unwillkürlich stehen. Bis zur Questura waren es nur zwei Minuten zu Fuß, aber während sie in der Bar gestanden hatten, schien sich die Strecke in der Hitze ausgedehnt zu haben, und es kam ihnen vor, als müssten sie durch die halbe Stadt. Die Sonne brannte auf den Gehweg am Kanal. Touristen saßen unter Schirmen vor der Trattoria auf der anderen Seite der Brücke. Brunetti sah kurz hinüber: Nichts rührte sich. Konnte es sein, dass die Hitze sie ausgetrocknet hatte, und da waren nur noch leere Hülsen, wie tote Heuschrecken? Dann aber trug ein Kellner ein großes Glas mit einer dunklen Flüssigkeit zu einem der Tische, und der Gast drehte langsam den Kopf danach um.
Sie brachen auf. Gewässer verbreiteten Kühle, sollte man meinen, doch die unbewegte dunkelgrüne Oberfläche des Kanals schien das Licht und die Hitze nur mit doppelter [22] Kraft zurückzuwerfen. Statt Linderung kam von dort nur Feuchtigkeit. Sie schleppten sich weiter.
»Ich hatte keine Ahnung, dass er Ingenieur ist«, sagte Vianello.
»Ich auch nicht.«
»Mit Spezialgebiet Hydraulik«, fügte Vianello mit unverhohlener Bewunderung hinzu. Bis zum Eingang der Questura waren es nur noch wenige Schritte. Der Wachposten hatte sich verständlicherweise nach drinnen verzogen.
Brunetti fuhr sich mit dem Hemdsärmel übers Gesicht und fragte sich, wie er so dumm gewesen sein konnte, an diesem Tag ein Hemd mit langen Ärmeln anzuziehen. »Wie lange ist er schon hier?«, fragte er auf dem Weg zur Treppe.
»Weiß nicht mehr genau. Drei, vier Jahre. Vermutlich die meiste Zeit als Illegaler, bis er seine Papiere bekam. Wenn ich damals in Uniform reingekommen bin, hat er sich immer verdrückt.« Vianello dachte mit einem Lächeln daran zurück. »So ein großer Bursche. Bemerkenswert, wie er im Handumdrehen verschwinden konnte, als hätte er sich in Luft aufgelöst.«
»Das tu ich auch gleich«, sagte Brunetti.
»Was?«
»Mich in Luft auflösen.«
»Hoffen wir, dass er es nicht tut«, sagte Vianello.
»Wer? Bambola?«
»Ja. Sergio kann doch nicht die ganze Zeit im Laden stehen. Und du musst zugeben, es sieht dort jetzt besser aus. Schon nach einem Tag.«
»Seine Frau war krank«, sagte Brunetti. »Gut, dass er ihn gefunden hat.«
[23] »Blöder Job, so als Barbesitzer«, sagte Vianello. »Den ganzen Tag Bereitschaftsdienst, nie weiß man, welchen Ärger vielleicht nicht schon der nächste Kunde mitbringt, und immer muss man höflich sein.«
»Genau wie bei uns«, sagte Brunetti.
Vianello verschwand lachend in Richtung Bereitschaftsraum, und Brunetti musste den Aufstieg in den zweiten Stock allein in Angriff nehmen.
[24] 3
Zwei Tage später saß Brunetti am Schreibtisch und fragte sich, ob sich mit den Kriminellen in der Stadt nicht eine Art Abkommen treffen ließe. Konnte man sie dazu bewegen, die Leute bis zum Ende der Hitzeperiode in Ruhe zu lassen? Doch an wen sollte man sich wenden? Das Verbrechen hatte sich zu sehr diversifiziert und war zu international geworden, als dass verlässliche Vereinbarungen noch möglich gewesen wären. Früher, als jeder Ort seine eigenen Verbrecher hatte, als diese stadtbekannt und geradezu ein Teil des sozialen Gefüges waren, hätte es vielleicht funktioniert, und die Verbrecher, von der erbarmungslosen Hitze ebenso geschlaucht wie die Polizei, wären womöglich zur Zusammenarbeit bereit gewesen. »Wenigstens bis zum ersten September«, sagte er laut.
Auf die Papiere auf seinem Schreibtisch konnte er sich bei der Hitze nicht konzentrieren, und so gab sich Brunetti weiter seinen müßigen Überlegungen hin. Wie könnte man die Rumänen dazu bringen, ihre Taschendiebstähle einzustellen, die Zigeuner, ihre Kinder auf Einbruchstour zu schicken? Und dabei ging es nur um Venedig. Auf dem Festland wären viel schwierigere Dinge einzufordern: Die Moldawier dürften keine dreizehnjährigen Mädchen mehr verkaufen, die Albaner keine Drogen. Wie groß aber war die Chance, italienische Männer – Männer wie ihn und Vianello – von jungen Prostituierten und billigen Drogen abzubringen?
Er spürte ein leises Kitzeln, während ihm der Schweiß an [25] allen möglichen Körperstellen über die Haut rann. In Neuseeland, hatte er gehört, trugen die Geschäftsleute bei so heißem Wetter Shorts und kurzärmelige Hemden. Und hatten die Japaner nicht beschlossen, in der schlimmsten Sommerhitze die Jacketts abzulegen? Er nahm sein Taschentuch und wischte an der Innenseite seines Kragens entlang. Bei so einer Witterung schlugen sich die Leute im Streit um einen Parkplatz tot. Oder wegen irgendeiner ungehaltenen Äußerung.
Seine Gedanken schweiften ab zu Paola, der er versprochen hatte, am Abend mit ihr über ihren gemeinsamen Urlaub zu reden. Er, ein Venezianer, würde sich und seine Familie zu Touristen machen, freilich zu Touristen, die Venedig verließen – um Platz für die Millionen zu schaffen, die man dieses Jahr erwartete. Letztes Jahr waren es zwanzig Millionen. Gott sei uns allen gnädig.
Er hörte ein Geräusch an der Tür, blickte auf und sah Signorina Elettra wie von einem Scheinwerfer angestrahlt in dem grellen Licht, das durch seine Fenster fiel. Konnte das sein? War es möglich, dass nach über einem Jahrzehnt, in dem die Sekretärin seines Vorgesetzten seine Tage mit der Makellosigkeit ihrer Erscheinung verschönert hatte, sogar sie von der Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden war? Da war doch nicht etwa eine Falte links an ihrer weißen Leinenbluse?
Brunetti blinzelte, schloss kurz die Augen, und als er sie wieder aufmachte, erkannte er seine Täuschung: Was er für eine Falte gehalten hatte, war nur ein Schatten vom einfallenden Licht. Signorina Elettra blieb an der Tür stehen und drehte den Kopf zur Seite, und im selben Augenblick trat neben ihr noch jemand über die Schwelle.
[26] »Guten Morgen, Dottore«, sagte sie. Der Mann neben ihr grüßte lächelnd: »Ciao, Guido.«
Brusca ließ sich während der Arbeitszeit außerhalb seines Büros so selten blicken wie ein Dachs außerhalb seines Baus bei Tageslicht. Brusca, der im Rathaus arbeitete, hatte Brunetti immer an dieses Tier erinnert: dichte dunkle Haare, aber weiße Schläfen; ein untersetzter Körper auf kurzen Beinen; unglaubliche Zähigkeit, wenn ein Thema sein Interesse geweckt hatte.
»Ich habe Toni auf der Treppe getroffen«, sagte Signorina Elettra; Brunetti hatte keine Ahnung gehabt, dass die beiden sich kannten. »Also dachte ich, ich zeige ihm den Weg zu Ihrem Büro.« Sie machte einen Schritt zurück und schenkte dem Besucher ein Lächeln erster Güte. Daraus konnte man zweierlei schließen; entweder war Brusca ein guter Freund von ihr, oder aber als Frau von unerschöpflicher und instinktiver Durchtriebenheit wusste sie: Der Mann war Leiter der städtischen Personalverwaltung und konnte somit potentiell von Nutzen sein.
Brusca nickte ihr freundlich zu und ging zu Brunettis Schreibtisch rüber, wobei er sich in dem Zimmer umsah. »Jedenfalls hast du mehr Licht als ich«, sagte er anerkennend. Brunetti bemerkte, dass Brusca eine Aktentasche mitgebracht hatte.
Der Commissario kam um seinen Schreibtisch herum, nahm Bruscas Hand und klopfte ihm ein paarmal auf die Schulter. Dann nickte er Signorina Elettra zu, die ihn mit einem Lächeln bedachte, wenn auch nicht mit einem erster Güte, und das Büro verließ.
Brunetti bot seinem Freund einen der Stühle vor seinem [27] Schreibtisch an und setzte sich auf den anderen. Er wartete, dass Toni zur Sache kam: Brusca war bestimmt nicht gekommen, um über die jeweiligen Vorzüge ihrer Büros zu reden. Toni war kein Mann, der Zeit und Energie verschwendete, wenn er einen Plan verfolgte oder etwas wissen wollte; das wusste Brunetti noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in der scuola media. Die beste Taktik war immer gewesen, einfach abzuwarten, und genau das hatte Brunetti jetzt vor.
Brusca legte zügig los: »Ich wollte dich etwas fragen, Guido.« Er zog eine durchsichtige Plastikhülle aus seiner Aktentasche und nahm ein paar Bögen Papier heraus.
Er stellte die Aktentasche auf den Boden, hielt die Papiere im Schoß und sah seinen Freund an. »Im Rathaus sprechen viele Leute mit mir«, sagte er. »Und manchmal erzählen sie mir Dinge, die mich neugierig machen, und dann höre ich mich um. Und da ich in einem Büro im Parterre und mit nur einem Fenster sitze, und da mein Job mir erlaubt, neugierig zu sein, was die Leute so treiben – und da ich immer sehr höflich und sehr gründlich bin –, antwortet man in der Regel gern auf meine Fragen.«
»Auch wenn es um Dinge geht, die dich beruflich eigentlich nichts angehen?«, fragte Brunetti, der schon ahnte, warum Brusca seinen Freund, den Polizisten, aufgesucht hatte.
»Durchaus.«
»Und so etwas hast du hier?«, fragte Brunetti und wies auf die Papiere. Wie Brusca zog auch er es vor, keine Zeit zu verschwenden.
Brusca reichte sie ihm hinüber. »Sieh’s dir an«, sagte er.
Das erste Blatt trug den Briefkopf des Tribunale di [28] Venezia. Darunter auf der linken Seite vier Spalten mit den Überschriften: »Aktenzeichen, Datum, Richter, Gerichtssaal«, rechts davon neben einem dicken senkrechten Strich ein Kasten, über dem »Ergebnis« stand. Brunetti schob das Blatt zur Seite und fand darunter drei weitere, ähnliche. Die Kopien waren von unterschiedlicher Qualität: Eine war so unscharf, dass sie kaum lesbar war. Rechts unten trug jede Seite einen Datumsstempel nebst Unterschrift, und daneben prangte der Stempel des Justizministeriums. Verschiedene Daten, immer dieselbe Unterschrift. Zweimal war das Siegel des Justizministeriums so nachlässig gestempelt, dass es nicht vollständig aufs Papier geraten war. Brunetti kam es vor, als habe er sein ganzes Leben mit solchen Dokumenten verbracht. Wie viele mochte er selbst abgestempelt und weitergeleitet haben?
Aber das hier war nicht die Art von Gerichtsdokumenten, die er in Zusammenhang mit seinen Ermittlungen zu lesen gewohnt war, weder die üblichen Transkripte von Zeugenaussagen oder Plädoyers am Ende eines Prozesses noch Kopien der schließlich ergangenen Urteile. Die hier waren nur zum internen Gebrauch bestimmt, und wenn er das richtig verstand, ging es um dem Urteil vorausgehende Termine. Ein Muster konnte er nicht erkennen.
Er sah Brusca an, der keine Miene verzog. Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Papieren zu. Er suchte nach Übereinstimmungen und stellte fest, dass man viele der aufgeführten Sitzungen ohne Verhandlung aufgeschoben oder vertagt hatte, und dann fiel ihm auf, dass die meisten dieser Fälle derselben Richterin zugeteilt waren. Er kannte ihren Namen und hatte keine gute Meinung von ihr, obwohl [29] er auf Nachfrage keinen Grund dafür hätte angeben können. Was man eben so hörte oder mitbekam, ein gewisser Tonfall, wenn ihr Name im Gespräch genannt wurde. Und hatte nicht vor Jahren einmal ein Informant eine Bemerkung fallen lassen? Nein, nicht direkt, nur eine Andeutung, und die bezog sich nicht auf sie selbst, sondern auf jemanden aus ihrer Familie. Der Name des Justizangestellten, der die Papiere unterschrieben hatte, sagte ihm nichts.
Er sah von den Papieren auf. »Ich vermute, diese Aufschübe bringen einer der beiden Prozessparteien einen Vorteil und Richterin Coltellini ist daran nicht unbeteiligt.«
Brusca nickte ermunternd und wies mit dem Kinn auf die Papiere, als fordere er einen vielversprechenden Schüler zum Weiterdenken auf.
»Wenn das heißt, dass ich hier noch mehr vermuten soll, dann vielleicht, dass die Person, die das abgezeichnet hat, ebenfalls nicht unbeteiligt ist.«
»Araldo Fontana«, sagte Brusca. »Vom Tribunale. 1975 hat er dort angefangen, zehn Jahre später wurde er zum obersten Gerichtsdiener befördert, und das ist er bis heute. Nach Plan wird er am 10.April 2014 in den Ruhestand gehen.«
»Farbe seiner Unterwäsche?«, fragte Brunetti trocken.
»Sehr komisch, sehr komisch, Guido.«
»Na schön. Vergiss die Unterwäsche, und erzähl mir von ihm.«
»Als oberster Gerichtsdiener hat er dafür zu sorgen, dass Akten termingerecht bearbeitet und weitergeleitet werden.«
»Und ›bearbeitet und weitergeleitet‹ bedeutet…?«
Brusca lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander und winkte mit der Hand unsichtbare Akten durch. »Es gibt [30] ein zentrales Aktenarchiv. Werden während einer Anhörung oder Verhandlung Unterlagen gebraucht, sorgen die Gerichtsdiener dafür, dass sie in den richtigen Sitzungssaal gebracht werden, damit der Richter sich erforderlichenfalls Einblick verschaffen kann. Nach der Sitzung legen die Gerichtsdiener die Dokumente dann wieder ab und holen sie zum nächsten Termin wieder hervor. Erst nach dem Urteilsspruch kommen alle Prozessunterlagen ins Depot.«
»Aber?«
»Aber manchmal gehen Unterlagen verloren oder werden nicht zugestellt, und wenn sie nicht da sind, sieht der Richter sich gezwungen, den Termin ausfallen zu lassen und einen neuen anzuberaumen. Und wenn dann gerade ein Feiertag in der Nähe ist, wird der Richter ihn wohl auf die Zeit nach dem Feiertag verlegen, in jedem Fall aber muss er einen freien Termin im Gerichtskalender finden, und somit kann es zu langen Verzögerungen kommen.«
Brunetti nickte: So hatte er sich das ungefähr vorgestellt. »Dann verrate mir«, sagte er, »denn dir zu lauschen, das ist, als habe man sein Ohr am Puls der Gerüchteküche, was geht hier vor?«
Brusca deutete ein Lächeln an, aus dem keine Belustigung sprach, sondern mit dem er vielmehr vor der Natur kapitulierte, wie sie nun einmal war, nicht wie irgendwer sie gern hätte. »Bevor ich davon anfange, was da vielleicht vor sich gehen könnte, muss ich etwas vorausschicken.« Er schwieg lange genug, um sicher zu sein, dass er Brunettis volle Aufmerksamkeit besaß, und fuhr dann fort: »Fontana ist ein äußerst korrekter Mensch. Das klingt altmodisch, ich weiß, aber er ist eben auch ein altmodischer Mensch. Er könnte [31] eher zur Generation unserer Eltern gehören: So reden die Leute von ihm. Er kommt täglich mit Schlips und Kragen zur Arbeit, tut seine Pflicht, ist zu jedermann höflich. Ich habe in all diesen Jahren nie etwas Negatives über ihn gehört, und in der Regel landet so etwas immer bei mir. Früher oder später bekomme ich so gut wie alles mit. Über Fontana aber nie ein schlechtes Wort, außer dass er farblos und schüchtern ist.«
Brunetti hatte den Eindruck, Brusca sei fertig, also fragte er: »Und warum steht dann sein Name auf diesen Dokumenten? Und warum hältst du es für angebracht, mir das zu zeigen?« Dann fiel ihm noch ein: »Und wie bist du überhaupt an diese Papiere gelangt?«
Brusca senkte den Blick, dann sah er Brunetti an, dann die Wand, dann wieder Brunetti. »Die hat mir jemand gegeben, der beim Tribunale arbeitet.«
»Zu welchem Zweck?«
Brusca zuckte die Achseln. »Vielleicht, damit die Information durch die Mauern des Tribunale dringt.«
»Das ist offenbar gelungen«, sagte Brunetti, ohne dabei zu lächeln. »Sagst du mir, von wem du das hast?«
Brusca ging über die Frage hinweg. »Das spielt keine Rolle, außerdem habe ich ihr versprochen, es keinem zu sagen.«
»Verstehe«, sagte Brunetti nur.
Nachdem er vergeblich auf weitere Erklärungen gewartet hatte, bat er: »Erklär mir, was das soll. Oder was das deines Erachtens zu bedeuten hat.«
»Du meinst die Terminverzögerungen?«
»Ja.«
[32] Brunetti lehnte sich weit zurück, verschränkte die Hände hinterm Kopf und betrachtete die Decke.
»Im Falle einer komplizierten Scheidung, wo es um viel Geld geht, kann es für die vermögendere Partei von Vorteil sein, das Verfahren zu verschleppen, um Vermögenswerte verschwinden zu lassen.« Brusca kam einer Zwischenfrage Brunettis zuvor: »Werden die Akten am Tag der Verhandlung in den falschen Gerichtssaal gebracht oder gar nicht zugestellt, kann der Richter die Verhandlung immer wieder vertagen, bis alle notwendigen Dokumente verfügbar sind.«
»Ich glaube, allmählich sehe ich klarer«, sagte Brunetti.
»Denk an die Gerichte, in denen du gewesen bist, Guido, und denk an die Aktenberge, die sich dort an den Wänden stapeln. Das sieht man in jedem Gerichtsgebäude.«
»Wird das nicht alles im Computer gespeichert?«, fragte Brunetti plötzlich, als ihm die Rundschreiben des Justizministeriums einfielen.
»Das braucht seine Zeit, Guido.«
»Und das heißt?«
»Das heißt, dass es Jahre dauert. Ich arbeite in der Personalabteilung, daher weiß ich, dass für diese Arbeit genau zwei Leute eingeteilt wurden: Die werden Jahre brauchen, wenn nicht Jahrzehnte. Manche von den Akten, die sie abtippen müssen, gehen bis in die fünfziger und sechziger Jahre zurück.«
»Die Zustellung der Akten liegt in Fontanas Verantwortung?«
»Ja.«
»Und die Richterin?«
[33] »Angeblich war sie eine Zeitlang die Geliebte dieses Duckmäusers.«
»Aber der ist doch nur ein kleiner Beamter, Herrgott noch mal. Und sie ist Richterin. Außerdem muss er doch zwanzig Jahre älter sein als sie.«
»Ach, Guido«, sagte Brusca. Er beugte sich vor und tippte ihm mit einem Finger ans Knie. »Ich wusste gar nicht, dass du so in alten Vorstellungen befangen bist. Klassenzugehörigkeit, Altersunterschiede – was sind das für Vorurteile? Du kannst nur an Liebe, Liebe, Liebe denken. Oder an Sex, Sex, Sex.«
»Woran sollte ich denn stattdessen denken?«, fragte Brunetti und gab sich Mühe, neugierig und nicht beleidigt zu klingen.
»Bei Fontana«, räumte Brusca ein, »könnte man vielleicht an Liebe, Liebe, Liebe denken, zumindest nach dem, was ich gehört habe. Aber bei der Richterin wäre man besser beraten, an Geld, Geld, Geld zu denken.« Brusca seufzte und fuhr dann sachlich fort: »Ich glaube, sehr viele Leute sind mehr an Geld interessiert als an Liebe. Oder an Sex.«
Diese Spekulationen weiterzuverfolgen war verlockend, doch Brunetti war mehr an Informationen interessiert und fragte daher: »Und Richterin Coltellini gehört auch dazu?«
Brusca ließ alle Scherze sein und sah ihn düster an. »Sie stammt von gierigen Leuten ab, Guido.« Er verstummte und sagte dann, als sei er soeben auf die Lösung eines Rätsels gestoßen: »Schon merkwürdig. Wenn wir annehmen, dass die Liebe zur Musik oder ein Talent zum Malen sich vererben können – warum dann nicht auch Gier?« Als Brunetti dazu schwieg, fragte er: »Hast du je darüber nachgedacht, Guido?«
[34] »Ja«, antwortete Brunetti, und so war es auch.
»Aha«, ließ Brusca sich vernehmen und kam vom Allgemeinen auf das Besondere: »Ihr Großvater war ein raffgieriger Mensch, und ihr Vater ist es noch heute. Sie hat das von den beiden gewissermaßen ehrlich erworben. Wäre die nicht schon tot, würde sie ihre eigene Mutter verkaufen.«
»Bist du schon mal mit ihr aneinandergeraten?«
»Nein, niemals«, sagte Brusca, aufrichtig erstaunt über die Frage. »Wie gesagt, ich hocke bloß in meinem winzigen Büro im Rathaus und führe die Personalakten: Wann die Leute eingestellt werden, wie viel sie verdienen, wann sie in Pension gehen. Ich mache meinen Job, die Leute reden mit mir, erzählen mir dies und das, und gelegentlich muss ich einen Anruf tätigen und eine Frage stellen. Um etwas zu klären. Und manchmal kann ich über eine Auskunft nur staunen, und dann erzählen sie mir mehr davon, oder sie erzählen mir was anderes. Im Lauf der Jahre hat es sich eingebürgert, mir alles anzuvertrauen.«
»Sogar solche Dokumente«, sagte Brunetti.
Brusca nickte, aber er nickte so sachlich, dass Brunetti fragte: »Weil du reinen Herzens und frommen Sinnes bist?«
Brusca lachte, und die Stimmung im Raum lockerte sich. »Nein. Weil meine Fragen meist so alltäglich und banal sind, dass es den Leuten gar nicht einfällt, mir etwas vorzumachen.«
»Die Technik würde ich auch gern beherrschen«, sagte Brunetti.
[35] 4
Sie verabschiedeten sich freundlich voneinander, wenn auch das unbehagliche Gefühl zurückblieb, dass Brusca mit keinem Wort erklärt hatte, warum er gekommen war oder was Brunetti mit den Informationen, die er ihm gegeben hatte, anfangen sollte. Brusca hatte deutlich gemacht, dass Richterin Coltellini von der Gier nach Geld getrieben wurde, woraus man leicht schließen konnte, dass sie von Leuten dafür bezahlt wurde, deren Prozesse zu verschleppen. Aber dass dieser Schluss leicht zu ziehen war, machte ihn noch nicht wahr, und erst recht gab es keine gerichtsverwertbaren Beweise.
Was mochte Fontana dazu bewegen, sich an dieser Sache zu beteiligen? Liebe, Liebe, Liebe schien Brunetti kein hinreichendes Motiv für einen Mann, der als »äußerst korrekt« beschrieben wurde, sich korrumpieren zu lassen, aber brauchte es überhaupt ein zwingendes Motiv?
Nach so vielen Jahren im Dienst empörte sich Brunetti nur noch selten, wenn ihm neue Enthüllungen über die Geschicklichkeit, mit der seine Mitbürger sich an den Gesetzen vorbeimogelten, zu Ohren kamen. Manche Fälle – auch wenn er das niemandem gegenüber zugab – nötigten ihm unfreiwillig Bewunderung für die Raffinesse ab, mit der da vorgegangen wurde, besonders wenn es Gesetze betraf, die er selbst für ungerecht hielt, oder Sachverhalte, die in seinen Augen der reine Wahnsinn waren. Wenn Ampeln vorsätzlich so programmiert wurden, dass sie schneller als [36] gesetzlich vorgeschrieben umsprangen, damit sich die Polizei die zusätzlichen Bußgelder mit den Leuten teilen konnte, die die Zeitschalter einstellten – wer außer einem Irren konnte es da noch für ein Verbrechen halten, Polizisten zu bestechen? Wenn Scharen von verurteilten Kriminellen im Parlament saßen – wer konnte da noch an den Rechtsstaat glauben?
Dass die dunklen Machenschaften der Richterin Coltellini Brunetti schockierten, ließ sich nicht gerade sagen; überrascht war er, das schon, aber auch nur, weil es sich um eine Frau handelte. Selbst wenn er seine Überzeugung, dass Frauen weniger kriminell als Männer seien, mit Statistiken untermauern konnte, war er doch eher durch seine Erziehung und seine Lebenserfahrung zu dieser Ansicht gelangt. Was er für die richtige Ordnung der Dinge hielt, wurde – wenn Bruscas Annahme sich als zutreffend erweisen sollte – gründlich über den Haufen geworfen.
Bruscas Andeutungen ließen ihn nicht los. Er breitete die Papiere auf seinem Schreibtisch aus und ging sie noch einmal durch. Dabei richtete er seine Aufmerksamkeit auf den Namen Coltellini, der auf jeder der vier Seiten mehrmals vorkam und insgesamt sechs verschiedene Aktenzeichen betraf. Brunetti holte ein paar farbige Textmarker aus seinem Schreibtisch. Dann machte er sich an die erste Seite und markierte mit dem grünen Stift ihren Namen bis zum Ende der Liste überall da, wo er mit dem ersten Fall in Zusammenhang stand, so dass alle diesbezüglichen Verhandlungstermine mit derselben Farbe gekennzeichnet waren. Für den nächsten Fall nahm er den rosa Stift. Für den dritten den gelben; für den vierten den orangefarbenen; die Nummer des [37] fünften musste er mit Bleistift einkreisen, und für den letzten Fall nahm er einen roten Kugelschreiber.
Mit Grün hatte sie nur dreimal zu tun gehabt: das zweite Mal an dem Tag, der in der »Ergebnis«-Spalte des ersten Termins stand, das dritte Mal an dem Tag, der beim zweiten Mal im Ergebnisfeld eingetragen war: Und trotzdem hatte der Prozess sich über zwei Jahre hingezogen. Der rosa Fall war zwar durchweg zu den jeweils angesetzten Terminen verhandelt worden, jedoch lagen die insgesamt sechs Verhandlungstage immer mindestens ein halbes Jahr auseinander. Brunetti hätte gern gewusst, worum es in dem Fall gegangen war. Wieso hatte man drei Jahre bis zur Entscheidung gebraucht?
Die gelbe Spur war ergiebiger. Die erste Verhandlung vor über zwei Jahren war kommentarlos um sechs Monate vertagt worden, und an dem betreffenden Termin hatte man wiederum ohne Angabe von Gründen einen neuen mehr als fünf Monate später anberaumt. Im »Ergebnis«-Kasten neben dem dritten Verhandlungstag stand ein neues Datum, diesmal sechs Monate später, sowie die Anmerkung: »Unterlagen fehlen«. Die nächste Verschiebung, wieder um sechs Monate, wurde mit »Krankheit« erklärt, nur wer da krank war, stand nicht dabei. Dieser nächste Termin am zwanzigsten Dezember schien nur dazu gedient zu haben, die Angelegenheit um weitere vier Monate zu verschleppen, diesmal mit der Anmerkung »Feiertage« in der letzten Spalte. Der neue Termin in der zweiten Aprilhälfte ließ Brunetti vermuten, er sei absichtlich in die Osterferien gelegt worden, doch zu seiner Überraschung war Richterin Coltellini zu der Verhandlung erschienen, jedoch nur, um einen neuen Termin – [38] sieben Monate später – festzusetzen, »zwecks Anhörung neuer Zeugen«.