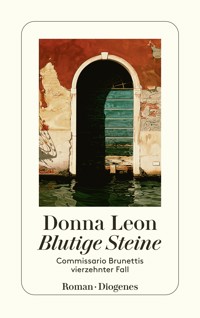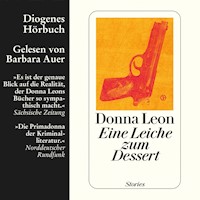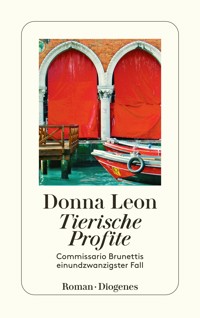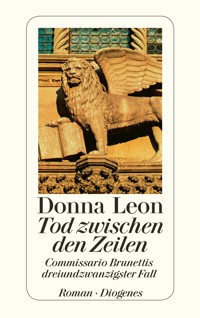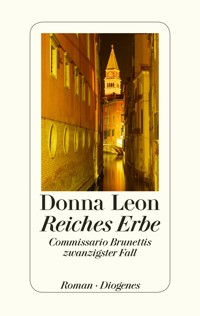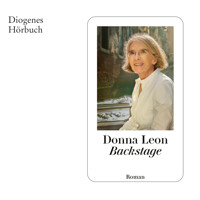10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Brunetti hat nicht viel zu tun, als sein Chef im Urlaub ist und Venedig erst allmählich aus dem Winterschlaf erwacht. Doch da beginnen die Machenschaften der Kirche sein Berufs- und Privatleben zu überschatten: Suor Immacolata, die aufopfernde Pflegerin von Brunettis Mutter, ist nach dem unerwarteten Tod von fünf Patienten aus ihrem Orden ausgetreten. Sie hegt einen schrecklichen Verdacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Donna Leon
Sanft entschlafen
Commissario Brunettis sechster Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel des Originals: ›Quietly in Their Sleep‹
Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Mozart, ›Così fan tutte‹, in der Übersetzung von Dietrich Klose, Reclam Verlag, Stuttgart 1992
›Die göttliche Komödie‹ von Dante in der Übersetzung von Philaletes, Diogenes Verlag, Zürich 1991
Covermotiv: Foto von Fulvio Roiter (Ausschnitt)
Copyright © Fulvio Roiter
Für Donald McCall
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2019
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23139 7
ISBN E-Book 978 3 257 60065 0
E sempre bene Il sospettare un poco, in questo mondo.
Es schadet nie, in dieser Welt, ein wenig Verdacht zu hegen.
[7] 1
Brunetti saß am Schreibtisch und starrte auf seine Füße. Sie lagen auf der herausgezogenen untersten Schublade und erwiderten vorwurfsvoll seinen Blick aus vier senkrechten Reihen kleiner, runder, metallumrahmter Augen. In der letzten halben Stunde hatte er seine Zeit und Aufmerksamkeit abwechselnd den Holztüren seines armadio an der Wand gegenüber und, wenn ihm das zu langweilig wurde, seinen Schuhen gewidmet. Hin und wieder, wenn die scharfe Schubladenkante ihm zu sehr in die Ferse schnitt, schlug er die Beine andersherum übereinander, aber das veränderte lediglich die Anordnung der kleinen runden Augen und trug wenig dazu bei, den Vorwurf in ihrem Blick zu mildern oder ihn selbst von seiner Langeweile zu erlösen.
Vice-Questore Giuseppe Patta machte seit zwei Wochen Urlaub in Thailand, ein Unternehmen, das die Belegschaft der Questura beharrlich als seine zweite Hochzeitsreise bezeichnete, und Brunetti war solange für die Verbrechensbekämpfung in Venedig zuständig. Aber offenbar war die Kriminalität mit dem Vice-Questore ins selbe Flugzeug gestiegen, denn kaum etwas von Bedeutung hatte sich ereignet, seit Patta mit seiner Frau, soeben heimgekehrt an seinen Herd und – man zitterte – in seine Arme, verreist war, abgesehen von den üblichen Einbrüchen und Taschendiebstählen. Die einzige interessante Missetat war vor zwei Tagen in einem Juweliergeschäft geschehen. Ein gutangezogenes Paar mit Kinderwagen war in den Laden gekommen, [8] und der frischgebackene Vater hatte sich, vor Stolz errötend, nach einem Diamantring erkundigt, den er der noch verlegeneren jungen Mutter schenken wolle. Sie hatte zuerst einen, dann einen anderen anprobiert. Schließlich hatte sie sich für einen lupenreinen Dreikaräter entschieden und gefragt, ob sie ihn sich draußen bei Tageslicht ansehen dürfe. Es kam, wie es kommen mußte: Sie ging vor die Tür, hob die Hand in die Sonne, lächelte und winkte dem jungen Vater, der sich über den Kinderwagen beugte, um die Decken zurechtzuzupfen, verlegen den Juwelier anlächelte und dann zu seiner Frau hinausging. Worauf sie natürlich beide verschwanden und den Kinderwagen samt Babypuppe als Hindernis in der Tür stehenließen.
So raffiniert das einerseits war, so wenig konnte man es als eine Verbrechenswelle bezeichnen, und Brunetti langweilte sich und wußte nicht recht, was ihm lieber war: die Verantwortung der Befehlsgewalt mitsamt den Papierbergen, die sie hervorzubringen schien, oder die Handlungsfreiheit, die seine untergeordnete Position ihm normalerweise gewährte. Nicht daß mit dieser Freiheit allzuviel anzufangen gewesen wäre …
Er blickte auf, als es klopfte, und lächelte erfreut, als die Tür aufging und er zum ersten Mal an diesem Tag Signorina Elettra sah, Pattas Sekretärin, die den Urlaub des Vice-Questore offenbar zum legitimen Anlaß nahm, erst um zehn Uhr zur Arbeit zu erscheinen, statt wie sonst um halb neun.
»Buon giorno, commissario«, sagte sie beim Eintreten, und ihr Lächeln erinnerte ihn flüchtig an gelato all’amarena – Rot und Weiß – zwei Farben, die sich in den Streifen ihrer Seidenbluse wiederfanden. Sie machte einen Schritt [9] zur Seite, um eine andere Frau hinter sich hereinzulassen. Brunetti warf einen kurzen Blick auf die zweite Frau und nahm flüchtig ein kastenförmig geschnittenes Kostüm aus billigem grauen Polyester wahr, dessen Rocksaum sich in unvorteilhafter Nähe zu ihren flachen Schuhen befand. Er sah die Hände der Frau linkisch eine steife Kunstlederhandtasche umklammern und wandte den Blick wieder zu Signorina Elettra.
»Commissario, hier möchte Sie jemand sprechen«, sagte sie.
»Ja?« fragte er und blickte, nicht sonderlich interessiert, noch einmal zu der anderen Frau. Aber dann sah er die Kontur ihrer rechten Wange und, als sie den Kopf drehte, um einen Blick durchs Zimmer zu werfen, den feinen Schwung von Kinn und Hals. »Ja?« wiederholte er, diesmal schon interessierter.
Auf seinen Ton hin wandte die Frau den Kopf und verzog den Mund zu einem leichten Lächeln, und in diesem Moment kam sie Brunetti irgendwie bekannt vor, obwohl er ganz sicher war, sie noch nie gesehen zu haben. Ihm kam der Gedanke, sie könnte vielleicht die Tochter eines Freundes sein, die seine Hilfe suchte und ihm aufgrund der Familienähnlichkeit bekannt vorkam.
»Ja, Signorina?« sagte er, wobei er sich erhob und auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch zeigte. Die Frau sah kurz zu Signorina Elettra, die ihr ein Lächeln schenkte, das sie für Leute parat hatte, denen es sichtlich unangenehm war, sich in der Questura wiederzufinden. Dann sagte sie etwas von Arbeit, zu der sie zurückmüsse, und verließ das Zimmer.
[10] Die Frau setzte sich, nicht ohne vorher ihren Rock zur Seite zu schlagen. Obwohl sie schlank war, bewegte sie sich unelegant, als trüge sie nie etwas anderes als flache Schuhe.
Brunetti wußte aus langer Erfahrung, daß es am besten war, erst einmal gar nichts zu sagen und nur mit ruhiger, interessierter Miene abzuwarten, dann würde das Schweigen sein Gegenüber früher oder später zum Reden bringen. Während er also wartete, sah er ihr kurz ins Gesicht, wieder fort und von neuem hin, wobei er in seiner Erinnerung kramte, woher es ihm so bekannt vorkam. Er suchte in dem Gesicht einen Elternteil zu erkennen, oder vielleicht eine Verkäuferin, die er in einem Laden gesehen hatte und nun in der andersartigen Umgebung nicht einzuordnen wußte. Aber, dachte er bei sich, wenn sie in einem Laden arbeitet, ist es sicher keiner, der etwas mit Kleidung oder Mode zu tun hat. Ihr Kostüm war ein gräßliches, kastenförmiges Gebilde in einem Schnitt, der schon seit Jahren aus der Mode war; ihre Frisur war nur Haar, das sehr kurz und zu lieblos geschnitten war, um jungenhaft oder schick zu wirken; sie trug keinerlei Make-up. Aber als er zum dritten Mal hinsah, hatte er den Eindruck, daß sie sich auch einfach verkleidet haben konnte und ihre Schönheit verbarg. Ihre dunklen Augen standen weit auseinander, und die Wimpern waren so lang und dicht, daß sie keiner Tusche bedurften. Ihre Lippen waren blaß, aber voll und geschmeidig. Für ihre gerade Nase, schmal und ganz leicht gewölbt, fand er kein besseres Wort als edel. Und unter dem unvorteilhaft abgemähten Haar sah er eine breite, faltenlose Stirn. Aber auch nachdem er ihre Schönheit erkannt hatte, wußte er sie nirgends unterzubringen.
[11] Sie schreckte ihn mit der Frage auf: »Sie haben mich nicht erkannt, nicht wahr, Commissario?« Sogar ihre Stimme kam ihm bekannt vor, aber auch sie gehörte nirgendwohin. Er bemühte sich vergebens, sich zu erinnern, aber mit Bestimmtheit konnte er nur sagen, daß sie nichts mit der Questura oder seinem Beruf zu tun hatte.
»Nein, Signorina. Tut mir leid. Aber ich weiß, daß ich Sie kenne und nur nicht erwartet hätte, Sie hier zu sehen.« Er lächelte sie offen an, warb um ihr Verständnis für diese verbreitete menschliche Schwäche.
»Ich nehme an, daß man die meisten Leute, die Sie kennen, eigentlich nicht in der Questura zu sehen erwartet«, antwortete sie und lächelte zum Zeichen, daß sie es humorvoll meinte.
»Stimmt, meine Freunde kommen selten freiwillig hierher, und bisher mußte auch noch keiner von ihnen unfreiwillig hier erscheinen.« Diesmal sollte sein Lächeln zeigen, daß auch er über die Polizeiarbeit zu scherzen verstand. »Zum Glück«, fügte er dann noch hinzu.
»Ich hatte noch nie mit der Polizei zu tun«, sagte sie, wobei sie sich wieder im Zimmer umsah, als fürchtete sie, daß ihr nun, nachdem sie eben doch hier war, irgend etwas Schlimmes zustoßen könnte.
»Das haben die meisten Leute nicht«, meinte Brunetti.
»Vermutlich«, antwortete sie, dann senkte sie den Blick auf ihre Hände und sagte ohne jede Überleitung: »Man nannte mich einmal die Unbefleckte.«
»Wie bitte?« Brunetti verstand überhaupt nichts mehr und begann sich zu fragen, ob dieser jungen Frau wohl ernstlich etwas fehlte.
[12] »Immacolata«, sagte sie, wobei sie wieder zu ihm aufsah und dieses sanfte Lächeln aufsetzte, das er schon so oft unter der gestärkten weißen Haube ihrer Tracht hatte hervorleuchten sehen. Der Name stellte sie augenblicklich an den richtigen Platz und löste das Rätsel. Der Haarschnitt fand eine Erklärung, desgleichen ihr offenkundiges Unwohlsein in der Kleidung, die sie trug. Brunetti hatte ihre Schönheit gleich bemerkt, als er Schwester Immacolata zum erstenmal in diesem Pflegeheim gesehen hatte, dem Ort der Altersruhe, an dem seine Mutter seit Jahren nicht zur Ruhe kam, aber damals hatten ihre Ordensgelübde und die lange weiße Tracht, in der sie zum Ausdruck kamen, sie mit einem Tabu umgeben, so daß Brunetti ihre Schönheit eher wie die einer Blume oder eines Bildes wahrgenommen und nur als Betrachter darauf reagiert hatte, nicht als Mann. Nun aber, befreit von Verbot und Verhüllung, hatte diese Schönheit sich mit ins Zimmer geschlichen, mochten Verlegenheit und billige Kleidung sie noch so sehr zu verbergen suchen.
Suor Immacolata war aus dem Pflegeheim seiner Mutter vor etwa einem Jahr verschwunden, und Brunetti, bestürzt ob der Verzweiflung, mit der seine Mutter auf den Verlust der Schwester reagierte, die immer am nettesten zu ihr gewesen war, hatte lediglich in Erfahrung bringen können, daß sie in ein anderes Pflegeheim des Ordens versetzt worden war. Fragen über Fragen gingen ihm jetzt durch den Kopf, die er aber alle als unpassend verwarf. Sie war ja hier; sie würde ihm schon sagen, warum.
»Ich kann nicht nach Sizilien zurück«, sagte sie unvermittelt. »Meine Familie würde es nicht verstehen.« Ihre Hände ließen die Tasche los und suchten aneinander Halt. [13] Als sie keinen fanden, sanken sie auf die Oberschenkel, suchten jedoch, als hätten sie plötzlich die Wärme des Fleisches unter sich gefühlt, gleich wieder Trost an den harten Kanten der Tasche.
»Seit wann sind Sie …«, begann Brunetti, fand nicht das Verb, verstummte und fragte dann: »Schon lange?«
»Drei Wochen.«
»Wohnen Sie hier in Venedig?«
»Nein, nicht hier, draußen am Lido. Ich habe ein Zimmer in einer Pension.«
War sie zu ihm gekommen, weil sie Geld brauchte? Wenn ja, wäre es ihm eine Ehre und eine Freude, ihr welches zu geben, so sehr fühlte er sich in ihrer Schuld, weil sie ihm und seiner Mutter jahrelang so viel Nächstenliebe entgegengebracht hatte.
Als hätte sie seine Gedanken gelesen, sagte sie: »Ich habe Arbeit.«
»So?«
»In einer Privatklinik am Lido.«
»Als Krankenschwester?«
»In der Wäscherei.« Sie bemerkte seinen kurzen Blick auf ihre Hände und lächelte: »Das geht heute alles mit Maschinen, Commissario. Man muß die Laken nicht mehr zum Fluß schleppen und auf den Steinen ausschlagen.«
Er lachte, ebenso über seine eigene Verlegenheit wie über ihre Antwort. Damit hellte er die Stimmung im Zimmer auf und fühlte sich frei zu sagen: »Es tut mir leid, daß Sie diese Entscheidung treffen mußten.« Früher hätte er den Satz mit »Suor Immacolata« beendet, aber jetzt wußte er keinen Titel mehr, mit dem er sie hätte anreden können. Mit [14] der Tracht war auch ihr Name fort, und wer weiß was sonst noch alles.
»Ich heiße Maria«, sagte sie. »Maria Testa.« Wie eine Sängerin, die einem schwebenden Ton nachlauschte, der den Übergang von einer Stimmlage in die andere markierte, hielt sie inne und lauschte dem Nachhall ihres Namens. »Obwohl ich nicht sicher bin, ob er mir überhaupt noch gehört«, fügte sie hinzu.
»Wie meinen Sie das?« fragte Brunetti.
»Man muß ein Verfahren durchlaufen, wenn man ausscheidet. Aus dem Orden, meine ich. Ich glaube, das ist, wie wenn eine Kirche säkularisiert wird. Sehr kompliziert. Und es kann lange dauern, bis sie einen gehen lassen.«
»Man will vielleicht sicher sein, daß Sie es sind – ich meine, Ihrer Sache sicher«, mutmaßte Brunetti.
»Ja. Das kann Monate dauern, vielleicht Jahre. Man muß Briefe von Leuten vorweisen, die einen kennen und glauben, daß man zu der Entscheidung fähig ist.«
»Sind Sie deswegen hier? Kann ich Ihnen damit aushelfen?«
Sie winkte ab, wischte seine Worte beiseite und mit ihnen ihr Gehorsamkeitsgelübde. »Nein, das spielt keine Rolle. Es ist erledigt. Vorbei.«
»Verstehe«, sagte Brunetti, ohne etwas zu verstehen.
Sie sah zu ihm herüber, ihr Blick so offen, ihre Augen so anrührend schön, daß Brunetti ein Vorgefühl des Neides auf den Mann empfand, der einmal ihr Keuschheitsgelübde hinwegfegen würde.
»Ich bin hier wegen der casa di cura. Was ich dort gesehen habe.«
[15] Brunettis Herz flog über die Ferne hinweg ans Bett seiner Mutter, augenblicklich wachsam für jede Andeutung von Gefahr.
Aber bevor er sein Erschrecken in eine Frage kleiden konnte, sagte sie: »Nein, Commissario, es geht nicht um Ihre Mutter. Ihr wird nichts zustoßen.« Sie verstummte, verlegen ob ihrer Worte und wie sie sich anhörten, auch ob der bitteren Wahrheit, die darin steckte: Brunettis Mutter konnte nichts mehr zustoßen als der Tod. »Entschuldigung«, fügte sie kleinlaut hinzu, sagte aber nichts weiter.
Brunetti betrachtete sie verwirrt, wußte aber nicht, wie er sie fragen sollte, was sie meinte. Ihm fiel der Nachmittag ein, an dem er seine Mutter zuletzt besucht hatte, halb in der Hoffnung, die lange vermißte Suor Immacolata zu sehen, denn er wußte, daß sie dort der einzige Mensch war, der den Schmerz verstand, der auf seiner Seele lastete. Doch dann hatte er statt der liebenswerten Sizilianerin nur Suor Eleonora im Gang angetroffen, eine Frau, die mit den Jahren säuerlich geworden war und deren Gelübde für sie Armut im Geiste, Enthaltsamkeit im Humor und Gehorsam nur gegenüber irgendeinem rigiden Pflichtverständnis bedeuteten. Daß seine Mutter sich auch nur einen Augenblick in der Obhut dieser Frau befinden sollte, hatte ihn als Sohn erzürnt; daß die casa di cura als eines der besten Heime galt, hatte ihn als Staatsbürger beschämt.
Ihre Stimme riß ihn aus seinem langen Tagtraum, aber er bekam nicht mit, was sie sagte, und mußte nachfragen. »Entschuldigen Sie, Suora«, sagte er, sofort gewahr, daß er sie aus langer Gewohnheit doch mit ihrem Titel angesprochen hatte. »Ich war in Gedanken.«
[16] Sie überging den Ausrutscher und fing noch einmal von vorn an: »Ich spreche von der casa di cura hier in Venedig, wo ich bis vor drei Wochen gearbeitet habe. Aber ich habe nicht nur dieses Heim verlassen, Dottore, ich bin aus dem Orden ausgetreten, habe alles hinter mir gelassen, um …« Hier unterbrach sie sich und blickte zum offenen Fenster hinaus auf die Fassade der Kirche San Lorenzo, als suchte sie dort nach dem richtigen Ausdruck. »Um mein neues Leben zu beginnen.« Sie sah ihn an und lächelte dünn. »La vita nuova«, wiederholte sie, hörbar um Ungezwungenheit bemüht, als wäre ihr ebenso bewußt wie ihm, welches Pathos sich da in ihre Stimme geschlichen hatte. »Wir mußten La Vita Nuova in der Schule lesen, aber besonders gut kann ich mich daran nicht mehr erinnern.« Sie sah ihn wieder an, die Augenbrauen fragend hochgezogen.
Brunetti hatte keine Ahnung, worauf dieses Gespräch hinauslaufen sollte; zuerst war von Gefahr die Rede gewesen, jetzt von Dante. »Wir haben das auch gelesen, aber ich glaube, da war ich noch zu jung. Mir hat La Divina Commedia sowieso immer besser gefallen«, erklärte er. »Besonders Purgatorio.«
»Wie eigenartig«, sagte sie mit echtem Interesse, oder vielleicht auch nur, um das, was sie eigentlich hergeführt hatte, noch etwas hinauszuschieben. »Ich habe noch nie jemanden sagen hören, daß dieses Buch ihm besser gefällt. Warum?«
Brunetti gestattete sich ein Lächeln. »Ich weiß, die Leute glauben immer, nur weil ich Polizist bin, müsse Inferno mir am besten gefallen. Die Bösen werden bestraft, und jeder kriegt, was er nach Dantes Meinung verdient. Aber mir hat [17] das nie gefallen, diese absolute Gewißheit der Urteile, dieses furchtbare Leiden. Auf ewig.« Sie blieb stumm, sah ihm nur ins Gesicht und hörte zu, was er zu sagen hatte. »Mir gefällt Purgatorio, weil da immer noch die Möglichkeit offenbleibt, daß sich etwas ändert. Für die anderen, ob im Himmel oder in der Hölle, ist alles erledigt: Sie bleiben, wo sie sind. Auf ewig.«
»Glauben Sie daran?« fragte sie, und Brunetti wußte, daß sie nicht von Literatur sprach.
»Nein.«
»Gar nichts davon?«
»Sie meinen, ob ich daran glaube, daß es einen Himmel oder eine Hölle gibt?«
Sie nickte, und er fragte sich, ob es wohl Reste eines Aberglaubens waren, die sie davon abhielten, die Worte des Zweifels auszusprechen.
»Nein«, antwortete er.
»Nichts?«
»Nichts.«
Nach sehr langem Schweigen sagte sie: »Wie schrecklich.«
Wie schon so viele Male, seit ihm klargeworden war, daß er nicht glaubte, zuckte Brunetti nur die Achseln.
»Wir werden es wohl irgendwann erfahren«, sagte sie, aber in ihrem Ton lag Zuversicht, kein Sarkasmus, keine Ablehnung.
Wieder wollte Brunetti im ersten Moment nur die Achseln zucken, denn dies waren Dinge, mit denen er schon vor Jahren abgeschlossen hatte, während des Studiums, da hatte er solchen Kinderkram abgelegt, überdrüssig aller Spekulation und gespannt auf das Leben. Aber ein kurzer Blick zu [18] ihr belehrte ihn, daß sie gewissermaßen eben erst aus dem Ei geschlüpft war, am Beginn ihres neuen Lebens stand, und daß solche Fragen, in der Vergangenheit gewiß undenkbar, für sie jetzt hochaktuell und lebenswichtig waren. »Vielleicht ist es ja alles wahr«, räumte er ein.
Ihre Antwort kam unverzüglich und heftig. »Sie brauchen mir keine Zugeständnisse zu machen, Commissario. Ich habe meine Berufung hinter mir gelassen, nicht meinen Verstand.«
Er gedachte weder sich zu entschuldigen noch diese unerhebliche theologische Diskussion fortzusetzen. Er schob einen Brief von einer Seite seines Schreibtischs auf die andere, rückte seinen Stuhl ein Stückchen zurück und schlug die Beine übereinander. »Wollen wir statt dessen darüber sprechen?« fragte er.
»Worüber?«
»Über den Ort, an dem Sie Ihre Berufung hinter sich gelassen haben.«
»Das Pflegeheim?« fragte sie unnötigerweise.
Brunetti nickte. »Von welchem ist die Rede?«
»San Leonardo. Das ist in der Nähe des Ospedale Giustinian. Der Orden stellt teilweise das Personal.«
Ihm fiel auf, daß sie beim Sitzen die Füße flach nebeneinander auf dem Boden stehen hatte, die Knie fest aneinander gepreßt. Sie öffnete mit einiger Mühe ihre Handtasche und nahm ein Blatt Papier heraus, das sie auseinanderfaltete, um das darauf Geschriebene zu betrachten. »Letztes Jahr«, begann sie unsicher, »sind dort fünf Leute gestorben.« Sie drehte das Blatt um und beugte sich vor, um es ihm hinzulegen. Brunetti besah sich die Liste.
[19] »Diese Leute?« fragte er.
Sie nickte. »Ich habe ihre Namen notiert, ihr Alter und woran sie gestorben sind.« Er blickte wieder auf die Liste: Es waren die Namen von drei Frauen und zwei Männern. Brunetti entsann sich, daß er einmal irgendeine Statistik gelesen hatte, die besagte, daß Frauen länger lebten als Männer, aber hier war das nicht der Fall. Eine der Frauen war in den Sechzigern gewesen, die anderen Anfang Siebzig. Beide Männer waren älter. Und wie es bei Leuten ihres Alters oft so geht, waren sie an Gehirnschlägen, Herzinfarkten und Lungenentzündungen gestorben.
»Warum geben Sie mir das?« fragte er, indem er sie ansah.
Obwohl sie auf die Frage vorbereitet gewesen sein mußte, ließ sie sich mit der Antwort Zeit. »Weil Sie der einzige Mensch sind, der da vielleicht etwas unternehmen kann.«
Brunetti wartete kurz, ob sie das näher erläutern würde, und als sie es nicht tat, fragte er: »Was meinen Sie mit ›da‹?«
»Ich habe Zweifel an ihrem Tod – an den Todesursachen.«
Er schwenkte die Liste zwischen ihnen durch die Luft. »Aber sind die Todesursachen hier nicht aufgeführt?«
Sie nickte. »Doch. Aber wenn das, was da steht, nicht wahr ist, haben Sie dann die Möglichkeit, festzustellen, woran sie wirklich gestorben sind?«
Brunetti brauchte nicht erst nachzudenken, bevor er antwortete; für Exhumierungen gab es klare Gesetze. »Nicht ohne richterliche Anordnung oder ein Ersuchen der Familie.«
»Oh«, sagte sie. »Das wußte ich nicht. Ich war – wie soll ich sagen –, ich war so lange aus der Welt, daß ich nicht mehr [20] weiß, wie diese Dinge ablaufen.« Sie schwieg einen Moment und fuhr dann fort: »Vielleicht habe ich es ja nie gewußt.«
»Wie lange haben Sie dem Orden angehört?« fragte er.
»Zwölf Jahre, seit meinem fünfzehnten Lebensjahr.« Sie bemerkte sein Erstaunen und sagte: »Das ist eine lange Zeit, ich weiß.«
»Aber so sehr waren Sie doch gar nicht aus der Welt«, meinte Brunetti. »Immerhin haben Sie eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht.«
»Nein«, antwortete sie rasch. »Ich bin keine Krankenschwester. Jedenfalls keine ausgebildete. Der Orden hat gesehen, daß ich eine …« Sie verstummte abrupt, und Brunetti begriff, daß sie in der ungewohnten Lage gewesen war, eine Begabung an sich anzuerkennen oder sogar sich selbst zu loben, worauf ihr nichts anderes übrigblieb, als kurzerhand in Schweigen zu versinken. Nach einer Pause, die es ihr gestattete, jegliches Eigenlob aus dem, was sie sagen wollte, zu entfernen, fuhr sie fort: »Der Orden fand, daß es gut für mich wäre, wenn ich alten Leuten zu helfen versuchte, deshalb wurde ich in die Altenheime geschickt.«
»Wie lange waren Sie da?«
»Sieben Jahre. Sechs draußen in Dolo und eines im San Leonardo«, antwortete sie. Demnach wäre Suor Immacolata, wie Brunetti sich klarmachte, gerade zwanzig gewesen, als sie ins Heim seiner Mutter kam, ein Alter, in dem die meisten Frauen zu arbeiten anfingen, einen Beruf wählten, Männer kennenlernten, Kinder bekamen. Er stellte sich vor, was diese anderen jungen Frauen in diesen Jahren alles erreicht haben konnten, dann stellte er sich vor, wie das Leben für Suor Immacolata ausgesehen haben mußte, [21] umgeben vom Geheul der Irren und dem Gestank der Inkontinenten. Wäre Brunetti ein Mann mit Sinn für Religion gewesen, einem Glauben an irgendein höheres Wesen, vielleicht hätte er Trost in dem spirituellen Lohn gefunden, den sie letztendlich für alle diese geopferten Jahre empfangen würde. Er schob den Gedanken beiseite und fragte, während er die Liste vor sich hinlegte und glättend mit der Hand darüberfuhr: »Was war ungewöhnlich am Tod dieser Leute?«
Sie ließ sich einen Augenblick Zeit, und als sie endlich antwortete, brachte sie ihn völlig durcheinander. »Nichts. Gewöhnlich haben wir alle paar Monate einen Todesfall, manchmal auch mehr, gleich nach den Ferien.«
Langjährige Erfahrung im Verhör der Willigen wie der Unwilligen gab Brunetti die Ruhe, mit der er fragte: »Warum haben Sie dann diese Liste zusammengestellt?«
»Zwei der Frauen waren Witwen, die dritte war nie verheiratet. Einer der Männer bekam nie Besuch.« Sie sah ihn an, wartete auf eine Ermunterung, aber er sagte noch immer nichts.
Ihre Stimme wurde sanfter, und Brunetti sah plötzlich wieder Suor Immacolata in ihrer weißen Tracht vor sich, die schwer mit dem Gebot rang, niemanden zu verleumden, über niemanden schlecht zu reden, nicht einmal über einen Sünder. »Zwei von ihnen«, fuhr sie schließlich fort, »habe ich das eine oder andere Mal sagen hören, daß sie bei ihrem Tod die casa di cura bedenken wollten.« Hier hielt sie wieder inne und blickte auf ihre Hände hinunter, die sich von der Handtasche gelöst und einander fest umklammert hatten.
[22] »Und? Haben sie Wort gehalten?«
Sie schüttelte den Kopf, sagte aber nichts.
»Maria«, sagte er bewußt leise, »heißt das, sie haben nicht Wort gehalten, oder wissen Sie es nur nicht?«
Sie sah nicht zu ihm auf, als sie antwortete: »Ich weiß es nicht. Aber zwei von ihnen, Signorina da Prè und Signora Cristanti … haben gesagt, daß sie es wollten.«
»Wie haben sie das gesagt?«
»Signorina da Prè sagte eines Tages nach der Messe, vor etwa einem Jahr – es gibt keine Kollekte, wenn Padre Pio bei uns die Messe liest – las.« Sie griff sich nervös an die Schläfe, und Brunetti sah, wie ihre Finger zurückglitten und den schützenden Halt ihrer Haube suchten. Sie fand aber nur ihre unbedeckten Haare und zog die Finger weg, als hätte sie sich verbrannt.
»Nach der Messe«, wiederholte sie, »als ich sie in ihr Zimmer zurückbegleitete, sagte sie, es mache nichts, daß es keine Kollekte gebe, man werde nach ihrem Ableben schon sehen, wie großzügig sie gewesen sei.«
»Haben Sie nachgefragt, was sie damit meinte?«
»Nein. Ich fand es völlig klar, daß sie dem Heim ihr Geld vermachen wollte, oder einen Teil davon.«
»Und?«
Wieder schüttelte sie den Kopf. »Ich weiß es nicht.«
»Wie lange danach ist sie gestorben?«
»Drei Monate.«
»Hat sie das noch zu jemand anderem gesagt, das mit dem Geld?«
»Ich weiß es nicht. Sie hat nicht mit vielen geredet.«
»Und die andere Frau?«
[23] »Signora Cristanti«, stellte Maria klar. »Sie war viel direkter. Sie hat gesagt, daß sie ihr Geld den Leuten vermachen wollte, die gut zu ihr waren. Das hat sie zu jedem gesagt, und immer wieder. Aber sie war … Ich glaube nicht, daß sie so eine Entscheidung überhaupt treffen konnte, jedenfalls nicht, nachdem ich sie kennengelernt hatte.«
»Warum sagen Sie das?«
»Sie war nicht ganz klar im Kopf«, antwortete Maria. »Jedenfalls nicht immer. Es gab Tage, da schien sie völlig normal, aber die meiste Zeit war sie nicht ganz da; hielt sich wieder für ein junges Mädchen, wollte ausgeführt werden.« Nach kurzem Schweigen fügte sie in ganz und gar sachlichem Ton hinzu: »Das ist an der Tagesordnung.«
»Daß die Leute in der Vergangenheit leben?« fragte Brunetti.
»Ja. Die Armen. Die Vergangenheit ist ihnen wahrscheinlich angenehmer als die Gegenwart. Jede Vergangenheit.«
Brunetti fiel sein letzter Besuch bei seiner Mutter ein, aber er schob die Erinnerung von sich. Statt dessen fragte er: »Was ist aus ihr geworden?«
»Signora Cristanti?«
»Ja.«
»Sie ist vor etwa vier Monaten einem Herzinfarkt erlegen.«
»Wo ist sie gestorben?«
»Dort. In der casa di cura.«
»Wo hatte sie den Herzinfarkt? In ihrem Zimmer, oder an einem Ort, wo noch andere Leute waren?« Brunetti nannte sie nicht »Zeugen«, nicht einmal in Gedanken.
»Nein, sie ist im Schlaf gestorben. Friedlich.«
[24] »Verstehe«, sagte Brunetti, ohne es wirklich zu meinen. Er ließ sich etwas Zeit, bevor er fragte: »Ist diese Liste so zu verstehen, daß die Leute Ihrer Ansicht nach an etwas anderem gestorben sind? Also nicht an dem, was jeweils hinter ihren Namen steht?«
Sie sah zu ihm auf, und ihre Überraschung wunderte ihn. Wenn sie mit so etwas schon zu ihm kam, mußte sie doch wissen, welche Bedeutung in ihren Worten lag.
Sie wiederholte, offenbar um Zeit zu gewinnen: »An etwas anderem?« Und als Brunetti keine Antwort gab, sagte sie: »Signora Cristanti hatte nie etwas am Herzen.«
»Und die anderen auf der Liste, die plötzlich gestorben sind?«
»Signor Lerini hatte es schon länger am Magen, aber sonst nichts«, sagte sie.
Brunetti sah wieder auf der Liste nach. »Diese andere Frau, Signora Galasso. Hatte sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme?«
Er sah sie plötzlich erröten. »Das Schlimme ist, daß ich mir nicht sicher bin. Ich muß nur immer daran denken, was diese Frauen zu mir gesagt haben.« Sie hielt inne und blickte zu Boden. Schließlich sagte sie so leise, daß er sie nur mit Mühe verstehen konnte: »Ich mußte mit jemandem darüber sprechen.«
»Maria«, sagte er, und nachdem er ihren Namen genannt hatte, wartete er, bis sie zu ihm aufsah. Dann sprach er weiter: »Ich weiß, daß es eine ernste Sache ist, falsches Zeugnis wider seinen Nächsten zu reden.« Sie zuckte zusammen, als hätte der Teufel aus der Bibel zitiert. »Aber es ist auch wichtig, die Schwachen zu schützen und alle, die sich nicht [25] selbst schützen können.« Brunetti erinnerte sich nicht, das in der Bibel gelesen zu haben, aber er fand, es gehörte unbedingt hinein. Als sie darauf nichts sagte, fragte er: »Verstehen Sie das, Maria?« Und als sie immer noch nicht antwortete, fragte er es anders: »Stimmen Sie dem zu?«
»Natürlich stimme ich dem zu«, sagte sie gereizt. »Aber wenn ich mich nun irre? Wenn ich mir das alles nur einbilde und diesen Leuten gar nichts zugestoßen ist? Dann wäre das doch üble Nachrede.«
»Wenn Sie das glaubten, wären Sie wohl nicht hier. Schon gar nicht in dieser Kleidung.«
Sie sagten beide eine Weile nichts, dann fragte Brunetti: »Waren diese Leute allein in ihren Zimmern, als sie starben?«
Sie überlegte kurz. »Ja.«
Brunetti schob die Liste zur Seite und wechselte, um seiner Geste auch verbal zu entsprechen, das Thema. »Wann haben Sie sich zu Ihrem Austritt entschlossen?«
Ihre Antwort hätte kaum rascher kommen können, wenn sie die Frage erwartet hätte. »Nachdem ich mit der Mutter Oberin gesprochen hatte«, sagte sie, und eine Erinnerung ließ ihre Stimme kratzig klingen. »Zuerst habe ich aber mit Padre Pio gesprochen, meinem Beichtvater.«
»Können Sie wiedergeben, was Sie zu den beiden gesagt haben?« Brunetti hatte der Kirche und all ihrem Getue und Gepränge schon so lange den Rücken gekehrt, daß er nicht mehr wußte, was man von einer Beichte weitersagen durfte und was nicht, und welche Strafen ein Zuwiderhandeln nach sich zog, er wußte nur noch, daß über die Beichte eigentlich nicht geredet werden sollte.
[26] »Ja, ich glaube schon.«
»Ist das derselbe Priester, der die Messe liest?«
»Ja. Er gehört unserem Orden an, aber er wohnt nicht dort. Er kommt zweimal die Woche.«
»Von woher?«
»Von unserem Kloster hier in Venedig. Er war früher in dem anderen Pflegeheim schon mein Beichtvater.«
Brunetti merkte, wie gern sie sich durch Details ablenken ließ, darum fragte er: »Was haben Sie ihm gesagt?«
Sie überlegte kurz und rief sich wohl das Gespräch mit ihrem Beichtvater ins Gedächtnis: »Ich habe ihm von den Leuten erzählt, die gestorben sind, und daß einige vorher nicht krank waren«, sagte sie, dann brach sie ab und schaute weg.
Als Brunetti sah, daß sie nicht weiterreden würde, fragte er: »Haben Sie sonst noch etwas gesagt, etwas über das Geld, oder was die Leute selbst darüber gesagt hatten?«
Sie schüttelte den Kopf. »Damals wußte ich davon gar nichts. Das heißt, es war mir nicht eingefallen, weil ihr Tod mich so mitgenommen hatte, also habe ich ihm nur das gesagt – daß sie gestorben waren.«
»Und er?«
Sie sah jetzt wieder Brunetti an. »Er hat gesagt, das verstehe er nicht. Da habe ich es ihm erklärt. Ich habe ihm die Namen der Verstorbenen genannt und was ich über ihre Krankengeschichte wußte, daß einige von ihnen kerngesund gewesen waren, bevor sie plötzlich starben. Er hat sich das alles angehört und gefragt, ob ich mir ganz sicher sei.« Dann fügte sie hinzu, als spräche sie mit sich selbst: »Nur weil ich aus Sizilien stamme, halten die Leute hier oben mich immer für dumm. Oder verlogen.«
[27] Brunetti warf einen Blick zu ihr hinüber, um zu sehen, ob in ihrer Bemerkung ein Tadel, ein Kommentar zu seinem eigenen Verhalten versteckt war, aber offenbar war das nicht der Fall.
»Ich denke, er konnte einfach nicht glauben, daß so etwas möglich war. Und«, fuhr sie fort, »als ich sagte, so viele Todesfälle auf einmal seien nicht normal, fragte er mich, ob ich wisse, wie gefährlich es sei, solche Dinge zu verbreiten. Wie gefährlich üble Nachrede sei. Als ich sagte, das wisse ich wohl, riet er mir zu beten.« Sie brach ab.
»Und?«
»Ich sagte ihm, ich hätte schon gebetet, tagelang. Dann fragte er, ob mir klar sei, was ich da angedeutet hätte, wie grauenvoll das sei.« Wieder unterbrach sie sich und fügte dann leise, wie nur für sich, hinzu: »Er war entsetzt. Ich glaube, die bloße Möglichkeit ging über seinen Verstand. Padre Pio ist ein sehr guter Mensch, und ziemlich weltfremd.«
Brunetti unterdrückte ein Lächeln. Das von einer Frau, die die letzten zwölf Jahre ihres Lebens in einem Kloster verbracht hatte! »Was dann?«
»Ich habe um eine Unterredung mit der Mutter Oberin gebeten.«
»Und Sie haben mit ihr gesprochen?«
»Es hat zwei Tage gedauert, aber schließlich hat sie mich empfangen, an einem Spätnachmittag, nach der Vesper. Ich habe ihr noch einmal alles gesagt, das mit den verstorbenen alten Leuten. Sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen. Darüber war ich froh, denn es hieß, daß Padre Pio ihr gegenüber nichts erwähnt hatte. Das wußte ich ja [28] eigentlich, aber was ich ihm gesagt hatte, war so schrecklich – also, da war ich mir doch nicht sicher …« Ihre Stimme verebbte.
»Und?« fragte er.
»Sie hat mir nicht zugehört, hat gemeint, sie hört sich keine Lügen an, und was ich da angedeutet hätte, schade dem Orden.«
»Und dann?«
»Sie hat mir befohlen – unter Berufung auf mein Gehorsamsgelübde –, einen Monat lang zu schweigen.«
»Heißt das, wenn ich es richtig verstehe, daß Sie einen Monat lang mit keinem Menschen reden durften?«
»Ja.«
»Und Ihre Arbeit? Mußten Sie nicht mit den Patienten sprechen?«
»Bei denen war ich nicht.«
»Wie denn das?«
»Die Mutter Oberin hat mir befohlen, mich die ganze Zeit nur in meinem Zimmer und in der Kapelle aufzuhalten.«
»Einen ganzen Monat?«
»Zwei.«
»Wie bitte?«
»Zwei«, wiederholte sie. »Nach dem ersten Monat kam sie zu mir ins Zimmer und fragte, ob meine Meditationen und Gebete mir schon den richtigen Weg gewiesen hätten. Ich sagte ihr, ich hätte gebetet und meditiert – das hatte ich ja auch –, aber diese Todesfälle gingen mir noch immer nicht aus dem Kopf. Sie wollte wieder nichts hören und befahl mir, mein Schweigen wiederaufzunehmen.«
[29] »Haben Sie das?«
Sie nickte.
»Und dann?«
»Ich habe die nächste Woche im Gebet verbracht, aber inzwischen konnte ich schon an gar nichts anderes mehr denken als an das, was diese Frauen gesagt hatten. Vorher hatte ich versucht, mir das Darandenken zu verbieten, aber nachdem ich einmal damit angefangen hatte, kam es mir immer wieder in den Sinn.«
Brunetti konnte sich gut vorstellen, was ihr nach über einem Monat Einsamkeit und Schweigen alles in den Sinn gekommen sein mochte. »Was geschah dann nach dem zweiten Monat?«
»Die Mutter Oberin kam wieder zu mir und fragte, ob ich zur Vernunft gekommen sei. Ich sagte ja, und das stimmte wohl auch.« Sie hielt mit Reden inne und bedachte Brunetti wieder mit diesem traurigen, nervösen Lächeln.
»Und dann?«
»Dann bin ich weggegangen.«
»Einfach so?« Brunetti dachte sofort an die praktische Seite: Kleidung, Geld, Transport. Merkwürdigerweise waren das dieselben Dinge, um die sich Leute sorgten, bevor sie aus dem Gefängnis entlassen werden sollten.
»Noch am selben Nachmittag bin ich mit den Leuten, die zur Besuchszeit gekommen waren, hinausgegangen. Niemand schien das komisch zu finden; keiner hat etwas gemerkt. Ich habe eine der Frauen, die gerade gingen, gefragt, ob sie mir sagen könnte, wo ich mir etwas zum Anziehen kaufen könne. Ich hatte nur siebzehntausend Lire.«
[30] Sie verstummte, und Brunetti fragte: »Hat sie es Ihnen gesagt?«
»Ihr Vater war einer meiner Patienten, daher kannte sie mich. Sie und ihr Mann wollten mich gleich zum Abendessen mit zu sich nach Hause nehmen. Da ich sonst nirgends hinkonnte, bin ich mitgegangen. Zum Lido.«
»Und?«
»Unterwegs auf dem Boot habe ich ihnen erzählt, wozu ich mich entschlossen hatte, aber über den Grund habe ich ihnen nichts gesagt. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn selbst kannte, oder ihn jetzt kenne. Ich wollte dem Orden oder dem Pflegeheim nichts Böses nachsagen. Das tue ich jetzt doch auch nicht, oder?« Brunetti, der keine Ahnung hatte, schüttelte den Kopf, und sie sprach weiter. »Ich habe nur der Mutter Oberin von diesen Todesfällen erzählt, daß mir das merkwürdig vorkam, so viele auf einmal.«
Brunetti meinte ganz und gar ruhig: »Ich habe irgendwo gelesen, daß alte Leute manchmal reihenweise sterben, ohne besonderen Grund.«
»Das habe ich ja eben gesagt. Gewöhnlich gleich nach den Ferien.«
»Könnte es auch hier so eine Erklärung geben?« fragte er.
Brunetti glaubte so etwas wie Zorn in ihren Augen aufblitzen zu sehen. »Natürlich könnte das sein. Aber warum hat sie dann versucht, mich zum Schweigen zu bringen?«
»Ich glaube, das haben Sie mir vorhin gesagt, Maria.«
»Was?«
»Ihr Gelübde. Gehorsam. Ich weiß nicht, wie wichtig das denen ist, aber es könnte sein, daß es ihnen mehr Sorgen bereitet als alles andere.« Als sie nicht antwortete, fragte er: [31] »Halten Sie das für möglich?« Sie verweigerte weiterhin die Antwort, darum fragte er jetzt: »Wie ist es dann weitergegangen? Mit diesen Leuten am Lido?«
»Sie waren sehr nett zu mir. Nach dem Essen hat die Frau mir ein paar Kleider von sich gegeben.« Sie zeigte auf den Rock, den sie anhatte. »Ich bin die erste Woche bei ihnen geblieben, dann haben sie mir geholfen, diese Arbeit im Krankenhaus zu finden.«
»Mußten Sie sich dafür nicht irgendwie ausweisen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Die waren so froh, jemanden zu finden, der zu dieser Arbeit bereit war, daß sie mir gar keine Fragen gestellt haben. Aber ich habe ans Bürgermeisteramt meiner Heimatstadt geschrieben und um Kopien meiner Geburtsurkunde und meines Personalausweises gebeten. Wenn ich in dieses Leben zurückkehren soll, werde ich die wohl brauchen.«
»Wohin haben Sie die schicken lassen, an die Klinik?«
»Nein, zu diesen Leuten.« Sie hatte die Besorgnis in seinem Ton gehört und wollte wissen: »Warum fragen Sie das?«
Er tat ihre Frage mit einer raschen Kopfbewegung ab. »Reine Neugier. Man weiß nie, wie lange so etwas dauert.« Es war eine dumme Lüge, aber Maria war so lange im Kloster gewesen, daß Brunetti bezweifelte, ob sie eine Lüge als solche erkennen würde, vor allem aus dem Munde eines Menschen, den sie als Freund betrachtete. »Haben Sie noch Verbindung mit irgend jemandem aus der casa di cura, oder von Ihrem Orden?«
»Nein, mit niemandem.« Nach kurzem Schweigen fügte sie hinzu: »Ich bin zwei Leuten begegnet, deren Eltern im [32] San Leonardo meine Patienten waren. Aber ich glaube nicht, daß sie mich erkannt haben.« Hier lächelte sie und meinte dann: »Genau wie Sie.«
Brunetti erwiderte ihr Lächeln. »Wissen die Leute im Pflegeheim, wohin Sie gegangen sind?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Das können sie unmöglich wissen.«
»Würden die Leute vom Lido es ihnen sagen?«
»Nein. Ich habe sie gebeten, niemandem etwas von mir zu erzählen, und ich glaube, das tun sie auch nicht.« Anscheinend fiel ihr Brunettis Unbehagen von vorhin wieder ein, denn schon wollte sie wissen: »Warum fragen Sie?«
Er sah keinen Grund, ihr nicht wenigstens das zu sagen. »Wenn etwas dran ist an Ihrem …«, begann er, merkte dann aber, daß er gar nicht wußte, wie er es nennen sollte: Eine Anschuldigung war es jedenfalls nicht, eigentlich nichts weiter als eine Wiedergabe unzusammenhängender Ereignisse. Er fing noch einmal von vorn an: »Wegen der Dinge, die Sie mir berichtet haben, könnte es ratsam sein, vorerst keinen Kontakt mit den Leuten von der casa di cura aufzunehmen.« Er machte sich klar, daß er keine Ahnung hatte, wer diese Leute waren. »Als Sie diese alten Frauen von ihrem Geld reden hörten, hatten Sie da irgendeine Ahnung, wem, ich meine welcher bestimmten Person, sie es vermachen wollten?«
»Darüber habe ich nachgedacht«, antwortete sie mit leiser Stimme, »und ich möchte es lieber nicht sagen.«
»Bitte, Maria, ich glaube, Sie können es sich jetzt nicht mehr aussuchen, was Sie über das alles sagen wollen und was nicht.«
[33] Sie nickte, aber sehr langsam; sie mußte wohl zugeben, daß er recht hatte, aber das machte es ihr keineswegs angenehmer. »Sie könnten es der casa di cura selbst vermacht haben, oder dem Direktor. Oder dem Orden.«
»Wer ist der Direktor?«
»Doktor Messini, Fabio Messini.«
»Käme sonst noch jemand in Frage?«
Sie dachte einen Moment darüber nach, dann meinte sie: »Vielleicht Padre Pio. Er ist so gut zu den Patienten, daß viele ihn sehr gern haben. Aber ich glaube nicht, daß er etwas annehmen würde.«
»Die Mutter Oberin?« fragte Brunetti.
»Nein. Der Orden erlaubt uns nicht, etwas zu besitzen. Den Frauen jedenfalls nicht.«
Brunetti zog sich ein Blatt Papier heran. »Kennen Sie Padre Pios Familiennamen?«
Die Angst stand deutlich in ihrem Gesicht. »Sie werden aber doch nicht mit ihm reden, nein?«
»Ich glaube nicht. Aber wissen möchte ich ihn gern. Falls es nötig wird.«
»Cavaletti«, sagte sie.
»Wissen Sie mehr über ihn?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nur daß er zweimal die Woche kommt, um die Beichte zu hören, und wenn jemand sehr krank ist, kommt er, um ihm die letzte Ölung zu spenden. Ich hatte selten Zeit, mit ihm zu sprechen. Außerhalb des Beichtstuhls, meine ich.« Sie besann sich einen Augenblick, dann sprach sie weiter: »Das letzte Mal habe ich ihn vor etwa einem Monat gesehen, am Namenstag der Mutter Oberin, das war der zwanzigste Februar.« Plötzlich zog sie [34] die Lippen ein und kniff die Augen zusammen, als täte ihr etwas furchtbar weh. Brunetti fürchtete schon, sie könne ohnmächtig werden, und beugte sich zu ihr vor.
Sie öffnete die Augen, sah ihn an und hob abwehrend die Hand. »Ist das nicht merkwürdig?« fragte sie. »Daß ich mich an ihr Namensfest erinnere?« Sie wandte den Blick ab, dann sah sie ihn wieder an. »Ich weiß nicht einmal mehr meinen Geburtstag. Nur den Tag der Unbefleckten, am achten Dezember.« Sie schüttelte den Kopf, ob traurig oder verwundert, hätte er nicht sagen können. »Es ist, als hätte ein Teil von mir die ganzen Jahre gar nicht mehr existiert, wie ausgelöscht. Ich weiß nicht mehr, wann mein Geburtstag ist.«
»Sie könnten vielleicht den Tag, an dem Sie das Kloster verlassen haben, dazu ernennen«, schlug Brunetti vor und lächelte zum Zeichen, daß er es nur freundlich meinte.
Sie hielt seinem Blick kurz stand, dann hob sie, die Augen geschlossen, Zeige- und Mittelfinger ihrer rechten Hand an die Stirn und rieb sich darüber. »La vita nuova«, sagte sie, mehr zu sich selbst als zu ihm.
Unvermittelt stand sie auf. »Ich glaube, ich möchte jetzt gehen, Commissario.« Ihr Blick war weniger ruhig als ihre Stimme, weshalb Brunetti keinen Versuch machte, sie aufzuhalten.
»Können Sie mir noch den Namen der Pension sagen, in der Sie wohnen?«
»La Pergola.«
»Am Lido?«
»Ja.«
»Und wie heißen die Leute, die Ihnen geholfen haben?«
[35] »Warum wollen Sie denn das wissen?« fragte sie ernstlich erschrocken.
»Weil ich immer alles wissen möchte«, sagte er. Eine ehrliche Antwort.
»Sassi. Vittorio Sassi. Via Morosini Nummer elf.«
»Danke«, sagte Brunetti, ohne sich diese Namen zu notieren. Sie wandte sich zur Tür, und einen Moment lang glaubte er schon, daß sie ihn fragen würde, was er denn nun eigentlich in dieser Sache unternehmen wolle, aber sie sagte nichts. Er stand auf und kam hinter seinem Schreibtisch hervor, hoffte ihr wenigstens noch die Tür öffnen zu können, aber sie war schneller. Sie hatte sie bereits aufgemacht, warf noch einen kurzen Blick zu ihm zurück, ohne dabei zu lächeln, und ging aus dem Zimmer.
[36] 2
Brunetti wandte sich wieder der Betrachtung seiner Füße zu, aber sie sprachen ihm nicht länger von Muße. Wie eine übermächtige Gottheit beherrschte seine Mutter all sein Denken, sie, die seit Jahren in den unerforschbaren Gefilden der Irren wandelte. Die Angst um ihre Sicherheit schlug mit wilden Flügeln auf ihn ein, obwohl er genau wußte, daß seiner Mutter nur noch eine letzte absolute Sicherheit blieb, eine Sicherheit, die sein Herz nicht wünschen konnte, sosehr ihn sein Verstand auch drängte. Unwillkürlich fühlte er sich hineingezogen in die Erinnerungen der letzten sechs Jahre, befingerte sie wie die Perlen eines grausigen Rosenkranzes.
Plötzlich stieß er mit einer heftigen Bewegung die Schublade zu und stand auf. Suor Immacolata – noch konnte er sie nicht anders nennen – hatte ihm versichert, daß seiner Mutter keine Gefahr drohe; bisher hatte er auch noch keinerlei Hinweis darauf, daß überhaupt Gefahr bestand. Alte Menschen starben nun einmal, und oft war es eine Erlösung für sie und ihre Nächsten, wie es auch für … Er ging zurück an seinen Schreibtisch und nahm die Liste, die sie ihm gegeben hatte, las noch einmal die Namen und das jeweilige Alter.
Schon stellte Brunetti die ersten Überlegungen an, wie er mehr über diese Leute erfahren könne, über ihr Leben und ihren Tod. Suor Immacolata hatte die Todesdaten notiert, über diese käme er an die Sterbeurkunden im Rathaus [37] heran, das erste Wegstück im unüberschaubaren Labyrinth der Bürokratie, durch das er schließlich auch an die Kopien ihrer Testamente käme. Spinnfäden – seine Neugier mußte so leicht und luftig sein wie Spinnfäden, seine Fragen mußten so behutsam tasten wie die Schnurrhaare einer Katze. Er versuchte sich zu erinnern, ob er Suor Immacolata je gesagt hatte, daß er commissario war. Vielleicht hatte er es an einem jener langen Nachmittage, an denen seine Mutter ihm gestattete, ihre Hand zu halten – aber nur, solange die junge Frau, die sie am liebsten mochte, mit im Zimmer blieb –, einmal beiläufig erwähnt. Über irgend etwas hatten sie da ja reden müssen, denn seine Mutter sprach oft stundenlang kein Wort, summte nur tonlos vor sich hin. Und Suor Immacolata, wie durch die Tracht an ihrer Persönlichkeit amputiert, hatte selten etwas von sich erzählt – aber sie hatte Brunetti hin und wieder mit ihren scharfsinnigen Bemerkungen über die Menschen verblüfft, die ihre kleine, abgegrenzte Welt bewohnten. Damals mußte er wohl, wie immer auf der Suche nach Gesprächsthemen, um diese endlosen schmerzlichen Stunden zu füllen, auch über seinen Beruf gesprochen haben. Und sie hatte zugehört und sich erinnert und war nun, ein Jahr später, mit ihrer Geschichte und ihrer Angst zu ihm gekommen.