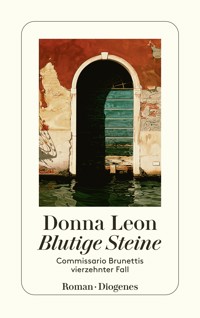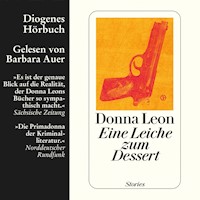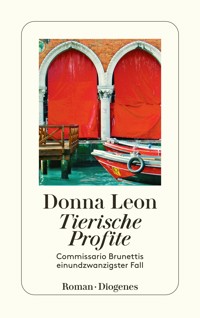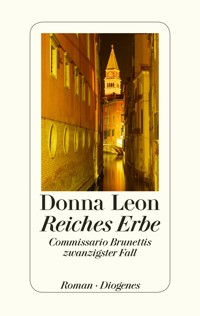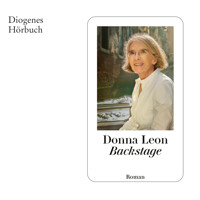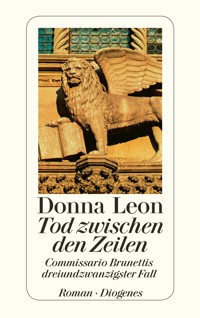
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Brunetti auf der Jagd nach Raritäten: Der Commissario wird zu einem ungewöhnlichen Tatort gerufen, der altehrwürdigen Biblioteca Merula. Wertvolle Folianten liegen aufgeschlitzt da, und der amerikanische Forscher, der ein Dauergast war, ist verschwunden. In Venedig, das einst auch eine florierende Bücherstadt war, entdeckt Brunetti eine eigenartige Welt: einen florierenden Schwarzmarkt für Bücher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Donna Leon
Tod zwischenden Zeilen
Commissario Brunettisdreiundzwanzigster Fall
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Werner Schmitz
Titel des Originals: ›By its Cover‹
Die deutsche Erstausgabe erschien 2015 im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Georg Friedrich Händel, Saul, Akt2, Szene8
Nachweis der übrigen zitierten Texte am Ende des Bandes
Covermotiv: Foto von age fotostock (Ausschnitt) Copyright ©age fotostock/LOOK-foto
Für Judith Flanders
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright ©2016
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24373 4 (1.Auflage)
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]Mean as he was, he is my brother now
Arm wie er war, er ist mein Bruder nun
[7]1
Es war ein nervtötender Montag, Brunetti hatte sich durch die Zeugenaussagen zu einer Schlägerei zwischen zwei Wassertaxifahrern hindurchgekämpft, als deren Ergebnis einer der beiden mit einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen rechten Arm ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ausgesagt hatte das amerikanische Ehepaar, das beim Hotelportier ein Taxi zum Flughafen bestellt hatte; der Portier, der eins der Taxis, mit dem sie immer zusammenarbeiteten, gerufen haben wollte; der Angestellte, der das Gepäck der Amerikaner in das wartende Boot verstaute, was schließlich sein Job war; und zu guter Letzt die beiden Taxifahrer – der eine vom Krankenhaus aus. Für Brunetti reimten sich die Aussagen nur dann zusammen, wenn das angeforderte Taxi zwar schnell zur Stelle war, da es sich zufällig in der Nähe befand, ihm aber dennoch am Hotelanleger ein anderes Wassertaxi zuvorgekommen war, das mit den Koffern beladen wurde. Das bestellte Taxi zwängte sich daneben, und der Fahrer rief laut die Amerikaner mit Namen, um sie zum Flughafen zu bringen. Der andere Fahrer aber bestand stur darauf, dass dies seine Fuhre sei, weil der Gepäckträger ihn herangewinkt habe. Jener bestritt das. Und dann fand sich der Fahrer, dessen Taxi bereits beladen war, plötzlich auf dem Deck des anderen Taxis wieder. Die Amerikaner waren außer sich, weil sie ihren Flug verpasst hatten.
Brunetti hatte zwar keine Beweise, konnte sich aber [8]bestens vorstellen, was geschehen war: Der Mann für das Gepäck hatte ein vorbeifahrendes Taxi herangewinkt, um dem Portier die Provision wegzuschnappen. Die Folgen lagen auf der Hand: Natürlich würde niemand sagen, wie der Hase lief, und die Amerikaner hatten wieder mal keine Ahnung, was los war.
Einen Moment hing Brunetti diesen Gedanken nach, vergaß sogar, dass er einen Kaffee trinken wollte. War er da etwa über die Formel gestolpert, die das aktuelle Weltgeschehen erklärte? Lächelnd nahm er sich vor, Paola am Abend davon zu erzählen, oder besser noch am nächsten Abend, für den sie bei den Faliers zum Essen eingeladen waren. Vielleicht konnte er seinen Schwiegervater, der paradoxe Situationen liebte, damit zum Lachen bringen. Bei seiner Schwiegermutter war er sich ganz sicher.
Er ließ das Träumen sein und machte sich auf den Weg nach unten, um endlich den Kaffee zu trinken, der ihn durch den Rest des Nachmittags hindurchretten würde. Doch kurz bevor er die Tür ins Freie öffnete, klopfte der Wachhabende in der Telefonzentrale ans Fenster seines winzigen Büros und winkte ihn herein. Brunetti bekam noch mit, wie der Wachmann ins Telefon sagte: »Ich denke, Sie sollten mit dem Commissario sprechen, Dottoressa. Der ist dafür zuständig.« Er reichte ihm den Hörer.
»Brunetti.«
»Sie sind ein Commissario?«
»Ja.«
»Hier spricht Dottoressa Fabbiani, Chefbibliothekarin der Biblioteca Merula. Man hat uns bestohlen. Vermutlich ist sogar mehrfach etwas entwendet worden.« Ihre Stimme klang [9]zittrig, wie bei allen Opfern eines Raubüberfalls, die Brunetti getroffen hatte.
»Aus der Sammlung?«, fragte Brunetti. Er kannte die Bibliothek, war als Student ein paarmal dort gewesen, doch das war Jahrzehnte her.
»Ja.«
»Was genau wurde gestohlen?«, fragte Brunetti und legte sich im Geist die nächsten Fragen zurecht.
»Das ganze Ausmaß ist uns noch nicht bekannt. Bis jetzt steht nur fest, dass aus mehreren Bänden einzelne Seiten herausgeschnitten wurden.« Er hörte sie tief Luft holen.
Brunetti zog Papier und Bleistift zu sich heran. »Um wie viele Seiten geht es denn?«
»Das weiß ich nicht. Ich habe es soeben erst bemerkt.« Ihre Stimme gewann allmählich wieder an Festigkeit.
Neben ihr sagte ein Mann etwas. Ihre Antwort klang gedämpft, offenbar hatte sie sich zu dem Sprecher umgedreht. Dann herrschte Stille am anderen Ende der Leitung.
Brunetti erinnerte sich an das Prozedere, wenn er in den Bibliotheken der Stadt ein Buch hatte einsehen wollen, und fragte: »Haben Sie nicht ein Verzeichnis aller Benutzer der Bibliothek?«
Überraschte es sie, dass ein Polizist eine solche Frage stellte? Dass er sich mit Bibliotheken auskannte? Auf jeden Fall antwortete sie nicht gleich. »Das versteht sich wohl von selbst«, versetzte sie schließlich. »Wir überprüfen es gerade.«
»Und sind Sie dem Täter auf der Spur?«, fragte Brunetti.
Es folgte eine noch längere Pause. »Ein Wissenschaftler, vermutlich«, erklärte sie schließlich. Und wie um sich zu rechtfertigen: »Er hat sich ordnungsgemäß ausgewiesen.« [10]Schon begann sie, sich genauso zu rechtfertigen wie alle Beamten, die sich dem leisesten Vorwurf der Nachlässigkeit ausgesetzt wähnen.
»Dottoressa«, sagte Brunetti, um einen möglichst überzeugenden und sachlichen Ton bemüht, »wir sind auf die Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen. Je früher wir den Täter finden, desto weniger Zeit hat er, das Diebesgut zu verkaufen.« Er konnte ihr diese Tatsache nicht ersparen.
»Die Bücher sind ruiniert«, jammerte sie so verzweifelt, als wäre ein geliebter Mensch gestorben.
Für eine Bibliothekarin war ein beschädigtes Buch offenbar ebenso schlimm wie ein entwendetes. Er beschloss, den Klagen ein Ende zu machen. »Ich komme, sobald ich kann, Dottoressa. Fassen Sie bitte nichts an.« Bevor sie etwas entgegnen konnte, setzte er hinzu: »Bitte halten Sie auch die Unterlagen bereit, mit denen er sich ausgewiesen hat.« Als sie hierauf nichts antwortete, hängte der Commissario ein.
Brunetti wusste noch, dass die Bibliothek an den Zattere lag, aber wo genau, erinnerte er sich nicht mehr. An den Wachmann gewandt, sagte er: »Falls jemand nach mir sucht, ich bin in der Biblioteca Merula. Nehmen Sie mit Vianello Kontakt auf, er soll mit zwei Männern rüberfahren und Fingerabdrücke nehmen lassen.«
Foa lehnte mit verschränkten Armen und gekreuzten Füßen am Kanalgeländer. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und hielt sein Gesicht mit geschlossenen Augen der Frühlingssonne entgegen. Kaum kam Brunetti näher, fragte der Bootsführer: »Wohin darf ich Sie bringen, Commissario?«, und schlug erst dann die Augen auf.
[11]»Zur Biblioteca Merula.«
»Dorsoduro 3429«, ergänzte Foa wie aus der Pistole geschossen.
»Woher wissen Sie das?«
»Mein Schwager wohnt mit seiner Familie im Haus nebenan«, der Bootsführer strahlte.
»Ich hatte schon befürchtet, der Tenente hätte Sie dazu verdonnert, alle Adressen der Stadt auswendig zu lernen.«
»Wer wie ich auf einem Boot aufgewachsen ist, findet sich blind in der Stadt zurecht, Signore. Besser als jedes Navi«, meinte Foa und tippte sich an die Stirn. Er stieß sich vom Geländer ab, wie um auf das Boot zu steigen, dann aber hielt er plötzlich inne und drehte sich zu Brunetti um. »Wissen Sie eigentlich, was aus denen geworden ist, Signore?«
»Woraus?«, fragte Brunetti verwirrt.
»Aus den Navis.«
»Was für Navis?«
»Die für die Boote bestellt wurden.«
Brunetti wartete stumm auf eine Erklärung.
»Vor ein paar Tagen habe ich mit Martini gesprochen«, erklärte Foa. Martini war der für die Materialbeschaffung zuständige Beamte. Man suchte ihn auf, wenn ein Funkgerät zu reparieren war oder eine neue Taschenlampe gebraucht wurde. »Er hat mir die Rechnung gezeigt und mich gefragt, ob die was taugen.«
»Und?«, meinte Brunetti, während er sich im Stillen fragte, wie sie auf das Thema gekommen waren.
»Oh, das weiß doch jeder, Signore. Die Dinger sind Mist. Die Wassertaxifahrer wollen sie nicht, ich kenne nur einen einzigen, der sich eins angeschafft hat, und den hat es so zur [12]Raserei getrieben, dass er es eines Tages von der Windschutzscheibe seines Boots gerissen und in den Kanal geworfen hat.« Foa machte ein paar Schritte auf sein Boot zu und hielt dann erneut inne: »Das habe ich Martini gesagt.«
»Und was hat er getan?«
»Was kann er schon tun? Die werden von irgendeiner zentralen Stelle in Rom geordert. Jemand dort streicht eine Kommission für die Bestellung ein, und ein anderer streicht etwas dafür ein, dass er die Bestellung abgezeichnet hat.« Er zuckte die Schultern und stieg aufs Boot.
Warum Foa ihm das erzählt haben mochte, fragte sich Brunetti, der auch nichts daran ändern konnte. So liefen die Dinge nun einmal.
Foa startete den Motor. »Martini meinte, die Bestellung belief sich auf ein Dutzend.« Das letzte Wort betonte er.
»Haben wir nicht nur sechs Boote?«, fragte Brunetti, was Foa gar nicht erst kommentierte.
»Wie lange ist das her, Foa?«
»Ein paar Monate. Muss irgendwann in diesem Winter gewesen sein.«
»Wissen Sie, ob die Navis jemals eingetroffen sind?«, fragte Brunetti.
Foa hob das Kinn und schnalzte mit der Zunge, so wie Straßenkinder eine absurde Vorstellung quittieren.
Brunetti hatte die Qual der Wahl: Falls er dagegen vorging, warf ihn das zurück; man konnte versuchen, über einen Umweg voranzukommen, oder einfach die Augen verschließen und sich ruhig verhalten. Wenn er mit Martini sprechen und erfahren würde, dass die Navigationsgeräte zwar bestellt und bezahlt, aber nie geliefert worden waren, [13]geriet er selbst in die Bredouille. Ging er dem auf eigene Faust nach, mochte er vielleicht weitere Plünderungen der öffentlichen Kassen verhindern. Doch er konnte die Sache auch einfach auf sich beruhen lassen und sich um wichtigere Dinge kümmern – oder weniger aussichtslose.
»Was meinen Sie, wird’s jetzt endlich Frühling?«, fragte er den Bootsführer.
Foa wandte in stillschweigendem Einverständnis lächelnd den Blick ab. »Ich denke schon, Signore. Hoffentlich. Ich habe die Kälte und den Nebel gründlich satt.«
Als sie ins bacinozurückgesetzt hatten und geradeaus sehen konnten, stöhnten sie beide unwillkürlich auf. Ihr Seufzer hatte nichts Übertriebenes an sich, er war lediglich die spontane Reaktion auf den jenseitigen, unvorstellbaren Anblick, der sich ihnen darbot. Vor ihnen ragte das Heck eines der neuesten und größten Kreuzfahrtschiffe in den Himmel. Es streckte ihnen sein gewaltiges Hinterteil entgegen, als sollten sie es nur wagen, eine kritische Bemerkung zu machen.
Sieben, acht, neun, zehn Stockwerke. War das möglich? Aus ihrer Froschperspektive verdeckte es die ganze Stadt, raubte ihnen das Licht, raubte jeden Sinn und Verstand. Sie fuhren langsam hinterher und beobachteten, wie die Lawine von Heckwellen gegen die riva schlug, Welle um Welle um Welle: Kaum auszudenken, was die Wucht dieser gewaltigen Menge verdrängten Wassers dem Mauerwerk und dem jahrhundertealten Mörtel antat, der es zusammenhielt. Doch ehe sie etwas sagen konnten, erstickten sie fast in einer gewaltigen Abgaswolke. Und genauso plötzlich lag wieder Frühling in der Luft, es duftete nach süßen Knospen, [14]frischem Laub und jungem Gras, jenes leise Kichern, wenn die Natur sich für das nächste Fest herausputzt.
Dutzende Meter über sich sahen sie Köpfe über Köpfe an der Reling aufgereiht, die sich wie Sonnenblumen der Schönheit der Piazza mit ihren Kuppeln und dem Glockenturm zuneigten. Ein Vaporetto kam ihnen entgegen, dessen Besatzung, zweifellos Venezianer, den Passagieren hoch oben mit den Fäusten drohten, doch die Touristen schauten in die andere Richtung und bekamen von den Eingeborenen nichts mit. Brunetti dachte an Captain Cook, den andere Eingeborene aus der Brandung gefischt, getötet, gekocht und verspeist hatten. »Gut so«, rutschte ihm unwillkürlich heraus.
An den Zattere angelangt, fuhr Foa wenig später rechts ran, schaltete in den Rückwärtsgang und ließ das Boot im Leerlauf zum Stillstand kommen. Er schnappte sich ein Tau, sprang aufs Pflaster und vertäute es am Poller. Dann half er Brunetti hinauf.
»Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern«, sagte Brunetti. »Am besten fahren Sie wieder zurück.«
Aber Foa war abgelenkt: Er sah dem riesigen Schiff nach, das auf die Anlegestelle San Basilio zuhielt. »Ich habe gelesen«, bemerkte Brunetti auf Veneziano, »dass erst etwas unternommen werden kann, wenn alle Beteiligten sich einig sind.«
»Ich weiß«, sagte Foa, ohne das Schiff aus den Augen zu lassen. »Magistrato alle Acque, Regione, die Stadtjunta, die Hafenbehörde, irgendein Ministerium in Rom…« Er verstummte, ganz im Bann des Monstrums, das sich allmählich entfernte und dennoch kaum kleiner zu werden schien. [15]Dann fand Foa seine Sprache wieder und nannte einige Beteiligte mit Namen.
Brunetti kannte etliche von ihnen. Foa endete mit drei ehemals hochrangigen städtischen Beamten, spuckte die Namen wie Hammerschläge aus, mit denen ein Tischler die letzten Nägel in einen Sargdeckel rammt.
»Ich habe nie verstanden, warum man die Zuständigkeiten so aufgesplittet hat«, sagte Brunetti. Immerhin stammte Foa aus einer Familie, die auf und von der laguna lebte: Fischer, Fischhändler, Seeleute, Bootsführer und Monteure der ACTV. Den Foas fehlten praktisch nur noch die Kiemen. Falls irgendjemand sich mit der Bürokratie zum Schutz der Gewässer auskannte, in und von denen diese Stadt lebte, dann mussten es Leute wie diese sein.
Foa lächelte so allwissend und von oben herab wie ein Lehrer, der es mit einem begriffsstutzigen Schüler zu tun hat. »Glauben Sie, dass acht verschiedene Gremien jemals zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen können?«
Endlich dämmerte es Brunetti: »Und nur eine gemeinsame Entscheidung wird die Kreuzfahrtschiffe von uns fernhalten« – eine Schlussfolgerung, die Foas Grinsen noch breiter werden ließ.
»Und so können sie endlos hin und her diskutieren«, sagte der Bootsführer mit unverhohlener Bewunderung dafür, wie raffiniert sich die diversen Gremien den Kuchen aufteilten. »Beziehen ihr Gehalt, veranstalten Dienstreisen in andere Länder, um sich kundig zu machen, halten Konferenzen ab, auf denen Projekte und Pläne zerredet werden. Oder sie engagieren sogar die eigenen Frauen und Kinder als Berater.« Das hatte neulich im Gazzettino gestanden.
[16]»Und sacken kleine Geschenke von den Gesellschaften ein, denen die Schiffe gehören?«, ergänzte Brunetti, auch wenn er sich uniformierten Kollegen gegenüber eigentlich nicht zu solchen Bemerkungen hinreißen lassen sollte.
Foas Lächeln wurde wärmer, aber dann zeigte er den schmalen abzweigenden Kanal hinunter: »Da unten, direkt vor der Brücke. Die grüne Tür, Signore.«
Brunetti winkte zum Dank fürs Mitnehmen und die Auskunft. Gleich darauf sprang der Motor an, und das Polizeiboot beschrieb einen weiten Bogen, um zur Questura zurückzugelangen.
Das Pflaster war nass, bemerkte Brunetti, und entlang den Hausmauern hatten sich große Pfützen gebildet. Neugierig ging er zur riva zurück und überprüfte den Wasserspiegel, doch der befand sich gut einen halben Meter tiefer. Es war Ebbe, es gab kein acqua alta, und seit Tagen hatte es nicht geregnet, also konnte das Wasser nur durch ein vorbeifahrendes Schiff herübergeschwappt sein. Und dennoch versuchte man, ihm und den anderen Bewohnern der Stadt weiszumachen, dass von den Kreuzfahrtschiffen keine Gefahr ausging.
Waren die meisten, die darüber zu befinden hatten, nicht selbst Venezianer? Waren sie nicht in dieser Stadt zur Welt gekommen? Besuchten ihre Kinder nicht hier die Schule und die Universität? Bestimmt hielten sie ihre Konferenzen sogar auf Veneziano ab.
Er hatte gedacht, er würde die Bibliothek wiedererkennen, wenn er sie sah, aber nichts in dieser Gegend wirkte vertraut. Auch wusste er nicht mehr, ob der Palazzo Merulas [17]Wohnsitz gewesen war, als er in Venedig gelebt hatte: Im Archivo Storico ließe sich das recherchieren, nicht aber bei der Polizei, deren Akten keine tausend Jahre zurückreichten.
Als Brunetti durch die offene grüne Tür den Hof betrat, kam dieser ihm vage bekannt vor – zumal er aussah wie die meisten anderen Renaissancehöfe der Stadt, einschließlich der Außentreppe zur ersten Etage und des gedeckten Brunnens. Von den umgebenden Mauern geschützt, hatte sich das Relief darauf prächtig erhalten. Pausbäckige Engel hielten ein Familienwappen, das er nicht kannte. Einige Flügelspitzen waren reparaturbedürftig, alles andere unversehrt. Vierzehntes Jahrhundert, schätzte er; unterhalb des Eisendeckels war eine Blütengirlande in den Rand gemeißelt. Ja, an diesen Brunnen konnte er sich noch genau erinnern.
Brunetti näherte sich der Treppe, deren breites Marmorgeländer in regelmäßigen Abständen mit ananasgroßen Löwenköpfen verziert war. Zwei der Köpfe tätschelte er im Vorbeigehen. Auf dem Treppenabsatz verkündete eine Messingtafel neben der Tür: »Biblioteca Merula«.
Er trat ein, ins Kühle. Es war ein milder Nachmittag, er hatte schon bereut, dass er noch sein Wolljackett trug, jetzt aber trocknete der Schweiß auf seinem Rücken.
In dem kleinen Empfangsbereich saß ein junger Mann mit modischem Zweitagebart an einem Pult, vor sich ein aufgeschlagenes Buch. Er begrüßte Brunetti mit einem Lächeln: »Was kann ich für Sie tun?«
Brunetti zückte seinen Dienstausweis. »Verstehe«, sagte der junge Mann. »Sie möchten zu Dottoressa Fabbiani. Die ist oben.«
[18]»Ist das hier nicht die Bibliothek?«, fragte Brunetti und wies auf die Tür hinter dem jungen Mann.
»Das ist die moderne Sammlung. Die älteren Werke sind oben. Sie müssen noch eine Treppe höher.« Als er Brunettis Verwirrung bemerkte, erklärte er: »Vor etwa zehn Jahren wurde alles umgestellt.« Und mit einem weiteren Lächeln: »Lange vor meiner Zeit.«
»Und lange nach meiner«, ergänzte Brunetti zum Abschied.
Da es keine weiteren Löwen gab, strich Brunetti, während er die Stufen hinaufstieg, über den gerundeten Handlauf, dessen Marmor vom jahrhundertelangen Gebrauch glattpoliert war. Rechts neben der Tür im nächsten Stock war eine Klingel. Nach geraumer Weile öffnete ihm ein Mann, der einige Jahre jünger sein mochte als Brunetti. Er trug ein dunkelblaues Jackett mit Kupferknöpfen und in Uniformschnitt; eine untersetzte Gestalt mittlerer Größe, mit klaren blauen Augen und einer schmalen Nase, die ein klein wenig schief stand. »Sind Sie der Commissario?«, fragte der Mann.
Brunetti bejahte und stellte sich vor.
»Piero Sartor«, erwiderte der andere und drückte kurz die dargebotene Hand. Er trat zurück, um Brunetti in einen Raum einzulassen, der wie der Kartenschalter eines kleinen Provinzbahnhofs wirkte. Linkerhand ein hüfthoher Holztresen, darauf ein Computer und zwei Holzablagen für Papiere. Ein Rollwagen mit alten Folianten parkte an der Wand dahinter.
Sie mochten jetzt Computer haben, die es zu seiner Studentenzeit in den Bibliotheken nicht gegeben hatte, aber [19]der Geruch war noch derselbe. Alte Bücher weckten in Brunetti stets die Sehnsucht nach Jahrhunderten, in denen er nicht gelebt hatte. Sie waren auf Papier gedruckt, hergestellt aus Lumpen, die in Handarbeit zerkleinert, gestampft, gewässert, nochmals gestampft, zu großen Bogen geschöpft, bedruckt, gefaltet und nochmals gefaltet, gebunden und genäht wurden: All diese Mühe, um aufzuzeichnen und festzuhalten, wer wir sind und was wir gedacht haben, sinnierte Brunetti. Er erinnerte sich, wie schön sie sich angefühlt hatten, vor allem aber erinnerte er sich an diesen leisen, aber unverkennbaren Geruch, mit dem die Vergangenheit ihn anhauchte.
Der Mann schloss die Tür und riss Brunetti aus seinen Träumereien. »Ich bin der Wachmann. Ich habe das Buch entdeckt«, erklärte er mit unverhohlenem Stolz.
»Das beschädigte?«, fragte Brunetti.
»Ja, Signore. Das heißt, ich habe das Buch aus dem Lesesaal nach unten gebracht, und als Dottoressa Fabbiani es aufschlug, stellte sie fest, dass Seiten herausgeschlitzt waren«, sagte er, jetzt nicht mehr stolz, sondern empört, ja beinahe zornig.
»Verstehe«, sagte Brunetti. »Ihre Aufgabe ist es, Bücher nach unten zum Schalter zu bringen?« Ihn interessierte, was ein Wachmann in dieser Einrichtung alles zu tun haben mochte. Offenbar war es sein Amt als Aufsicht, das Sartor der Polizei gegenüber so ungewöhnlich mitteilsam machte.
Der Mann warf ihm einen kurzen, scharfen Blick zu, aus dem Erschrecken oder Verwirrung sprach. »Nein, Signore, ich hatte das Buch gelesen – na ja, Teile davon–, also erkannte ich es sofort und war der Meinung, dass es nicht auf [20]dem Tisch herumliegen sollte«, sprudelte er hervor. »Cortés. Der Spanier, der nach Südamerika gefahren ist.«
Sartor schien unsicher, wie er das erklären sollte, und fuhr langsamer fort: »Er war so begeistert von den Büchern, die er las, dass ich selbst neugierig wurde und mir das eine oder andere ansah.« Brunettis fragende Miene veranlasste ihn zu der Erklärung: »Ein Amerikaner, spricht aber sehr gut Italienisch – hat kaum einen Akzent–, also wir unterhielten uns immer noch ein wenig, wenn ich unten war, während er wartete, dass die Bücher gebracht wurden.« Brunetti sah sein Gegenüber aufmunternd an. »Nachmittags haben wir eine Pause, aber ich rauche nicht, und Kaffee kann ich nicht trinken. Mein Magen. Der schafft das nicht mehr. Ich trinke grünen Tee, aber in den Bars hier gibt es den nicht, jedenfalls keinen genießbaren.« Bevor Brunetti fragen konnte, warum der Mann ihm das alles erzähle, fand Sartor zum Thema zurück: »Ich hatte also immer eine freie halbe Stunde und wollte nicht nach draußen gehen, also fing ich an zu lesen. Ich bekomme ja oft mit, was für Bücher hier bestellt werden, und manchmal nehme ich mir eins davon vor.« Er lächelte nervös, als fürchte er, man könne ihn für anmaßend halten. »So kann ich meiner Frau was Interessantes erzählen, wenn ich nach Hause komme.«
Brunetti war froh, dass die Welt ihn immer noch zu überraschen vermochte: Die Menschen taten und sagten die unvorhersehbarsten Dinge, im Guten wie im Schlechten. Als ein Kollege ihm einmal erzählt hatte, wie er, während seine Frau in der siebzehnten Stunde ihrer Wehen mit dem ersten Kind lag, ihre Klagen nicht mehr ertrug, hätte Brunetti ihm am liebsten eine Ohrfeige verpasst. Er dachte an [21]die Frau seines Nachbarn, die jeden Abend ihre Katze aus dem Küchenfenster ließ, damit sie auf den Dächern des Viertels umherstreifen konnte; und jeden Morgen kredenzte der Kater ihr eine Wäscheklammer, so wie Sartor seiner Frau interessante Geschichten mitbrachte.
Brunetti fragte ernsthaft interessiert: »Hernán Cortés?«
»Ja«, antwortete Sartor. »Der diese Stadt in Mexiko erobert hat, die man früher das Venedig des Westens nannte.« Und damit Brunetti ihn nicht für einen Dummkopf hielt, stellte er klar: »Mit ›man‹ meine ich natürlich die Europäer, nicht die Mexikaner.«
Brunetti nickte zum Zeichen, dass er verstand.
»Ein interessantes Buch, obwohl er dauernd Gott dankt, wenn er mal wieder einen Haufen Menschen umgebracht hat. Das hat mir weniger gefallen, aber er hat schließlich an den König geschrieben, also musste er so etwas vielleicht sagen. Aber was er über Land und Leute schreibt, das ist faszinierend. Meiner Frau hat es auch gefallen.«
Er sah Brunetti an, der seinen Bruder im Geiste mit beifälligem Lächeln zum Weitererzählen ermunterte. »Ich fand es spannend, wie viel damals so ganz anders war als heute. Ich war schon ziemlich weit und wollte es zu Ende lesen. Jedenfalls fiel mir der Titel ins Auge – Relación –, als ich es an dem Platz liegen sah, wo er gewöhnlich sitzt; ich nahm es an mich und brachte es nach unten, weil ein solches Buch nicht einfach so da oben herumliegen sollte.«
Da Brunetti annahm, dieser namenlose »er« sei der Mann, den man verdächtigte, Seiten herausgetrennt zu haben, fragte er: »Warum haben Sie das Buch nach unten gebracht, wenn er doch damit gearbeitet hat?«
[22]»Riccardo aus der ersten Etage hatte mir gesagt, er habe ihn die Treppe herunterkommen sehen, während ich in der Mittagspause war. Das hatte er noch nie getan. Er kommt immer, kurz nachdem wir aufmachen, und bleibt bis nachmittags.« Nach einigem Nachdenken fügte er aufrichtig besorgt hinzu: »Ich weiß nicht, wie er das mit dem Mittagessen hält: Er wird doch hoffentlich nicht hier drin gegessen haben?« Als sei ihm der bloße Gedanke peinlich, erklärte er: »Also bin ich rauf, um nachzusehen, ob er noch mal zurückkommt.«
»Woran merken Sie das?«, fragte Brunetti neugierig.
Sartor deutete ein Lächeln an. »Wenn man so lange hier arbeitet, Signore, erkennt man die Zeichen. Keine Bleistifte, keine Lesezeichen, kein Notizbuch. Ich kann das schlecht erklären, aber ich weiß einfach, ob die Leute fertig sind. Oder nicht.«
»Und er war fertig?«
Der Wachmann nickte energisch. »Die Bücher vor seinem Platz aufgestapelt. Die Lampe aus. Für mich stand fest, dass er nicht zurückkommen würde. Also habe ich das Buch mit nach unten genommen.«
»War das ungewöhnlich?«
»Für ihn schon. Sonst hat er immer alles zusammengepackt und die Bücher selbst nach unten gebracht.«
»Wann ist er gegangen?«
»Genau kann ich das nicht sagen, Signore. Ich bin um halb drei zurückgekommen, da war er schon weg.«
»Und dann?«
»Wie gesagt, als ich von Riccardo erfuhr, dass er gegangen war, bin ich hoch, um nach den Büchern zu sehen.«
[23]»Und das machen Sie immer so?«, bohrte Brunetti. Als er sich das erste Mal danach erkundigt hatte, war der Wachmann nervös geworden.
Diesmal blieb er ruhig. »Eigentlich nicht, Signore. Aber früher habe ich hier als Magazinbote gearbeitet – musste den Leuten die Bücher bringen und sie nachher ins Regal zurückstellen–, davon ist mir etwas geblieben.« Und dann frei heraus: »Ich kann es nicht ausstehen, wenn Bücher auf den Tischen herumliegen und niemand da ist, der sie benutzt.«
»Verstehe«, sagte Brunetti. »Erzählen Sie weiter, bitte.«
»Ich hatte die Bücher also zur Theke zurückgetragen. Dottoressa Fabbiani kam gerade von einer Besprechung, und als sie den Cortés dort liegen sah, wollte sie einen Blick hineinwerfen, und da hat sie die Bescherung entdeckt.« Langsamer, fast als rede er mit sich selbst, fuhr er fort: »Ich verstehe nicht, wie er das geschafft hat. Normalerweise sind immer mehrere Leute im Leseraum.«
Brunetti ließ das so stehen. »Warum hat sie gerade dieses Buch aufgeschlagen?«, fragte er.
»Sie sagte, sie habe es als Studentin gelesen, und ihr gefalle die Zeichnung der Stadt darin. Und da hat sie es genommen und aufgeschlagen.« Er dachte kurz nach. »Sie hat sich richtig gefreut, das nach so vielen Jahren wiederzusehen. – Leute, die hier arbeiten«, fügte er erklärend hinzu, »empfinden nun mal so, wenn es um Bücher geht.«
»Sie sagten, normalerweise sind mehrere Leute im Lesesaal?«, hakte Brunetti freundlich nach. Sartor nickte. »Meistens sind ein oder zwei Wissenschaftler da, außerdem ein Mann, der seit drei Jahren die Kirchenväter liest. Wir nennen [24]ihn Tertullian: Das war das erste Buch, das er bestellt hat, und der Name ist ihm geblieben. Er kommt täglich, ist gewissermaßen schon einer von uns.«
Brunetti ging nicht näher auf Tertullians Lesestoff ein, sondern bemerkte lächelnd: »Das kann ich verstehen.«
»Was, Signore?«
»Dass Sie jemandem vertrauen, der sich seit Jahren mit den Kirchenvätern beschäftigt.«
Brunettis Tonfall schien den Mann nervös zu machen. »Vielleicht war das fahrlässig von uns«, sagte er. Da Brunetti dazu schwieg, erklärte er: »Was die Sicherheit angeht, meine ich. Wir haben so wenig Besucher in der Bibliothek, da schleicht sich nach einer Weile das Gefühl ein, wir kennten die Leute. Wir glauben, nichts von ihnen befürchten zu müssen.«
»Das ist riskant«, bemerkte Brunetti.
[25]2
Sie war groß und dünn und glich auf den ersten Blick einem dieser Stelzvögel, die es früher so zahlreich in der laguna gegeben hatte. Ihr Schopf war silbergrau und sehr kurz geschnitten, und im Stehen lehnte sie sich nach vorn, die Arme auf dem Rücken und eine Hand ums Gelenk der anderen gelegt. Genau wie jene Vögel hatte sie breite schwarze Füße am Ende sehr langer Beine.
Sie schritt auf die beiden zu, holte ihre rechte Hand nach vorne und streckte sie Brunetti entgegen. »Patrizia Fabbiani. Ich bin die Direktorin.«
»Bedaure, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen, Dottoressa«, sagte Brunetti, der Unbekannten gegenüber gerne förmlich blieb, bis er sie genauer einschätzen konnte.
»Hast du den Commissario bereits unterrichtet, Piero?«, fragte Dottoressa Fabbiani den Wachmann. Das vertrauliche Du wirkte so, als spräche sie mit einem Freund, nicht mit einem Untergebenen.
»Ich habe ihm erzählt, dass ich das Buch nach unten gebracht, aber nicht bemerkt hatte, dass Seiten fehlen«, antwortete Sartor, ohne eine direkte Anrede, so dass Brunetti nicht erkennen konnte, ob alle in diesem Haus die Direktorin duzen durften. In einem Schuhladen mochte das üblich sein, aber in einer Bibliothek?
»Und die anderen Bücher, die er benutzt hat?«, fragte Brunetti.
[26]Die Dottoressa schloss die Augen, als ertrüge sie die Vorstellung der herausgerissenen Seiten nicht. »Die habe ich mir sofort bringen lassen. Es waren drei weitere. Bei einem fehlten neun Seiten.«
Ob sie dabei wohl Handschuhe getragen hatte? Eine Bibliothekarin fackelte angesichts von Büchern, die womöglich beschädigt worden waren, bestimmt nicht lange, so wie ein Arzt angesichts einer blutenden Wunde.
»Wie schwerwiegend ist der Verlust?«, fragte Brunetti, der eine Vorstellung gewinnen wollte, um was für Größenordnungen es ging. Gestohlen wurden Dinge, die wertvoll waren, aber Wert war, Bargeld einmal ausgenommen, immer relativ. Manche Dinge hatten Liebhaberwert, bei anderen bestimmte der Markt den Preis. In diesem Fall dürften Seltenheit, Zustand und Begehrtheit für den Wert maßgeblich sein. Kann man Schönheit mit einem Preisschild versehen? Oder historische Bedeutung? Einen Moment betrachtete er versonnen die Bücher auf dem Gestell an der Wand.
Die Dottoressa hatte einen offenen Blick. Er sah nicht in die Augen eines Stelzvogels, sondern in die einer blitzgescheiten Frau, die auf seine Frage keine simple Antwort geben mochte.
Sie griff nach einer mehrseitigen Liste. »Wir versuchen gerade zu ermitteln, was er über die schon bekannten Bücher hinaus hier eingesehen hat«, erwiderte sie stattdessen. »Wenn wir alles durchgegangen sind, können wir abschätzen, was sonst noch fehlt.«
»Seit wann kommt er hierher?«
»Seit drei Wochen.«
[27]»Darf ich die Bücher sehen, die Sie bereits gefunden haben?«, fragte Brunetti.
»Ja, selbstverständlich.« Sie wandte sich an den Wachmann: »Piero, mach einen Zettel an die Tür, dass wir geschlossen haben. Technische Probleme.« Und zu Brunetti mit bitterem Lächeln: »Das kommt der Wahrheit ziemlich nahe, nicht wahr?«
Brunetti antwortete nicht.
Während Piero den Zettel schrieb, fragte Dottoressa Fabbiani ihn: »Ist noch jemand im Lesesaal?«
»Nein. Heute war sonst nur noch Tertullian da, und der ist gegangen.« Sartor nahm Papier und eine Rolle Klebeband aus einer Schublade hinter dem Schalter und ging zur Tür.
»Oddio«, flüsterte Dottoressa Fabbiani. »Den hatte ich ganz vergessen. Er gehört hier gewissermaßen zum Mobiliar.« Sie schüttelte den Kopf, ärgerlich über ihre Vergesslichkeit.
»Und wer ist das?«, fragte Brunetti, neugierig, ob ihre Auskunft sich mit der des Wachmanns decken würde.
»Er ist Dauergast. Seit Jahren. Liest religiöse Abhandlungen und ist zu allen hier sehr höflich.«
»Verstehe«, sagte Brunetti, ohne fürs Erste weiter darauf einzugehen. »Erklären Sie mir, was man tun muss, wenn man Ihre Sammlung benutzen möchte?«
Sie nickte. »Das ist ganz unkompliziert. Bürger der Stadt müssen ihre carta d’identità vorlegen und ihre aktuelle Adresse nachweisen. Von Auswärtigen, die bestimmte Bücher einsehen möchten, verlangen wir eine schriftliche Erläuterung ihres Forschungsprojekts, ein Empfehlungsschreiben einer akademischen Einrichtung oder einer anderen Bibliothek und die Vorlage eines Ausweises.«
[28]»Wie erfährt man, dass man hier recherchieren kann?« Ihre verwirrte Miene sagte ihm, dass er seine Frage schlecht formuliert hatte. »Ich meine, wie erfährt man, welche Bücher Sie in Ihrer Sammlung haben?«
Sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen. »Das ist alles online. Man braucht nur nachzusehen.«
»Versteht sich«, bog Brunetti die Frage ab. »Als ich studiert habe, war das noch anders.« Er sah sich um. »Alles war anders.«
»Sie waren hier?«, fragte die Dottoressa erstaunt.
»Ein paarmal, zu meiner Zeit auf dem liceo.«
»Und was haben Sie gelesen?«
»Hauptsächlich Geschichte. Die Römer; manchmal die Griechen.« Der Ehrlichkeit halber fügte er hinzu: »Aber nur in Übersetzungen.«
»Für die Schule?«, fragte sie.
»Gelegentlich«, sagte Brunetti. »Aber meistens, weil die Autoren mir gefielen.«
Sie warf Brunetti einen prüfenden Blick zu und ging dann ohne ein weiteres Wort ihm voraus in den hinteren Teil des Gebäudes.
Brunetti dachte an seine Studentenzeit und die Ewigkeiten, die er in Bibliotheken verbracht hatte: den Titel in der Kartei aufspüren, das Bestellformular ausfüllen (in doppelter Ausfertigung, maximal drei Bücher), die Formulare am Schalter abgeben, auf die Bücher warten, an einen Tisch gehen und lesen, am Ende des Tages die Bücher zurückgeben. Er erinnerte sich an Bibliographien und wie eifrig er darin gestöbert hatte, immer in der Hoffnung, weitere Titel zu dem Thema zu finden, an dem er gerade arbeitete. Manchmal [29]erwähnte ein Professor nützliche Quellen, aber das war die Ausnahme; die meisten horteten ihr Wissen, als glaubten sie, die Herrschaft darüber zu verlieren, wenn sie es an die Studenten weitergäben.
»Hat der Amerikaner sich für Bücher zu einem bestimmten Thema interessiert?«, fragte Brunetti.
»Reisen«, sagte sie. »Entdeckungsreisen von Venezianern in der Neuen Welt.« Sie blätterte die Liste durch. »Zunächst jedenfalls. Nach zwei Wochen ließ er sich Bücher geben, die nicht von Venezianern stammten, und dann…« Sie warf einen Blick auf das letzte Blatt in ihrer Hand. »Dann verlangte er Bücher zur Naturgeschichte.« Sie wandte sich wieder Brunetti zu. »Sind alle hier aufgeführt.«
»Was hatten diese Bücher gemeinsam?«, fragte Brunetti.
»Illustrationen«, sagte sie und bestätigte damit Brunettis Vermutung. »Karten, Zeichnungen von exotischen Pflanzen und Tieren, angefertigt von den Entdeckern und den Künstlern, die sie begleiteten. Viele handkoloriert.« Plötzlich schlug die Dottoressa eine Hand vor den Mund und erstarrte mit zusammengekniffenen Augen.
»Was ist passiert?«, fragte Brunetti.
»Die Merian«, lautete ihre verwirrende Antwort. Sie stand so stocksteif da, dass Brunetti schon fürchtete, sie hätte einen Anfall erlitten. Da entspannte sie sich: Ihre Hand sank nach unten, und sie schlug die Augen wieder auf.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
Sie nickte.
»Was ist passiert?«, fragte Brunetti und kam aus Vorsicht nicht näher.
»Ein Buch.«
[30]»Was denn für eins?«
»Ein Buch mit Zeichnungen von Sybilla Merian«, sagte sie, schon etwas ruhiger. »Wir besitzen ein Exemplar. Ich hatte befürchtet, er könnte es in die Finger bekommen haben, aber dann ist mir eingefallen, dass es an eine andere Bibliothek ausgeliehen ist.« Sie schloss die Augen und flüsterte: »Gott sei Dank.«
Brunetti wagte erst nach geraumer Zeit zu fragen: »Haben Sie seine Unterlagen bereitgelegt?«
»Ja«, antwortete sie lächelnd, als wäre sie froh über den Themawechsel. »In meinem Büro. Das Empfehlungsschreiben seiner Universität; darin wird der Gegenstand seiner Forschungen erklärt. Und die Kopie seines Reisepasses.« Wieder bedeutete sie ihm, ihr zu folgen.
Die Dottoressa öffnete die Tür mit einer Sensorkarte, die sie an einem langen Band um den Hals trug. Brunetti folgte ihr und schloss die Tür hinter sich. Sie führte ihn durch einen langen, nur von künstlichem Licht beleuchteten Gang.
Am Ende des Gangs benutzte sie wieder ihren Kartenschlüssel, und sie betraten einen riesigen Raum voller Regale, die so eng standen, dass man sich nur einzeln hindurchzwängen konnte. Hier drinnen war der Geruch noch ausgeprägter: Brunetti fragte sich, ob die Mitarbeiter irgendwann nichts mehr davon wahrnahmen. Gleich hinter der Tür nahm die Dottoressa ein Paar weiße Baumwollhandschuhe aus der Tasche. Sie zog sie an und sagte: »Ich hatte noch keine Zeit, die anderen Bücher zu prüfen, mit denen er sich beschäftigt hat, nur die von heute. Einige sind hier. Das können wir schnell noch nachholen.«
Sie warf einen Blick auf ihre Liste und ging zum dritten [31]Regal links, blieb, ohne groß auf die Rücken zu sehen, auf halbem Weg stehen, bückte sich und zog ganz unten eins heraus.
»Sie wissen von jedem Buch, wo es steht?«, fragte Brunetti vom Ende des Gangs.
Sie kam zurück und legte das Buch auf einen Tisch neben ihm. Dann zog sie eine Schublade auf, nahm ein Paar Baumwollhandschuhe heraus und gab sie ihm. »So ziemlich. Ich arbeite seit sieben Jahren hier.« Und mit einer ausladenden Geste: »Ich muss Hunderte von Kilometern in diesem Magazin zurückgelegt haben.«
Er dachte an einen uniformierten Polizisten aus seiner Zeit in Neapel, der einmal bemerkt hatte, er sei in seinen siebenundzwanzig Dienstjahren mindestens fünfzigtausend Kilometer zu Fuß gegangen, mehr als einmal um die Erde. Und da Brunetti das nicht glauben konnte, hatte der Kollege es ihm vorgerechnet: zehn Kilometer pro Arbeitstag, siebenundzwanzig Jahre lang. Brunetti versuchte, die Länge des Gangs abzuschätzen. Fünfzig Meter? Mehr?
Zwanzig Minuten lang folgte er ihr von einem Saal zum andern, der Stapel in seinen Armen wurde immer größer. Ihm fiel auf, dass der Geruch ihm nicht mehr so in die Nase stach. Zwischendurch machte die Dottoressa einmal halt, nahm ihm die Bücher ab und brachte sie zu dem Tisch. Sie wurde seine Ariadne, die ihn durch das Labyrinth der Bücher führte; ab und zu blieb sie stehen und reichte ihm das nächste. Bald wusste Brunetti kaum noch, wo er war: Orientieren konnte er sich nur an Fenstern, die auf die Giudecca hinausgingen; die anderen Fenster, dicht an den Nachbargebäuden, lieferten keine Anhaltspunkte.
[32]Noch zwei Bücher, und sie waren am Ende der Liste angelangt. »Am besten sehen wir uns das gleich hier an«, sagte sie und führte ihn zu dem Tisch zurück.
Nachdem sie ihm die Bücher aus den Armen genommen und abgelegt hatte, griff die Dottoressa nach dem obersten Buch vom ersten Stapel und schlug es auf. Über ihre Schulter sah Brunetti das Vorsatzblatt. Sie blätterte um, und er sah rechts das Titelblatt. Vom Frontispiz war nur noch die steife Innenkante übrig. Obwohl dieser schmale Streifen ganz und gar nicht wie eine Wunde aussah, ertappte Brunetti sich bei dem Gedanken, das Buch müsse gelitten haben.
Er hörte sie aufstöhnen. Sie klappte das Buch zu und besah sich den Buchblock von unten, sah nach Lücken in dem dicken Papier. Sie legte das Buch hin und begann, langsam zu blättern. Bald stieß sie auf den nächsten schmalen Rest einer herausgeschnittenen Seite, dann noch einen, und noch einen.