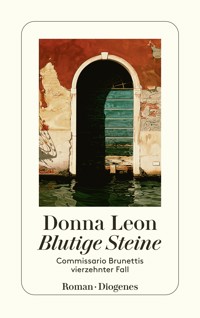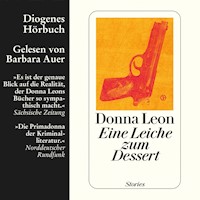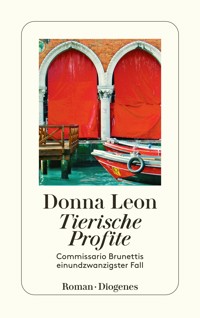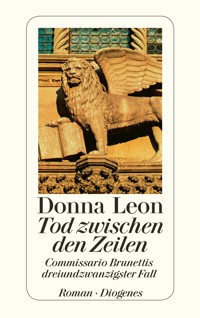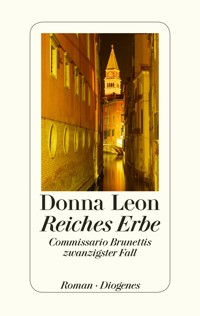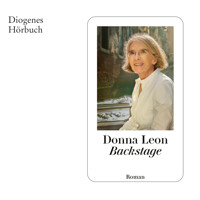10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Flavia Petrelli ist zurück in Venedig! In der Titelrolle von ›Tosca‹ tritt die Sopranistin im venezianischen Opernhaus La Fenice auf. Als eine junge Sängerin aus dem Kollegenkreis die Treppe einer Brücke hinuntergestoßen wird, beginnt Flavia um ihr eigenes Leben zu fürchten. Brunetti ermittelt in den Kulissen der Oper. Tod in Venedig, und das auf der Bühne: ein Buch, das Sehnsucht nach Venedig macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Donna Leon
Endlich mein
Commissario Brunettis vierundzwanzigster Fall
Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz
Diogenes
Für Ada Pesch
Le voci di virtù
Non cura amante cor, o pur non sente.
Die Stimme der Tugend
hilft dem verliebten Herz nicht,
oder es hört nicht auf sie.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, RODELINDA
1
Die Frau kniete über ihrem Geliebten, ihr Gesicht, ihr ganzer Körper versteinert vor Entsetzen, starrte sie auf das Blut an ihrer Hand. Er lag auf dem Rücken, einen Arm ausgestreckt, die Handfläche nach oben, als erflehe er etwas; vielleicht sein Leben. Sie hatte ihn an der Brust gepackt, um ihn aufzurütteln, wollte mit ihm fliehen, doch er hatte sich nicht gerührt, und dann hatte sie ihn geschüttelt, den alten Langschläfer, der nie aus den Federn zu kriegen war.
Doch da bemerkte sie das Blut und schlug unwillkürlich die Hand vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken, sie durfte kein Geräusch machen, die andern durften nicht wissen, dass sie hier war. Dann aber siegte das Grauen über ihre Vorsicht, und sie schrie seinen Namen, schrie und schrie, denn sie wusste, er war tot, das war das Ende; das blutige Ende.
Sie sah dorthin, wo ihre Hand gewesen war, und bemerkte die roten Stellen auf seiner Brust: Wie konnte so viel Blut aus ihnen strömen, sie waren doch so klein, so klein? Sie fuhr sich mit der anderen Hand über den Mund, und schon war auch diese rot vom Blut in ihrem Gesicht. In Panik, die Augen starr auf das Blut gerichtet, sagte sie seinen Namen. Es war aus, vorbei. Wieder sprach sie seinen Namen, lauter diesmal, aber er konnte sie nicht mehr hören, ihr nicht mehr antworten, niemandem mehr. Ohne zu überlegen, beugte sie sich über ihn, wollte ihn küssen, packte ihn an den Schultern, wie um etwas Leben in ihn hineinzuschütteln, aber es gab kein Leben mehr, für sie beide nicht mehr.
Von links erscholl ein lauter Ruf vom Anführer der Bande, die ihn getötet hatte, und sie presste eine Hand gegen die Brust. Vor Angst versagte ihr die Stimme, sie konnte nur stöhnen, wie ein wundes Tier. Sie drehte sich um und sah die Bande, hörte ihr Gebrüll, verstand aber kein Wort davon: Sie empfand nichts als Entsetzen und plötzlich, da er nun tot war, auch Angst um sich selbst, Angst vor dem, was jene mit ihr vorhatten.
Sie stemmte sich hoch und wich zurück: nur ja kein Blick zurück. Er war tot, alles war dahin: jegliche Hoffnung, jegliche Zukunft, aus und vorbei.
Die Männer, vier von links, fünf weitere von rechts, erschienen auf dem staubigen Dach, wo der Mord stattgefunden hatte. Der Anführer brüllte etwas, das nicht mehr zu ihr vordrang, genauso wenig wie alles andere. Sie hatte nur noch das Bedürfnis zu fliehen, aber die Männer versperrten ihr von allen Seiten den Weg. Sie wandte sich um, aber da war nur die Brüstung, kein anderes Gebäude weit und breit: nichts, wo sie Zuflucht suchen, nichts, wo sie sich verstecken konnte.
Sie hatte die Wahl, doch im Grunde hatte sie keine Wahl: Der Tod war besser als alles, was hier geschehen war oder mit Sicherheit noch geschehen würde, sobald diese Männer sie in ihrer Gewalt hätten. Sie lief los, stolperte einmal, zweimal, erreichte die Brüstung, stieg mit verblüffender Anmut hinauf und sah nach den Männern, die auf sie zugerannt kamen. »O Scarpia, avanti a Dio«, rief sie und sprang.
Die Musik brauste noch einmal auf, gipfelte in ein paar Paukenschlägen, und dann war er vorbei, dieser raffiniert gemachte Reißer, es herrschte sekundenlang benommene Stille, während den Zuschauern aufging, was sie da soeben gehört und gesehen hatten. Seit den Zeiten der Callas – und das war ein halbes Jahrhundert her – hatte man eine solche Tosca nicht mehr erlebt. Tosca hatte den Polizeichef Scarpia wirklich getötet! Und ihr Geliebter war wirklich von diesen uniformierten Schuften erschossen worden! Und sie war wirklich in den Tiber gesprungen. Bei Gott, was für eine Schauspielerin, und vor allem, was für eine Sängerin! Alles vollkommen real: der Mord, die Scheinhinrichtung, die sich als echt erwies, und schließlich ihr Sprung, als sie alles verloren hatte und ihr keine Hoffnung mehr blieb. Ein Melodram jenseits aller Glaubwürdigkeit – aber warum klatscht sich das Publikum die Hände wund und schreit sich die Seele aus dem Leib?
Der Vorhang teilte sich langsam in der Mitte, und Flavia Petrelli glitt durch die Öffnung. Sie trug Rot, ein leuchtendes Rot, und ein Diadem, das ihren Sturz in den Fluss unversehrt überstanden hatte. Ihr Blick schweifte über das Publikum, und ein Ausdruck freudiger Verblüffung erhellte ihr Gesicht. Für mich? All dieser Aufruhr für mich? Ihr Lächeln wurde breiter, sie hob eine Hand – wie durch Zauber frei von Blut oder dem, was man stattdessen verwendet hatte – und presste sie gegen ihr Herz, als müsse sie es mit Gewalt daran hindern, ihr angesichts all dieses Jubels die Brust zu sprengen.
Sie nahm die Hand vom Herz, streckte erst einen Arm aus, dann beide, als wolle sie die Anwesenden umarmen, worauf der Beifall gegen ihren ganzen Körper brandete. Dann nahm sie beide Hände vor die Brust und machte eine Bewegung nach vorn, halb Verbeugung, halb Kniefall. Der Applaus steigerte sich, und Stimmen, männliche und weibliche, riefen »Brava« oder, wer blind oder kein Italiener war, »Bravo«. Was ihr nichts auszumachen schien, solange sie nur riefen. Noch eine Verbeugung, dann hielt sie ihr Gesicht dem prasselnden Beifall entgegen wie einem warmen Regenguss.
Da fiel die erste Rose, langstielig und goldgelb wie die Sonne, vor ihr nieder. Unwillkürlich zog sie den Fuß zurück, als fürchte sie, die Rose zu verletzen – oder sich an ihr –, und dann bückte sie sich so langsam, dass die Bewegung wie einstudiert wirkte, und hob sie auf. Sie hielt die Rose mit gekreuzten Händen über ihrer Brust. Ihr Lächeln war kurz erstarrt, als die Rose ihr vor die Füße fiel – »Die ist für mich? Für mich?« –, doch das Gesicht, das sie den oberen Rängen zeigte, strahlte vor Freude.
Wie von ihrem Strahlen ermutigt, kamen jetzt weitere Rosen geflogen: erst zwei, dann drei, einzeln von der rechten Seite, und dann immer mehr und mehr, bis Dutzende ihr zu Füßen lagen, so wie der Scheiterhaufen, der Jeanne d’Arc bis zu den Knöcheln, ja noch höher gereicht hatte.
Flavia lächelte in den donnernden Applaus, verbeugte sich abermals, machte ein paar Schritte zurück und schlüpfte durch den Vorhang. Sekunden später erschien sie wieder, mit ihrem wiederauferstandenen Geliebten an der Hand. Bei seinem Anblick schwoll der Beifall an wie vorher das Gebrüll von Scarpias Schergen und strebte jener Raserei entgegen, wie sie häufig nach dem Auftritt eines gutaussehenden jungen Tenors zu hören ist, der alle hohen Töne beherrscht und gerne damit angibt. Die beiden sahen nervös zu Boden, wie um den Rosen auszuweichen, dann gaben sie es auf und zertrampelten den Blumenteppich.
Als eine Nuance im Applaus Flavia zu erkennen gab, dass der Beifall nun dem Tenor galt, trat sie einen Schritt zurück und klatschte ihm mit hocherhobenen Händen zu. Genau in dem Moment, als der Applaus nachzulassen begann, stellte sie sich wieder neben ihn, hakte sich unter, lehnte sich zu ihm hinüber und küsste ihn auf die Wange, ein kameradschaftliches Küsschen, wie man es einem Bruder oder einem guten Kollegen gibt. Darauf fasste er ihre Hand und riss sie zusammen mit seiner eigenen in die Höhe, als verkünde er den Gewinner eines Wettbewerbs.
Der Tenor zertrat noch mehr Rosen, als er Flavia den Vortritt ließ, die ihm voran durch den Vorhang verschwand. Kurz darauf kam der wiederauferstandene Scarpia in seiner noch blutgetränkten Brokatjacke heraus und trat, am Rand des Rosenteppichs entlang, an die Rampe. Er verbeugte sich, einmal, zweimal, kreuzte zum Zeichen seiner Dankbarkeit die Hände vor der blutigen Brust, kehrte zu der Öffnung im Vorhang zurück, griff hinein und zog Flavia hervor, die wiederum den jungen Tenor an der Hand hatte. Scarpia führte die Polonaise dreier Lebender an den vorderen Bühnenrand und zertrampelte dabei Blüten, die der Saum von Flavias Kleid beiseitefegte. Vereint hoben sie die Hände, verbeugten sich und strahlten vor Freude über die Anerkennung des Publikums dankbar um die Wette.
Flavia löste sich von den beiden Männern, schlüpfte durch den Vorhang und erschien gleich darauf Hand in Hand mit dem Dirigenten. Er war der Jüngste auf der Bühne, stand jedoch den älteren Kollegen an Selbstbewusstsein in nichts nach. Er schritt nach vorn, ohne die Rosen auch nur eines Blickes zu würdigen, und schaute in den Saal. Nach einer lächelnden Verbeugung bedeutete er den Orchestermusikern mit einem Wink, sich zu erheben und ihren Teil des Beifalls entgegenzunehmen. Nach einer weiteren Verbeugung reihte der Dirigent sich zwischen Flavia und dem Tenor ein. Die vier traten vor und verbeugten sich mehrmals, immer noch freudig erregt. Genau in dem Moment, als der Beifall abzuebben begann, winkte Flavia wie zum Abschied vor einer Zug- oder Schiffsreise noch einmal fröhlich ins Publikum, dann führte sie ihre männlichen Kollegen hinter den Vorhang. Der Applaus flaute ab und legte, da die Sänger verschwunden blieben, sich schließlich ganz, bis ein Mann aus dem ersten Rang mit lauter Stimme »Evviva Flavia« rief, was noch einmal wildes Klatschen aufbranden ließ. Danach Stille und nur noch das leise Gemurmel der Zuschauer, die zu den Ausgängen drängten.
2
Hinter dem Vorhang war Schluss mit der Schauspielerei. Flavia entfernte sich grußlos von den drei Männern und eilte zu ihrer Garderobe. Der Tenor sah ihr nach und machte ein Gesicht wie Cavaradossi, als der an ihre »dolci baci, o languide carezze« dachte, auf die verzichten zu müssen schlimmer wäre als der Tod. Scarpia zückte sein telefonino und teilte seiner Frau mit, er sei in zwanzig Minuten im Restaurant. Der Dirigent, den an Flavia nur interessierte, dass sie seinen tempi folgte und ordentlich sang, nickte den Kollegen stumm zu und machte sich auf den Weg zu seiner Garderobe.
Auf dem Korridor blieb Flavia mit dem Absatz im Saum ihres tiefroten Gewandes hängen, geriet ins Stolpern und stürzte nur deswegen nicht, weil sie sich gerade noch an einer Kostümassistentin festhalten konnte. Die junge Frau erwies sich als überraschend kräftig und geistesgegenwärtig: Sie umschlang die Sängerin mit beiden Armen und fing so ihr Gewicht und die Wucht auf, ohne dass sie beide zu Boden gingen.
Sowie Flavia wieder sicher stand, löste sie sich aus der Umarmung der Jüngeren und fragte: »Sie haben sich doch nichts getan?«
»Nichts passiert, Signora«, sagte die Assistentin und rieb sich die Schulter.
Flavia legte ihr eine Hand auf den Unterarm. »Danke, das war Rettung in höchster Not.«
»Ich habe gar nicht nachgedacht, ich habe einfach zugepackt. Ein Sturz reicht für heute, finden Sie nicht?«
Flavia nickte, bedankte sich noch einmal und ging weiter zu ihrer Garderobe. Sie wollte schon die Tür öffnen, doch da erfasste sie ein Zittern, das sie innehalten ließ, von dem knapp verhinderten Sturz, aber auch all dem Adrenalin, mit dem eine Aufführung ihren Körper überflutete. Benommen stützte sie sich mit einer Hand am Türpfosten ab und schloss sekundenlang die Augen. Erst als am Ende des Korridors Stimmen ertönten, riss sie sich zusammen, öffnete die Tür und ging hinein.
Rosen hier, Rosen da, Rosen, Rosen überall. Es verschlug ihr den Atem, der ganze Raum war vollgestellt mit Vasen, deren jede Dutzende von Rosen enthielt. Sie schloss die Tür hinter sich. Regungslos musterte sie das gelbe Blütenmeer, und ihr Unbehagen wuchs noch, als sie bemerkte, dass es sich bei den Vasen nicht um die üblichen billigen Dinger handelte, wie sie die meisten Theater für alle Fälle in Reserve haben: angeschlagen oder mit Farbe beschmiert, und deshalb aus der Requisite aussortiert.
»Oddio«, flüsterte sie und wich durch die Tür zurück, die sich soeben für die Garderobiere geöffnet hatte. Die dunkelhaarige Frau war alt genug, dass sie die Mutter der Kostümassistentin hätte sein können, die Flavia eben vor dem Sturz bewahrt hatte. Wie nach jeder Vorstellung wollte sie Flavias Kostüm und Perücke abholen und in den Fundus zurückbringen.
Flavia trat zur Seite und fragte mit einer Handbewegung, die das Zimmer umfasste: »Marina, haben Sie gesehen, wer diese Blumen gebracht hat?«
»O, che belle«, rief Marina. »Was die gekostet haben müssen! Das sind ja Hunderte!« Und dann fielen auch ihr die Vasen auf. »Wo kommen die denn her?«, fragte sie.
»Gehören die nicht dem Theater?«
Marina schüttelte den Kopf. »Nein. So etwas haben wir nicht. Die hier sind echt.« Als Flavia verwirrt dreinsah, zeigte Marina auf eine große Vase, auf der sich weiße und durchsichtige Streifen abwechselten. »Aus Glas, meine ich. Die ist von Venini«, erklärte sie. »Lucio hat dort gearbeitet, daher weiß ich das.«
Flavia, die sich nur wundern konnte, wie das Gespräch sich entwickelte, wandte der Frau den Rücken zu und bat: »Können Sie mir den Reißverschluss öffnen?«
Sie hob die Arme, und Marina half ihr aus Schuhen und Kostüm. In ihrem Morgenmantel setzte Flavia sich vor den Spiegel und begann sich abzuschminken. Marina hängte das Kleid an die Tür, trat hinter Flavia und half ihr beim Abnehmen der Perücke, indem sie mit den Fingern von hinten unter die Perücke fuhr und sie hochhob. Nachdem das geschafft war, schälte sie ihr die engsitzende Gummikappe von den Haaren. Endlich! Flavia seufzte erleichtert auf und massierte sich eine volle Minute lang mit beiden Händen die Kopfhaut.
»Alle sagen, das ist das Schlimmste«, meinte Marina. »Die Perücke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie alle das aushalten.«
Flavia spreizte die Finger und fuhr sich mehrmals durchs Haar; in dem überheizten Raum würde es schnell trocknen. Es war kurz wie das eines Jungen, einer der Gründe, warum sie auf der Straße so selten erkannt wurde, denn ihre Fans hatten natürlich immer die langhaarige Schönheit auf der Bühne vor Augen, nicht diese Frau mit kurzem Lockenschopf, die bereits einzelne graue Haare hatte. Sie rubbelte fester und stellte erleichtert fest, dass ihre Frisur schon fast trocken war.
Das Telefon klingelte; zögernd meldete sie sich mit ihrem Namen.
»Signora, können Sie mir sagen, wie lange Sie noch brauchen?«, fragte eine Männerstimme.
»Fünf Minuten«, antwortete sie wie immer, ganz gleich, ob sie tatsächlich nur noch fünf Minuten brauchte oder eine halbe Stunde. Die anderen würden warten.
»Dario«, sagte sie, bevor er auflegen konnte. »Wer hat diese Blumen gebracht?«
»Die wurden mit einem Boot angeliefert.«
Was in Venedig ja wohl auch kaum anders möglich war, doch sie fragte nur: »Wissen Sie, wer sie geschickt hat? Wessen Boot das war?«
»Keine Ahnung, Signora. Zwei Männer haben alles hier vor die Tür gestellt.« Dann fiel ihm noch ein: »Das Boot habe ich nicht gesehen.«
»Haben sie einen Namen genannt?«
»Nein, Signora. Ich dachte … na ja, ich dachte, bei so vielen Blumen werden Sie schon wissen, von wem sie kommen.«
Flavia ignorierte das. »Fünf Minuten«, wiederholte sie und legte auf. Marina war mit Kleid und Perücke verschwunden, Flavia blieb allein in der stillen Garderobe zurück.
Sie starrte in den Spiegel, nahm eine Handvoll Papiertücher und reinigte ihr Gesicht, bis der größte Teil der Schminke entfernt war. Am Ausgang würden womöglich Fans auf sie warten, also legte sie Mascara auf, überdeckte die Spuren von Müdigkeit um ihre Augen mit etwas Make-up und schminkte sich sorgfältig die Lippen. Völlig erschöpft schloss sie die Augen und hoffte, das Adrenalin werde sie schon wieder munter machen. Schließlich schlug sie die Augen wieder auf und besah sich die Gegenstände auf dem Tisch, dann zog sie ihre Umhängetasche aus der Schublade und fegte alles hinein – Make-up, Kamm, Bürste, Taschentuch. Irgendwelche wertvollen Dinge nahm sie schon seit langem nicht mehr ins Theater mit. In Covent Garden hatte man ihren Mantel gestohlen; im Palais Garnier ihr Adressbuch, sonst nichts, alles andere hatte der Dieb in ihrer Handtasche gelassen. Wer um Himmels willen konnte etwas mit ihrem Adressbuch anfangen? Sie hatte es seit Ewigkeiten, kein Mensch war imstande, das Chaos von durchgestrichenen Namen und Anschriften mit den dazwischengequetschten neuen E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu entziffern – ihre einzige Verbindung zu den ständig auf der ganzen Welt umherreisenden Kollegen in diesem seltsamen Beruf. Zum Glück hatte sie die meisten Angaben auch in ihrem Computer, aber es dauerte Wochen, bis sie die fehlenden halbwegs wieder beisammenhatte. Und da sie kein neues Adressbuch fand, das ihr gefiel, beschloss sie, ganz auf ihren Computer zu vertrauen, und konnte nur beten, dass kein Virus oder Absturz ihr alles auf einen Schlag nehmen würde.
Die heutige Vorstellung war erst die dritte ihres Gastspiels, also warteten draußen bestimmt noch Fans. Sie zog eine schwarze Strumpfhose an, darüber den Rock und den Pullover, in denen sie gekommen war. Sie schlüpfte in ihre Schuhe, nahm den Mantel aus dem Schrank und schlang sich einen Wollschal – rot wie ihr Bühnenkostüm – um den Hals. Ein Schal war für Flavia so etwas wie ein Hidschab: Ohne ging sie nicht aus dem Haus.
An der Tür blieb sie stehen und sah sich noch einmal um: War dies die Wirklichkeit, als die sich der Traum vom Erfolg entpuppte? Eine kleine, unpersönliche Kammer, die nacheinander von verschiedenen Leuten benutzt wurde? Ein Schrank; ein von Glühbirnen umrahmter Spiegel, genau wie im Kino; kein Teppich; ein winziges Bad mit Dusche und Waschbecken. Sonst nicht viel: Und das machte einen zum Star? Sie hatte es, also musste sie ein Star sein. Aber sie fühlte sich nicht so, nur – sie sah dieser Tatsache bewusst ins Gesicht – wie eine Frau in den Vierzigern, die gut zwei Stunden lang geschuftet hatte wie ein Tier und jetzt hinausgehen und irgendwelchen namenlosen Leuten zulächeln musste, die sich nach ihr sehnten, die ihr Freund, ihr Vertrauter oder womöglich gar ihr Geliebter sein wollten.
Sie selbst wollte nur ins nächstbeste Restaurant, etwas essen und trinken, dann nach Hause, ihre beiden Kinder anrufen, hören, wie es ihnen ging, und ihnen gute Nacht sagen. Schließlich, wenn das Adrenalin sich verflüchtigte, wieder ein wenig Normalität eintrat, zu Bett gehen und hoffentlich etwas Schlaf finden. Bei Inszenierungen, an denen ihr bekannte oder befreundete Kollegen mitwirkten, freute sie sich immer auf die gesellige Runde beim gemeinsamen Essen nach der Vorstellung, die Scherze und Anekdoten über Agenten, Intendanten und Regisseure, das Zusammensein mit Menschen, mit denen sie das Wunder des Musizierens erlebt hatte. Aber hier in Venedig, einer Stadt, in der sie viel Zeit verbracht hatte und eine Menge Leute kannte, scheute sie den Kontakt zu ihren Kollegen: einem Bariton, der nur von seinen Erfolgen sprach, einem Dirigenten, der sein Desinteresse kaum verhehlen konnte, und einem Tenor, der sich offenbar Hoffnungen machte – ganz gewiss ohne ihr Zutun, dachte sie und sah sich dabei fest in die Augen. Schließlich war er gerade mal zehn Jahre älter als ihr Sohn und viel zu naiv, um für sie in Frage zu kommen.
Während sie noch da stand, fiel ihr auf, dass sie die Blumen erfolgreich verdrängt hatte. Und die Vasen. Für den Fall, dass der Mann, der das alles geschickt hatte, am Ausgang wartete, sollte sie sich beim Verlassen des Theaters eigentlich mit wenigstens einem der Sträuße blicken lassen. »Zum Teufel mit ihm«, sagte sie zu der Frau im Spiegel, die ihr mit weisem Nicken zustimmte.
Begonnen hatte es vor zwei Monaten in London, nach der letzten Vorstellung der Hochzeit des Figaro, als ihr beim ersten Vorhang und dann bei allen weiteren gelbe Rosen vor die Füße regneten. Kurz darauf, bei einem Soloauftritt in St. Petersburg, kamen sie zusammen mit einer Menge konventionellerer Sträuße. Sie war gerührt gewesen, als etliche Russen, hauptsächlich Frauen, nach der Vorstellung zur Bühne drängten und ihr die Sträuße heraufreichten. Flavia sah gern die Augen der Leute, die ihr Blumen schenkten oder Komplimente machten: Das war irgendwie menschlicher.
Und hier ging es weiter, schon bei der Premiere, Dutzende Rosen, die wie ein gelber Regen auf die Bühne niedergingen, aber noch keine nach der Vorstellung in ihrer Garderobe. Und dann das heute Abend. Kein Name, kein Hinweis, keine Karte, die eine so übertriebene Geste erklärte.
Sie zögerte, sie wollte jetzt nicht entscheiden, was mit den Blumen zu tun sei, sie hatte auch keine Lust, Programmhefte zu signieren und mit Fremden oder, was manchmal noch schlimmer war, mit gewissen Fans zu plaudern, die immer wieder zu ihren Vorstellungen kamen und sich einbildeten, das allein berechtige sie zu plumpen Vertraulichkeiten.
Sie hängte die Baumwolltasche über ihre Schulter und fuhr sich noch einmal durchs Haar; es war trocken. Dann brach sie auf, und als sie am Ende des Korridors die Garderobiere sah, rief sie nach ihr.
»Sì, Signora«, antwortete die Frau und kam auf sie zu.
»Marina, Sie können die Rosen gern mit nach Hause nehmen, wenn Sie wollen. Sie und Ihre Kolleginnen, alle, die sie haben möchten.«
Zu Flavias Überraschung antwortete Marina nicht sofort. Wie oft bekamen Frauen Dutzende Rosen geschenkt? Dann aber strahlte Marinas Miene in heller Freude auf. »Das ist sehr nett von Ihnen, Signora, aber möchten Sie nicht auch welche mitnehmen?« Sie zeigte in den Raum, der von den Rosen geradezu erleuchtet wurde.
Flavia schüttelte eilig den Kopf. »Nein, Sie können sie alle haben.«
»Aber Ihre Vasen?«, fragte Marina. »Denken Sie, die sind hier sicher?«
»Das sind nicht meine. Die können Sie auch mitnehmen, wenn Sie wollen«, sagte Flavia, tätschelte Marinas Arm und fügte freundlich hinzu: »Sie nehmen die Venini, ja?« Und damit ging sie zum Aufzug, der sie zu den wartenden Fans bringen würde.
3
Flavia wusste, sie hatte sehr lange zum Umkleiden gebraucht, und hoffte, wenigstens einige von den Leuten, die warteten, hätten mittlerweile aufgegeben und seien entmutigt nach Hause gegangen. Sie war müde und hungrig: Nach fünf Stunden in einem vollen Theater, bedrängt von allen Seiten, hinter, auf und vor der Bühne, ersehnte sie ein ruhiges Plätzchen, wo sie ungestört essen konnte.
Im Erdgeschoss angekommen, ging sie den langen Flur zur Pförtnerloge hinunter, vor der die Besucher warteten. Sie begannen schon zu klatschen, als Flavia noch zehn Meter von ihnen entfernt war, und Flavia setzte ihr strahlendstes, nur für ihre Fans bestimmtes Lächeln auf. Jetzt war sie froh, dass sie die Spuren der Erschöpfung so gut es ging übermalt hatte. Sie beschleunigte ihren Schritt, ganz die Sängerin, die freudig ihren Fans entgegeneilt, um mit ihnen zu plaudern, Autogramme zu geben und ihnen für ihre Geduld zu danken.
Zu Beginn ihrer Karriere hatten Flavia diese Begegnungen immer in Hochstimmung versetzt: Die Leute warteten, weil ihnen so viel an ihr lag, sie wollten ihre Anerkennung, ihre Aufmerksamkeit, irgendein Zeichen, dass ihr Zuspruch Flavia etwas bedeutete. So war es damals, so war es jetzt. Flavia war ehrlich genug, sich einzugestehen, dass sie diesen Zuspruch immer noch brauchte. Wenn sie es nur ein wenig schneller erledigen könnten: einfach sagen, wie sehr ihnen die Oper oder ihr Gesang gefallen habe, ihr die Hand geben und gehen.
Zwei erkannte sie schon von weitem, ein Ehepaar – alt und geschrumpft seit ihrer ersten Begegnung vor mehreren Jahren. Sie lebten in Mailand, kamen zu vielen von Flavias Vorstellungen und schauten hinterher kurz vorbei, um ihr die Hand zu geben und sich zu bedanken. Sie hatte sie all die Jahre gesehen, wusste aber immer noch nicht den Namen. Hinter ihnen stand noch ein Paar, jünger und weniger bereit, nur kurz danke zu sagen. Bernardo, der mit dem Bart – daran erinnerte sie sich, weil beides mit B anfing –, begann jedes Mal mit Lob für eine bestimmte Stelle oder auch nur einen einzelnen Ton, offenkundig zum Beweis, dass er von Musik genauso viel verstand wie sie. Der andere, Gilberto, stand daneben und fotografierte, während sie das Programmheft signierte, gab ihr die Hand und bedankte sich pauschal, nachdem Bernardo sich um die Details gekümmert hatte.
Nächster in der Reihe war ein großer Mann mit einem leichten Mantel über den Schultern. Flavia bemerkte den Samtkragen und versuchte sich zu erinnern, wann sie so etwas das letzte Mal gesehen hatte, wohl eher nach einer Premiere oder einem Galakonzert. Sein weißes Haar bildete einen starken Kontrast zu den gebräunten Zügen. Er küsste ihr die Hand, sagte, vor einem halben Jahrhundert habe er in Covent Garden die Callas in dieser Rolle gehört, und dankte ihr, ohne sie durch irgendwelche Vergleiche in Verlegenheit zu bringen, ein Zartgefühl, das sie zu schätzen wusste.
Dann eine junge Frau mit zartem Gesicht, braunen Haaren und schlechtgewähltem Lippenstift, der so gar nicht zu ihrem blassen Teint passen wollte. Vermutlich eigens für die Begegnung mit mir aufgelegt, dachte Flavia. Sie gab ihr die Hand und versuchte mit einem Blick über deren Schulter unauffällig herauszufinden, wie viele Leute noch hinter ihr warteten. Als die junge Frau – sie konnte nicht viel älter als zwanzig sein – von der Oper zu schwärmen begann, staunte Flavia über ihre Stimme, die schönste Sprechstimme, die sie je gehört hatte. Ein tiefer, samtener, warmer Alt, der so gar nicht zu ihrem offenbar noch sehr jungen Alter passen wollte. Flavia lauschte elektrisiert, als würde ihr Gesicht von einem Kaschmirschal gestreichelt. Oder von einer Hand.
»Sind Sie Sängerin?«, fragte Flavia unwillkürlich.
»Gesangsschülerin, Signora«, sagte die andere, und die schlichte Antwort traf Flavia im Innersten wie der tiefste Ton eines Cellos.
»Wo?«
»Am Pariser Konservatorium, Signora. Ich bin im letzten Jahr.« Flavia entging nicht, dass die junge Frau vor Nervosität schwitzte, aber ihre volltönende Stimme schwankte so wenig wie ein Schlachtschiff bei stiller See. Während sie sich weiter unterhielten, begann Flavia die zunehmende Unruhe im Rest der Schlange zu spüren.
»Also dann, alles Gute«, sagte Flavia und gab ihrem Gegenüber noch einmal die Hand. Wenn sie mit dieser Stimme auch sang – was nicht so oft vorkam –, stünde in wenigen Jahren sie hier an ihrer Stelle; dann wäre sie es, die ihren dankbaren Fans Freundlichkeiten sagte und mit den Kollegen essen ging, statt verschüchtert vor ihr zu stehen.
Tapfer machte Flavia weiter, schüttelte Hände, lächelte, plauderte, dankte für anerkennende und wohlwollende Worte und das lange Warten. Wenn sie Programmhefte und CDs signierte, erkundigte sie sich jedes Mal nach dem Namen der Leute, denen die Widmung gelten sollte. Ungeduld oder mangelnde Bereitschaft, sich die Geschichten ihrer Fans anzuhören, war ihr nicht anzumerken. Es war, als stünde ihr »Sprecht mit mir« auf die Stirn geschrieben, so sehr glaubten die Leute daran, dass Flavia an ihren Lippen hing. Allein durch ihr Können als Sängerin verdiente sie das Vertrauen und die Zuneigung dieser Menschen. Und, dachte sie, ihr Können als Schauspielerin. Jetzt fielen ihr die Augen zu, und sie strich sich mit den Fingern darüber, als sei ihr etwas hineingeflogen. Sie blinzelte ein paarmal und strahlte in die Runde.
Im Hintergrund der noch Herumstehenden bemerkte sie einen dunkelhaarigen Mann mittleren Alters, der mit gesenktem Kopf einer Frau neben ihm zuhörte. Die Frau war interessanter: naturblond, kräftige Nase, helle Augen, wahrscheinlich älter, als sie aussah. Sie lächelte über irgendeine Bemerkung des Mannes, stupste ihn mit dem Kopf mehrmals an der Schulter, trat dann zurück und sah zu ihm auf. Der Mann legte einen Arm um sie und zog sie an sich, bevor er sich reckte und nachsah, was sich vorne an der Schlange abspielte.
Jetzt erkannte sie ihn, obwohl es Jahre her war, dass sie ihn zuletzt gesehen hatte. Sein Haar hatte mittlerweile graue Strähnen, sein Gesicht war schmaler geworden, und vom linken Mundwinkel bis zum Kinn hinunter zog sich eine Falte, die dort früher nicht gewesen war.
»Signora Petrelli«, sagte ein junger Mann, der sich irgendwie ihrer Hand bemächtigt hatte. »Ich kann Ihnen nur sagen, es war wunderbar. Heute war ich zum ersten Mal in der Oper.« Errötete er? Das Geständnis musste ihm doch schwerfallen.
Sie erwiderte seinen Händedruck. »Schön«, sagte sie. »Tosca ist ein sehr guter Anfang.« Er nickte, seine Augen leuchteten vor Begeisterung. »Ich hoffe, es hat Ihnen Lust auf mehr gemacht«, fügte Flavia hinzu.
»O ja. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr das …« Er zuckte die Schultern über sein Unvermögen, sich genauer auszudrücken, und als er noch einmal ihre Hand nahm, fürchtete sie schon fast, er werde sie an seinen Mund ziehen und küssen. Aber er ließ wieder los, sagte nur »Danke« und ging.
Nach vier weiteren Fans kamen der Mann und die blonde Frau an die Reihe. Er gab Flavia die Hand und sagte: »Flavia, ich habe dir ja gesagt, dass meine Frau und ich dich gerne einmal singen hören würden.« Sein Lächeln vertiefte die Falten in seinem Gesicht. »Das Warten hat sich gelohnt.«
»Und ich habe dir gesagt«, ging Flavia über das Kompliment hinweg, »dass ich dich und deine Frau gern zu einer Vorstellung einladen würde.« Sie reichte seiner Begleiterin die Hand und sagte: »Sie hätten mich anrufen sollen. Ich hätte Ihnen Karten besorgt. Wie versprochen.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen«, sagte die Frau. »Aber mein Vater hat ein abbonamento, er hat uns die Karten überlassen.« Als wolle sie den Eindruck verscheuchen, sie seien vielleicht nur da, weil ihre Eltern keine Lust gehabt hatten, erklärte sie: »Wir wären auch so gekommen, aber meine Eltern haben zu tun.«
Flavia nickte. Außer den beiden war niemand mehr da. Wie sollte der Abend jetzt weitergehen? Sie hatte allen Grund, diesem Mann dankbar zu sein, seitdem er sie vor Schlimmem bewahrt hatte … vor was im Einzelnen, wusste sie selbst nicht, weil seine Hilfe so schnell und so umfassend gewesen war. Zweimal hatte er sie gerettet, nicht nur einmal, und beim zweiten Mal hatte er auch den Menschen gerettet, der ihr damals am meisten bedeutet hatte. Danach hatte sie ihn noch einmal zum Kaffee getroffen, und dann war er verschwunden; beziehungsweise sie hatte es anderswohin verschlagen im Zuge ihrer kometenhaften Karriere, mit Engagements in anderen Städten und an anderen Theatern, fern dieser Provinzstadt und dieses sehr provinziellen Theaters. Ihr Lebensradius, ihr Horizont, ihr Talent – alles war weitreichender geworden, und sie hatte seit Jahren nicht mehr an ihn gedacht.
»Es war hinreißend«, sagte die Frau. »Eigentlich mag ich diese Oper nicht so sehr, aber heute kam sie mir ganz wirklich vor, sehr bewegend. Jetzt verstehe ich, warum sich so viele Leute dafür begeistern.« An ihren Mann gewandt, meinte sie: »Obwohl der Polizist ja nicht sehr gut wegkommt, oder?«
»Ein typischer Arbeitstag, meine Liebe, mit allem, was wir so gut können«, erwiderte jener freundlich. »Sexuelle Nötigung, versuchte Vergewaltigung, Mord, Amtsmissbrauch.« Und zu Flavia: »Ich habe mich wie zu Hause gefühlt.«
Sie lachte laut auf und erinnerte sich, dass er ein Mann war, der sich selbst nicht zu wichtig nahm. Sollte sie die beiden zum Essen einladen? Sie wären bestimmt eine angenehme Gesellschaft, aber im Grunde wollte sie jetzt gar keine Gesellschaft, nicht nach der Vorstellung und dem Anblick der vielen Blumen.
Er bemerkte ihre Unentschlossenheit und nahm ihr die Entscheidung ab. »Und genau da müssen wir jetzt hin«, sagte er. »Nach Hause.« Dass er nicht drum herumredete, nahm sie dankbar zur Kenntnis.
Sie gerieten ins Stocken, und Flavia fiel nur noch ein: »Ich bin noch eine Woche hier. Vielleicht können wir uns auf einen Drink treffen?«
Die Frau überraschte sie mit der Frage: »Dürfen wir Sie für Sonntagabend zum Essen einladen?«
Flavia hatte mit den Jahren eine Verzögerungstaktik entwickelt und schützte gewöhnlich eine andere Einladung vor, wenn sie nicht sicher war, ob sie ein Angebot annehmen sollte, oder noch Zeit zum Überlegen brauchte. Jetzt aber dachte sie an die Rosen und dass sie ihm davon erzählen könnte. »Ja, gern«, sagte sie. Damit die beiden nicht auf die Idee kämen, sie fühle sich einsam und verlassen in dieser Stadt, fügte sie hinzu: »Morgen Abend habe ich zu tun – aber Sonntag passt mir sehr gut.«
»Hätten Sie etwas dagegen, uns bei meinen Eltern zu treffen? Nächste Woche«, erklärte die Frau, »fahren sie nach London, und das ist unsere einzige Chance, sie vor der Abreise noch einmal zu sehen.«
»Können Sie mich denn einfach so …?«, fing Flavia an. Sie siezte die Frau, während sie den Mann geduzt hatte.
»Einladen? Aber ja«, erklärte die Frau resolut. »Glauben Sie mir, die beiden würden sich sehr über Ihren Besuch freuen. Mein Vater schwärmt seit Jahren von Ihnen, und meine Mutter spricht heute noch von Ihrer Violetta.«
»Wenn das so ist«, sagte Flavia, »komme ich gern.«
»Wenn du jemanden mitbringen möchtest«, begann der Mann, brach dann aber ab.
»Sehr freundlich«, sagte sie höflich, »aber ich komme allein.«
»Aha«, sagte er, und ihr entging sein Tonfall nicht.
»Das Haus steht in Dorsoduro, nicht weit vom Campo San Barnaba«, erklärte seine Frau und ging nun ebenfalls dazu über, Flavia zu duzen: »Du nimmst die calle links von der Kirche, auf der anderen Seite des Kanals. Die letzte Tür links. Falier.«
»Um wie viel Uhr?«, fragte Flavia, die wusste, wo das war.
»Halb neun«, kam die Antwort, worauf der Mann sein telefonino hervorzog und sie die Nummern austauschten.
»Gut«, sagte Flavia, nachdem sie die Nummern der beiden eingegeben hatte, »danke für die Einladung.« Innerlich noch immer mit der Frage nach der Herkunft der Blumen beschäftigt, sagte sie: »Ich muss noch mit dem Pförtner sprechen.«
Flavia Petrelli gab ihnen die Hand und wandte sich der Pförtnerloge zu, während Paola Falier und Guido Brunetti nach Hause gingen.
4
Der Pförtner saß nicht am Platz, vielleicht machte ernoch eine Runde durchs Theater, oder aber er war schon nach Hause gegangen. Sie hätte ihn befragen wollen, wie genau die Rosen angeliefert worden waren und wie die Männer ausgesehen hatten. Und von welchem Blumenhändler sie kamen. Biancat, ihr Lieblingsladen, existierte nicht mehr: Das hatte sie am Tag nach ihrer Ankunft festgestellt, als sie Blumen für die Wohnung kaufen wollte und die üppige Blütenpracht des Floristen von chinesischen Handtaschen und Portemonnaies verdrängt sah. Die Farben im Schaufenster erinnerten Flavia an die billigen Süßigkeiten, die ihre Kinder so geliebt hatten, als sie ganz klein waren: quietschrot, giftgrün, alles sehr vulgär. Die Taschen waren aus einem Material gefertigt, das sich mit seinen grellen Farben vergeblich Mühe gab, irgendwie anders auszusehen als Plastik.
Ihre Fragen an den Pförtner konnten warten, entschied sie und verließ das Theater. Sie machte sich auf den Weg zu ihrer Wohnung in Dorsoduro bei der Accademia-Brücke, in einem piano nobile. Seit sie vor einem Monat hier angekommen war, hatten ihre venezianischen Kollegen von kaum etwas anderem gesprochen als vom Niedergang der Stadt, die langsam, aber sicher ein Disneyland an der Adria werde. Zur Mittagszeit quälte man sich im Zentrum durch Menschenmassen; die Vaporetti waren hoffnungslos überfüllt. Biancat hatte zugemacht: Aber was kümmerte sie das? Sie war zwar Norditalienerin, aber keine Venezianerin, und warum oder an wen die Venezianer ihr Kulturgut ausverkauften, ging sie nichts an. Stand in der Bibel nicht etwas von einem Mann, der sein Erstgeburtsrecht für – der Ausdruck hatte sie fasziniert, als sie ihn vor Jahrzehnten im Katechismusunterricht zum ersten Mal hörte – ein Linsengericht hergegeben hatte? Die Worte erinnerten sie daran, wie hungrig sie war.
Am Campo Santo Stefano kehrte sie bei Beccafico ein und verzehrte geistesabwesend eine Pasta; von ihrem Glas Teroldego trank sie nur die Hälfte: weniger, und sie würde nicht schlafen können, mehr, und sie würde ebenfalls nicht schlafen. Dann über die Brücke, nach links, über die Brücke bei San Vio und in die erste calle links, Schlüssel ins Schloss und in die riesige Eingangshalle des Palazzo.
Nicht vor Erschöpfung, eher aus Gewohnheit blieb Flavia am Fuß der Treppe stehen. Nach jedem Auftritt versuchte sie, falls der Zeitunterschied nicht dagegensprach, ihre beiden Kinder anzurufen, aber dazu musste sie erst die Vorstellung, die sie gerade gegeben hatte, in Gedanken noch einmal durchgehen. Sie rief sich den ersten Akt ins Gedächtnis und fand nicht viel daran auszusetzen. Ebenso der zweite. Im dritten war die Stimme des jungen Tenors ein wenig unsicher geworden, woran allerdings auch der Dirigent mit schuld war, der bestenfalls dessen hohe Töne gelten ließ und ansonsten keinen Hehl aus seiner schlechten Meinung von ihm machte. Sie selbst hatte gut gesungen. Nicht herausragend, aber gut. Im Grunde ihres Herzens mochte sie diese Oper nicht besonders, es gab nur wenige Stellen, wo sie glänzen konnte, aber sie hatte schon so oft mit dem Regisseur gearbeitet, dass er ihr freie Hand ließ und sie die effektvollen Momente zu ihrem Vorteil gestalten konnte.
Was den Bariton, der den Scarpia sang, anbelangte, war sie sich mit dem Regisseur einig, ließ sich ihre Meinung aber weniger anmerken. Der Regisseur hatte bestimmt, dass Tosca ihm das Messer in den Bauch, nicht in die Brust stoßen solle; und zwar mehrmals. Als der Bariton gegen einen so schmachvollen Tod Protest einlegte, erklärte der Regisseur, Toscas Brutalität müsse durch ebensolche Brutalität von Scarpias Seite in den ersten beiden Akten provoziert werden: Das biete dem Bariton Gelegenheit, schauspielerisch und stimmlich an die Grenzen zu gehen, dabei kämen seine darstellerischen Qualitäten deutlicher zum Tragen denn je.
Flavia sah die selbstgefällige Miene des Baritons aufleuchten, als ihm klar wurde, dass der Regisseur ihm die Möglichkeit gab, Tosca an die Wand zu spielen; sie hatte aber auch gesehen, wie der Regisseur ihr hinter Scarpias Rücken zuzwinkerte, als dieser sich einwickeln ließ. Sie hatte noch nicht viele Leute auf der Bühne getötet, aber ihn zu ermorden und die Vorfreude darauf, dies noch dreimal tun zu dürfen, kam ihr vor wie ein Geschenk des Himmels.
Beflügelt ging sie die Treppe hinauf; das Geländer verschmähte sie, vielmehr kostete sie die breiten Treppenstufen aus, die womöglich so angelegt waren, damit Frauen in Reifröcken bequem aneinander vorbei oder Arm in Arm hinauf- oder hinuntergehen konnten. Im ersten Stock angekommen, wandte sie sich nach rechts zu ihrer Wohnungstür.
Sie traute ihren Augen nicht. Vor der Tür lag der größte Blumenstrauß, den sie jemals gesehen hatte: gelbe Rosen – wie konnte es anders sein? –, fünf, sechs Dutzend, zusammengesteckt zu einem riesigen leuchtenden Klumpen, wobei Flavia keinerlei Freude angesichts von so viel Schönheit empfand, sondern fast schon so etwas wie nacktes Entsetzen.
Sie sah auf die Uhr: nach Mitternacht. Sie lebte allein in der Wohnung; wer auch immer die Blumen gebracht hatte, musste unten durch die Tür gekommen sein. Womöglich war er noch da. Sie atmete mehrmals tief durch, bis ihr Herz wieder im normalen Rhythmus schlug.
Dann nahm sie ihr telefonino und wählte die Nummer des Freundes, der ihr die Wohnung überlassen hatte. Er wohnte ein Stockwerk höher, aber sie war geistesgegenwärtig genug zu bedenken, dass ein Anruf zu dieser Stunde weniger beunruhigend wäre als das Läuten der Türglocke.
»Pronto?«, meldete sich eine Männerstimme nach dem vierten Klingeln.
»Freddy?«, fragte sie.
»Ja. Bist du das, Flavia?«
»Ja.«
»Hast du dich ausgesperrt?«, fragte er freundlich, beinahe väterlich: keine Spur von Tadel.
»Bist du noch auf?«, antwortete sie mit einer Gegenfrage.
»Ja.«
»Kannst du mal runterkommen?«
Er zögerte kaum merklich. »Sicher. Eine Minute. Ich sage nur Silvana Bescheid.« Und schon hatte er aufgelegt.
Flavia wich an die Wand zurück, möglichst weit weg von der Tür und diesen Blumen. Zur Ablenkung überlegte sie, was diesem gewaltigen Strauß von der Größe her ähnlich wäre. Ein Hula-Hoop-Reifen? Nein, der wäre zu groß. Ein Strandball zu klein. Ein Autoreifen: Das kam ungefähr hin. Die Blumen waren zu einem pilzförmigen Bukett geballt, einem Pilz freilich, der unförmig wucherte wie von Atomstrahlen verseuchte Lebewesen in Horrorfilmen, Filme, für die sie früher gern ins Kino gegangen war und an die sie noch heute erheitert zurückdachte.
Von oben kein Geräusch. Was war bedrohlicher: dieser stille Strauß – Schönheit, die sich durch die Umstände in ihr Gegenteil verwandelt –, oder jene Atompilze? Albernheiten dieser Art ersparten ihr Grübeleien darüber, was die Rosen zu bedeuten haben könnten oder wie jemand überhaupt Zutritt zu dem Palazzo bekommen hatte. Oder was zum Teufel hier vorging.
Jetzt tat sich oben etwas, sie hörte Stimmen, einen Mann und eine Frau. Schritte kamen die Treppe herunter. Sie spähte durchs Geländer und sah Füße in Pantoffeln, die Hosenbeine eines Schlafanzugs, den Saum und dann den Gürtel eines rotseidenen Hausmantels, eine Hand, an der ein Schlüsselbund baumelte, und schließlich das behagliche bärtige Gesicht des Marchese Federico d’Istria. Ihr Freund und ehemaliger Geliebter Freddy, widerwilliger Trauzeuge bei ihrer Hochzeit, widerwillig aber nicht aus Eifersucht, sondern, wie sie später erfahren sollte, weil er den Bräutigam nur zu gut kannte, sich jedoch moralisch verpflichtet fühlte, ihr nichts davon zu sagen – und sein Schweigen dann bitter bereute.
Er blieb auf der letzten Stufe stehen und sah von ihr zu dem Riesenstrauß vor ihrer Tür. »Hast du die mitgebracht?«
»Nein, die lagen hier. Hast du jemanden ins Haus gelassen?«
»Nein. Silvana auch nicht. Da war niemand.«
»Und die Leute oben?«, fragte sie und zeigte mit einem Finger hinauf, als wisse er nicht, wo »oben« sei.
»Die sind in London.«
»Es war also niemand da?«
»Nicht dass ich wüsste; Silvana und ich sind zur Zeit die Einzigen hier.«
Freddy kam den letzten Schritt nach unten und besah sich den Strauß genauer. Er stupste ihn mit dem Fuß an, wie einen Betrunkenen, der auf seiner Schwelle eingeschlafen war, oder wie ein verdächtiges Paket. Nichts geschah. Er sah zu Flavia hinüber und zuckte mit den Schultern, dann bückte er sich und hob den Strauß auf. Er verschwand beinahe dahinter.
»Gelbe Rosen«, bemerkte er überflüssigerweise.
»Meine Lieblingsblumen.« Kaum hatte Flavia das gesagt, erkannte sie, dass es nicht mehr stimmte.
»Soll ich sie mit reinnehmen?«, fragte er.
»Nein«, erwiderte sie heftig. »Die will ich nicht in meiner Wohnung haben. Gib sie Silvana. Oder leg sie in die calle.« Sie hörte die Panik in ihrer Stimme und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand.