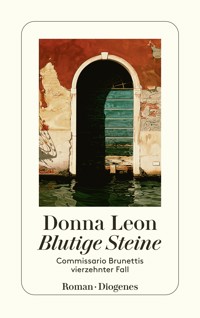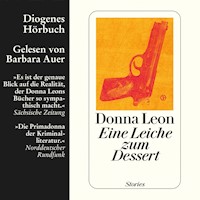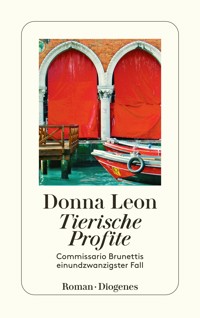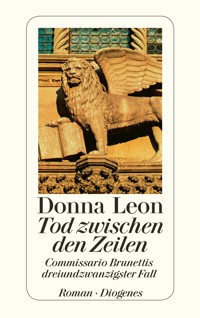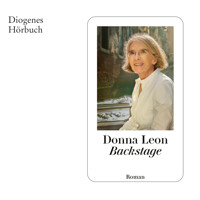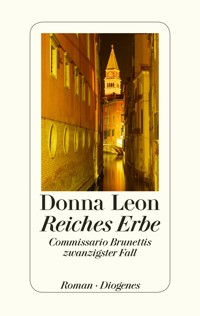
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Herzversagen – das diagnostiziert der penible Pathologe Rizzardi beim Tod von Signora Altavilla. Kein Fall für Brunetti mithin? Der Commissario traut dem Frieden nicht. Wer sucht, der findet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Donna Leon
Reiches Erbe
Commissario Brunettis zwanzigster Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel des Originals:
›Drawing Conclusions‹
Die deutsche Erstausgabe erschien 2012
im Diogenes Verlag
Umschlagfoto:
Copyright © Andreas Strauss/
look-foto
Für Jenny Liosatou
und Giulio D’Alessio
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 06820 7 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60153 4
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Im Namen Gottes, Amen. Ich, Georg Friedrich Händel, erkläre in Anbetracht der Ungewissheit des menschlichen
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
[7] 1
Da Anna Maria Giusti seit vielen Jahren literarische Texte aus dem Englischen und Deutschen ins Italienische übersetzte, kannte sie sich mittlerweile auf allen möglichen Gebieten aus. Gerade hatte sie ein amerikanisches Selbsthilfebuch fertig, in dem es um die Bewältigung von Gefühlskonflikten ging. Über manche einfältige Formulierung – die auf Italienisch noch einfältiger klang – hatte sie nur kichern können, einiges aber ging ihr nach, während sie die Treppe zu ihrer Wohnung hochstieg.
»Man kann derselben Person gegenüber zwei ganz widersprüchliche Empfindungen hegen.« Genau das traf auf ihre Gefühle für den Mann, den sie liebte, zu, dessen Familie sie gerade in Palermo besucht hatte. »Auch Menschen, die wir gut zu kennen glauben, sind in einer anderen Umgebung bisweilen nicht wiederzuerkennen.« »Anders« war kein Wort für das, was sie in Palermo erlebt hatte. »Andersartig«, »exotisch«, »befremdend«: nicht einmal diese Wörter fingen es ein, aber wie es dann in Worte fassen? Hatten sie nicht alle ein telefonino? Waren sie nicht alle tadellos gekleidet und hatten gute Manieren? An der Sprache lag es auch nicht, denn sie alle sprachen ein Italienisch, das eleganter war als alles, was sie von ihren venezianischen Angehörigen und Freunden her gewohnt war. Und an Geld fehlte es schon gar nicht, der Reichtum von Nicos Familie war auf Schritt und Tritt zu spüren.
Sie hatte in Palermo seine Familie kennenlernen wollen, [8] war aber nicht etwa bei ihnen zu Hause aufgenommen worden, man hatte sie vielmehr im Hotel einquartiert, einem Hotel mit mehr Sternen, als sie sich als Übersetzerin hätte leisten können; doch die Rechnung hatte man ihr ohnedies nicht ausgehändigt, obwohl sie mehrmals darum bat.
»Nein, Dottoressa«, hatte ihr der Hoteldirektor lächelnd erklärt, »das hat L’Avvocato schon erledigt.« Nicos Vater. »L’Avvocato«. Bei der Begrüßung hatte sie ihn mit »Dottore« angesprochen, doch diese höfliche Anrede hatte er wie eine Fliege verscheucht. »Avvocato« hatte sie einfach nicht über die Lippen gebracht und daher fortan alle in der Familie mit dem förmlichen »Lei« angesprochen.
Zwar hatte Nico sie gewarnt, es werde nicht einfach sein, aber so schlimm hatte sie es sich dann doch nicht ausgemalt. Er begegnete seinen Eltern mit Ehrerbietung: Bei jedem anderen Mann als dem, den sie zu lieben glaubte, hätte sie ein solches Verhalten als kriecherisch bezeichnet. Wenn seine Mutter ins Zimmer kam, küsste er ihr die Hand, und wenn sein Vater nahte, erhob er sich.
An einem Abend weigerte sie sich schließlich, mit der Familie zu speisen. Nach einem hastigen Essen im Restaurant brachte er sie ins Hotel, gab ihr im Foyer einen Kuss und wartete, bis sie im Aufzug verschwunden war, um seinerseits lammfromm im Palazzo seiner Familie zu übernachten. Als sie am nächsten Tag fragte, was das sollte, antwortete er, so seien hier nun einmal die Sitten. Noch am selben Nachmittag, als er sie ins Hotel zurückbrachte und ankündigte, er werde sie um acht wieder zum Essen abholen, sagte sie ihm vorm Hotel lächelnd auf Wiedersehen, ging hinein und erklärte dem jungen Mann an der Rezeption, sie [9] wolle auschecken. Dann ging sie in ihr Zimmer, packte, rief ein Taxi und hinterließ Nico am Empfang eine Nachricht. Für den Abendflug nach Venedig gab es nur noch einen Platz in der Businessklasse, aber den nahm sie gern, als kleinen Ausgleich für die Hotelrechnung, die sie nicht selbst hatte bezahlen dürfen.
Ihr Koffer war schwer und polterte laut, als sie ihn auf dem ersten Treppenabsatz abstellte. Giorgio Bruscotti, der ältere Sohn ihrer Nachbarn, hatte seine Sportschuhe vor der Tür stehen lassen, aber heute Abend freute sie sich geradezu darüber: Bewies es doch, dass sie wieder zu Hause war. Sie hob den Koffer und schleppte ihn in den zweiten Stock, wo sie wie erwartet ordentlich verschnürte Packen von Famiglia cristiana und Il Giornale liegen sah. Signor Volpe, der im hohen Alter zum leidenschaftlichen Umweltschützer geworden war, stellte das gesammelte Altpapier immer schon am Sonntagabend vor die Tür, obwohl es erst dienstagmorgens abgeholt wurde. Sie war so froh über den wieder eingekehrten Alltag, dass sie nicht einmal wie sonst üblich murmelte, diese beiden Presseerzeugnisse gehörten ohnehin in den Müll.
Der dritte Absatz war leer, ebenso der Tisch links von der Tür. Anna Maria war enttäuscht, denn entweder hieß das, im Lauf der Woche war keinerlei Post für sie gekommen – was sie kaum glauben konnte –, oder Signora Altavilla hatte vergessen, ihr die Post hinzulegen.
Sie sah auf die Uhr: kurz vor zehn. Sie wusste, die ältere Dame blieb lange auf: Sie hatten einander einmal anvertraut, das Beste am Alleinleben sei die Freiheit, so lange im Bett lesen zu können, wie man wolle. Sie trat von Signora [10] Altavillas Wohnungstür einen Schritt zurück, um zu sehen, ob noch Licht durch die Ritze drang, aber dafür war es im Treppenhaus zu hell. Dann horchte sie an der Tür, hoffte, von drinnen Geräusche zu vernehmen, vielleicht den Fernseher, was bedeuten würde, dass Signora Altavilla noch wach war.
Nichts. Frustriert hob sie ihren Koffer ein wenig an und stellte ihn geräuschvoll auf die Fliesen. Sie lauschte wieder, hörte aber keinen Laut. Also ging sie weiter, die nächste Treppe hinauf, wobei sie den Koffer an die Stufen schlagen ließ und einen solchen Lärm veranstaltete, dass sie, hätte das ein anderer getan, über dessen Gedankenlosigkeit geschimpft oder gar den Kopf zur Tür hinausgestreckt hätte, um zu sehen, was los war.
Oben angekommen, stellte sie den Koffer ab, suchte ihren Schlüssel, schloss ihre eigene Wohnung auf und empfand aufatmend Frieden und Geborgenheit. Dies war ihr Reich, in ihren eigenen vier Wänden konnte sie tun und lassen, was sie wollte. Hier musste sie sich an keine fremden Regeln halten, niemandem die Hand küssen, und dieser Gedanke zerstreute die letzten Zweifel, jetzt war sie sicher, dass es richtig gewesen war, aus Palermo abzureisen und mit Nico Schluss zu machen.
Sie machte Licht und warf automatisch einen prüfenden Blick auf das Sofa, wo die mit militärischer Präzision angeordneten Kissen ihr bestätigten, dass die Putzfrau in ihrer Abwesenheit da gewesen war. Sie trug den Koffer hinein, schloss die Tür und genoss die Stille. Zu Hause.
Anna Maria ging durchs Wohnzimmer und öffnete das Fenster und die Fensterläden. Auf der anderen Seite des campo, direkt gegenüber, stand San Giacomo dell’Orio: Wäre [11] die gerundete Apsis ein Schiffsbug, würde das Kirchenschiff mit vollen Segeln auf sie zukommen und sie jeden Moment rammen.
Sie öffnete nach und nach alle Fenster der Wohnung, stieß die Läden auf und hakte sie fest. Dann trug sie den Koffer ins Gästezimmer, schwang ihn aufs Bett und machte noch einmal die Runde, um die Fenster wegen der Kühle des Oktoberabends wieder zu schließen.
Auf dem Tisch im Esszimmer fand Anna Maria einen Zettel mit einer von Lubas kurios formulierten Mitteilungen – »Gekommen für Sie« – und daneben den unverwechselbaren gelbbraunen Benachrichtigungsschein, der von der versuchten Zustellung eines Einschreibens kündete. Sie sah sich den Schein genau an: ausgestellt vor vier Tagen. Wer mochte ihr ein Einschreiben schicken? Der Absender war nicht zu entziffern. Als Erstes kam ihr die vage Befürchtung, irgendeine Behörde habe eine Unregelmäßigkeit entdeckt und teile ihr nun mit, es gebe Ermittlungsbedarf, weil sie irgendetwas getan oder unterlassen habe.
Üblicherweise kam nach zwei Tagen eine weitere solche Benachrichtigung. Ihr Fehlen bedeutete, dass Signora Altavilla, die seit längerem die Post für sie entgegennahm, den Empfang des Briefs bestätigt und ihn jetzt unten in ihrer Wohnung hatte. Ihre Neugier erwachte. Sie ließ die Benachrichtigung auf dem Tisch liegen und ging in ihr Arbeitszimmer. Signora Altavillas Nummer kannte sie auswendig. Besser, sie mit einem Anruf zu stören, als sich bis zum Morgen Gedanken über diesen Brief zu machen, der sich, dachte sie, bestimmt als harmlos herausstellen würde.
Das Telefon läutete viermal, ohne dass jemand abnahm. [12] Mit dem Hörer in der Hand öffnete sie das Fenster, lehnte sich hinaus und hörte es unten klingeln. Wo mochte die Signora um diese Zeit sein? Im Kino? Manchmal ging sie mit Freundinnen aus, manchmal hütete sie auswärts ihre Enkel, ein andermal übernachteten die älteren von ihnen bei ihr.
Anna Maria legte den Hörer auf und ging ins Wohnzimmer zurück. Obwohl sie altersmäßig fast zwei Generationen auseinanderlagen, waren sie und die Frau unter ihr im Lauf der Jahre gute Nachbarn geworden. Vielleicht nicht gerade gute Freundinnen: Noch nie hatten sie zusammen gegessen, aber gelegentlich trafen sie sich auf der Straße und gingen einen Kaffee trinken, und unzählige Male hatten sie auf der Treppe einen Schwatz gehalten. Manchmal musste Anna Maria auf Konferenzen als Simultandolmetscherin arbeiten und war dann tagelang oder gar wochenlang außer Haus. Da Signora Altavilla wiederum jedes Jahr im Juli mit ihrem Sohn und seiner Familie in die Berge fuhr, hatte Anna Maria die Schlüssel für unten, damit sie die Blumen gießen konnte und, wie Signora Altavilla bei der Übergabe gesagt hatte, »überhaupt für alle Fälle«. Sie hatten auch vereinbart, dass Anna Maria, wenn sie von einer Reise zurückkam und Signora Altavilla nicht zu Hause war, die Wohnung betreten durfte, um ihre Post zu holen.
Sie nahm die Schlüssel aus der zweiten Schublade in der Küche, klemmte ihre Handtasche in die Wohnungstür, machte Licht und ging nach unten.
Obschon überzeugt, dass niemand da war, drückte Anna Maria auf den Klingelknopf. Tabu? Rücksicht auf die Privatsphäre? Als niemand aufmachte, steckte sie den Schlüssel ins Schloss, doch wie so oft ließ er sich nicht ohne weiteres [13] drehen. Sie versuchte es noch einmal, indem sie gleichzeitig an der Klinke zog und den Schlüssel bewegte. Vom Druck ihrer Hand ging die Klinke nach unten, und es stellte sich heraus, dass die Tür gar nicht abgeschlossen war, denn sie schwang widerstandslos auf und zog Anna Maria einen Schritt in die Wohnung hinein.
Als Erstes dachte sie an Costanzas Alter: Warum vergaß sie ständig, die Tür abzuschließen? Warum hatte sie die Tür nicht längst durch eine porta blindata ersetzen lassen, die automatisch verriegelte, wenn sie zufiel? »Costanza?«, rief sie. »Ci sei?« Sie horchte, aber niemand antwortete. Ohne nachzudenken, ging Anna Maria zu dem Tisch gegenüber der Tür, auf dem eine Handvoll Briefe lag, nicht mehr als vier oder fünf, daneben der Espresso von dieser Woche. Erst jetzt, als sie das Titelblatt der Zeitschrift sah, fiel ihr auf, dass im Flur Licht war; auch durch die halboffene Wohnzimmertür und die weit geöffnete Tür des größeren Schlafzimmers drang Licht in den Flur.
Signora Altavilla war im Italien der Nachkriegszeit aufgewachsen, und wenn sie auch durch ihre Ehe reich und glücklich geworden war, hatte sie sich die einmal erlernte Sparsamkeit doch nie abgewöhnt. Anna Maria, Kind einer wohlhabenden Familie zur Zeit des Wirtschaftsbooms, hatte nie geizen müssen. So hatte die Jüngere es immer seltsam gefunden, dass die Ältere jedes Mal das Licht ausmachte, wenn sie ein Zimmer verließ, im Winter zwei Pullover trug oder sich ernsthaft darüber freute, wenn sie bei Billa ein Schnäppchen gemacht hatte.
»Costanza?«, rief sie noch einmal, eher um sich von ihren Gedanken abzulenken als jetzt noch eine Antwort erwartend. [14] Aus dem unbewussten Bedürfnis, die Hände frei zu haben, legte sie die Schlüssel auf den Briefen ab, dann sah sie schweigend nach dem Licht, das durch die offene Tür am Ende des Flurs fiel.
Sie holte tief Luft, machte einen Schritt nach vorn und noch einen und noch einen. Dann hielt sie inne, sie konnte einfach nicht weiter. Sie sagte sich, wie töricht sie sei, nahm ihren Mut zusammen und riskierte einen Blick durch die halboffene Tür. »Costan–«, begann sie, schlug aber beide Hände vor den Mund, als sie auf dem Fußboden eine Hand liegen sah. Dann den Arm, die Schulter und schließlich den Kopf, zumindest den Hinterkopf. Und das kurze weiße Haar. Anna Maria hatte die alte Frau seit Jahren fragen wollen, ob ihre Weigerung, sich die Haare in dem für Frauen ihres Alters obligatorischen Rot färben zu lassen, ebenfalls mit ihrer Sparsamkeit zu tun habe oder ob sie damit bloß akzeptierte, dass weißes Haar ihr faltiges Gesicht weicher und würdevoller erscheinen ließ.
Sie sah auf die reglose Frau hinunter, die Hand, den Arm, den Kopf. Und erkannte, dass sie ihr die Frage niemals mehr stellen konnte.
[15] 2
Guido Brunetti, Commissario di Polizia der Stadt Venedig, saß mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten Vice-Questore Giuseppe Patta beim Abendessen und verwünschte sein Schicksal. Von ihm aus hätten Aliens ihn entführen oder bärtige Terroristen, mit blutrünstigen Blicken wild um sich schießend, das Restaurant stürmen können. In dem Chaos hätte Brunetti, der wie gewöhnlich keine Waffe trug, einem der Angreifer die seine entrissen und damit nicht nur den Vice-Questore, sondern auch Tenente Scarpa erschossen, der neben dem Vice-Questore saß und in diesem Augenblick sein bedächtiges – negatives – Urteil über den Grappa aussprach, der ihnen zum Ende der Mahlzeit serviert worden war.
»Ihr im Norden«, sagte der Tenente mit einem herablassenden Nicken in Brunettis Richtung, »könnt doch keinen vernünftigen Wein herstellen, und von allem anderen habt ihr auch keine Ahnung.« Er trank seinen Grappa aus, zog einen angewiderten Flunsch – so sorgfältig einstudiert, dass Brunetti mühelos einen Unterschied zwischen angewidert und regelrecht angeekelt machen konnte – und stellte das Glas auf den Tisch. Er sah Brunetti unverfroren ins Gesicht, als fordere er ihn auf, seinerseits einen weinkundigen Kommentar abzugeben, doch Brunetti ging nicht darauf ein und gab sich damit zufrieden, sein Glas zu leeren. Sosehr ihn dieses Essen mit Patta und Scarpa nach der Wiederkehr des Kellners verlangen ließ – oder nach der Wiederkunft [16] Christi –, bewog ihn die Erkenntnis, dass der Abend dann noch länger würde, den zweiten Grappa auszuschlagen, so wie sein gesunder Menschenverstand ihn bewog, den von Scarpa ausgeworfenen Köder zu ignorieren.
Brunettis stoische Reaktion – oder aber der Grappa, sein zweiter – stachelte den Tenente an, noch einmal nachzuhaken: »Ich begreife nicht, warum die friaulischen Weine so…«, aber Brunettis Interesse an dem, was der Tenente zu offenbaren haben mochte, wurde vom Läuten seines telefonino abgelenkt. Wann immer er eine Einladung unmöglich ausschlagen konnte – wie die von Patta zu diesem Essen, bei dem sie über Kandidaten für eine Beförderung gesprochen hatten –, trug Brunetti vorsorglich sein telefonino bei sich, und oft kam die Erlösung durch einen Anruf Paolas, die ihn mit irgendeinem erfundenen häuslichen Drama zum sofortigen Aufbruch zwang.
»Sì«, antwortete er enttäuscht, als er sah, dass der Anruf aus der Zentrale der Questura kam.
»Guten Abend, Commissario«, sagte eine Stimme, die er Ruffolo zuordnete. »Eben kam ein Anruf von einer Frau in Santa Croce. Sie hat eine Tote in ihrer Wohnung gefunden. Es gab Blutspuren, deshalb hat sie uns angerufen.«
»In wessen Wohnung?«, fragte Brunetti, auch wenn das im Augenblick keine Rolle spielte; aber er konnte solche Unklarheiten nicht leiden.
»Sie sagte, es war in ihrer eigenen Wohnung. Das heißt, in der Wohnung der Toten. Die Wohnung unter ihr.«
»Wo in Santa Croce?«
»Giacomo dell’Orio, Signore. Genau gegenüber der Kirche. Eins sieben zwei sechs.«
[17] »Wer ist vor Ort?«
»Niemand, Commissario. Ich habe als Erstes Sie angerufen.«
Brunetti sah auf die Uhr. Es war kurz vor elf, weit über die Zeit hinaus, die er mit diesem Essen hatte vergeuden wollen. »Versuchen Sie, Rizzardi aufzutreiben, und schicken Sie ihn hin. Und rufen Sie Vianello an – der müsste zu Hause sein. Lassen Sie ihn mit einem Boot abholen. Und trommeln Sie die Spurensicherung zusammen.«
»Und Sie, Signore?«
Brunetti hatte bereits den in seine Gene eingeprägten Stadtplan von Venedig konsultiert. »Zu Fuß bin ich schneller. Ich treffe mich mit den Leuten dort.« Dann fiel ihm noch ein: »Falls in der Nähe eine Streife unterwegs ist, schicken Sie die auch dorthin. Und rufen Sie die Frau an und sagen ihr, sie soll in der Wohnung nichts anfassen.«
»Sie ist in ihre eigene Wohnung gegangen, um uns anzurufen. Ich habe ihr gesagt, sie soll dortbleiben.«
»Gut. Wie heißt sie?«
»Giusti, Signore.«
»Wenn Sie mit der Streife sprechen, sagen Sie, ich bin in zehn Minuten da.«
»Jawohl, Signore«, bestätigte der Polizist und legte auf.
Vice-Questore Patta sah Brunetti neugierig an. »Etwas Unangenehmes, Commissario?«, fragte er in einem Ton, der Brunetti bewusst werden ließ, wie sehr sich Neugier von Interesse unterschied.
»Ja, Signore. In Santa Croce wurde eine Tote aufgefunden.«
»Und deshalb hat man Sie angerufen?«, unterbrach Scarpa, [18] wobei er es gerade noch schaffte, das »Sie« nicht allzu unhöflich klingen zu lassen.
»Griffoni ist noch nicht aus dem Urlaub zurück, und ich wohne am nächsten dran«, antwortete Brunetti ungerührt.
»Natürlich«, meinte Scarpa und drehte sich nach dem Kellner um.
Brunetti wandte sich an Patta: »Ich werde mir das mal ansehen, Vice-Questore.« Er setzte die Miene eines geplagten Beamten auf, den eine lästige Pflicht von seinem Vergnügen abhält, schob seinen Stuhl zurück und erhob sich. Er gab Patta noch Gelegenheit zu einem Kommentar, aber der blieb stumm.
Draußen überließ es Brunetti seinen Beinen, den Weg zu finden, nahm sein telefonino und rief zu Hause an.
»Brauchst du moralische Unterstützung?«, fragte Paola statt einer Begrüßung.
»Scarpa hat mir gerade erzählt, wir Norditaliener hätten keine Ahnung vom Weinanbau«, sagte er.
Nach kurzem Schweigen meinte sie: »Was du nicht sagst, aber mir scheint, da ist noch etwas anderes.«
»Ich bin angerufen worden. In Santa Croce wurde eine Tote gefunden, drüben bei San Giacomo.«
»Warum hat man gerade dich angerufen?«
»Wahrscheinlich, weil man Patta oder Scarpa nicht damit behelligen wollte.«
»Da hat man also dich angerufen, während du mit den beiden zusammen warst? Köstlich.«
»Man hat nicht gewusst, wo ich war. Außerdem bin ich auf diese Weise von den beiden losgekommen. Ich gehe mir das jetzt mal ansehen. Ich habe sowieso den kürzesten Weg.«
[19] »Soll ich auf dich warten?«
»Nein. Wer weiß, wie lange das dauert.«
»Wenn du kommst, wache ich auf«, sagte sie. »Falls nicht, stups mich an.«
Brunetti lächelte bei der Vorstellung, beschränkte sich aber auf ein unverbindliches Brummen.
»Es wäre nicht das erste Mal, dass ich aus dem Schlaf gerissen würde«, sagte sie mit gespielter Entrüstung, denn ihr Radar hatte genau erfasst, dass er ihr mit seinem Brummen keinen Glauben schenkte.
Brunetti erinnerte sich: Zuletzt war das in der Nacht passiert, als das Fenice abbrannte und der immer wieder übers Haus fliegende Hubschrauber sie schließlich aus dem tiefen Abgrund holte, in den sie jeden Abend versank.
Versöhnlicher sagte sie: »Hoffentlich ist es nichts allzu Schreckliches.«
Er dankte ihr, verabschiedete sich und schob das Telefon in die Jackentasche. Dann konzentrierte er sich auf den Weg. Die Straßen waren hell erleuchtet: auch so ein üppiges Geschenk der Verschwender in Brüssel. Wenn ihm danach gewesen wäre, hätte Brunetti im Licht der Laternen eine Zeitung lesen können. Auch aus vielen Schaufenstern kam noch Licht: Er dachte an Satellitenfotos von dem leuchtenden nächtlichen Planeten, die er gesehen hatte. Nur im tiefsten Afrika gab es noch wirkliche Dunkelheit.
Am Ende der Scaleter Ca’ Bernardo wandte er sich nach links und passierte den Turm von San Boldo, dann ging er über die Brücke in die Calle del Tintor und kam an der Pizzeria vorbei. Daneben hatte noch ein Geschäft geöffnet, das billige Portemonnaies verkaufte; hinter dem Ladentisch [20] saß eine junge Chinesin, die eine chinesische Zeitung las. Er hatte keine Ahnung, wie lange die Geschäfte nach der aktuellen Gesetzeslage geöffnet haben durften, aber innerlich lehnte er sich dagegen auf, dass zu so später Stunde noch Geschäfte gemacht wurden.
Vor ein paar Wochen hatte er mit einem Hauptmann der Grenzpolizei zu Abend gegessen, der ihm unter anderem erzählt hatte, derzeitigen Schätzungen zufolge liege die Zahl der gegenwärtig in Italien lebenden Chinesen irgendwo zwischen 500000 und 5 Millionen. Nach dieser Feststellung lehnte er sich erst einmal zurück, um Brunettis Verblüffung auszukosten. Und bemerkte dann: »Wenn alle Chinesen in Europa Uniform tragen würden, kämen wir nicht mehr umhin, die Invasion als solche anzuerkennen.« Dann hatte er seine Aufmerksamkeit wieder den gegrillten Calamari zugewandt.
Zwei Türen weiter sah er einen anderen Laden, und auch dort saß eine junge Chinesin an der Kasse. Aus einer Bar strömte noch mehr Licht auf seinen Weg; davor standen vier oder fünf junge Leute, rauchend und mit Gläsern in der Hand. Ihm fiel auf, dass drei von ihnen Coca-Cola tranken: so viel zum Nachtleben von Venedig.
Er gelangte auf den campo; auch der war von Licht überflutet. Vor Jahren, kurz nachdem er aus Neapel zurückversetzt worden war, war dieser campo ein berüchtigter Drogenumschlagplatz gewesen. Er dachte an die Geschichten von weggeworfenen Spritzen, die damals jeden Morgen aufgekehrt werden mussten, und erinnerte sich vage an einen Jugendlichen, der hier tot auf einer Bank gelegen hatte, gestorben an einer Überdosis. Doch seit sich nur noch wohlhabende Leute diese Gegend leisten konnten, war alles clean – [21] oder aber der Umstieg auf Designerdrogen hatte Spritzen überflüssig gemacht.
Er sah nach den Gebäuden zu seiner Rechten, gegenüber der Apsis. In einem hellen Fenster im vierten Stock eines der Häuser zeigte sich der Schatten einer Frau. Brunetti widerstand dem Impuls, ihr zuzuwinken, und ging auf das Haus zu. Die Hausnummer war nirgends auf der Fassade zu entdecken, aber ihr Name stand neben dem obersten Klingelknopf.
Er läutete, und schon sprang die Tür auf; offenbar war sie, als sie einen Mann auf den campo kommen sah, gleich zur Wohnungstür gegangen. Brunetti war der einzige Spaziergänger zu dieser Stunde gewesen, die Touristen allesamt verschwunden, alle anderen zu Hause im Bett, so dass es sich bei diesem Sonderling nur um den Polizisten handeln konnte.
Er ging die Treppen hinauf, vorbei an den Schuhen und Zeitungsbündeln: einem Venezianer wie ihm kam dieses amöbenhafte Sich-Ausbreiten so vollkommen natürlich vor, dass er dem kaum Beachtung schenkte.
Auf dem letzten Treppenabsatz hörte er von oben eine Frauenstimme: »Sind Sie von der Polizei?«
»Sì, Signora«, sagte er, griff nach seinem Dienstausweis und verkniff sich die Bemerkung, wie leichtsinnig es von ihr sei, Fremde einfach so ins Haus zu lassen. Als er oben ankam, ging sie ihm einen halben Schritt entgegen und hielt ihm die Hand hin.
»Anna Maria Giusti«, sagte sie.
»Brunetti«, antwortete er und ergriff ihre Hand. Als er ihr seinen Ausweis zeigte, sah sie nur flüchtig hin. Er schätzte [22] sie auf Anfang dreißig: groß und schlank, aristokratische Nase und dunkelbraune Augen. Ihr Gesicht war starr vor Anspannung und Müdigkeit; in entspanntem Zustand mochte sie eine Schönheit sein. Sie zog ihn hinter sich her, ließ seine Hand los und trat einen Schritt zurück. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte sie und spähte an ihm vorbei, um sich zu vergewissern, dass er allein gekommen war.
»Mein Mitarbeiter und die anderen sind unterwegs, Signora«, sagte Brunetti, ohne weiter in die Wohnung zu gehen. »Könnten Sie mir inzwischen erzählen, was passiert ist?«
»Das weiß ich nicht«, sagte sie und rang die Hände wie Frauen in Filmen der fünfziger Jahre, wenn sie ihrer Verzweiflung Ausdruck geben wollten. »Ich bin vor einer Stunde aus dem Urlaub gekommen, und als ich zu Signora Altavilla in die Wohnung ging, habe ich sie dort gefunden. Tot.«
»Sind Sie sicher?«, fragte Brunetti, weil er annahm, sie mit dieser Frage weniger zu verwirren, als wenn er sie darum bitten würde, ihm zu beschreiben, was sie gesehen hatte.
»Ich habe ihren Handrücken berührt. Der war kalt«, sagte sie. Sie presste die Lippen zusammen. Mit gesenktem Blick fuhr sie fort. »Und ihr Handgelenk, ich habe nach ihrem Puls gefühlt. Aber da war nichts.«
»Signora, am Telefon haben Sie gesagt, es gab Blut.«
»Auf dem Boden, neben ihrem Kopf. Als ich das gesehen habe, bin ich nach oben gegangen und habe Sie angerufen.«
»Sonst noch etwas, Signora?«
Sie wies auf das Treppenhaus hinter ihm, meinte aber offenbar die Etage darunter. »Die Wohnungstür war offen.« Als sie seine Überraschung bemerkte, fügte sie erklärend [23] hinzu: »Das heißt: nicht abgeschlossen. Zu, aber nicht abgeschlossen.«
»Verstehe«, sagte Brunetti. Er dachte nach und fragte schließlich: »Könnten Sie mir sagen, wie lange Sie fort gewesen sind, Signora?«
»Fünf Tage. Vorige Woche bin ich nach Palermo gefahren, und heute Abend bin ich zurückgekommen.«
»Danke«, sagte Brunetti und fragte dann angelegentlich: »Haben Sie Freunde besucht, Signora?«
Der Blick, mit dem sie ihn bedachte, zeigte ihm, wie klug sie war und wie sehr die Frage sie beleidigte.
»Es geht mir darum, alles Mögliche auszuschließen, Signora«, sagte er beschwichtigend.
Ihre Stimme war ein bisschen lauter, ihre Aussprache etwas deutlicher, als sie sagte: »Ich habe in einem Hotel gewohnt. Villa Igiea. Sie können sich dort erkundigen.« Verlegen, so schien es Brunetti, wandte sie den Blick ab. »Jemand anders hat die Rechnung beglichen, aber ich stehe in den Büchern.«
Das würde sich leicht überprüfen lassen, also fragte Brunetti nur: »Sie sind in Signora Altavillas Wohnung gegangen, um…?«
»Ich wollte meine Post holen.« Sie wandte sich ab und ging in ein großes offenes Zimmer, dessen Schrägen verrieten, dass es – vor wie vielen Jahrhunderten? – einmal ein Dachboden gewesen war. Brunetti folgte ihr und spähte zu den zwei Dachfenstern hinauf, ob sich dort Sterne zeigten, sah aber nur das von unten widergespiegelte Licht.
Sie nahm einen Zettel vom Tisch und hielt ihn Brunetti hin. Er erkannte die beige Empfangsbestätigung für ein [24] Einschreiben. »Ich wusste nicht, was das sein könnte, und dachte, vielleicht ist es etwas Wichtiges«, sagte sie. »Und weil ich nicht bis morgen warten wollte, um das herauszufinden, bin ich nach unten gegangen, um zu sehen, ob der Brief dort ist.«
Brunetti sah sie fragend an, und sie fuhr fort: »Wenn ich weg bin, nimmt sie meine Post entgegen und legt sie mir, wenn ich wieder zurückkomme, vor die Tür, oder ich geh runter und hole sie ab.«
»Und wenn sie einmal nicht da ist?«, fragte Brunetti.
»Sie hat mir die Schlüssel gegeben, damit ich mir die Post selbst holen kann.« Sie drehte sich zu den Fenstern um, durch die Brunetti die angestrahlte Apsis der Kirche sah. »Also bin ich runter in ihre Wohnung. Die Briefe waren da, wo sie immer waren: auf der Ablage beim Eingang.« Sie schien nicht weiterzuwissen, aber Brunetti wartete.
»Und dann bin ich ins vordere Zimmer gegangen. Einfach so, ohne Grund – aber da war Licht – sie macht immer das Licht aus, wenn sie aus einem Zimmer geht –, und ich dachte, vielleicht hat sie mich nicht gehört. Aber das klingt nicht besonders logisch, oder? Und da habe ich sie gesehen. Und ihre Hand berührt. Und das Blut gesehen. Und dann bin ich wieder hier rauf und habe Sie angerufen.«
»Möchten Sie sich nicht setzen, Signora?«, fragte Brunetti und wies auf einen Stuhl, der an der Wand neben ihr stand.
Sie schüttelte den Kopf, machte aber gleichzeitig einen Schritt darauf zu. Schwer ließ sie sich nieder, gab dann ihrer Schwäche nach und lehnte sich zurück. »Furchtbar. Wie kann jemand nur…«
Bevor sie die Frage aussprechen konnte, läutete die Klingel. Brunetti ging zur Sprechanlage und hörte, wie Vianello [25] sich selbst und Dottor Rizzardi meldete. Brunetti drückte den Knopf, der die Haustür öffnete, legte den Hörer auf und teilte der immer noch Sitzenden mit: »Die anderen sind eingetroffen, Signora.« Und auch das musste er noch fragen: »Ist die Tür abgeschlossen?«
Verwirrt sah sie zu ihm auf: »Was?«
»Die Tür unten. Die Wohnungstür. Ist sie abgeschlossen?«
Sie schüttelte zwei-, dreimal den Kopf und schien sich dieser Geste so wenig bewusst, dass er erleichtert war, als sie damit aufhörte. »Ich weiß nicht. Ich hatte die Schlüssel.« Sie suchte in ihren Jackentaschen, fand die Schlüssel aber nicht. Sie sah ihn verlegen an. »Ich muss sie unten gelassen haben, auf der Post.« Sie schloss die Augen und sagte: »Aber Sie können hineingehen. Die Tür schließt nicht automatisch.« Dann hob sie eine Hand, als habe sie etwas Wichtiges zu sagen. »Sie war eine gute Nachbarin.«
Brunetti dankte ihr und ging zu den anderen nach unten.
[26] 3
Vianello und Rizzardi warteten vor der Wohnungstür. Brunetti und Vianello nickten sich zu, sie hatten sich noch am Nachmittag gesehen; dem Pathologen gab Brunetti die Hand. Wie immer war der Doktor gekleidet wie ein englischer Gentleman, der soeben aus seinem Club kam. Er trug einen dunkelblauen, eindeutig maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug. Sein Hemd sah aus, als habe er es soeben erst auf der Treppe angezogen, und seine Krawatte hatte für Brunetti etwas »Ehrfurchtgebietendes«, auch wenn ihm selbst nicht ganz klar war, was er damit meinte.
Rizzardi war erst vor kurzem aus seinem Urlaub in Sardinien zurückgekehrt, dennoch sah er müde aus, wie Brunetti beunruhigt feststellte. Aber wie fragte man einen Arzt nach seinem Befinden?
»Schön, dich zu sehen, Ettore«, sagte er. »Wie…«, fing Brunetti an, fand dann aber, er sollte die Frage neutraler formulieren, »…war dein Urlaub?«
»Turbulent. Giovanna und ich hatten vor, die Zeit unter einem Sonnenschirm am Strand zu verbringen, nur lesen und aufs Meer hinausschauen. Aber dann fragte Riccardo in letzter Minute, ob wir nicht die Enkel mitnehmen wollten, und wie hätten wir da nein sagen können, also hatten wir die zwei Kinder dabei, acht und sechs Jahre alt.« Er zog ein Gesicht wie jemand, der einen Raubüberfall erlebt hat. »Ich hatte vergessen, wie das ist, mit Kindern zusammen.«
»Und vorbei war’s mit Sonnenschirm und Strand und [27] Lesen und Aufs-Meer-Hinausschauen, nehme ich an«, sagte Brunetti.
Rizzardi zuckte die Achseln, doch mit einem Lächeln. »Wir haben es beide sehr genossen«, sagte er. »Auch wenn wir das besser nicht laut sagen sollten.« Dann wurde er sachlich: »Was liegt an?«
»Die Frau oben ist aus dem Urlaub gekommen, hat ihre Post nicht vorgefunden, wollte sie hier unten holen und hat dabei die Tote gefunden.«
»Und sie hat die Polizei und nicht den Notarzt angerufen?«, unterbrach Vianello.
»Sie sagt, sie habe Blut gesehen: Deswegen habe sie uns alarmiert«, erklärte Brunetti.
Die Tür, fiel Brunetti auf, war eine altmodische Holztür mit Klinke, wie man sie in dieser von Einbrüchen geplagten Stadt kaum noch sah. Auch wenn Signora Giusti beim Hineingehen zweifellos alle etwa vorhandenen Fingerabdrücke beschädigt oder unbrauchbar gemacht hatte, achtete Brunetti beim Öffnen der Tür darauf, die Klinke nur mit der offenen Handfläche am äußersten Ende nach unten zu drücken.
Beim Eintreten sah er links an der Wand eine Ablage, darauf ein paar Briefe und einen Schlüsselbund. Aus einer offenen Tür rechts drang Licht, ebenso aus einer weiteren am Ende des Flurs. Er ging zu der ersten und sah hinein: ein einfaches Schlafzimmer mit einem Einzelbett und einer Kommode.
Aus Gewohnheit öffnete er die Tür gegenüber, wobei er wieder nur das Ende der Klinke berührte. Aus dem Flur fiel genug Licht in dieses kleinere Zimmer, und Brunetti sah ein [28] weiteres Einzelbett, daneben einen Nachttisch und eine niedrige Kommode. Die Tür zum Bad war angelehnt.
Er drehte sich um und ging ans Ende des Flurs, während die anderen so wie er einen Blick in die vorderen Zimmer warfen. Die Frau lag auf der rechten Seite, mit dem Rücken zu ihm, und blockierte mit einem Fuß die Tür, einen Arm hatte sie ausgestreckt, der andere war unter ihr eingeklemmt. Sie schien kaum größer als ein Kind zu sein und wog bestimmt nicht einmal fünfzig Kilo. Teilweise von ihrem Kopf verdeckt schimmerte, etwas kleiner als eine CD, ein angetrockneter, dunkler Blutfleck auf dem Boden. Brunetti betrachtete ihr kurzes weißes Haar, die dunkelblaue Kaschmirjacke, den Kragen einer gelben Bluse, den schmalen goldenen Streifen an ihrem Ringfinger.
Brunetti war jeglicher Aberglaube fremd, für ihn zählten nur Vernunft und gesunder Menschenverstand, ohne die man seiner Meinung nach nicht richtig denken konnte. Dies hielt ihn jedoch keineswegs davon ab, das mögliche Vorhandensein weniger greifbarer Phänomene in Betracht zu ziehen – deutlicher hatte er das bis jetzt noch nicht formulieren können. Etwas, das zwar nicht zu sehen war, aber doch Spuren hinterließ. Und hier nahm er solche Spuren wahr: Diese Frau war unschön gestorben. Nicht unbedingt durch Gewalteinwirkung, nur unschön. Er spürte das, wenn auch nur vage, und kaum drang dieses Gefühl in sein Bewusstsein vor, legte es sich auch schon wieder, vom Verstand abgetan als das übliche Unwohlsein angesichts eines plötzlich zu Tode gekommenen Menschen.
Er sah sich rasch im Zimmer um, registrierte das Mobiliar, zwei Stehlampen, eine Fensterreihe, aber die Frau zu [29] seinen Füßen verdrängte alles und machte es ihm schwer, sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren.
Er ging in den Flur zurück. Von Vianello war nichts zu sehen, nur der Pathologe wartete. »Sie ist da drin, Ettore«, sagte Brunetti. Als der Doktor herankam, wurde Brunetti von Geräuschen abgelenkt, die von unten heraufdrangen. Schritte und Männerstimmen, erst eine tiefe, dann eine hellere. Eine Tür fiel zu.
Die Schritte näherten sich der Wohnung, und dann erschien Marillo, ein Mitarbeiter der Spurensicherung, in der offenen Tür, gefolgt von zwei Männern, die das nötige Handwerkszeug hereintrugen. Marillo, ein großer dünner Lombarde, der nur die schlichte, buchstäbliche Wahrheit jeder Aussage oder Situation zu verstehen schien, grüßte Brunetti und kam hinein, seine Leute ihm nach. Als der Letzte die Tür geschlossen hatte, erklärte er: »Unten wollte jemand wissen, was der Lärm hier zu bedeuten hat.«
Brunetti grüßte die Männer, doch als er sich wieder Rizzardi zuwenden wollte, war der schon in dem anderen Zimmer verschwunden. Er sagte den Männern, Vianello werde ihnen erklären, wo sie mit dem Fotografieren und der Erfassung von Fingerabdrücken anfangen sollten. Er fand Rizzardi, beide Hände umsichtig in den Hosentaschen, über die Leiche der Frau gebeugt. Als Brunetti herankam, richtete er sich auf und sagte: »Könnte ein plötzlicher Herztod gewesen sein. Oder ein Schlaganfall.«
Brunetti wies schweigend auf die kleine Blutlache, und Rizzardi, der lange genug in dem Zimmer gewesen war, um sich sorgfältig umzusehen, zeigte auf einen Heizkörper, der nicht weit von der Frau unter einem Fenster stand.
[30] »Sie könnte darauf gestürzt sein«, sagte Rizzardi. »Eine bessere Vorstellung bekomme ich erst, wenn ich sie umdrehen darf.« Er trat einen Schritt von der Leiche zurück. »Also lassen wir erst einmal die Fotos machen, ja?«
Jedem anderen Arzt hätte Brunetti es vermutlich übelgenommen, dass er den Blutfleck nicht als Zeichen von Gewalt interpretieren wollte, aber er kannte Rizzardis Grundsatz, nichts anderes als unmittelbar einleuchtende Todesursachen anzuerkennen, und auch die nur, wenn er sie mit eigenen Augen sah oder selbst beweisen konnte. Manchmal gelang es Brunetti, dem Doktor Spekulationen zu entlocken, aber einfach war das nicht.
Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit von Rizzardi und der Frau zu seinen Füßen ab. Das Zimmer machte einen ordentlichen Eindruck, abgesehen von zwei Sofakissen auf dem Boden und einem in Leder gebundenen Buch, das mit der Vorderseite nach unten daneben lag. Es gab einen Schrank, aber beide Türen waren zu.
Der Fotograf kam herein. »Marillo und Bobbio kümmern sich um die Fingerabdrücke, dann kann ich ja schon mal hier anfangen«, sagte er und ging an Brunetti vorbei zu der Leiche, während er an seiner Kamera herumfingerte.
Brunetti ließ ihn arbeiten. Er hörte Rizzardi hinter sich etwas murmeln, ignorierte ihn aber und ging in den Flur zurück.
In dem größeren Schlafzimmer stand Vianello vor den aufgezogenen Schubladen der Kommode; er trug Latexhandschuhe und untersuchte einige Papiere, die auf der Kommode lagen. Brunetti sah ihm zu, wie er das obere Blatt mit einer Fingerspitze beiseiteschob, das Blatt darunter las, auch dies wegschob und das letzte las.
[31] Als Antwort auf Brunettis Schweigen sagte Vianello: »Das ist ein Brief von einem Mädchen in Indien. ›An Mamma Costanza‹. Muss eine dieser Organisationen sein, über die man ein Kind unterstützen kann.«
»Was steht drin?«, fragte Brunetti.
»Der Brief ist in Englisch«, sagte Vianello und hielt die Papiere hoch. »Mit der Hand geschrieben. Soweit ich das verstehe, dankt sie ihr für ein Geburtstagsgeschenk und erzählt, dass sie es ihrem Vater geben wird, damit er davon Reis für die Frühjahrsaussaat kaufen kann.« Dann fügte er noch hinzu: »Außerdem hat sie ihr Schulzeugnis und ein Foto mitgeschickt.«
Vorsichtig schob Vianello die Papiere wieder zusammen. »Was meinst du, sind solche Wohltätigkeitsorganisationen eigentlich seriös?«, fragte er.
»Das kann ich nur hoffen«, sagte Brunetti. »Wenn nicht, ist lange Zeit viel Geld bei den falschen Stellen angekommen.«
»Machst du da auch mit?«, fragte Vianello.
»Ja.«
»Indien?«
»Ja«, sagte Brunetti, dem das beinahe peinlich war. »Paola kümmert sich darum.«
»Nadia macht das auch«, sagte Vianello hastig. »Aber warum wir eigentlich Geld in Länder wie Indien oder China schicken, verstehe ich nicht. In jeder Zeitung kann man lesen, was für eine starke Wirtschaft die haben und dass sie in zehn Jahren die Welt beherrschen werden. Oder in zwanzig. Wozu müssen wir also ihre Kinder unterstützen?« Und dann sagte er noch: »Mir jedenfalls ist das nicht klar.«
[32] »Wenn man Fazio glauben kann«, brachte Brunetti seinen Freund von der Grenzpolizei ins Spiel, »ist es falsch, ihnen Kleider und Spielzeuge und Elektrogeräte abzukaufen. Hingegen tut es nicht weh, ein paar hundert Euro zu spenden, damit dort ein Kind zur Schule gehen kann.«
Vianello nickte. »Die Kinder dort brauchen trotzdem was zu essen, nehme ich an. Und Bücher.« Er streifte die Handschuhe ab und steckte sie ein.
In diesem Augenblick erschien der Fotograf in der Tür und sagte Brunetti, Rizzardi wolle ihn sprechen. Die Tote lag inzwischen auf dem Rücken, beide Arme dicht am Körper: Als Brunetti sie so sah, konnte er den Eindruck nicht mehr nachvollziehen, den er beim ersten Anblick der Leiche gehabt hatte. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Mund offen, ihre Seele entwichen. Keinerlei Hoffnung, dass in diesem Körper noch eine Seele wohnte. Man könnte darüber diskutieren, wohin sie gegangen war oder ob sie überhaupt je existiert hatte, aber dass hier kein Leben war, stand unwiderruflich fest.
Über ihrem rechten Auge, unmittelbar über der Braue, sah Brunetti eine Platzwunde, das Fleisch geschwollen und verfärbt. Aus der Wunde war eine dunkle Substanz, die an Siegellack erinnerte, in ihre Haare gesickert – offenbar die Quelle für das Blut auf dem Fußboden. Nachdem sie auf den Rücken gedreht worden war, hatte man ihre Strickjacke aufgeknöpft und die gelbe Bluse zur Seite gezogen, so dass im Bereich des linken Schlüsselbeins ein länglicher Fleck erkennbar wurde.
Unbewusst krümmte Brunetti die Finger und hielt die Hände so vor sich hin, als wolle er den Abstand zwischen [33] seinen Daumen messen. Dann erst merkte er, dass Rizzardi ihn beobachtete.
»Dann wären ihre Augen blutunterlaufen«, sagte der Doktor, der die Geste des Commissarios richtig interpretierte.
Brunetti hörte hinter sich einen Stoßseufzer. Es war Vianello, den er nicht hatte kommen hören. Der Ispettore machte ein routiniert neutrales Gesicht.
Brunetti wandte sich wieder der Toten zu. Eine ihrer Hände war zur Faust geballt, wie erstarrt bei dem Versuch, ihre fliehende Seele festzuhalten. Die andere lag locker und offen da, als winke sie gleichmütig ihrer Seele nach.
»Kannst du das gleich in der Frühe erledigen?«, fragte Brunetti.
»Ja.«
»Und siehst du dir alles genau an?«
Rizzardi stöhnte auf und sagte mit kaum gezügelter Ungeduld: »Guido.«
Rizzardi sah auf die Uhr: Brunetti wusste, der Doktor musste in den Totenschein eintragen, wann sie gestorben war, aber der Pathologe schien sich mit der Entscheidung außerordentlich viel Zeit zu lassen. Schließlich sah er Brunetti an. »Für mich gibt es hier nichts mehr zu tun, Guido. Ich schicke dir den Bericht so bald wie möglich.«
Brunetti nickte, sah, dass es schon fast ein Uhr morgens war, und dankte dem Doktor, dass er gekommen war, auch wenn das natürlich zu Rizzardis Dienstpflichten gehörte. Als der Doktor sich zum Gehen wandte, legte Brunetti ihm kurz eine Hand auf den Oberarm, sagte aber nichts mehr.
»Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin«, sagte Rizzardi. Damit wandte er sich ab und verließ die Wohnung.
[34] 4
Brunetti schloss die Tür, unbefriedigt von seinem Gespräch mit Rizzardi, weil der Doktor die Dinge nicht so sehen wollte, wie er selbst sie sah. Bevor er mit Vianello reden konnte, vernahmen sie von unten ein Geräusch: Wieder ging die Tür, dann waren Männerstimmen zu hören. Marillo kam an die Tür des Zimmers, in dem er mit seinen Leuten arbeitete, und sagte: »Der Doktor hat die schon vor einer Weile gerufen; die sollen sie abholen. Das sind sie jetzt wohl.«
Weder Brunetti noch Vianello erwiderte etwas, die Kriminaltechniker hielten in ihrer Arbeit inne. Schweigend und gebannt harrten sie alle aus bis zur Ankunft der Kollegen, die für die Toten zuständig waren. Brunetti ging öffnen. Die beiden Männer auf der Schwelle wirkten in ihren langen blauen Sanitäterkitteln ganz alltäglich. Einer hatte eine zusammengerollte Trage unterm Arm. Alle in der Wohnung wussten: Unten wartete ein Dritter mit dem schwarzen Plastiksarg, in den die Leiche gelegt würde, ehe man sie aus dem Haus trug und auf das wartende Boot brachte.
Stille Begrüßung, hier und da ein Nicken; die meisten waren sich schon früher unter ähnlichen Umständen begegnet. Brunetti, der ihre Gesichter, nicht aber ihre Namen kannte, wies den Flur hinunter. Die zwei Männer gingen in das Wohnzimmer, und Brunetti, Vianello sowie Marillo und hinter ihm seine zwei Mitarbeiter warteten, wobei sie zu überhören und nicht zu interpretieren versuchten, was sich dort abspielte. [35] Wenig später erschienen die beiden mit der Trage, die Gestalt darauf von einer dunkelblauen Decke verhüllt. Erleichtert registrierte Brunetti, dass die Decke sauber und frisch gebügelt war, auch wenn das eigentlich keinen Unterschied mehr machte.
Die beiden nickten Brunetti zu und verließen die Wohnung; Vianello schloss hinter ihnen die Tür. Niemand im Zimmer sagte etwas, solange die Männer die Treppe hinabstiegen. Als nichts mehr zu hören war und damit feststand, dass die Tote aus dem Haus gebracht worden war, rührte sich immer noch niemand. Schließlich brach Marillo den Bann, indem er sich abwandte und seine Leute wieder an die Arbeit scheuchte.
Vianello ging in das kleinere Gästezimmer, Brunetti folgte ihm. Das Bett war ordentlich gemacht, das weiße Laken über eine einfache graue Wolldecke umgeschlagen. Es gab nichts Auffälliges in diesem schlichten, fast militärisch – oder klösterlich – eingerichteten Zimmer zu sehen. Auch die Kriminaltechniker hatten bei der Suche nach Fingerabdrücken kaum sichtbare Spuren hinterlassen.
Brunetti ging durch das Zimmer und schob die Badezimmertür auf. Wer auch immer das Bett gemacht hatte, musste auch die Sachen auf den Ablagen dort geordnet haben: winzige Probeflaschen Shampoo und ein kleines, noch eingepacktes Stück Seife, wie man sie in Hotelzimmern findet; ein Kamm in einer Plastikhülle, eine ebenso verpackte Zahnbürste. An einem Halter neben der geschlossenen Duschkabine hingen frische Handtücher und ein Waschlappen.
Jemand rief nach Brunetti. Er und Vianello gingen in das [36]