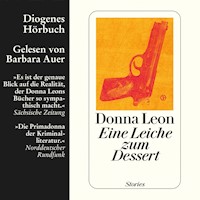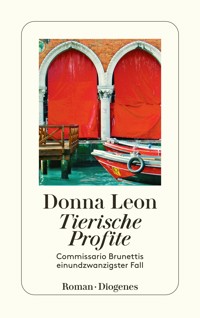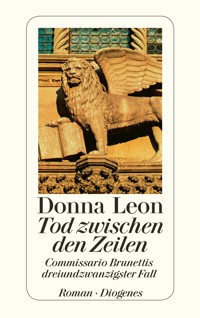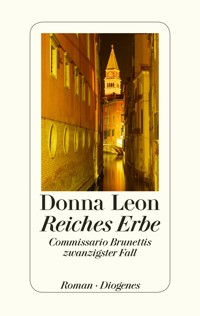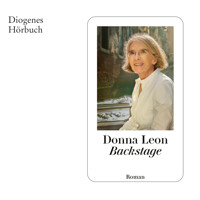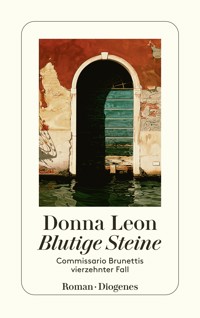
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Tod eines Afrikaners auf dem Campo Santo Stefano. Ein Streit unter Immigranten? Oder steckt mehr hinter der Ermordung eines Illegalen? Brunetti hakt trotz Warnungen von höchster Stelle nach und entdeckt Verbindungen, die weit über Venedig hinausreichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Donna Leon
Blutige Steine
Commissario Brunettis vierzehnter Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel des Originals:
›Blood from a Stone‹
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2006 im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Mozart, Die Zauberflöte
Text von Emanuel Schikaneder,
hrsg. von Kurt Soldan. Leipzig: Peters 1932
Umschlagfoto: Reynard Milici, ›Venice Door‹
Copyright © Louis K. Meisel Gallery, Inc./Corbis
Für Gesine Lübben
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23665 1 (5. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60072 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Weil ein Schwarzer häßlich ist, Ist mir denn kein Herz gegeben?
[7] 1
Zwei Männer traten durch den hölzernen Torbogen hinaus auf den festlich geschmückten Campo Santo Stefano, wo die farbigen Lichterketten über ihren Köpfen sie in buntscheckige Harlekine verwandelten. In den hell erleuchteten Buden auf dem Weihnachtsmarkt lockten Händler und Erzeuger verschiedener italienischer Provinzen mit ihren Spezialitäten: papierdünnes Brot und Käse mit tiefdunkler Rinde aus Sardinien, Oliven in unterschiedlichen Formen und Farben aus allen Regionen des Landes; Öl und Käse aus der Toskana; Salami in jeder Länge, jeder Dicke und mit allen nur erdenklichen Zutaten aus der Reggio Emilia. Hin und wieder stimmte einer der Verkäufer ein Loblied auf seine Delikatessen an: »Signori, kosten Sie diesen Käse, und ich garantiere Ihnen einen Vorgeschmack aufs Paradies.« – »Es ist spät, Herrschaften, und ich möchte endlich heim zum Abendessen: Also neun Euro das Kilo, so lange der Vorrat reicht.« – »Probieren Sie diesen Pecorino, Signori, einen besseren finden Sie nirgends!«
Die beiden Männer schoben sich durch die Budengasse, doch sie hatten kein Ohr für die Schmeicheleien der Händler, keinen Blick für die Salamipyramiden, die sich rechts und links auf den Tresen türmten. Die wenigen Käufer, die trotz der Kälte so kurz vor Ladenschluß noch unterwegs waren, erstanden Dinge, von denen jeder argwöhnte, bei sich im Viertel hätte er sie preiswerter und noch dazu in besserer Qualität bekommen. Andererseits: Was wäre wohl [8] stimmungsvoller als so ein Einkaufsbummel an einem verkaufsoffenen Adventssonntag; und gab es einen besseren Beweis für die eigene Unabhängigkeit und Individualität als den, sich etwas zu gönnen, das man gar nicht brauchte?
Am anderen Ende des campo, hinter der letzten Holzbude, machten die Männer halt. Der Größere sah auf seine Uhr, obwohl beide sich eben erst anhand der Kirchturmuhr versichert hatten, wie spät es war. Der offizielle Ladenschluß um halb acht war bereits um mehr als eine Viertelstunde überschritten, aber es würde sich wohl kaum ein Ordnungshüter dieser Kälte aussetzen, nur um zu kontrollieren, ob die Stände auch pünktlich zumachten. »Allora?« fragte der Kleinere und sah zu seinem Begleiter auf.
Dieser streifte die Handschuhe ab, stopfte sie zusammengerollt in die Manteltaschen und schob die Hände hinterher. Der andere folgte seinem Beispiel. Beide Männer trugen Kopfbedeckungen, der große einen dunkelgrauen Borsalino, der kleine eine Pelzmütze mit Ohrenklappen. Beide hatten Wollschals um den Hals geschlungen, die sie im Lichtkegel des letzten Standes noch höher zogen, bis zu den Ohren hinauf: nichts Ungewöhnliches, wenn einem vom Canal Grande, gleich hinter San Vidal, ein scharfer Wind entgegenblies.
Der Wind zwang sie auch, die Köpfe zu senken, als sie mit hochgezogenen Schultern, die Hände in den warmen Taschen, voranschritten. Zwanzig Meter hinter dem letzten Stand hatte sich zu beiden Seiten des Platzes eine Gruppe hochgewachsener Afrikaner eingefunden, die Decken oder Tücher auf dem Boden ausbreiteten und sie an den Ecken mit je einer Damenhandtasche beschwerten. Sobald die [9] Unterlage dergestalt verankert war, kamen aus riesigen, wurstförmigen Beuteln, die ringsum am Boden standen, stapelweise Modelltaschen unterschiedlicher Form und Größe zum Vorschein.
Hier eine Prada, dort eine Gucci, dazwischen eine Louis Vuitton: Die Marken waren so zahlreich vertreten wie sonst nur in jenen exklusiven Läden, die es sich leisten können, alle namhaften Designer zu führen. Flink und mit einer durch lange Übung geschulten Behendigkeit bückten sich die Männer oder gingen in die Hocke, um ihre Waren auf den Tüchern zu verteilen. Manche gruppierten sie zu lauter Dreiecken; andere bevorzugten eine Präsentation in Reih und Glied. Einer hatte den wunderlichen Einfall, seine Taschen im Kreis anzuordnen, doch als er zurücktrat, um das Ergebnis zu begutachten, und sah, daß eine übergroße dunkelbraune Schultertasche von Prada die Symmetrie durchbrach, wurde aus dem Kreis in Windeseile ein Spalier, dem die Prada in der linken oberen Ecke als Stütze diente.
Zwischendurch plauderten die Männer miteinander und tauschten sich über Dinge aus, die halt so zur Sprache kommen, wenn Kollegen sich während einer Schicht die Zeit vertreiben: daß einer die Nacht zuvor schlecht geschlafen hatte, wie bitterkalt es war, daß ein anderer darum bangte, ob sein Sohn die Aufnahmeprüfung für die Privatschule bestehen würde, wie sehr sie sich nach ihren Frauen sehnten. Sobald einer mit seinem Arrangement zufrieden war, stand er auf und trat hinter seine Waren zurück; wobei sie sich fast immer am einen oder anderen Deckenzipfel postierten, um das Gespräch mit dem Kollegen nebenan nicht abreißen zu lassen. Die Männer waren meist auffallend groß und alle [10] sehr schlank. Ihre Haut besaß – soweit das an Gesichtern und Händen zu erkennen war – den glänzenden Ebenholzschimmer jener Afrikaner, deren Vorfahren sich nie mit Weißen vermischt hatten. Sie wirkten nicht nur gesund und kräftig, sondern es lag auch eine gewisse Heiterkeit in ihren Zügen, ihren Bewegungen, so als könnten sie sich für diesen Abend kein größeres Vergnügen vorstellen, als in der klirrenden Kälte auszuharren, um gefälschte Markentaschen an Touristen zu verhökern.
Ihnen gegenüber hatten in einem kleinen Kreis von Zuhörern drei Straßenmusikanten Aufstellung genommen, zwei Geiger und ein Cellist, die ein Stück vortrugen, das ebenso barock wie verstimmt klang. Aber da die Musiker sich begeistert ins Zeug legten und zudem jung waren, fand ihr Publikum Gefallen an ihnen, und nicht wenige traten vor und warfen ein paar Münzen in den Geigenkasten, der aufgeklappt vor dem Trio stand.
Es war noch früh am Abend, vermutlich zu früh für einen schwunghaften Handel; dennoch nahmen die Straßenverkäufer stets pünktlich zum Ladenschluß ihre Arbeit auf. Und so standen, als die beiden Männer herankamen, alle Afrikaner hinter ihren Decken und warteten auf die erste Kundschaft. Frierend traten sie von einem Fuß auf den anderen und hauchten zwischendurch in die gefalteten Hände, ohne daß die davon warm geworden wären.
Am Ende des Deckenspaliers blieben die beiden Weißen, scheinbar ins Gespräch vertieft, stehen, obwohl in Wahrheit kein Wort zwischen ihnen fiel. Sie hielten die Köpfe gesenkt, wohl um die Gesichter vor dem Wind zu schützen; nur ab und zu hob einer von ihnen den Blick und nahm die [11] Reihe der Schwarzen ins Visier. Schließlich faßte der Größere den Kleinen am Arm, wies mit dem Kinn auf einen der Afrikaner und sagte etwas. Gleichzeitig schob sich eine Reisegruppe mit lauter Senioren, die in ihren farbenfrohen Gesundheitsschuhen und wattierten Parkas aussahen wie hutzlige Kleinkinder, von der Kirche her in die schmale Gasse zwischen den Straßenmusikanten und den Afrikanern. Auf halbem Wege blieb die Vorhut stehen, um auf die Nachzügler zu warten, und als alle wieder beisammen waren, flanierte man lachend und schwatzend an den Afrikanern vorbei und machte sich gegenseitig durch Zurufe auf die verschiedenen Taschensortimente aufmerksam. Ohne zu schubsen oder zu drängeln, nahmen sie nach und nach in Dreierreihe vor den Schwarzen und ihren Decken Aufstellung.
Der größere der beiden Männer steuerte auf die Seniorengruppe zu, dicht gefolgt von seinem Begleiter. Unweit der Kirche blieben sie stehen und postierten sich mit Bedacht hinter zwei älteren Ehepaaren, die abwechselnd auf die eine oder andere Tasche zeigten und sich nach dem Preis erkundigten. Der junge Händler, vor dessen Tuch sich das abspielte, war so sehr auf die Fragen seiner potentiellen Käufer konzentriert, daß er die beiden Männer zunächst gar nicht bemerkte. Plötzlich aber stockte er und straffte sich, angespannt wie ein Tier, das Gefahr wittert.
Sein Nachbar nutzte geistesgegenwärtig diese Chance, dem Kollegen die vielversprechende Kundschaft abzuwerben. Ihre Schuhe verrieten ihm, daß er es mit Amerikanern zu tun hatte, und so legte er sofort auf englisch los: »Gucci, Missoni, Armani, Trussardi. Bei mir finden Sie alles, Ladies [12] und Gentlemen. Beste Qualität, direkt vom Hersteller.« Bei der schummrigen Beleuchtung hier am Ende des Platzes war sein Gesicht kaum zu erkennen; um so heller blitzten die lächelnd entblößten, strahlend weißen Zähne.
Drei Mitglieder der Seniorengruppe schlängelten sich an den beiden Männern vorbei zu ihren Freunden nach vorne durch; man diskutierte lebhaft über die Taschen, wobei das Interesse mittlerweile zwischen den Angeboten der beiden rivalisierenden Händler schwankte. Auch die zwei Außenseiter rückten auf ein Zeichen des Größeren näher, bis sie nur noch ein halber Schritt von den Amerikanern in der ersten Reihe trennte. Als er sie vortreten sah, stieß sich der erste Verkäufer mit dem rechten Fuß ab und wich in einer halben Drehbewegung von seinem Tuch, vor den Touristen und den beiden Männern zurück. Die aber zogen gleichzeitig und so geschmeidig und routiniert, daß es niemandem auffiel, die rechte Hand aus der Tasche und zückten jeder eine Pistole mit aufgesetztem Schalldämpfer. Der Größere feuerte zuerst, doch man hörte nichts weiter als ein dumpfes Tock, Tock, Tock, begleitet vom zweifachen Echo aus der Waffe seines Gefährten. Die Straßenmusikanten waren unterdessen ans Ende des Allegros gelangt, und ihre Instrumente im Verein mit den Zurufen und dem Gejohle des sie umringenden Publikums verschluckten die Schüsse buchstäblich, auch wenn die Afrikaner zu beiden Seiten der Gasse sofort darauf reagierten.
Seine Schwungkraft trug den jungen Taschenverkäufer noch ein Stück weit von seinem Tuch fort; dann erschlaffte die Bewegung allmählich. Die zwei Männer, die ihre Waffen blitzschnell wieder eingesteckt hatten, entfernten sich [13] rückwärts durch die Menge, die ihnen höflich Platz machte. Gleich darauf trennten sie sich: Einer lief zur Accademia-Brücke, der andere Richtung Santo Stefano und Rialto, und im Nu verschwanden beide im Strom der hin und her eilenden Passanten.
Der junge Afrikaner stieß einen Schrei aus und riß den Arm hoch. Einmal noch drehte sein Körper sich halb um die eigene Achse, dann stürzte der Mann inmitten seiner Taschen zu Boden.
Wie aufgescheuchte Gazellen, die beim ersten Gefahrenzeichen in panischer Angst das Weite suchen, erstarrten seine Kollegen eine Schrecksekunde lang, um dann um so ungestümer auszubrechen. Vier von ihnen ließen ihre Waren einfach im Stich und rannten wie gehetzt in die calle zum Markusplatz; zwei nahmen sich die Zeit, mit jeder Hand vier oder fünf Taschen zusammenzuraffen, bevor sie über die Brücke zum Campo San Samuele verschwanden; die vier übrigen ließen alles stehen und liegen und flohen in Richtung Canal Grande, wo sie eine andere Händlergruppe aufschreckten, über deren am Fuß der Brücke plazierte Tücher sie hinwegpreschten, bevor sie auseinanderstoben und in den calli von Dorsoduro abtauchten.
Drüben auf dem Weihnachtsmarkt hatte eine weißhaarige Frau, die direkt vor seiner Auslage stand, mit angesehen, wie der junge Schwarze zusammenbrach. Sie rief nach ihrem Mann, der ein Stück weit abgedrängt worden war, und kniete neben dem Gestürzten nieder. Das Tuch, auf dem er lag, tränkte sich mit dem Blut, das unter dem Körper hervorsickerte.
Als der Mann seine Frau rufen hörte und sie zu Boden [14] gleiten sah, drängte er sich erschrocken zu ihr durch. Erst als er beschützend den Arm um sie legte, sah er den Afrikaner in seinem Blut liegen. Lange, bange Sekunden tastete er nach dem Puls des Mannes, dann ließ er die Hand sinken und erhob sich mühsam; die altersschwachen Knie wollten nicht mehr so recht. Noch einmal bückte er sich, um seiner Frau aufzuhelfen.
Suchend blickten die beiden um sich, sahen aber nur die Mitglieder ihrer Reisegruppe, die verständnislos von einem zum anderen und dann wieder auf den Mann zu ihren Füßen starrten. Am Boden ausgebreitet, lagen die verlassenen Tücher, zumeist noch mit den gefällig zur Schau gestellten Taschen bestückt. Die Musikanten drüben hörten auf zu spielen, als ihre Zuhörer sich einer nach dem anderen abwandten.
Es dauerte noch einige Minuten, bis der erste Italiener hinzukam. Sobald er den Schwarzen am Boden liegen sah, dazu das blutige Tuch, zog er sein telefonino
[15] 2
Die Polizei rückte in einem Tempo an, das die italienischen Zuschauer verblüffte, die Amerikaner dagegen empörte. Eine halbe Stunde, um ein Boot zu ordern und einen Trupp Beamte samt Spurensicherung zum Campo Santo Stefano zu befördern, erschien den Venezianern nicht lange, doch da waren die meisten Amerikaner schon entnervt auf und davon, nachdem sie untereinander vereinbart hatten, daß man sich im Hotel wiedertreffen werde. Niemand fühlte sich bemüßigt, den Tatort im Auge zu behalten, und folglich waren, als die Polizei endlich eintraf, die meisten Taschen von den Tüchern verschwunden, sogar von dem mit der Leiche. Einige von denen, die den Toten bestohlen hatten, hinterließen rote Fußspuren auf seinem Tuch; ein Paar davon verlor sich als blutige Fährte in Richtung Rialto.
Alvise, der erste Beamte am Tatort, befahl der kleinen Menschentraube, die immer noch um den Toten versammelt war, zurückzutreten. Dann näherte er sich der Leiche und betrachtete sie, als wisse er nicht recht, was jetzt, da er das Opfer vor sich sah, zu tun sei. Endlich bat ihn ein Kriminaltechniker, aus dem Weg zu gehen, während er das Tuch mit Holzpfosten umstellte. Einer der Kisten, die seine Leute mitgebracht hatten, entnahm er eine Rolle rot-weiß gestreiftes Plastikband, fädelte es durch die Schlitze am Kopf der Pfosten und schuf so eine deutliche Abgrenzung zwischen dem Toten und dem Rest der Welt.
Alvise trat unterdessen zu einem Mann, der auf den [16] Kirchenstufen stand, und fragte in herrischem Ton: »Wie heißen Sie?«
»Riccardo Lombardi«, antwortete der Mann. Er war groß, um die Fünfzig, gut gekleidet, jemand, der nach Alvises Einschätzung hinter einem Schreibtisch saß und Anweisungen erteilte.
»Und was machen Sie hier?«
Erstaunt über den Ton des Polizisten, antwortete der Mann: »Ich kam zufällig vorbei, und als ich den Auflauf sah, bin ich stehengeblieben.«
»Haben Sie gesehen, wer’s war?«
»Was meinen Sie?«
Erst da fiel Alvise ein, daß er ja selbst noch keine Ahnung hatte, was vorgefallen war. Er wußte nur, daß jemand die Questura angerufen und gemeldet hatte, auf dem Campo Santo Stefano liege ein toter Schwarzer. »Können Sie sich ausweisen?« fragte er barsch.
Der Mann zückte seine Brieftasche und reichte Alvise eine carta d’identità. Der Sergente warf einen Blick darauf, gab sie zurück und erkundigte sich in unverändertem Ton: »Haben Sie etwas gesehen?«
»Ich sagte doch schon, ich kam zufällig hier vorbei, sah die vielen Leute und blieb stehen, um zu erfahren, was los sei. Weiter nichts.«
»Na schön. Sie können gehen«, erklärte Alvise gebieterisch. Dann machte er kehrt und ging zurück zur Absperrung, hinter der die Fotografen ihre Ausrüstung schon wieder einpackten.
»Was gefunden?« fragte er einen Mann von der Spurensicherung.
[17] Santini, der am Boden kniete und in Handschuhen zwischen den Pflastersteinen nach Patronenhülsen suchte, sah kurz auf. »Ja, einen Toten«, meinte er trocken und machte sich wieder an die Arbeit.
Alvise ließ sich von der Abfuhr nicht beirren, holte Notizblock und Füller aus der Innentasche seines Uniformparkas, schlug den Block auf und schrieb: »Campo Santo Stefano.« Er hielt inne und ergänzte nach einem Blick auf seine Uhr: »20 Uhr 58«, bevor er den Füller zuschraubte und ihn mitsamt dem Block wieder einsteckte.
Da hörte er von rechts eine vertraute Stimme fragen: »Was ist denn hier los, Alvise?«
Mit einer trägen Handbewegung deutete der Beamte ein Salutieren an und sagte: »Ich weiß nicht genau, Commissario. Jemand hat uns angerufen und einen Toten gemeldet. Also sind wir hergefahren.«
Sein Vorgesetzter, Commissario Guido Brunetti, entgegnete ungehalten: »Daß der Mann tot ist, sehe ich, Alvise. Aber wie ist er ums Leben gekommen?«
»Ich weiß nicht, Commissario. Wir warten noch auf den Doktor.«
»Wer kommt?« fragte Brunetti.
»Wer kommt wohin, Commissario?« fragte Alvise verdutzt zurück.
»Welcher Gerichtsmediziner kommt? Haben Sie sich erkundigt?«
»Nein, Commissario. Ich mußte doch in aller Eile die Spurensicherung zusammentrommeln. Da habe ich die Kollegen in der Questura beauftragt, im Ospedale anzurufen, damit man einen Doktor herschickt.«
[18] Brunettis Frage war beantwortet, als Dottor Ettore Rizzardi, medico legale der Stadt Venedig, auf der Bildfläche erschien.
»Ciao, Guido.« Rizzardi nahm seine Tasche in die andere Hand und bot dem Commissario die Rechte. »Na, was haben wir denn heute?«
»Einen Toten«, antwortete Brunetti. »Die diensthabenden Kollegen haben mich zu Hause angerufen. Es hieß, hier sei ein Mord geschehen. Mehr weiß ich nicht. Ich bin auch eben erst gekommen.«
»Dann wollen wir uns die Sache mal ansehen.« Rizzardi ging auf die Absperrung zu. »Hast du schon mit jemandem gesprochen?« fragte er noch.
»Nein. Bis jetzt mit niemandem.« Gespräche mit Alvise zählten nicht.
Rizzardi bückte sich und schlüpfte, mit einer Hand aufs Pflaster gestützt, unter der Absperrung durch. Dann hielt er das Plastikband hoch, damit Brunetti ihm leichter folgen konnte. »Habt ihr schon Aufnahmen gemacht?« fragte Rizzardi einen der Kriminaltechniker.
»Sì, Dottore«, antwortete der Mann. »Von allen Seiten.«
»Dann kann’s ja losgehen«, meinte Rizzardi und stellte seine Tasche ab. Er holte zwei Paar Plastikhandschuhe heraus und reichte eines davon Brunetti. »Willst du mir assistieren?« fragte er.
Die beiden knieten neben der Leiche nieder, der eine rechts, der andere links. Der Mann war vornübergestürzt, man sah nur die Hände und die rechte Gesichtshälfte. Brunetti staunte im ersten Moment über die tiefschwarze Haut, wunderte sich dann aber über sich selbst: Was hatte er bei [19] einem Afrikaner anderes erwartet? Im Unterschied zu den schwarzen Amerikanern, die er kannte und deren Schattierung von Kakao bis Kupfer reichte, wirkte die Haut dieses Mannes wie auf Hochglanz poliertes Ebenholz.
Gemeinsam griffen Brunetti und Rizzardi unter den Leichnam und drehten ihn auf den Rücken. Die frostige Kälte hatte das ausgetretene Blut rasch gerinnen lassen. Mit den Knien hielten die beiden das Tuch, auf dem der Tote lag, am Boden fest. Doch als sie ihn anhoben, blieben Jacke und Tuch aneinander haften und lösten sich mit einem satten Schmatzlaut vom Pflaster. Bei dem Geräusch ließ Rizzardi die Schulter des Mannes wieder zu Boden gleiten; stumm folgte Brunetti seinem Beispiel.
Blutversteifte Stoffzacken auf der Brust des Toten erinnerten makaber an die Garnierung einer Geburtstagstorte durch einen phantasievollen Konditor.
»Verzeihung«, sagte Rizzardi – ob zu Brunetti oder dem Toten, blieb ungewiß. Immer noch kniend, beugte er sich vor und betastete mit behandschuhten Fingern eins nach dem anderen die Löcher im Parka. »Fünf Einschüsse«, murmelte er. »Die wollten offenbar ganz sichergehen.«
Brunetti sah, daß die Augen des Toten offenstanden; ebenso wie sein Mund, der im panischen Aufschrei beim ersten Schuß erstarrt schien. Er war ein gutaussehender junger Mann, dessen blendendweiße Zähne in auffallendem Kontrast zum schwarzglänzenden Teint standen. Brunetti schob eine Hand in die rechte, dann in die linke Tasche des Parkas und förderte etwas Kleingeld und ein gebrauchtes Taschentuch zutage. In der Innentasche fanden sich ein Schlüsselbund und ein paar kleine Euroscheine. Außerdem [20] eine ricevuta fiscale von einer Bar in San Marco, wahrscheinlich eins der Lokale hier auf dem campo. Sonst nichts.
»Wer sollte einen vucumprà umbringen wollen?« fragte Rizzardi und erhob sich. »Als ob es für die armen Teufel nicht so schon schwer genug wäre.« Forschend betrachtete er den Toten. »Welche Kugel tödlich war, kann ich zwar erst nach der Obduktion sagen, aber von den drei Einschüssen in der Herzgegend hätte sicher jeder einzelne ausgereicht, ihn ins Jenseits zu befördern.« Und während er seine Handschuhe in die Tasche steckte, fragte Rizzardi noch: »Glaubst du, es war ein Profikiller?«
»Sieht ganz danach aus«, antwortete Brunetti. Was diesen Mord nur noch rätselhafter machte. Dienstlich hatte er sich bisher noch nie mit den vucumprà zu befassen brauchen, da Gewaltverbrechen in ihren Reihen höchst selten vorkamen, und diese wenigen Fälle waren immer in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Kommissariats gefallen. Wie die meisten Polizisten, ja wie der Großteil der Bevölkerung hatte auch Brunetti angenommen, daß die Senegalesen von einem Kartell des organisierten Verbrechens in Schach gehalten wurden. Womit oftmals ihr so überaus höfliches Auftreten in der Öffentlichkeit begründet wurde: Solange sie nicht unangenehm auffielen, würde sich kaum jemand die Mühe machen nachzuforschen, wie sie es anstellten, für die Behörden quasi unsichtbar und daher unbehelligt zu bleiben. Brunetti selbst hatte mit den Jahren aufgehört, sie zu bemerken, und erinnerte sich kaum noch, wann die Senegalesen die ursprünglichen vucumprà – französischsprachige Algerier und Marokkaner – ersetzt hatten.
Ungeachtet gelegentlicher Razzien und [21] Ausweiskontrollen hatte man die vucumprà nie so wichtig genommen, als daß sie Opfer von Vice-Questore Pattas berüchtigten Großeinsätzen geworden wären. Obwohl sie sich illegal in Italien aufhielten und obendrein Schwarzarbeit betrieben, ließen die Ordnungskräfte sie nahezu ungehindert ihrem Gewerbe nachgehen und vermieden so das bürokratische Fiasko, das unweigerlich entstanden wäre, hätte man ernsthaft versucht, Hunderte von Ausländern ohne gültige Papiere auszuweisen und in den Senegal zurückzuschicken, wo die meisten von ihnen mutmaßlich herstammten.
Warum aber dann dieser brutale Mord, der unverkennbar den Stempel des Profikillers trug?
»Wie alt schätzt du ihn?« fragte Brunetti, um das lange Schweigen zu beenden.
»Ich weiß nicht.« Rizzardi schüttelte ratlos den Kopf. »Bei Schwarzen kann ich das schwer beurteilen, solange ich sie nicht inwendig sehe, aber ich tippe auf Anfang Dreißig, vielleicht auch jünger.«
»Hast du Zeit?«
»Gleich morgen früh. Reicht das?«
Brunetti nickte.
Rizzardi bückte sich nach seinem Arztkoffer. »Ich weiß nicht, warum ich den immer mitschleppe«, sagte er. »Als ob ich ihn je brauchen könnte, um ein Menschenleben zu retten. Macht der Gewohnheit, nehme ich an«, setzte er schulterzuckend hinzu. Dann gab er Brunetti die Hand und wandte sich zum Gehen.
Brunetti rief den Kriminaltechniker zu sich, der die Fotos gemacht hatte. »Wenn ihr den Toten in die Gerichtsmedizin bringt, würden Sie dann noch einmal sein Gesicht [22] fotografieren – im Profil sowie frontal – und mir die Aufnahmen zukommen lassen, sobald sie entwickelt sind?«
»Wie viele Abzüge, Commissario?«
»Jeweils ein Dutzend.«
»Geht in Ordnung. Bis morgen früh.«
Brunetti bedankte sich und winkte Alvise heran, der in Hörweite gelauert hatte. »Haben wir irgendwelche Augenzeugen?« fragte er.
»Nein, Commissario.«
»Mit wem haben Sie denn gesprochen?«
»Mit einem Mann«, antwortete Alvise und deutete zur Kirche hinüber.
»Name?« fragte Brunetti.
Alvises Augen weiteten sich in unverhohlenem Staunen. Nach einer so ausgedehnten Pause, daß sie jedem anderen peinlich gewesen wäre, sagte er endlich: »Den habe ich nicht behalten, Commissario.« Und auf Brunettis eisiges Schweigen hin verteidigte er sich: »Der Mann sagte, er habe nichts gesehen, Commissario. Wozu hätte ich da seinen Namen notieren sollen?«
Brunetti wandte sich an die beiden Sanitäter, die eben eingetroffen waren. »Ihr könnt ihn jetzt ins Ospedale bringen, Mauro«, sagte er und fügte hinzu: »Alvise wird euch begleiten.«
Bevor der Sergente widersprechen konnte, erklärte ihm Brunetti: »Da können Sie gleich feststellen, ob in der Klinik ein Patient mit Schußverletzungen eingeliefert wurde.« Bei der offenkundigen Treffsicherheit der Schützen, die den Afrikaner getötet hatten, war das zwar unwahrscheinlich, aber wenigstens schaffte ihm diese Ausrede Alvise vom Hals.
[23] »Geht in Ordnung, Commissario«, versetzte Alvise und wiederholte seinen schlaffen Salut. Er sah zu, wie die beiden Sanitäter den Toten auf die Bahre legten, und geleitete sie dann mit so gewichtigen Schritten zu ihrem Boot zurück, als könnten sie den Weg dorthin nur dank seiner Führung finden.
Brunetti rief den Mann vom Erkennungsdienst zu sich, der gerade jenseits des abgesperrten Bereichs Nahaufnahmen von den Fußspuren machte, die zum Rialto führten. »Ist Alvise allein gekommen?«
»Ich glaube, ja, Commissario«, antwortete der Mann. »Riverre war unterwegs, eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt.«
»Hat schon jemand versucht, etwaige Zeugen zu ermitteln?« forschte Brunetti weiter.
Der Kriminaltechniker sah ihn lange schweigend an. »Alvise?« fragte er lakonisch zurück, bevor er sich wieder über seinen Fotoapparat beugte.
An einer Gartenmauer lehnten ein paar Teenager. Brunetti ging auf sie zu und erkundigte sich, ob sie etwas beobachtet hätten.
»Nein, Signore«, antwortete einer aus der Gruppe. »Wir sind eben erst gekommen.«
Seufzend kehrte Brunetti zu dem abgesperrten Bereich zurück, wo sich drei oder vier Passanten eingefunden hatten. »War jemand von Ihnen dabei, als es passierte?« fragte er.
Die Leute wandten sich ab und blickten angelegentlich zu Boden. »Haben Sie irgend etwas gesehen?« versuchte Brunetti es noch einmal. Doch sein Ton blieb sachlich, er verlegte sich nicht aufs Bitten.
[24] Ein Mann im Hintergrund stahl sich davon und verschwand über den campo. Brunetti machte keine Anstalten, ihn aufzuhalten. Unterdessen löste sich auch das restliche Grüppchen auf, bis bloß noch eine alte Frau übrigblieb, die sich nur mit Hilfe zweier Krückstöcke aufrecht hielt. Brunetti kannte sie vom Sehen und wußte, daß sie normalerweise von zwei räudigen alten Kötern begleitet wurde. Als sie herangehumpelt kam, sah er das runzlige Gesicht, die dunklen Augen, die weißen Borsten am Kinn.
»Ja, Signora?« fragte er. »Haben Sie vielleicht etwas gesehen?« Unwillkürlich hatte er sie im venezianischen Dialekt angesprochen.
»Es waren ein paar Amerikaner dabei, als es passierte.«
»Woher wissen Sie denn, daß es Amerikaner waren, Signora?« forschte er.
»Sie trugen weiße Schuhe und haben sehr laut gesprochen«, antwortete sie.
»Und Sie?« hakte er nach. »Waren Sie dabei, als es passiert ist? Haben Sie es mit angesehen?«
Sie hob den rechten Stock und wies damit auf die Apotheke in etwa zwanzig Meter Entfernung. »Nein, ich stand da drüben. War eben erst gekommen. Aber die Amerikaner, die habe ich gesehen. Sie kamen von der Brücke her und sind hier entlanggegangen. Alle haben bei den vucumprà haltgemacht und sich ihre Taschen angeschaut.«
»Und Sie, Signora?«
Die Alte bewegte ihren Stock ein paar Millimeter nach links. »Ich bin in die Bar gegangen.«
»Wie lange haben Sie sich dort aufgehalten, Signora?«
»Lange genug.«
[25] »Lange genug wofür?« fragte Brunetti lächelnd und keineswegs verärgert über ihre unklare Antwort.
»Wissen Sie, kurz nach acht sammelt Barbara – ihr gehört die Bar – alle unverkauften tramezzini ein und stellt sie, in kleine Stücke zerteilt, auf die Theke. Wer etwas zu trinken bestellt, darf davon essen, so viel er mag.«
Das überraschte Brunetti, der solche Großzügigkeit von Barbesitzern, ja von Besitzern überhaupt nicht gewohnt war.
»Sie ist ein braves Mädchen, die Barbara«, fuhr die Alte fort. »Und ich habe schon ihre Mutter gekannt.«
»Und wie lange ungefähr waren Sie in der Bar, Signora?« fragte Brunetti.
»Etwa eine halbe Stunde«, antwortete die Alte und setzte erklärend hinzu: »Das ist mein Abendessen, wissen Sie. Ich gehe jeden Abend in die Bar.«
»Gut zu wissen, Signora. Ich werde dran denken, falls ich mal wieder in die Gegend komme.«
»Sie sind doch jetzt da«, entgegnete die Alte, und als er nicht darauf einging, fuhr sie fort: »Die Amerikaner sind auch reingegangen. Also zwei von ihnen«, erläuterte sie und wies abermals mit erhobenem Stock auf die Bar.
»Sie sitzen ganz hinten und trinken heiße Schokolade. Wenn es Ihnen paßt, könnten Sie die beiden jetzt gleich befragen.«
»Ich danke Ihnen, Signora«, versetzte Brunetti und wandte sich der Bar zu.
»Am besten schmecken die mit prosciutto und carciofi
[26] 3
Brunetti war schon seit Jahren nicht mehr in der Bar gewesen, nicht seit jenem kurzen Intermezzo, als eine amerikanische Eisdiele dort Einzug gehalten und so mächtige Kalorienbomben angeboten hatte, daß er nach einmaligem Verzehr unter heftigen Verdauungsbeschwerden litt. Es hatte, erinnerte er sich, fast so geschmeckt wie Schmalz, allerdings nicht das salzige Schweineschmalz aus seiner Kindheit, das dazu diente, einen Topf Bohnen oder Linsensuppe geschmacklich abzurunden, sondern so, wie pures Schmalz schmecken würde, wenn man es mit Zucker und Erdbeeren versetzt.
Seine Mitbürger hatten das offenbar ähnlich empfunden, denn schon nach kurzer Zeit war der nächste Besitzerwechsel erfolgt. Doch Brunetti war seitdem nicht mehr hergekommen. Inzwischen waren die Eiströge verschwunden, und das Café präsentierte sich wieder im Stil einer italienischen Bar. Die Gäste, die an der geschwungenen Theke standen, unterhielten sich lebhaft und deuteten oft nach draußen, auf den jetzt verlassenen campo. Ein paar andere saßen an kleinen Tischen, die den Durchgang zum hinteren Teil des Lokals säumten. Von den drei Frauen hinter der Bar grüßte eine den eintretenden Brunetti mit einem freundlichen Lächeln. Er ging nach hinten durch und sah am letzten Tisch links ein älteres Paar sitzen. Daß es Amerikaner waren, erkannte man auf den ersten Blick; fehlte nur noch das Sternenbanner. Im übrigen konnte Brunetti sich des [27] wunderlichen Eindrucks nicht erwehren, die beiden hätten ihre Kleider vertauscht. Die Frau trug ein kariertes Flanellhemd und ein Paar dicke Wollhosen, der Mann einen rosa Pulli mit V-Ausschnitt, dunkle Hose und weiße Tennisschuhe. Beide hatten offensichtlich denselben Friseur. Die Haare der Frau waren nicht eigentlich länger als die ihres Mannes: Sie waren nur nicht ganz so kurz.
»Verzeihen Sie«, sagte Brunetti auf englisch, als er an Ihren Tisch trat. »Aber darf ich fragen, ob Sie vorhin draußen auf dem campo waren?«
»Als der schwarze Händler getötet wurde?« fragte die Frau zurück.
»Ja«, bestätigte Brunetti.
Der Mann zog Brunetti einen Stuhl heran und blieb mit altmodischer Galanterie stehen, bis der Commissario Platz genommen hatte. »Ich bin Guido Brunetti, von der venezianischen Polizei«, stellte Brunetti sich vor. »Und ich interessiere mich für alles, was Sie dort draußen gesehen haben.«
Die beiden Amerikaner hatten typische Seefahrergesichter: ständig blinzelnde, zusammengekniffene Augen, tiefe Falten in der von zuviel Sonne gegerbten Haut und jenen klaren Blick, der auch durch schwere See nicht zu erschüttern ist.
Der Mann streckte die Hand aus und sagte: »Ich bin Fred Crowley, und das ist meine Frau Martha.« Als er Brunettis Hand losließ, überraschte die Frau den Commissario mit ihrem festen Händedruck.
»Wir kommen aus Maine«, erklärte sie. »Genauer gesagt, aus Biddeford Pool«, und als sei das noch nicht präzise genug, ergänzte sie: »Unser Ort liegt direkt am Meer.«
[28] »How do you do, Mr. und Mrs. Crowley«, versetzte Brunetti, selbst überrascht, daß ihm diese altmodische Floskel noch geläufig war. »Wenn Sie mir nun bitte schildern würden, was Sie gesehen haben?« Welch eine merkwürdige Konstellation: er, der ungeduldige Italiener, und diese beiden Amerikaner, die erst umständlich den Höflichkeitsregeln Genüge tun mußten, ehe sie sich den eigentlich wichtigen Dingen widmen konnten.
»Doctores«, berichtigte die Frau.
»Wie meinen Sie?« fragte Brunetti verständnislos.
»Dr. Crowley und Dr. Crowley«, erklärte sie. »Fred ist Chirurg, ich bin Internistin.« Und bevor Brunetti sein Erstaunen darüber äußern konnte, daß Leute ihres Alters noch berufstätig seien, ergänzte sie: »Das heißt, wir waren’s, bis zu unserer Pensionierung.«
»Verstehe«, sagte Brunetti und hielt inne. Ob die beiden wohl jetzt gesonnen waren, seine eigentliche Frage zu beantworten?
Sie wechselten einen Blick, dann ergriff wieder die Frau das Wort. »Also wir waren gerade drüben auf diesem campo angekommen, da entdeckte ich die fliegenden Händler mit all den Taschen. Ich wollte sehen, ob vielleicht etwas für unsere Enkeltochter dabei wäre, und ich stand ganz vorn und schaute mir die Waren an, als ich dieses merkwürdige Geräusch hörte – es klang ungefähr wie das pfft, pfft, pfft ihrer Kaffeemaschinen, wenn man den Hebel betätigt, damit der Dampf austritt. Dreimal rechts von mir und dann noch zweimal von links, immer das gleiche Geräusch: pfft, pfft.« Sie stockte, als höre sie es noch einmal, und fuhr dann fort. »Ich drehte mich um, wollte feststellen, woher das Geräusch [29] kam, aber ich sah nur die Leute neben und hinter mir, einige davon aus meiner Reisegruppe, und einen Mann im Überzieher. Als ich mich wieder umwandte, da lag dieser arme junge Mensch am Boden. Ich kniete mich neben ihn hin und versuchte ihm zu helfen. Ich glaube, dann habe ich nach Fred gerufen, vielleicht aber auch erst später, als ich das Blut sah. Zuerst nahm ich an, der junge Mann sei ohnmächtig geworden, ein Schwächeanfall, womöglich weil er die Kälte nicht gewohnt war. Doch dann sah ich das Blut, und wahrscheinlich habe ich in dem Moment nach Fred gerufen; genau weiß ich es nicht mehr. Wissen Sie, mein Mann hat sehr viel in der Notaufnahme gearbeitet. Aber als Fred endlich kam, wußte ich bereits, daß der junge Mann tot war.« Sie überlegte einen Moment und fuhr dann fort: »Ich weiß nicht, wieso ich mir so sicher war, denn ich konnte nur seinen Hinterkopf sehen, aber sie haben so eine Aura um sich, die Toten. Als Fred neben mir niederkniete und ihn berührte, wußte auch er gleich Bescheid.«
Brunetti wandte sich ihrem Gatten zu, der jetzt das Wort ergriff. »Martha hat ganz recht. Ich wußte es sogar schon, bevor ich ihn anlangte. Der arme Junge war noch warm, doch das Leben war bereits aus seinem Körper gewichen. Kann nicht älter als dreißig gewesen sein.« Dr. Crowley schüttelte den Kopf. »Ganz gleich wie oft man es mit ansieht, die Erfahrung ist immer wieder neu. Und furchtbar.« Abermals schüttelte er den Kopf und schob, wie um seine Worte zu unterstreichen, die leere Tasse ein paar Zentimeter von sich fort.
Seine Frau legte ihre Hand auf die seine und sagte so vertraulich, als wäre Brunetti gar nicht dabei: »Wir hätten [30] nichts mehr machen können, Fred. Diese beiden Männer wußten genau, was sie taten.«
Sie sagte es mit der größten Selbstverständlichkeit: »diese beiden Männer«.
»Was denn für Männer?« fragte Brunetti so ruhig wie irgend möglich. »Können Sie mir die vielleicht beschreiben?«
»Also da war einmal der im Überzieher«, begann Martha Crowley. »Er stand rechts hinter mir. Den zweiten habe ich nicht gesehen, aber er muß links von mir gestanden haben, weil doch das Geräusch von dort kam. Ich bin nicht einmal sicher, ob es ein Mann gewesen ist. Das habe ich nur angenommen, weil doch der andere, also der im Überzieher, ein Mann war.«
»Und Sie, Doktor?« wandte Brunetti sich an den Ehemann. »Haben Sie diese Männer auch gesehen?«
Fred Crowley schüttelte den Kopf. »Leider nein. Ich war wohl zu sehr mit dem Feilschen um die Taschen beschäftigt. Nicht einmal das Geräusch habe ich mitbekommen.« Wie zum Beweis drehte er den Kopf zur Seite und zeigte Brunetti die elfenbeinfarbene Schnecke des Hörgeräts in seinem linken Ohr. »Als ich Martha rufen hörte, hatte ich keine Ahnung, was los war. Ehrlich gesagt befürchtete ich, ihr sei etwas zugestoßen, und so drängte ich mich durch die Menge, um so rasch wie möglich zu ihr zu gelangen. Und als ich sie da am Boden sah, obschon sie kniete – also ich werde Ihnen nicht sagen, was ich vermutete, aber es war jedenfalls nichts Gutes.« Wie von einer schmerzlichen Erinnerung heimgesucht, stockte er und lächelte unsicher.
Brunetti war klug genug, ihn nicht zu drängen, und nach einer kurzen Pause nahm Crowley den Faden wieder auf. [31] »Wie gesagt, sobald ich den jungen Mann berührte, wußte ich, daß es vorbei war mit ihm.«
Brunetti wandte sich wieder Martha Crowley zu. »Diesen Mann, den Sie gesehen haben, Dottoressa, können Sie mir sagen, wie der aussah?«
In dem Moment kam die Bedienung und erkundigte sich nach ihren Wünschen. Brunetti sah die Amerikaner an, aber beide schüttelten den Kopf. Obwohl ihm nicht danach war, bestellte der Commissario einen Kaffee.
Eine ganze Minute verging schweigend. Die Frau blickte auf ihre leere Tasse, folgte dem Beispiel ihres Mannes und schob sie fort. Dann sah sie wieder Brunetti an und sagte: »Es fällt mir nicht leicht, ihn zu beschreiben. Er trug einen Hut, so einen wie die Männer im Kino.« Und zur Verdeutlichung setzte sie hinzu: »Also früher, in den Filmen der dreißiger und vierziger Jahre.«
Sie hielt inne, als versuche sie sich die Szene ins Gedächtnis zu rufen. »Nein, alles, woran ich mich erinnere, ist eine sehr große, kräftige Gestalt. Er trug, wie gesagt, einen Überzieher – grau oder dunkelbraun, ich weiß es wirklich nicht. Und diesen Hut.«
Die Bedienung brachte Brunetti den Kaffee und ging wieder. Der Commissario ließ die Tasse unberührt, lächelte Martha Crowley ermunternd zu und sagte: »Bitte, fahren Sie fort.«
»Ja, also ich glaube, er hatte einen Schal umgebunden; grau vielleicht oder auch schwarz. Die Leute standen ja so dicht gedrängt, daß ich den Mann nur von der Seite gesehen habe.«
»Können Sie sein Alter schätzen?« fragte Brunetti.
[32] »Oh, ich weiß nicht, es war ein erwachsener Mann, soviel ist sicher, vielleicht in Ihrem Alter«, antwortete sie. »Ich glaube, er hatte dunkles Haar, aber bei der Beleuchtung und mit dem Hut ist das schwer zu sagen. Und ich habe ja auch nicht sonderlich auf ihn geachtet, weil ich doch keine Ahnung hatte, was passieren würde.«
Obwohl ihm klar war, wie das im Hinblick auf das Opfer klingen mußte, fragte Brunetti: »War es ein Weißer?«
»O ja, er war Europäer«, antwortete Martha Crowley. »Mir scheint allerdings, er wirkte südländischer als mein Mann und ich.« Sie milderte ihren Nachsatz mit einem Lächeln ab, und Brunetti nahm auch keinen Anstoß daran.
»Woraus schließen Sie das?« fragte er.
»Nun, ich glaube, sein Teint war dunkler als unserer, und er hatte wohl auch dunkle Augen. Er war größer als Sie, Inspektor, und ein gutes Stück größer als mein Mann und ich.« Nach einigem Überlegen setzte sie hinzu: »Und kräftiger. Jedenfalls kein schlanker Typ.«
Brunetti beugte sich zu ihrem Gatten hinüber. »Können Sie sich erinnern, ob Sie diesen Mann gesehen haben, Dr. Crowley? Oder vielleicht den anderen, von dem Ihre Frau sprach?«
Der weißhaarige Amerikaner schüttelte den Kopf. »Nein, ich war, wie gesagt, nur um meine Frau besorgt. Als ich sie rufen hörte, habe ich alles andere vergessen. Ich könnte Ihnen nicht einmal sagen, wie viele von unserer Gruppe zugegen waren.«
»Und Sie, Dottoressa«, wandte Brunetti sich nun wieder an Martha Crowley. »Erinnern Sie sich, wer alles dabei war?«
[33] Die Frau schloß die Augen, wie um sich besser zu konzentrieren. Nach einer Weile sagte sie: »Also links neben mir waren die Petersons, und der Mann mit dem Überzieher, der stand rechts hinter mir. Und ich glaube, Lydia Watts war auf der anderen Seite der Petersons.« Als sie nach einem Moment die Augen wieder aufschlug, schüttelte sie bedauernd den Kopf. »Nein, sonst erinnere ich mich an niemanden. Das heißt, ich weiß natürlich, daß wir alle zusammen unterwegs waren, aber gesehen habe ich nur diese drei.«
»Wie groß ist denn Ihre Gruppe?«
Diesmal antwortete der Ehemann. »Sechzehn Teilnehmer. Die Ehepartner nicht mitgerechnet. In der Mehrzahl pensionierte Ärzte, einige auch im Vorruhestand. Alle aus dem Nordosten der USA.«
»Und wo sind Sie untergebracht?«
»Im Paganelli«, sagte Dr. Crowley. Brunetti wunderte sich, wie eine so große Gesellschaft dort Platz fand, und mehr noch, daß es Amerikaner gab, die so klug waren, dieses Hotel zu wählen.
»Und heute abend? Ist da irgendwo ein gemeinsames Essen geplant?« erkundigte sich Brunetti mit dem Hintergedanken, bei der Gelegenheit vielleicht gleich alle miteinander befragen zu können, solange ihre Erinnerungen noch frisch waren.
Die Crowleys wechselten einen Blick. »Nein, nicht direkt«, antwortete er. »Wissen Sie, dies ist unser letzter Abend in Venedig, da wollten einige von uns auf eigene Faust losziehen.« Und mit einem verlegenen Lächeln setzte er hinzu: »Wir sind es wohl langsam leid geworden, jeden Abend mit denselben Leuten zu speisen.«
[34] »Wir hatten vor, ein bißchen herumzubummeln, bis wir ein Restaurant finden, das uns gefällt, und wollten dann dort einkehren«, ergänzte seine Frau und lächelte, als sei sie stolz auf diesen eigenständigen Entschluß. »Aber jetzt ist es schon recht spät geworden.«
»Und die Gruppe?« hakte Brunetti nach.
»Für die ist in einem Restaurant in San Marco reserviert«, sagte die Frau.
»Aber das«, fiel ihr Mann ein, »hat uns nicht gereizt. Es klang zu sehr nach kitschigem Lokalkolorit.«
Womit sie wahrscheinlich recht hatten. »Wissen Sie noch den Namen des Restaurants?« fragte Brunetti.
Die Crowleys schüttelten bedauernd den Kopf; der Mann antwortete für beide. »Tut mir leid, Inspektor, aber den habe ich nicht behalten.«
»Sie sagten, dies sei Ihr letzter Abend in Venedig«, begann Brunetti erneut; beide nickten. »Und wann brechen Sie morgen auf?«
»Nicht vor zehn«, antwortete sie. »Wir fahren mit dem Zug nach Rom, und am Donnerstag geht unser Flug. So sind wir rechtzeitig vor Weihnachten daheim.«
Brunetti griff nach der Rechnung der beiden, addierte seinen Kaffee hinzu und legte fünfzehn Euro auf den Tisch. Fred Crowley wollte es nicht dulden, aber Brunetti sagte: »Das geht aufs Spesenkonto«, was gelogen war, doch der Amerikaner gab sich damit zufrieden.
»Ich kann Ihnen ein Restaurant empfehlen«, erbot sich Brunetti und fuhr fort: »Ich würde gern morgen früh in Ihr Hotel kommen und noch einmal mit Ihnen reden und mit den anderen aus Ihrer Gruppe, die Sie erwähnt haben.«
[35] »Frühstück ab halb acht«, versetzte Mrs. Crowley, »und die Petersons sind immer sehr pünktlich. Lydia Watts könnte ich nachher anrufen und sie bitten, um acht herunterzukommen, damit Sie auch mit ihr sprechen können.«
»Geht Ihr Zug um zehn, oder verlassen Sie um zehn das Hotel?« Brunetti hoffte sehr, daß es ihm erspart bliebe, schon früh um halb acht am anderen Ende von San Marco zu sein.
»Der Zug fährt um zehn, also müssen wir Viertel nach neun aufbrechen. Die Reiseleitung hat ein Boot bestellt, das uns zum Bahnhof bringt.«
Brunetti erhob sich und wartete, bis der Doktor seiner Frau in den Parka geholfen und dann den seinen übergezogen hatte. In den wattierten Jacken verdoppelte sich der Körperumfang der beiden. Brunetti ging voran und hielt ihnen die Tür auf. Draußen, auf dem campo, deutete er nach rechts und wies ihnen den Weg über die Calle della Mandola zum Rosa Rossa. Dem Wirt sollten sie ausrichten, Commissario Brunetti habe sie geschickt.
Beide wiederholten seinen Namen, und Fred Crowley sagte: »Entschuldigen Sie, Commissario. Als Sie sich vorstellten, habe ich wohl Ihren Dienstgrad nicht verstanden. Hoffentlich nehmen Sie’s mir nicht übel, daß ich Sie zum Inspektor degradiert habe.«
»Aber ich bitte Sie!« Brunetti lächelte verbindlich. Man gab sich die Hand, und der Commissario sah den beiden nach, bis sie hinter der Kirche verschwanden.
Als er wieder an den Tatort kam, salutierte der uniformierte Beamte, der neben einem der Absperrpfosten stand. »Sind [36] Sie ganz allein hier?« fragte Brunetti. Sämtliche Decken und die wenigen vorhin noch verbliebenen Taschen waren verschwunden; letztere hatte vermutlich die Spurensicherung beschlagnahmt.
»Jawohl, Commissario. Ach, und Santini läßt Ihnen ausrichten, er habe nichts gefunden.« Also weder Projektile, dachte Brunetti, noch sonstige Indizien, die auf die Spur der Mörder hätten führen können.
Sein Blick schweifte über das abgesperrte Areal. Es dauerte einen Moment, bis er auf den ovalen Sägemehlhügel in der Mitte aufmerksam wurde. »Was ist das?« fragte er und wies mit vorgestrecktem Kinn auf die Erhebung.
»Das – ähem – ist wegen dem Blut, Commissario«, antwortete der Polizist. »Die Kälte, wissen Sie.«
Brunetti verscheuchte hastig das groteske Bild, das diese Bemerkung heraufbeschwor, und wies den Polizisten an, um Mitternacht in der Questura anzurufen und die Kollegen daran zu erinnern, ihm um ein Uhr die Ablösung zu schicken. Dann gab er dem jungen Mann Gelegenheit, noch einen Kaffee zu trinken, bevor die Bar schloß, und hielt solange für ihn Wache.
Als der uniformierte Beamte zurückkam, instruierte ihn Brunetti: Sofern ihm andere vucumprà begegneten, solle er diese vom Tod ihres Kollegen unterrichten und sie auffordern, etwaige Informationen über ihn umgehend der Polizei zu melden. Er müsse, schärfte Brunetti ihm ein, den Leuten unbedingt klarmachen, daß sie weder ihre Personalien anzugeben noch auf der Questura vorstellig zu werden bräuchten, sondern daß es der Polizei ausschließlich um den toten Afrikaner gehe.
[37] Als nächstes rief der Commissario über sein telefonino in der Questura an und wiederholte die Anweisungen, die er eben dem jungen Beamten am Tatort gegeben hatte; er betonte auch hier, daß freiwillige Zeugen anonym bleiben dürften, verlangte aber, jeden Anruf, der den Mord auf dem Campo Santo Stefano betraf, mitzuschneiden. Ein zweiter Anruf galt den Carabinieri. Und obwohl er sich diesmal über seine Amtsbefugnis nicht im klaren war, forderte Brunetti abermals Unterstützung sowie Diskretion gegenüber freiwilligen Zeugen. Und als der Maresciallo beides zusicherte, bat er auch ihn, sachdienliche Anrufe aufzuzeichnen. Der Maresciallo gab ihm sein Wort, dämpfte jedoch seine Hoffnungen, was die Informationsbereitschaft der vucumprà betraf.
Danach blieb vorerst nichts weiter zu tun; also wünschte Brunetti dem jungen Beamten einen guten Abend, der hoffentlich nicht noch kälter werden würde, und machte sich, nachdem er entschieden hatte, daß er um die Zeit zu Fuß schneller vorankäme, via Rialto auf den Heimweg.
[38] 4
Paola stand vor Staunen der Mund offen; sie fürchtete, all ihre pädagogischen Bemühungen seien kläglich gescheitert und sie habe statt eines Kindes ein Monster großgezogen. Fassungslos starrte sie ihre Tochter an; konnte es sein, daß ihr Baby, ihr heller, strahlender Engel vom Teufel besessen war?
Bis hierher war das Abendessen ganz normal verlaufen, sofern eine durch Mord verzögerte Mahlzeit Normalität überhaupt zuläßt. Brunetti, der, wenige Minuten bevor sie sich zu Tisch setzten, abberufen worden war, hatte kurz nach neun telefoniert und sie noch eine Weile vertröstet. Das Gejammer der Kinder, sie seien fast am Verhungern, hatte unterdessen Paolas Widerstand so weit erschöpft, daß sie nur das Essen für sich und Guido warm stellte, Raffi und Chiara dagegen sofort verköstigte. Sie setzte sich zu ihnen an den Tisch und nippte lustlos an einem Prosecco, der allmählich warm und schal wurde, während die Kinder riesige Mengen Auflauf aus Polenta, Ragout und Parmigiano vertilgten. Hinterher gab es zwar lediglich geschmorten Radicchio, mit einer dicken Schicht stracchino überbacken, aber Paola wunderte sich, daß die beiden nach dem üppigen ersten Gang überhaupt noch Appetit hatten.
»Warum muß er immer zu spät kommen?« nörgelte Chiara, während sie nach dem Radicchio griff.
»Er kommt nicht immer zu spät«, wandte Paola nüchtern ein.
[39] »Scheint aber so«, entgegnete Chiara. Sie wählte zwei besonders lange Stengel aus, hievte sie auf ihren Teller und löffelte ausgiebig geschmolzenen Käse darüber.
»Er hat versprochen, daß er so bald wie möglich heimkommt.«
»Es ist aber doch nicht so furchtbar wichtig, oder? Ich meine, daß er so lange wegbleiben muß?« maulte Chiara.
Da die Kinder wußten, warum man ihren Vater geholt hatte, konnte Paola sich Chiaras Einwand nicht erklären.
»Ich dachte, ich hätte euch gesagt, daß jemand ermordet wurde«, versetzte sie nachsichtig.
»Ja, aber doch bloß ein vucumprà«, erwiderte Chiara und nahm ihr Messer zur Hand.
Es war diese Bemerkung, bei der Paola der Mund offen stehenblieb. Sie griff nach ihrem Glas, tat so, als nippe sie daran, und schob Raffi, der seiner Schwester anscheinend nicht zugehört hatte, den Radicchio hin. »Was meinst du denn mit ›bloß‹, Chiara?« fragte sie und stellte zufrieden fest, daß ihre Stimme dabei ganz unverfänglich klang.
»Was ich gesagt habe, daß er eben keiner von uns war«, entgegnete ihre Tochter.
Paola bemühte sich, aus Chiaras Antwort einen sarkastischen Beiklang herauszuhören oder aber den Versuch, sie zu provozieren, fand jedoch von beidem keine Spur. Chiaras Ton wirkte vielmehr wie ein Echo des ihren: ruhig und sachlich.
»Und wen bezeichnest du mit ›uns‹, Chiara? Nur die Italiener oder die gesamte weiße Rasse?« forschte sie weiter.
»Nein«, sagte Chiara. »Uns Europäer.«
»Ah, natürlich«, versetzte Paola, hob ihr Glas, drehte [40] zerstreut den Stiel zwischen den Fingern und setzte es, ohne zu trinken, wieder ab. »Und wo, bitte, endet dieses Europa?« fragte sie schließlich.
»Was denn noch, mammà?« seufzte Chiara, die inzwischen auf eine Frage ihres Bruders geantwortet hatte. »Entschuldige, ich hab grade nicht zugehört.«
»Ich frage dich, wo Europas Grenzen verlaufen.«
»Aber das weißt du doch, mammà. Steht ja in allen Büchern.« Und bevor Paola etwas erwidern konnte, fuhr Chiara fort: »Gibt’s noch Nachtisch?«
Als junge Mutter hatte Paola, die selbst ohne Geschwister aufgewachsen war und bis dahin keinerlei Erfahrung im Umgang mit kleinen Kindern besaß, alles an Büchern und Ratgebern verschlungen, was zum Thema moderner Erziehung auf dem Markt war. Sie wußte, daß die Fachleute einhellig dagegen waren, ein Kind ernsthaft zu tadeln, bevor man nicht die Gründe für sein Verhalten erforscht und abgewogen hatte. Und selbst wenn all das berücksichtigt war, wurden die Eltern noch einmal dringend vor möglichen Schäden bei der Entwicklung der kindlichen Psyche gewarnt.
»Das ist das Herzloseste und Abscheulichste, was mir an diesem Tisch je untergekommen ist. Und ich schäme mich, ein Kind großgezogen zu haben, das es fertigbringt, so etwas zu sagen«, versetzte die aufgeklärte Mutter.
Raffi, der sich erst eingeklinkt hatte, als Paola diesen ungewohnt harschen Ton anschlug, ließ die Gabel fallen. Chiara blieb, ganz Spiegelbild ihrer Mutter, der Mund offenstehen, und zwar aus ziemlich dem gleichen Grund: Sie war schockiert und fassungslos, daß ein Mensch, der so [41] ungemein wichtig war für ihr Glück und Wohlergehen, etwas derart Grausames zu ihr sagen konnte. Und gleich ihrer Mutter schlug auch Chiara jegliche Diplomatie in den Wind und fragte aufgebracht: »Was soll das denn heißen?«
»Es soll heißen, daß du die vucumprà nicht auf irgendein bloß reduzieren und sie abtun kannst, als ob der Tod eines der ihren überhaupt nicht zählt.«
Mehr als Paolas Worte wirkte ihre vor Erregung bebende Stimme auf Chiara, und sie sagte abwehrend: »So hab ich’s doch nicht gemeint.«
»Ich habe keine Ahnung, was du meinst, Chiara, aber gesagt hast du, der Ermordete sei bloß ein vucumprà. Und du müßtest dir schon eine sehr gute Erklärung einfallen lassen, um mich glauben zu machen, daß ein Unterschied besteht zwischen dem, was mit diesem Satz gesagt und was damit gemeint ist.«
Chiara legte das Besteck auf den Teller und fragte: »Darf ich auf mein Zimmer gehen?«