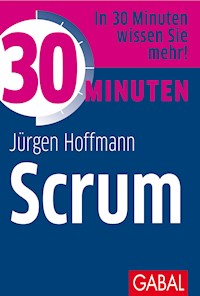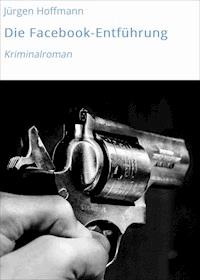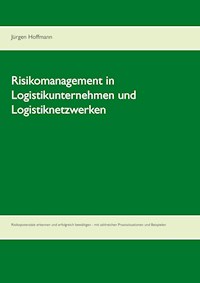Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Für Glück und Zufriedenheit im Ruhestand können wir selbst aktiv werden und die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Das vorliegende Buch soll Leserinnen und Lesern helfen, nicht nur eine Reflexion des bisherigen Lebens, sondern eine individuelle Perspektive auf die aktive Gestaltung des neuen Lebensabschnitts zu finden. Manche Menschen glauben vielleicht, mit einer gewissen Automatik in den Ruhestand gehen zu können, und dann wird alles bestens sein. Einige andere empfinden Angst vor dem Unausweichlichen und dem Gefühl des Nichtmehrgebrauchtwerdens. In welcher Weise das eigene Leben etwas Nützliches, etwas Wertvolles für sich und andere bieten wird, liegt in unserer Hand. Das Buch beschreibt allgemeine Gedanken sowie eigene Wahrnehmungen und persönliche Erfahrungen des Verfassers und stellt weder eine wissenschaftliche Abhandlung noch einen allumfassenden Ratgeber dar. In diesem Sinne werden vom Verfasser die verschiedenen Lebensbereiche beleuchtet und den Leserinnen und Lesern Anregungen für die eigene Gestaltung des Ruhestandes entsprechend ihrer individuellen Gefühle und Bedürfnisse geben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Was mich zu diesem Buch motivierte
Wie wir über das Alter und älter werden denken
Sichtweisen und Einstellungen
Die emotionalen Welten im Alter
Gedanken werden zu Mustern
Was ich über negative Gedanken lernte
Der Zusammenhang von Ursache und Wirkung
Über Angst und Sorgen im Alter
Es ist Zeit loszulassen
Wie wir uns auf den Ruhestand vorbereiten
Die letzte Lebensphase vor dem Ruhestand
Abschied und Neubeginn
Frieden mit der Vergangenheit und neue Lebensvision
Ich entdecke mich neu
Ein Lebensskript für den Ruhestand entwickeln
Wir sind die Regisseure unserer letzten Lebensabschnitte
Das Lebensskript zwischen Kontinuität und Neuland
Lebenslanges Lernen im Alter – wie geht das?
Das Gehirn will gefordert werden
Man lernt nie aus
Lernen und Neugier als Teil der Lebensphilosophie – aber bitte mit Struktur
Mein Umgang mit Medien und Nachrichten
Im Ruhestand sich zu zweit neu kennenlernen
Alte Liebe rostet nicht – auf eine glückliche Partnerschaft im Alter
Wie die neue Gemeinsamkeit gelingt
Wie wir miteinander kommunizieren
Meine Kommunikation nach der Platin-Regel
Wie eine erfolgreiche Konfliktbewältigung gelingt
Auf zu neuem Mut…und einer neuen Beziehung
Wie Glück und Zufriedenheit im Alter entstehen
Was ist Glück?
Meine drei Lebensweisheiten für Glück: „Love it, change it or leave it!“
Zufriedenheit mit meiner neuen Rolle im Ruhestand
Wie wir mehr Lebensfreude ausstrahlen
Kleider machen Leute…und auch Ruheständler
Nur Mut – keine Chance den Selbstzweifeln!
Selbstzweifel – was tun?
Was hilft bei Motivationstiefs?
Das Verhängnis des Verdrängens – oder: Wohin Aufschieberitis führen kann
Mein Umgang mit Misserfolg – Umkehr ins Positive
Soziale Beziehungen und Kommunikation
Die neue Art sozialer Kontakte im Ruhestand
Die Rolle der Familie, Kinder und Enkel
Was tun gegen die Einsamkeit im Ruhestand
Abschied
Menschen können eigene Lebenseinstellung beeinflussen
Der Wert von Begegnungen
Klassentreffen
Kommunikation im Alter und was die Sprache bestimmt
Gesprächsthemen im Alter und was sie ausdrücken
Humor im Alter
Die sprachliche Ausdrucksweise altert – oder auch nicht!
Gesundheit im Alter – zwischen Chancen und Risiken
Allgemeines Gesundheitsrisiko Ruhestand?
Gesundheitsfaktor Suchtgefahren
Gesundheitsfaktor Pharmaprodukte
Gesundheitsfaktor Organische Krankheiten
Gesundheitsfaktor Bewegung
Gesundheitsfaktor Ernährung
Gesundheitsfaktor Alzheimer und Demenz
Gesundheitsfaktor Stärke des Immunsystems
Wellness und Beauty – wollen wir jung oder alt aussehen?
Gesunde Lebensweise durch Gesundheitswissen
Gesundheitsschwächen im höheren alter – was tun?
Einige meiner Lebensregeln und Weisheiten
Spontaneität und das Prinzip „Versuch und Irrtum“
Ziele im Ruhestand oder „Der Weg ist das Ziel.“?
Mein neuer Umgang mit Zeit im Ruhestand
Ruhe und Gelassenheit – Wege zum mentalen Gleichgewicht
Gelassenheit und innere Ruhe
Achtsamkeit – Schritte zur mentalen Gesundheit
Sinn und Unsinn im Alter alles zu vereinfachen
Geheimnisse, die das Leben entscheidend vereinfachen
Wie ich lernte, Ballast im Leben abzuwerfen
Vom Wert des Minimalismus im Alter
Einfachheit kann zu falscher Bequemlichkeit führen
Abschied vom Bewerten und Verurteilen
Bewerten und urteilen – unsere menschlichen Neigungen und ihre Gefahren
Verzicht auf die altersbedingte „Besserwisserei“
Wie ich mit Bewertungen anderer Menschen umgehe
Wie ich über Neid erhaben sein kann
Bewertung und Beurteilung jüngerer Generationen
Bewertung von Partnern eigener Kinder und Enkeln
Bewertung neuer Lebensbedingungen und -stile
Bewertung von Erziehungsmethoden
Bewertung zur Ausbildung und Berufstätigkeit
Finanzen und Vermögen im Ruhestand
Die finanzielle Absicherung für den Ruhestand
Über den Umgang mit Vermögen
Der Wert des Verzichtens – mit Bescheidenheit als Tugend leben
Reisen – Hobby – Do-it-yourself
Reisen – Spannungsfeld von aktivem und passivem Erleben
Hobby, Garten, Do-it-yourself – Glück in alten und neuen Leidenschaften
Neue Leidenschaften
Garten, Natur und Umwelt
Im Wald und auf der Heide – Leben im Einklang mit der Natur
Epilog
Was uns zum Ende des Lebens beschäftigen wird
Gedanken und Prioritäten wandeln sich
Umgang mit der Einsamkeit
Erinnerungen lebendig erhalten und dokumentieren
Quellenverzeichnis
Prolog
Was mich zu diesem Buch motivierte
Der Anstoß zu diesem Buch ist eher zufällig entstanden, als mir bewusstwurde, dass ich für mein Glück und die Zufriedenheit im Ruhestand selbst aktiv werden und die Verantwortung für mein Leben übernehmen kann. Das Schreiben meines Buches hat mir selbst geholfen, nicht nur eine Reflexion des bisherigen Lebens, sondern eine Perspektive auf die aktive Gestaltung des neuen Lebensabschnitts zu finden. Manche Menschen glauben vielleicht, mit einer gewissen Automatik in den Ruhestand gehen zu können, und dann wird alles bestens sein. Einige andere empfinden Angst vor dem Unausweichlichen und dem Gefühl des Nichtmehrgebrauchtwerdens. In welcher Weise das eigene Leben etwas Nützliches, etwas Wertvolles für sich und andere bieten wird, liegt in unserer Hand.
Das Buch stellt allgemeine Gedanken sowie meine eigenen Wahrnehmungen und persönlichen Erfahrungen dar. Bei meiner Suche nach Ratgebern für den Ruhestand fand ich neben einigem Nützlichen auch vielfach Bücher von Autoren, die selbst noch nicht im Ruhestand sind oder zu wenig auf individuelle Gefühle und Bedürfnisse für den Übergang in diesen Lebensabschnitt eingehen. In diesem Sinne habe ich die verschiedenen Lebensbereiche beleuchtet und möchte den Lesern damit Anregungen für die eigene Gestaltung des Ruhestandes geben. Es stellt weder eine wissenschaftliche Abhandlung noch einen allumfassenden Ratgeber dar.
Dem Buch liegen neben eigenen Erfahrungen und Gedanken sehr viele Gespräche mit meiner Ehepartnerin zugrunde, die mich zum Schreiben stets motiviert und durch zahlreiche kritische Anmerkungen begleitet hat. Ihr gebührt ein liebes Dankeschön.
„Es ist sichtbar ein Vorzug des Alters, den Dingen der Welt ihre materielle Schärfe und Schwere zu nehmen und sie mehr in das innere Licht der Gedanken zu stellen, wo man sie in größerer, beruhigender Allgemeinheit übersieht.“
- Wilhelm von Humboldt -
Wie wir über das Alter und älter werden denken
Sichtweisen und Einstellungen
„Wenn ich alt bin, will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich.“
In der Beschäftigung mit dem Alter und dem Älterwerden finde ich einige grundlegende Gedanken und Sichtweisen zu diesem Thema sehr nützlich. Verhaltensweisen, Lebensstile und Erwartungen haben häufig eine geistige Grundlage, die in unseren Einstellungen und Bewusstseinsinhalten verankert ist. Leser dieses Buches könnten dieses erste Kapitel etwas zu philosophisch oder zu esoterisch empfinden. Ich denke, dass uns für Glück und Zufriedenheit in der letzten Lebensphase, dem Ruhestand, diese Gedanken und Einstellungen sehr hilfreich begleiten werden. ir sollten nicht permanent auf „aktuelle“ oder „neue“ Studien über das Älterwerden hören, deren wissenschaftliche oder statistische Grundlagen oft fragwürdig erscheinen, sondern das eigene Gedächtnis aktivieren und positive Gedanken über das Thema entwickeln.
„Nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere Einstellung dazu.“
- Marcus Tullius Cicero -
Der bekannte Buchautor und Arzt Eckart von Hirschhausen findet klare Worte zum Alter:
„Warum reden so wenige öffentlich darüber, wie man nicht nur dem Leben mehr Jahre, sondern auch den Jahren mehr Leben einhauchen kann? Was für Qualitäten lassen sich über den Lebensbogen aufbauen? Dieser Teil der Geschichte fehlt uns in unserem kollektiven Bewusstsein. Ich bin ja ein großer Fan von Paul Watzlawick, dem mit ‚Anleitung zum Unglücklichsein‘ eines der witzigsten Selbsthilfebücher überhaupt gelungen ist. Er hat darin wie kein anderer erklärt, wie wir uns ständig die Realität selber erzeugen, vor der wir eigentlich Angst haben.“ (von Hirschhausen/Esch, 2018, S.24)
Es gilt die positiven Seiten zu betonen und zu leben, unsere Erwartungen und Ängste geistig in die richtige Richtung zu lenken. Eckart von Hirschhausen: „Alter kann auch Reichtum, Wissen, Weisheit, Erfahrung, Würde und Schönheit bedeuten.“ Darüber entscheiden nicht in erster Linie die Gene. „Das heißt, obwohl unsere ‚Werkseinstellungen‘ reale Risiken mit sich bringen, können wir dennoch wesentliche Teile davon selbst beeinflussen. Und das geht los mit unseren kulturellen Ideen über das Altern. Sind die eher positiv oder negativ?“(von Hirschhausen/Esch, S. 27)
Unsere Gesellschaft verbindet in vielen Werturteilen mit „dem Alter“ oder „den Alten“ gleichsam Vorurteile, die nicht zuletzt in einer sozialen und intellektuellen Polarisierung und Abwertung münden. In einer vermeintlich biologischen und medizinisch begründeten Denkweise wird älteren Menschen eine Verringerung von Fähigkeiten nachgesagt. Das zeigt sich beispielhaft in Bezug auf den Straßenverkehr, die Bearbeitung von Formularen, das Festhalten an althergebrachten privaten Ritualen, die Lernbereitschaft und -fähigkeit, ein mangelndes Anpassungsverhalten an neue Entwicklungen. Zudem unterstellt man älteren Menschen überzogenes Anspruchsdenken. Die Quellen derartiger Wert- und Vorurteile liegen häufig in Erscheinungsformen einer Neidgesellschaft und der Missgunst und können die Gedankenwelten der Menschen im Alter negativ beeinflussen.
Die emotionalen Welten im Alter
Müssen wir uns im Alter jung fühlen? Und müssen wir so sein wie die Jugend? Nein!!! Warum auch? Wer erwartet denn das von uns?
Der Buchautor und Neurobiologe Tobias Esch meint dazu:
„Lange endete die Entwicklungspsychologie ja bei der Jugend, man ging davon aus, dass unsere Persönlichkeitsentwicklung dann abgeschlossen ist. Heute wissen wir, dass wesentliche Schritte mit jedem weiteren Jahrzehnt erfolgen – solche, die vielleicht weniger offensichtlich sind als die äußeren Veränderungen der Pubertät. Im Gegensatz zur Unbeständigkeit und Unruhe der Jugend rücken andere Werte in den Vordergrund: Zufriedenheit, innerer Frieden, Gelassenheit.“(von Hirschhausen/Esch, S. 31) „Ich bin überzeugt, dass jede Lebensphase ihre eigene Bedeutung hat. Wir machen oft den Fehler, dass wir die verschiedenen Phasen bewerten, abwerten oder überbewerten und nicht wahrnehmen, welche Aufgabe wir gerade in dieser Phase haben. Jede Phase hat ihren eigenen Rhythmus. Wichtig ist, dass wir nicht immer hinterherlaufen – oder weit vor unserer Zeit da sind.“(von Hirschhausen/Esch, S. 47)
Viele fühlen sich mit dem Eintritt in den Ruhestand noch nicht zum „alten Eisen“ gehörend. Es gibt unzählige Beispiele von Menschen, die noch bis ins hohe Alter geistig und körperlich fit sind. Im Alter jung auszusehen und fit zu sein, wird in den meisten Fällen nicht an den industriell beworbenen Schönheitsprodukten liegen, mit denen allenfalls nur eine oberflächliche Verjüngung erreicht wird. Obwohl man sich dann beim Betrachten im Spiegel gut fühlen kann und auch Komplimente von anderen erhält, ist das oft nur Fassade. Doch wie sieht es dahinter aus und wie schaffe ich es, mich jung und fit zu fühlen und auszusehen? Für mich gilt der Spruch „Man ist so jung wie man sich fühlt.“ Altern stellt für mich nicht in erster Linie eine Frage des biologischen Alterns, also eines körperlichen Abbaus, sondern vielmehr einen mentalen Prozess und den Zustand meiner Gedanken zum Leben dar. Wenn ich das Alter nicht fürchte oder verachte, sondern liebe, dann hat das positive Folgen. Und wenn ich mich für alt und nutzlos halte, werde ich in meinem Alltag auch so agieren.
Für die meisten beginnt in ihren Gedanken der Ruhestand um das Alter von 65 Jahren. Der Buchautor Kajo Schuhmacher meint zu Recht: „Diese 65 ist eine vor mehr als hundert Jahren willkürlich gewählte Zahl. Aber sie hat jedes deutsche Leben infiziert, unser Denken, unser Verhalten, unsere Selbstwahrnehmung, die ganze Gesellschaft. Sie ist gleichsam ein eiserner Vorhang, der nützliches von unnützem Leben trennt.“ (Schuhmacher, S. 201)
Für mich persönlich ist das „Alter“ nur eine durch mein Geburtsjahr definierte mathematische Größe, also eine Zahl. Ab welcher Zahl man als „alt“ gilt oder sich selbst als „alt“ wahrnimmt, hängt von der eigenen Betrachtungsperspektive ab. Ich lasse mir nicht einreden und suggeriere es selbst nicht, alt zu sein. Wer behauptet denn allen Ernstes, dass wir im Alter von 60 oder 70 Jahren weniger leisten oder eine weniger aktive Lebensweise führen als Menschen in den dreißiger Jahren? Ich gebe mir jedenfalls alle Mühe, solche Sätze wie „Man wird alt.“ oder „In meinem Alter…“ oder „Als ich noch jünger war, …“ aus meinem Sprachschatz zu verdrängen. Ich gebe zu, dass in manchen Bereichen, wie z.B. der Digitalisierung, junge Menschen etwas schneller sind, schließlich mit diesen Instrumenten anders aufgewachsen sind als ich. Dennoch gibt es für mich keinen Grund, die neuen Digitalisierungsinstrumente nicht zu begreifen oder nicht anwenden zu wollen. Vielleicht dauert der Lernprozess etwas länger, aber dafür hilft mir die Rationalität meiner Lebenserfahrung beim Umgang mit digitalen Anwendungen.
„Die Macht unserer Gedankenmodelle ist gewaltig. Seit Generationen tragen wir die Dreiteilung von Lernen – Arbeiten – Verfall in uns, drei scheinbar hermetisch abgeriegelte Räume, die wir nacheinander betreten.“ (Schuhmacher, S. 201) Ich frage mich, was die Gedankenmodelle dieser Dreiteilung in uns auslösen?
Gedanken werden zu Mustern
„Es gibt nichts Gutes oder Böses, erst unsere Gedanken machen es dazu.“
– William Shakespeare -
Gedanken sind Kräfte. Erfolg und Glück beginnen mit der Erweiterung des Bewusstseins und des Blickwinkels. Gedanken sind Saatkörner, die sich im Inneren des Menschen nach und nach ausbreiten. Wenn sich dabei ein Gedanke – also eine Kraft – entwickelt und sich zu verdichten beginnt, dann wächst der Mensch ganz langsam von innen nach außen. Von Earl Nightingale habe ich einmal den Satz gelesen: „Das seltsamste Geheimnis: Sie werden das, was Sie die meiste Zeit denken.“
Gedanken- und Reaktionsmuster fräsen sich im Gehirn ein wie Regenbahnen im Staub einer schmutzigen Fensterscheibe. Solche Muster zu verändern, braucht viel Zeit, Training und Durchhaltewillen. Die „Dinge“ von heute auf morgen einfach so verändern, bleibt meistens nur ein Wunsch. Vieles kann man aber in kleinen Schritten verbessern: Belastungen vermindern, Beschleunigung abbauen, Reize reduzieren.
In manchen Situationen hatte ich früher das Gefühl, dass das Leben irgendwie „unfair“ mit mir spielt: eine Zeit, in der meine Geduld, meine Leidenschaft, meine Motivation, meine Widerstandskraft bis an die äußerste Grenze strapaziert wurden. Ich hatte jedoch erkannt, dass die Bewältigung solcher „Lebensproben“ von der Art und Weise, wie wir diese wahrnehmen und wie wir mit uns selbst kommunizieren, entscheidend abhängt. Und in diesem Sinne ist mein innerer Zustand primär für die Art der Reaktion verantwortlich.
Gedanken haben einen engen Zusammenhang mit unseren Glaubenssätzen. Als junger Mensch hatte ich den Begriff „Glauben“ immer mit religiösen Inhalten in Verbindung gebracht – und da ich nicht „gläubig“ war, als Unsinn abgetan. Doch viel später hatte ich bemerkt, dass der Glaube eine Art innere Kraft, innere Überzeugung von einer Fähigkeit ist, den richtigen Weg erkannt zu haben und das Ziel zu erreichen. Glauben ist für mich nicht träumen von einer über- oder außerirdischen Macht, sondern Überzeugtheit von der inneren eigenen Kraft, seine Vorhaben, Träume und Visionen umsetzen zu können. Ich habe mich oft gefragt, woher früher meine – insbesondere negativen - Glaubenssätze kommen. Die meisten unserer Glaubenssätze sind eingeredet – durch Autosuggestion oder Fremdsuggestion. Glaubenssätze entstehen durch die Umgebung (z.B. durch erfolgreiche oder erfolglose Menschen), bestimmte, meist unvergessliche Ereignisse im Leben, Wissen, frühere Erfolgserlebnisse, zukünftige Vorstellungen über erwünschte Zustände. Ich habe in meiner Tätigkeit diese Glaubenssätze oft unter dem „Gesetz der sich selbst erfüllenden Prophezeiung“ gelehrt.
„Glaube an Grenzen und sie gehören dir.“
(sinngemäß aus „Die Möwe Jonathan“ von Richard Bach, Bildquelle: www.amazon.de)
Eine beispielhafte Episode aus meiner gestressten Zeit der 1990er Jahre war meine ständige lautstarke negative Artikulation während der Parkplatzsuche in einer Stadt. Es hatte mich einfach genervt und ich hatte stets damit die ganze Menschheit verflucht, sehr auch zum Ärger meiner MitfahrerInnen. Das Schimpfen hat jedoch nichts genutzt. Ich hatte mir dann eine „Gedankenkarte“ geschrieben: „Glaube an einen Parkplatz und du findest einen.“ Das hat im Laufe der Zeit immer besser funktioniert. Übrigens war immer ein freier Parkplatz vorhanden, den ich leider oft vor Wut nicht gesehen hatte.
Gedanken und Gedankenmuster verstecken sich tief in unserem Unterbewusstsein und viele sind uns daher nicht bewusst. Ich entschied mich von Zeit zu Zeit, mit Unterstützung meiner Frau, zu einer Art Gedankeninventur. Sicher ein hochtrabendes Wort, aber hilfreich und zugleich anstrengend: Welche Gedanken sind konstruktiv, ausbaufähig und positiv und es wert behalten zu werden? Welche Gedanken sind negativ und sollten aus meinem Leben verbannt werden? Ich ertappte mich immer mehr mit der Bemerkung „Wenn ich gesundheitlich noch in der Lage bin…“ oder „Wenn ich das dann noch kann…“. Was ist denn das für ein Blödsinn! Also kehrte ich meine Gedanken ins Positive um: „Ich will bis ins hohe Alter gesund bleiben.“ Das ist zwar immer noch etwas unkonkret, aber immerhin schon positiver formuliert.
Ich machte mir meine Lebensumstände bewusst und richtete meine Aufmerksamkeit stärker auf meine Gedanken. Wer seine Gedanken nicht beherrscht, lässt andere über sein Leben bestimmen. Jeden Moment muss man bewusst leben und entscheiden, was man tut. Das Erstaunliche in meiner Wahrnehmung war, dass neben tatsächlich positiven Momenten auch die scheinbar „beschissenen“ einen positiven Wert besaßen: sie waren lehrreich, ich hatte eine Erfahrung mehr, wusste hin und wieder, was nicht funktionierte. Ja, selbst in Situationen, in denen ich im Straßenverkehr geblitzt wurde, lernte ich wieder eine Erfahrung hinzu: Was im Leben sind fünf Minuten wert, die ich schneller am Ziel bin? Ich erinnere mich an eine Verkehrssituation an einem Freitagabend Ende August: Ich fuhr von Glauchau nach zehn Stunden Vorlesung bei 35 Grad Celsius in einer Baustelle auf der Autobahn A4 nach Hause. Ich hatte nur im Kopf, wie ich, zu Hause angekommen, nach anstrengender Woche mit kurzer Hose und Bierchen endlich in meinem Garten sitzen kann. Ich fuhr in der Baustelle auf der linken Spur, nur geringer Verkehr, Höchstgeschwindigkeit war 80 km/h. Ping und rote Blitzlampe kam! Wer kennt dieses beschissene Gefühl nicht. Ich schaute sofort auf den Tacho und sah 125 km! Zu Hause angekommen, erzählte ich es meiner Frau schon am Gartentor, denn solche Dinge halten wir voreinander nicht geheim. Was treibt dich denn wie ein Angestochener… nach Hause, so ähnlich war die Reaktion meiner Frau. Die Zitterpartie hielt dann sechs Wochen an, doch ich hatte Glück: kein Fahrverbot, nichts, Gerät war wohl schon abgeschaltet. Aber die Erfahrung blieb: konzentriere dich besser auf den Straßenverkehr, Zeitgewinn heilt nicht alles!
Was ich über negative Gedanken lernte
In unserem Wortschatz gibt es viele Wörter, die negative Assoziationen in unserem Denken aktivieren oder Blockaden auslösen. Ich wusste früher nicht, welche Wirkungen derartige Wörter wie „vielleicht“, „muss“, „versuchen“, „unmöglich“, „möchte“ auslösen können.
„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.“
- Hermann Hesse -
Das scheinbar Unmögliche wurde zur Realität, wenn ich meine innere Blockade überwinden konnte. Im Kopf tauchen leider zu viele solche negativen Wörter und deren Assoziationen zu bestimmten Lebensbereichen auf. Ich habe dies zum Beispiel einmal mit dem Begriff „Die Tyrannei des MUSS“ in Zusammenhang gebracht. Wie oft verwenden wir im Alltag das Wort „muss“? „Wir müssen arbeiten.“ „Ich muss noch den Haushalt oder Garten…“, „Ich muss heute noch E-Mails beantworten.“ …und so weiter! Ich habe mich irgendwann – so auch vor und während eines Seminars mit Unternehmerfrauen – immer wieder gefragt, was wir wirklich müssen. Auch meine Frau ermahnte mich regelmäßig, wenn ich das „Muss“ wieder übertreiben wollte.
Ohne darüber nachzudenken und oft unbewusst hatte ich leider auch „Schimpfwörter“ oder Wörter mit normalerweise negativen Assoziationen verwendet, wie „Scheiße“, „Arschloch“, „Vogel“, „Lahmarsch“, „Mist“ verwendet. Ich bin glücklicherweise oft von meiner Frau daraufhin zurechtgewiesen worden und habe mir einmal zwei Fragen gestellt: Was bewirken diese Wörter und Redewendungen in meinem Kopf und in meinen Beziehungen zu anderen Menschen? und: Wie komme ich davon weg? Es gelingt, sich zu disziplinieren – und diese Wörter verschwinden nach und nach.
„Das Leben ist voller Gegensätze – und es liegt an dir, welcher Seite du die größere Bedeutung gibst.“
– Anton Oreto -
Negative Wirkungen werden auch durch Selbstmitleid erzeugt. Selbstmitleid entsteht durch Situationen, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben und an denen nichts mehr geändert werden kann. Da fällt auch bei mir schon mal der Satz „Warum muss ich mir das eigentlich noch antun…?“ Was soll denn diese Frage, und vor allem wie sieht die Antwort aus? Selbstmitleid ist überflüssig und vergeudet nur unnötige Kraft. Im persönlichen Umfeld wird man durch das Selbstbedauern wertlos, ja sogar mit seiner destruktiven Haltung unbeliebt. Die Umkehr von Anzeichen des Selbstmitleides kann nur durch positives Denken in die Zukunft gelingen, wozu auch der Mut gehört, Nein zu unerwünschten äußeren Erwartungen zu sagen, die man nicht erfüllen kann oder will, und zu Rollen, die man nicht spielen kann oder will.
Umkehr heißt: Ein positiv denkender Mensch ist nie gegen etwas, er ist stets für etwas. Er fragt nicht: Was erwarte ich noch vom Leben, sondern: welche Ansprüche stelle ich an das Leben und mich? Auch ein positiv denkender Mensch hat Probleme. Allen anderen hat er allerdings eines voraus: Er ist nicht selbst das Problem! Mir gelingt diese Umkehr von negativen in positive Gedanken bereits mit der Wahl meiner Sätze. Ich hatte schon vom negativ belegten Wort „muss“ gesprochen. Mit den Worten „Ich muss noch Sport machen.“ erkennt mein Gehirn nur einen Zwang, keine Freude.
Wir haben im Alltag mehr Dinge selbst in der Hand, als wir glauben. Wir altern, wie wir gelebt haben. All das, was wir jeden Tag in unseren Köpfen und Herzen tun, bestimmt mit, wie freudig wir auf die bessere Hälfte zugehen. Lebensstil, Engagement und positive Erwartung verlängern nachweislich das Leben.
Der Zusammenhang von Ursache und Wirkung
„Alles, was wir sind, ist ein Resultat dessen, was wir gedacht haben.“
Der Persönlichkeitstrainer Nikolaus Enkelmann fragte zu Recht in seinem Buch „Die Macht der Motivation“: „Gesundheit oder Krankheit, Glück oder Unglück, Erfolg oder Misserfolg, ja sogar eine gute oder schlechte Ehe, ist das alles nur Zufall? Regiert und bestimmt wirklich der Zufall das Leben jedes einzelnen Menschen?“ Wir sollten unsere Einstellung und unser Verhalten genau überdenken. Jede Aktion bewirkt eine Reaktion.
Alles, was geschieht, hat immer eine Ursache. Erfolg ist daher nicht das Resultat von Zufällen, sondern das Ergebnis früherer Gedanken, auch wenn Zufälle begleitend eine Rolle spielen können. Wenn wir im Alltag bestimmte Lebensumstände, Zustände oder Ereignisse dem (äußeren, vielleicht übernatürlichen) Zufall zuschreiben, dann liegt es daran, dass wir die Ursache nicht kennen oder bewusst nicht wissen wollen. Dann müssten wir ja vielleicht die Ursachen bei uns selbst suchen. Erfolgsstrategie heißt also, Chancen erkennen und den Mut und das Selbstbewusstsein aufzubringen, alles zu nutzen, was uns weiterbringt. Der Grad des Erfolgs, den wir im Leben erreichen, hängt wesentlich von der Art und Weise sowie der Qualität unserer Kommunikation ab. Ich habe mir irgendwann einmal die Frage gestellt, was die Menschen dazu bringt, auf Herausforderungen des Lebens so verschieden zu reagieren. Der Unterschied liegt wesentlich in der Kommunikation „mit uns selbst“ (innere Kommunikation), insbesondere in der Wahrnehmung und Interpretation der Situation und in der Art und Weise des darauf beruhenden Handelns. Der neurophysiologische Zustand, den wir erleben, ist nicht naturgegeben, sondern veränderbar. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass wir lähmende Zustände (Verwirrung, Depression, Furcht, Angst, Trauer, Frustration) überwinden und in beflügelnde Zustände (Vertrauen, Liebe, innere Stärke, Freude, Begeisterung) verwandeln können. Aus der Neurolinguistischen Programmierung (NLP) habe ich einen wichtigen Leitsatz gelernt: „Die Landkarte ist nicht das Gebiet.“ Unsere internale Repräsentation ist also nicht die exakte Wiedergabe der Realität, der Ereignisse, der Umwelt. Man kann eine Situation immer in einer Weise repräsentieren, mit der man die Kraft zu einem positiven Weg findet. Ich hatte im Leben nie richtige Langeweile. Doch gerade diese wäre ein Beispiel für eine internale Repräsentation einer Situation, der wir nicht machtlos ausgesetzt sind.
Alle Lebenssituationen mit einer einfachen Ursache-Wirkung-Beziehung klären zu wollen, ist jedoch gefährlich und führt zu vielen Irrtümern und Illusionen. Wir neigen aufgrund unserer menschlichen Kognition instinktiv viel zu oft dazu, Kausalzusammenhänge dort anzunehmen, wo sie nicht existieren. Aus gegebenen Fakten versuchen wir schnell und mühelos Ursache-Wirkung-Beziehungen zu erkennen und diese unseren Bewertungen und Entscheidungen zugrunde zu legen. Diese schnelle Denkweise unseres Gehirns zielt darauf ab, die erstbeste Schlussfolgerung anzunehmen, die sich bietet, leider manchmal jedoch falsch ist.
Über Angst und Sorgen im Alter
Der herannahende Ruhestand und das schrittweise Altern ließen in mir ein gewisses Gefühl des Unausweichlichen, ein düsteres Bild vom Altern aufkommen. Sorgenvolle Denkmuster versuchten, sich in mir breit zu machen. Vermutlich wird es vielen Ruheständlern ähnlich gehen. Das liegt einerseits an dem fortschreitenden biologischen Alter. Andererseits nehmen wir aus unserem Umfeld immer wieder schicksalhafte Beispiele der Erkrankung, von Pflegefällen oder des frühen Todes wahr. Sorgen macht uns hin und wieder, wie wir künftig mit dem Alleinsein zurechtkommen werden, wenn unser Partner/unsere Partnerin vor uns sterben sollte. Wir können diese natürlichen Sorgen und Ängste, welche sich im Alter Ende 70/Anfang und Mitte 80 deutlich verstärken, nicht einfach ausblenden, ausschalten oder abtun, sondern sollten ihnen mit positiven Reaktionen entgegnen. Ich verfalle daher nicht in Panik, verdränge die entstehenden Bilder aber nicht vollends. Der morgendliche Blick in den Badspiegel verrät: wir werden nicht jünger. Zumindest glauben wir das festzustellen – obwohl unsere heutige Wahrnehmung keinen direkten Vergleich zu früheren Jahren erlaubt. Wie soll ich also mit diesen Bildern umgehen? Jammern und Verdrängen hilft in den wenigsten Fällen, sondern persönliche Ehrlichkeit zu sich selbst: Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen mich und wie kann ich bewusst meine Gefühle lenken?
Wir Menschen brauchen etwas Gewissheit über die Zukunft. Die Angst des Menschen ist im Grunde eine Angst vor dem Unbekannten, das Resultat dessen, dass wir die Dinge zu eng sehen. Von Kurt Tepperwein habe ich gelernt: Angst entsteht insbesondere, wo das Vertrauen in das Leben und seinen Sinn verlorengegangen ist. Angst vor neuen Situationen, neuer Verantwortung, neuen Aufgaben ist etwas Natürliches. Ich stellte mir also oft die Frage: Was wäre das Schlimmste, das hier passieren könnte?
„Man ist nur unglücklich, weil man Zeit hat, zu überlegen, ob man unglücklich ist oder nicht.“
– George Bernhard Shaw -
Es gibt vielfältige Beispiele, die leicht Angst einflößen: Vermögensverlust, Unfälle, Verlust der Arbeit oder der Arbeitsfähigkeit, Verlust von Familienangehörigen. Der frühe Tod einiger Bekannter schreckte mich auf: einige starben an Covid-19, ein anderer an Bauchspeicheldrüsenkrebs oder an Leberzirrhose. Andere Gleichaltrige oder leider auch Jüngere hatten Blasenkrebs oder wurden am Kehlkopf operiert. Das hat mich emotional schon berührt. Ich erlebte, dass ich mit