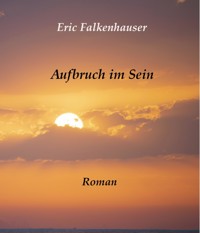
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Eltern waren eine Kriegsgeneration. Seine frühe Kindheit war behütet, aber später geprägt von Angst bis zu seiner Belastungsgrenze. Max erwachte aus seinem zerbrechlichen Sein und nahm den Kampf des Lebens auf. Niemand sollte ihm mehr Leid zufügen und er wollte auf die Überholspur des Lebens. Er suchte das Glück, erlebte Schmerz und musste lernen, dass auch Erfolg eine zweite Seite hat. Dennoch war Aufgeben nie eine Option. Der Roman vereint alles, was das Leben von Max hergab. Spannend, unterhaltsam und humorvoll geschrieben. Ein kurzweiliges Lesevergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eric Falkenhauser
Aufbruch im Sein
Roman
Die Eltern waren eine Kriegsgeneration.
Seine frühe Kindheit war behütet, aber später geprägt von Angst bis zu seiner Belastungsgrenze.
Max erwachte aus seinem zerbrechlichen Sein und nahm den Kampf des Lebens auf.
Niemand sollte ihm mehr Leid zufügen und er wollte auf die Überholspur des Lebens.
Er suchte das Glück, erlebte Schmerz und musste lernen, dass Erfolg auch eine zweite Seite hat.
Dennoch war Aufgeben nie eine Option.
Manche Lebensabschnitte waren lustig und mit Erfolg gewürzt, andere waren traurig und versalzen.
Der Roman vereint alles, was das Leben von Max hergab.
Spannend, unterhaltsam und humorvoll geschrieben.
Ein kurzweiliges Lesevergnügen.
Impressum:
Copyright© Eric Falkenhauser
Alle Rechte vorbehalten
c/o Block Services, Stuttgarterstraße 106,
70736 Fellbach
Druck und Vertrieb: epubli -ein Service der Neopubli GmbH,
Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Lektorat & Korrektur: Mentorium GmbH, 10789 Berlin
Coverbild: pixabay
Ausgabe 2024
Roman
Aufbruch im Sein
Die Frau hatte nach ihrer Meinung nichts Wichtigeres zu tun, als die auf Holzböcken aufgelegten Holzfensterläden mit einer Wurzelbürste zu schrubben. Es störte sie schon seit einiger Zeit, dass sich die Spinnen mit ihren Netzen in den grünen Schlitzen breit gemacht hatten.
Der Mann, der mit ihr im gleichen Haus wohnte, war unermüdlich in dem kleinen Reihenhaus unterwegs, um die noch im oberen Stockwerk an den Fenstern befindlichen Fensterläden auszuhängen und nach unten vor die Haustür zur beabsichtigten Reinigung zu schleppen.
Es war seine Mutter, die mit diesen ruckartigen Bewegungen das Fruchtwasser in ihrem Bauch so in Wallung brachte, dass ihm in der aufgewühlten Brandung kotzübel wurde. Ihm blieb nichts anderes übrig, als mit seinen kleinen Beinen gegen die obere Bauchdecke zu treten, um ihren Aktionismus zu beenden. So löste er wahrscheinlich die Wehen bei ihr aus, denn es wurde ruhiger in der rauen See. Der Mann, der anscheinend sein Vater war, wurde in seiner nächsten Laufrunde unterbrochen und musste zu einer öffentlichen gelben Telefonzelle rennen, um die zuständige Hebamme anzurufen.
Es sollten noch Stunden vergehen, in denen die Hebamme mit der werdenden Mutter beschäftigt war. Abwechselnd wurde gepresst, massiert und wieder Ruhepausen eingelegt und so hatte er im Inneren noch Zeit, sich über sein baldiges Dasein Gedanken zu machen.
***
Seine Eltern waren beide Jahrgang 1926. Eine Kriegsgeneration, aufgewachsen mit Leid und persönlichen Schicksalsschlägen. Mit traumatischen Erlebnissen aus der schlimmen Zeit des Zweiten Weltkrieges, in der der Tod sie jeden Tag begleitet hatte. Geprägt von Verletzungen und Vertreibung. Das werden seine Eltern sein, wenn er auf die Welt kommt. Es erwartet ihn ein Zuhause in einer Arbeiterfamilie. Ohne Reichtum, keine großartigen Immobilien, keine weitläufigen Ländereien und kein Vitamin B. Es wird für ihn ein Lebensweg werden aus ganz normalen Verhältnissen wie es sie zu Millionen in der Nachkriegszeit gab.
Eigentlich fühlte er sich noch ganz wohl in seiner Blase und Eile kannte er bisher nicht, aber mit den Tritten gegen seine Behausung hatte er einen Prozess ausgelöst, der nicht mehr zu stoppen war.
Das Herbstlaub fiel im September 1957 zu Boden, er hoffentlich nicht. So war es dann auch. Die Hebamme war um sein Wohl sehr bemüht und pünktlich; wie es sich für einen Schwaben gehört, wurde der Bub am Montagmorgen um sieben Uhr geboren.
Sein Aufbruch im Sein hatte begonnen. Er lebte nun in einer größeren Stadt im Süden von Deutschland, zusammen mit seinem Vater Franz, seiner Mutter Maria und mit seiner vier Jahre älteren Schwester Rita. Damit der Bub auch hört, wenn man etwas von ihm will, gab man ihm den Namen Maximilian. Es war abzusehen, dass es bei dieser altertümlichen Bezeichnung nicht bleiben sollte, und schon bald hieß der Kleine auch nur noch Max. Seine neue Unterkunft war jetzt ein kleines Reihenhaus, wie es in der Nachkriegszeit vielfach für junge Familien gebaut wurde.
Seine Mutter Maria kam aus einem kleinen Dorf unweit der Stadt, welches man nicht gerade als Schwungrad der Welt bezeichnen konnte. Dieses Kaff hatte vielleicht fünfhundert Einwohner und da waren die Hühner und Hasen in den bäuerlichen eingezäunten Gärten mit Sicherheit eingerechnet.
Als die Mutter zwölf Jahre alt war, verstarb ihr leiblicher Vater an einer Blinddarminfektion. Sie erzählte später viel von ihm, dass er ein sehr liebevoller Vater war, der seine beiden Töchter abgöttisch liebte. Ihre Mutter heiratete wieder, aber ab diesem Zeitpunkt wurde ihr Zuhause zur Hölle. Der kleine, kauzige Stiefvater hatte nicht viel übrig für sie und ihre jüngere Schwester. Er bevorzugte die eigene Tochter, welche die Mutter als Nesthäkchen noch von ihm bekam.
Eine kaufmännische Lehre oder gar ein Studium hätte Maria sehr gerne begonnen, aber dies wurde ihr von der Mutter und dem Kauz verweigert.
Sie musste als Jugendliche arbeiten gehen, um Geld nach Hause zu bringen, welches die Alten dann für sich einsackten. Der Pflicht-Arbeitsdienst war für Maria dann wie eine Erlösung vom Elternhaus. Beim letzten Dienst in einer gebildeten Familie im Stadtzentrum von Stuttgart blühte sie richtig auf. Es wäre schön für sie gewesen, wenn es so weitergegangen wäre, aber der Krieg machte alles zunichte. Stuttgart wurde durch die Bombardierung der Alliierten schwer in Mitleidenschaft gezogen. Als junge Frau saß sie im Keller eines großen Stadthauses, während der Putz durch die Bombeneinschläge von der Kellerdecke bröselte. Danach mussten die Verletzten und Toten geborgen werden und auf dem zerbombten Dachboden wurden die Blindgänger der Streubomben mit Wäschekörben eingesammelt. Auf dem Weg bis zur Abgabestelle herrschte bei allen die pure Angst, ob es gleich für immer Nacht werden würde.
Sie war eine aparte junge Frau, so wie man es sich aus Bildern der Sechzigerjahre vorstellt. Mittellanges welliges Haar, ein hübsches liebes Gesicht mit braunen Augen und einem charmanten Lächeln. Chancen hatte sie bei Männern damals genug und über einen angehenden Arzt berichtete sie immer wieder. Denn dass dieser ihr ganz intensiv nachstellte, gefiel ihr schon sehr. Sie ließ sich aber Zeit und war sehr zurückhaltend gegenüber diesem Charmeur. Als sie erfuhr, dass dieser noch zusätzlich eine andere Liebschaft hatte, die sogar ein Kind von ihm bekommen sollte, da war es mit der Freundschaft vorbei.
Sein Vater Franz wurde im früheren Bessarabien geboren. Seine Vorfahren sind im 19. Jahrhundert vom Süden Deutschlands umgesiedelt, in eine dortige deutsche Enklave. Franz hatte noch einen älteren Bruder, der aber früh an einer Krankheit verstarb, und einen um zwei Jahre jüngeren Bruder. Seine Schwester wird noch auf der bevorstehenden Flucht während des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland zur Welt kommen. Das Verhältnis zu seinem Vater Heinrich und seiner Mutter Elfriede war streng und die Anrede war aus Respekt und Würdigung den Eltern gegenüber immer in der dritten Person.
Heinrich bewirtschaftete einen Bauernhof, obwohl er eine Maurerlehre in Odessa abgeschlossen hatte. Franz musste natürlich als ältester Sohn und Jungbauer auf dem Hof mitarbeiten.
Der Zweite Weltkrieg holte sie auch in dieser ländlichen und abgeschiedenen Gegend ein. Heinrich und sein Sohn Franz wurden von der Deutschen Wehrmacht eingezogen und Elfriede war nun mit dem jüngeren Sohn Ernst allein auf dem Hof. Fortan musste Ernst Kinderkleider tragen, damit die Wehrmacht ihn nicht auch noch holte. Franz war bei der Einberufung gerade mal 18 Jahre alt und wurde an der Ostfront als Aufklärer eingesetzt. Ein Todeskommando ganz vorn an der Front, um nach dem Feind zu suchen. Bei einem Einsatz, ein halbes Jahr vor Kriegsende, gerieten er und seine Kameraden unter Beschuss und Franz wurde durch eine Maschinengewehrsalve schwer verletzt. Sein Bein wurde zerschossen und ein weiteres Geschoss schlug oberhalb des rechten Ellenbogengelenks ein und trat hinten wieder aus. Was ihn rettete, war die Tatsache, dass es im strengen Winter passierte. Das Blut hing wie ein Eiszapfen an seinem Ellbogen herunter und die Verletzung am Bein war auch zugefroren. Zehn Kilometer schleppte er sich allein zu Fuß ins Feldlazarett zurück, denn seine Kameraden waren alle tot. Der Feldarzt legte keinen Wert auf eine lange Wundbehandlung und nach kurzer Untersuchung war es für ihn klar.
»Das Gelenk ist zerschossen und der Arm muss ab, das Bein wahrscheinlich auch!« Franz war aber immer schon zäh und gegen sich rigoros.
»Nichts wird bei mir abgenommen und wenn ich daran sterben sollte, dann sterbe ich«, sagte er zum Feldarzt. Das Bein blieb dran, der Arm auch, aber das Gelenk war angewinkelt und steif. Das war schon fatal, weil Franz bereits seit Kindertagen einen beeinträchtigten linken Arm hatte, von einem Bruch, der ärztlich nicht versorgt worden war.
Elfriede war derweil zunächst mit dem jüngsten Sohn Ernst bis nach Westpreußen geflüchtet und Anna wurde dort geboren. Franz hatte somit eine Schwester, die er noch nie gesehen hatte. Die Flucht von Elfriede mit den Kindern ging nach Deutschland weiter, bis in ein Flüchtlingslager bei Hannover. Ihr Mann Heinrich kam nach dem Krieg dazu und er bekam Arbeit bei einem Gutsbesitzer.
Natürlich wollten sie wissen, was mit ihrem Sohn Franz geschehen war und suchten über verschiedene Meldestellen nach ihm. Er lebte, lag in einem Lazarett und hatte nur noch das, was er am Leibe trug. Seine Mutter Elfriede nähte aus englischen Armeedecken einen Anzug, damit er überhaupt etwas zum Anziehen hatte und holten ihn aus dem Lazarett heraus. Die Familie war wieder vereint. Später konnten sogar alle auf dem Gutshof wohnen und arbeiten.
Die älteste Tochter des Gutsbesitzers verstand sich sehr gut mit Franz und sie wurde seine erste große Liebe. Es war eine gute Zeit, und die Vorstellung einer glücklichen und besseren Zukunft war geboren. Lange war ihm aber dieses Glück nicht vergönnt; das Schicksal schlug erbarmungslos zu. Seine große Liebe wurde schwer krank und verstarb nach kurzer Zeit.
Auf dem Gutshof war es für Franz deshalb unerträglich geworden. Nicht, weil die Arbeit oder das Verhältnis zum Gutsbesitzer sich verschlechterten, nein, Franz fehlte ein Teil seines Herzens, und alles um ihn herum erinnerte ihn an seine verstorbene Liebe.
Die jüngere Tochter des Gutsbesitzers war nicht abgeneigt, den Platz ihrer verstorbenen Schwester einzunehmen, aber für Franz war dies keine Option.
Warum ist nicht bekannt, aber das Familienoberhaupt Heinrich wollte absolut nicht im Norden bei Hannover bleiben und hatte bei der Stadt, aus der seine Vorfahren kamen, einen Antrag auf Aufnahme gestellt. Erst nachdem in alten kirchlichen Schriften die Wurzeln der Familie nachgewiesen wurden, wurde die Genehmigung erteilt. So zog die komplette Familie in die mittelgroße Stadt in den Süden von Deutschland, in ein kleines Reihenhaus, welches Heinrich und Elfriede erwerben konnten. Heinrich arbeitete in der Stadt jetzt wieder als gelernter Maurer und Franz schlug sich mit Hilfsarbeiten durch. Dies war kein Zuckerschlecken für ihn. Von der Landwirtschaft hinein in eine Gerberei als Färber von Lederwaren. Von der Natur, mit frischer Luft, in eine Halle, in der es nach gegerbtem Leder und Tierhäuten stank.
Franz arbeitete viel, verdiente Geld und konnte sich damit etwas leisten. In sein äußerliches Erscheinungsbild wurde investiert. Er kaufte sich einen schicken Anzug mit Krawatte und ging zum Tanzen in die Stadt.
Fesch sah er aus, mit den schwarzen, nach hinten gekämmten Haaren und seinem markanten schmalen Gesicht. Dort lernte er Maria kennen. Er war verliebt und umgarnte sie, wann immer er konnte. Jeden Abend kam er mit dem Fahrrad und brachte sie von der Arbeit nach Hause. Die Treffen der beiden wurden immer häufiger und die Liebe zueinander wuchs. Lange dauerte es nicht, bis Franz erleben musste, wie seine Maria zu Hause behandelt wurde. Er hätte dem kauzigen Schwiegervater am liebsten die kleinen Hammelbeine langgezogen. Er nahm Maria mit in das Reihenhaus seiner Eltern. Der erste Schritt für eine gemeinsame Zukunft war getan und der zweite folgte mit:
»Ja, ich will.«
Die Hochzeit war bescheiden, ohne viel Glanz und Glimmer, schlicht im kleinen Kreis.
Es waren bisher nicht so viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vergangen. Niemand hatte viel an Luxus und alle mussten zwangsläufig zusammenrücken. So lebten drei Familien auf engstem Raum in dem kleinen Reihenhaus. Heinrich und Elfriede mit ihrer kleinen Tochter Anna, und die Söhne Franz und Ernst mit ihren Frauen. Zu viert hausten die Brüder in einem Nebenraum des Wohnzimmers, der ungefähr nur zehn Quadratmeter groß war. Es musste aber trotzdem einen unbeobachteten Moment gegeben haben, da Maria schwanger wurde.
Die Küche war so winzig, dass man mit zwei Personen darin Schwierigkeiten hatte, nicht die Kochtöpfe von der Herdplatte zu stoßen. Durch die unterschiedlichen Arbeitszeiten wurde die Küchenbenutzung zeitweise in einer Art Schichtbetrieb festgelegt, damit jede Familie für sich kochen konnte. Auf Dauer war diese Wohnkultur jedoch keine Lösung.
Wie die Eltern von Max dann zu ihrem jetzigen eigenen Reihenhaus kamen, war der Verdienst von Maria. Es müsste so Anfang 1953 gewesen sein. Maria arbeitete als Näherin bei einer Firma in der Stadt. Im Gespräch mit Arbeitskolleginnen erfuhr sie, dass die Stadt ein neues Wohnviertel für junge Familien bauen wollte. Sie ließ nicht viel Zeit verstreichen, um sich mit der Stadtverwaltung und der zuständigen Abteilung vom Bauamt in Verbindung zu setzen. Maria bewarb sich um ein kleines Reihenhaus in der neuen Wohnsiedlung, aber das Bauamt ließ sich Zeit mit der Entscheidung. Immer wieder wurde sie vertröstet und nichts ging voran.
Es war dann an einem Freitagmorgen, als Maria mit dem Bus in die Stadt fuhr. Das Ziel war das Bauamt der Stadtverwaltung, und dort überfiel sie den zuständigen Sachbearbeiter. Dieser hatte nach seiner Meinung überhaupt keine Zeit für den spontanen, unangemeldeten Besuch und wollte sie abweisen.
»So geht es aber nicht«, sagte dieser.
»Einfach kommen und ohne Termin.
Fahren Sie nach Hause.« Jetzt war Maria richtig resolut.
»Ich habe kein Zuhause und ich werde nirgends hinfahren. Hier in diesem Gang bleibe ich so lange sitzen, bis ich eine schriftliche Zusage über den Kauf eines Reihenhauses habe, selbst wenn es so lange dauert, dass ich meine Tochter hier im Gang auf die Welt bringen muss.«
Man konnte ihre Hartnäckigkeit nur bewundern.
Es dauerte bis zum Abend und der zuständige Sachbearbeiter besprach die Angelegenheit mit seinem Vorgesetzten, da sich Maria nicht mehr von der Stelle rührte. Das Bauamt gab schließlich auf, weil die Belagerung des Ganges noch Monate bis zur Geburt von Rita hätte dauern können. Maria fuhr mit dem Bus und einem Schreiben vom Bauamt nach Hause. Sie hatte die schriftliche Zusage in der Tasche, dass Franz und sie ein Reihenhaus in der neuen Wohnsiedlung erwerben könnten. Die Verhandlung bei der Bank zur Finanzierung des Reihenhauses lief nach dem gleichen Schema ab und später wurde zu irgendwelchen Ämtern ihre Tochter Rita mitgenommen, um der Sache noch mehr Nachdruck zu verleihen.
In einigen esoterischen Büchern kann nachgelesen werden, dass sich die Seele vor der Geburt die Eltern und die Lebenszeit aussucht. Hatte Max eine Wahl und suchte er sich seine Eltern oder sogar seine Lebenszeit aus? Erinnern konnte er sich auf jeden Fall nicht daran, dasser sich etwas ausgesucht hatte. Sein Dasein hatte nichts mit Spirituellem, sondern nur mit Biologie zu tun. Ein gedankenloser Spermafaden war auf dem Weg zur Gebärmutter gewesen, hatte sich dort eingenistet und ab diesem Zeitpunkt begann ein neues Leben. Wohin der Weg führt und wie lange er dauert, weiß keiner.
Was Max aber dachte, war etwas anderes.
»Wenn ich die Klugheit, die Feinfühligkeit und die Geselligkeit von Mutter haben könnte und die handwerklichen geschickten Hände, das Durchhaltevermögen und die Zähigkeit von Vater, dann nehme ich dies.«
Er wollte natürlich nicht zum Ausdruck bringen, dass sein Vater nicht klug war, aber Bücher lesen, studieren und philosophieren, das war nicht sein Ding. Handwerkliche Projekte planen und umzusetzen, dazu hatte er Ideen und Geschick.
***
Des Laufens war Max schon etwas mächtig, also war er etwas über ein Jahr alt. Dies hieß, dass man ihn hinter Gitter bringen musste, wenn man als Elternteil etwas ungestört tun wollte. Dafür hatte seine Mutter ihn samt seinem Holzlaufstall direkt vor der Haustür platziert, vorausgesetzt das Wetter war nicht ganz so schlecht. Holzlaufstall hört sich mehr oder weniger nach domestizierter Haustierhaltung an.
Im linken Eckhaus des Wohnblockes lebte auch eine kleine Familie, und zwar eine jüngere schwangere Frau und die Eltern ihres ersten Mannes. Der Opa saß auf der obersten der zwei Treppenstufen vor seiner Eingangstür, genau neben der Eingangstür, wo Max jetzt wohnte.
Er war schon sehr alt, trug eine schwarze Cordhose, dunkle klobige Halbschuhe, ein weißes Hemd und eine schwarze ärmellose Weste. Vom Modestil her wie die Zimmermannsleute. Außerdem hatte er einen schwarzen Hut auf, so einen, wie ihn Humphrey Bogart im Film „Casablanca“ hatte. Er war klein, schmal und etwas kantig im Gesicht, rauchte Pfeife und lächelte immer. Er war damals schon um die 80 Jahre alt und musste somit zu Lebzeiten von Sitting Bull geboren worden sein. Der berühmte Lakota-Sioux-Häuptling, der sich gegen die damalige US-Regierung zur Wehr setzte, verstarb im Jahr 1890. Was für eine zeitliche Vorstellung.
Max hatte herausgefunden, dass der Laufstall keinen Boden hatte und er ihn anheben konnte, um mit ihm zu laufen. Deshalb heißt das Ding auch Laufstall. Der Ausflug war jedoch auf diesem Weg begrenzt, weil das Gartentor vorn an der Straße schmaler war als sein besagter Laufstall. Dort blieb er zwischen den Pfosten stecken. Der Opa kam verlässlich, um ihm zu zeigen, dass ein Ausbruch zwecklos sei. Er hob den Laufstall wie auch Max an und zog alles zur Startposition zurück. Weit wäre Max ohnehin nicht gekommen, weil er keinen Geldbeutel dabeihatte, es fehlte für diesen die Gesäßtasche am Strampelanzug. Dennoch hatte er einen Ausbruch geschafft. Mit viel Gehirnschmalz war dieser jedoch nicht geplant, denn die Erhebungen in der Leistengegend waren keine Muskeln, sondern die Folgen eines Leistenbruchs - wahrscheinlich hatte er zu schwer gehoben.
Die nette Krankenschwester im Krankenhaus mochte Max besonders gerne; sie schloss ihn in ihr Herz und wollte ihn nicht mehr gehen lassen. „Guten Morgen, mein kleiner Sonnenschein“, war die Begrüßung und damit er ein paar Tage länger in ihrer Umgebung bleiben konnte, klemmte sie ihm seine Finger in die Nachttischschublade ein. Dies war seine erste Erfahrung, dass Liebe auch sehr schmerzhaft sein kann. Die Reihenhäuser waren Wand an Wand gebaut und Max hörte an einem Abend lautes Winseln und Jammern. Es war nicht schön, es war beklemmend und machte ihm Angst. Seine Mutter Maria musste es ihm angesehen haben und erklärte:
»Der Nachbar-Opa ist schon sehr alt und ganz arg krank.« Danach war er nie mehr auf der Treppe, um auf Max aufzupassen.
***
Es war eine richtige Blütezeit für seine Eltern, denn es ging bergauf. Sein Vater Franz war nicht mehr in der Gerberei, da er eine bessere und schönere Arbeit bei einer Firma gefunden hatte, die Industriebürsten jeglicher Art herstellte. Natürlich mit besserer Bezahlung als Mitarbeiter im Versand und eine Aufstiegschance als Leiter dieser Abteilung gab es noch dazu.
Die Eltern von Max kauften ihr erstes Auto. Es war ein schnittiger blauer Opel mit einem weißen Dach. Der ganze Stolz einer jungen Familie zeigte den wirtschaftlichen Aufschwung. Bisher besaßen nicht viele Nachbarn in der Straße ein Auto und die sonntäglichen Ausflüge mit dem motorisierten Gefährt begannen.
Zu der Zeit waren seine Eltern viel mit seiner Tante und seinem Onkel unterwegs. Diese hatten eine kleine Bäckerei und auch einen Opel als Kombi, um ihre Backwaren an Schulen auszufahren. Den Onkel konnte Max besser leiden als seine Tante. Die Tante war zwar auch nett, aber manchmal zu laut, zu aufbrausend und schüchterte Max deshalb immer ein. Die lustigen Fahrten mit dem Onkel entsprachen keiner Sicherheitsvorschrift, wie man sie heute kennt. Alle Kinder, die kleiner als einen Meter waren, wurden ganz hinten in den Kombi gestopft. Der Onkel fuhr dann so wild, dass alle Halbwüchsigen kreuz und quer auf der Ladefläche herum gepurzelt sind. Die Tante brüllte in der Blechkarosse und der Onkel nahm dies zum Anlass, um noch lauter zu lachen. Einmal lachte er so heftig, dass er geradeaus durch einen Gartenzaun bretterte und erst an einer Hauswand zum Stehen kam. Die Tante war klein und schmal, hatte aber ein Organ wie der Blasebalg einer Orgel. Es wurde mächtig laut im Kombi, und die Worte, die der Onkel zu hören bekam, sollten in keinem Buch veröffentlicht werden.
Der schaute kurz nach den Kindern.
„Nichts passiert?“
Dann ging die Lache wieder los.
Leider hatte Max nicht vergessen, dass es eine ekelhafte Angewohnheit gab. Seine Mutter tränkte mit Spucke ein Taschentuch und rieb es dann über seine Gosch. Einfach abstoßend und widerlich. Er hatte den Eindruck, dass dieses volkstümliche Ritual auch der Freifahrschein für viele andere war. Zudem wurde diese Angewohnheit vererbt und hat sich zum Kult entwickelt, weil man es heute immer noch sieht.
Dieses Ekelgefühl hat sich bei Max erhalten.
Nicht die Aktion mit dem vollgesabberten Taschentuch, das kommt nicht mehr vor, aber er kann nicht aus fremden Gläsern trinken, geschweige denn von einem fremden Teller essen.
»Verzeiht mir, aber ich bin in meiner frühsten Kindheit mit Spucke geschändet worden und habe seitdem eine posttraumatische Belastungsstörung.«
***
Eines Morgens wurde Max schick gemacht, der Fasson-Schnitt noch einmal durchgekämmt und dann ging es an der Hand seiner Mutter los. Die Fasson-Frisur war damals ein üblicher Haarschnitt, den alle Männer hatten: Opa, sein Vater und eben auch Max. Es war wahrscheinlich der einzige Schnitt, den der ältere Herren-Friseur konnte. Die Haare wurden mit einem Seitenscheitel auf die Seite gekämmt, um die Ohren herum freigeschnitten und zum Schluss der Kopf mit Birken-Öl eingeschmiert; fertig.
Wahrscheinlich hatte seine Mutter vor, auf ein Amt oder zu einer Bank zu gehen, um mit ihm persönliche Forderungen mit Nachdruck zu erreichen. Hatte er aufgrund seiner zwergenhaften Gestalt die Stelle von seiner Schwester übernommen?
Es war aber nicht so. Nur ein paar hundert Meter von seinem Zuhause entfernt war das Ziel. Ein größeres Gebäude mit einem Spielplatz, auf dem viele Kinder im eingezäunten Gehege wild durcheinander rannten und kreischten. Eine der Kindergärtnerinnen ging mit Max und seiner Mutter in das Innere des Gebäudes, in einen Raum mit einem großen Tisch und drei Stühlen. Regale mit unheimlich vielen Büchern darin waren an den Wänden. Die Eltern von Max hatten zu Hause auch ein Buch. Das von Karl May „Der Schatz im Silbersee“. Dieses hatten die hier aber nicht ausgestellt. Die Erzieherin entschied sich zügig dafür, sich auf den bequem aussehenden Stuhl hinter dem Tisch zu setzen. Der war mit Leder überzogen und drehte sich. Max hatte nur die Auswahl, ob er links oder rechts auf einem der harten Holzstühle neben seiner Mutter sitzen wollte. Er wusste überhaupt nicht, was Mutter im Detail mit der Kindergartentante besprach. Es ging aber wohl darum, ihn hier abzugeben. Zumindest für Stunden oder ein paar Tage. Oder für immer?
Ein Deal kam aber nicht zustande. Vielleicht war die Ablösesumme für den Kindergarten zu hoch oder der gebotene Verkaufspreis für seine Eltern zu niedrig. Er wusste es nicht und sie sind beide wieder gegangen. Auf jeden Fall war es so, dass er diese Einrichtung nie mehr betreten hat. Es lag aber nicht an dem Verhandlungsgeschick seiner Mutter, sondern an seinem äußeren Erscheinungsbild. Für sein Alter war Max noch richtig winzig; man wollte wahrscheinlich mit dem Eintritt in den Kindergarten abwarten, bis er erwachsen ist.
Eigentlich legt man erst viel später Wert auf sein Äußeres, aber immer öfter wurde über Max gesprochen.
Einmal war er mit seiner Mutter im Konsum. Konsum war ein etwas größerer Einkaufsladen seiner Zeit. Eine Bekannte seiner Mutter kam des Weges daher und begrüßte sie beide.
»Ja, hallo, ja, wie geht es dir?«
»Mir geht es gut, danke der Nachfrage«, antwortete Maria.
»Ach, ist dies dein Sohn?« Und schon beugte sich diese Gestalt zu ihm hinunter, begutachtete ihn von oben bis unten und dann kam wieder solch ein Satz, den er vom Inhalt her so langsam hasste.
»Ja, Bub, bekommst du zu Hause nichts zu essen? Du bist so klein und dünn, ist bei euch eine Hungersnot ausgebrochen?« Den Text konnte man leicht ändern, aber vom Sinn her lautete er schon so. Dies sagte diese korpulente, dicke Frau zu ihm. Ohne Respekt, denn sie hatten sich im ganzen Leben noch nie gesehen. Am liebsten hätte Max gesagt:
»Ja, wir haben zu Hause eine Hungersnot und ich weiß jetzt, wer daran schuld ist.«
Leider hatte er zu dem Zeitpunkt nicht dieses Vokabular und die Schlagfertigkeit, so blieb er stumm und verlegen. Viel Zeit zum Überlegen und sich Sprüche ausdenken, hatte er ohnehin nicht, weil seine Mutter sofort darauf reagierte.
»Was wird der bei uns nichts zum Essen bekommen!«
Um das Wort „der“ im Satz zu verdeutlichen, zog sie ihn an seinem dünnen Arm hin und her, hoch und wieder runter, und er sah aus wie die Spielzeugfiguren, an denen man unten am Strick ziehen konnte. Immer wieder hörte er fortan solche Andeutungen.
»Kind, du musst mehr essen, sonst wird nichts aus dir.« Seine Mutter nervte diese Bemerkungen genauso, wie wenn sie nichts kochen würde. Selbst eine Erholungsreise an die Nordsee wurde abgesagt, weil man befürchtete, dass Max die lange Fahrt mit dem Zug nicht überleben würde. Am schlimmsten sah es aus, wenn er im Sommer kurze Hosen anhatte. Jeder fragte sich, was für zwei Stricke bei ihm da unten aus der Hose heraushängen.
Rosenkohl wurde als Abhilfe gegen Untergewicht aufgetischt und das Animationsprogramm abgespielt.
»Eine grüne Kugel kannst du noch essen, die ist lecker und gesund.«
Konnte seine Mutter schlecht zählen?
Statt einer Kugel lagen drei auf dem Teller. Auch wenn Rosenkohl eisenhaltig ist, machen diese ekelhaften Dinger einen nicht viel schwerer. Mit vollgestopften Backen saß er am Küchentisch und dachte, wenn ich jetzt kotze, dann haut mir der Vater zuerst eine links und rechts auf die geleerten Backen, bevor die anderen auch noch drankommen. Es war für ihn eine Foltermethode mit diesem Gemüse.
Seine Gedanken legten fest, dass er, wenn er aus irgendeinem Grund einmal gefoltert werden sollte, „Waterboarding“ statt Rosenkohl wählen würde.
Hatte Max etwas von Günter Grass literarischem Werk „Die Blechtrommel“ mitbekommen? Dieses Buch wurde um diese Zeit herum verfilmt. Inspirierte ihn der Oskar Matzerath, der beschlossen hatte, nicht mehr zu wachsen? Wer weiß, ein Schwarz-Weiß-Fernseher stand bei seinen Eltern im Haus herum.
***
Max’ Vater Franz war in der Zwischenzeit im Reihenhaus sehr aktiv und somit in seinem Element. In der Waschküche baute er ein kleines Badezimmer ein, mit einem Warmwasserboiler, der mit Holz befeuert wurde. Der Blick ging durch ein kleines Fenster in die Waschküche. Sogar mit Vorhängen, es war gewiss niedlich. Max wollte immer als Letzter baden, weil dann am meisten Wasser in der Wanne war. Im Abwasser der Familie zu sitzen, war nicht so schlimm, weil seine mitgenommenen Indianerfiguren so tiefer tauchen konnten.
Keines der anderen Reihenhäuser hatte diesen Luxus. Freunde und Nachbarn kamen sogar, um sich zum Badetag mit seinen Eltern zu verabreden. Interessiert hätte es Max schon, ob es bei den Gästen auch nur eine Wanne mit Wasser gab.
In der unteren Stube hämmerte Franz eine Tür in die Außenwand zum Garten, und eine Terrasse wurde mit Betonplatten belegt. Selbstgemachte rote und gelbe Waschbetonplatten waren es, so dass es aussah wie vor amerikanischen Truck-Stopps. Wenn Franz schon mit der Schaufel unterwegs war, hob er auch gleich einen Gartenteich aus. Dieser war allerdings nicht tief genug und eher eine Snackbar für die Nachbarkatze Luise, die die armen Goldfische dann alle gefressen hat.
Sein nächstes Projekt war der Dachboden. Dort in dem Raum, in dem noch viele kleine Vogelkäfige standen und Kanarienvögel eingesperrt waren, um auf Wettbewerben zu singen, dort sollte neuer Wohnraum geschaffen werden. Es gab natürlich einen Grund für den Ausbau, denn Maria war wieder schwanger geworden.
Es war im Mai 1963. Drei Männer und ein Halber
saßen bei Max zu Hause in der Stube. Der Tisch war groß und stabil. Dunkles massives Holz und an beiden Enden mit zusätzlichen Platten ausziehbar. Genau die richtige Größe, um die vielen Bierflaschen, Schnapsgläser und die Aschenbecher zu verteilen. Zwischen den Männeraccessoires wurden Spielkarten nacheinander auf den Tisch geklopft. Die Wucht des Aufschlags war notwendig, um die Auswahl dieser Spielkarte zu unterstreichen.
Franz, sein Kumpel Manfred, und Max’ Opa Heinrich spielten Binokel. 150, 200, 250 und weg.
Der Spielort wechselte sich immer ab, was eine Maßnahme zum Schutz des Eigentums war. Jede Woche diesen stinkenden Zigarettenrauch in einem Zimmer und den Gestank hätte niemand mehr aus den Gardinen und den Wänden gebracht. Eingebrannt in die Sitzpolster für alle Ewigkeit. Das heutige Spiel zu Hause bei Franz ging schon über Stunden und die Stube war in der diagonalen Strecke vor lauter Qualm nicht mehr sichtbar. Alle Anwesenden rauchten, was die Lungen an Teer aufnehmen konnten. Selbst der kleine Max als passiver Raucher inhalierte kräftig mit. War ein Spiel gewonnen oder verloren, wurde noch heftig diskutiert. Wer hätte, wann und was für eine Karte bringen müssen, damit dieses Spiel anders ausgegangen wäre. Auf den Erfolg oder auf den Misserfolg wurde gleich wieder eine Zigarette angezündet und noch ein Schnaps hinuntergeschüttet. Das Spiel des Abends war in einer entscheidenden Phase. Es ging um den Gesamtsieg oder um eine herbe Niederlage, von der man sich die nächsten Wochen nicht mehr erholte. Die Stubentür ging etwas auf und ein Kopf, mit zerzaustem Haar, schaute durch den geöffneten Spalt in die Räucherkammer hinein. Keiner der im Spiel vertieften Männer beachtete die Erscheinung an der Tür.
»Hallo«, war eine leise Stimme zu hören.
Es war Maria, und noch einmal kam ein leises,
»Hallo!«
Man hörte aber nur 150, 180, 200 und weg, aber dann endlich meldete sich eine fürsorgliche Stimme aus dem Nebel der Spielhölle.
»Was ist jetzt schon wieder los?«
»Ich kann jetzt nicht!«, war die Antwort von Franz.
»Du, ich glaube, es geht los!«, sagte Maria.
»Was geht los, jetzt geht nichts los?«, kam es zurück.
»Die Wehen setzen schon regelmäßig ein, ich glaube, du solltest dringend die Hebamme holen.« Max dachte, das ist eine gute Idee, die kann es bestimmt noch. Gehofft hatte er auf einen Bruder, damit man die große Schwester auch mal zu zweit verkloppen kann.
Mit der Promillegrenze muss es zu der Zeit etwas toleranter gewesen sein, denn Franz versuchte, die Hebamme mit dem Auto zu holen, und die anderen Spieler fuhren genauso besoffen nach Hause. Die Anreise der Hebamme klappte trotz der vernebelten Sicht und später war Kindergeschrei im Haus zu hören. Max’Wunsch ging in Erfüllung, es war sein Bruder Alexander.
Die Kanarienvögel vom Dachboden waren inzwischen ausgezogen. Dachfenster wurden eingebaut und zwischen den Dachsparren wurde mit Glaswolle isoliert. Rigipsplatten waren verschraubt, verspachtelt und tapeziert. Zwei zusätzliche Schlafzimmer waren so entstanden. Rita bekam ihren Unterschlupf auf der rechten Seite nach dem Treppenaufgang, Max und sein Bruder Alexander die linke Seite. Das Zimmer von Rita war nicht mit einer schalldichten Tür abgetrennt, sondern nur mit einem dünnen Vorhang. Wahrscheinlich war dies die effektivste Verhütungsmaßnahme seiner Zeit.
Spaßig würde es werden, wenn der erste Freund von Rita kommt und abends länger geknutscht wird. Dann müsste er die knarrende Treppe hinuntersteigen und einen halben Meter entfernt, ums Bett der schlafenden Schwiegereltern in spe herumschleichen, um aus dem Haus zu kommen. Viel Erfolg beim leichten Schlaf von Mutter und toi, toi, toi.
Max machte sich keine Sorgen, dass seine erste Freundin auch einmal um das Bett seiner Eltern herumschleichen müsste. Er war noch sehr jung und bis dahin wären seine Eltern bestimmt ausgezogen.
***
Ein weiteres Jahr war schnell vergangen und ein neuer Lebensabschnitt stand in den Startlöchern. Max war nun fast sieben Jahre alt und im September sollte er in die Grundschule eintreten. Bei der Anmeldung zur Schule muss es so ähnlich gewesen sein wie damals beim Gespräch für den Kindergarten. Die Rektorin der Schule machte den Vorschlag, dass es aufgrund seiner körperlichen Statur vielleicht besser wäre, wenn er nächstes Jahr wiederkomme. Wahrscheinlich befürchtete seine Mutter, dass es wie beim Kindergarten ausgehen könnte, denn diesen hat er nach dem versuchten Aufnahmegespräch nie wieder besucht. Ein weiteres Aussetzen an einer Bildungseinrichtung, hätte für seine Entwicklung fatale Auswirkungen, so dass Maria auf die Einschulung zum jetzigen Zeitpunkt bestand. Sie versprach der Rektorin, dass Max fleißig weiter Rosenkohl bekommen würde, um sein Wachstum zu fördern.
Anfang September war es dann so weit. Nachdem der Bub neu eingekleidet war, wurde beim Friseur versucht, seine Frisur auf das neueste Niveau zu heben. Mehr als der Fasson-Schnitt kam dabei aber nicht heraus. Mit einer für ihn überdimensionalen Schultüte war Max auf dem Weg zu seinem ersten Schultag. Die Schultüte war nicht größer als die der anderen Schüler; nur im Verhältnis zu seiner körperlichen Statur sah diese riesig aus. Er verstand nicht, warum der untere Teil der Tüte mit Watte ausgestopft war und nicht, wie der obere, mit Süßigkeiten gefüllt. Er hätte die zusätzlichen Kalorien mit Sicherheit locker vertragen.
Die neuen Schüler mit den Tüten in den Armen waren schon etwas eingeschüchtert von den verschiedenen Ansprachen. Ihr Aufenthalt in dieser Anstalt sollte Jahre dauern, vielleicht sogar ein ganzes Jahrzehnt und unter Umständen noch länger. Fotos als Beweis der Abgabe wurden gemacht und im Klassenzimmer die Sitzplätze verteilt. Dies war jetzt unter der Woche der Ort, an dem Max zumindest morgens sein wird, in der Ludwig-Finckh-Grundschule. Er dachte, dass dieser Ludwig sehr reich sein müsste, und ihm gehörte dieses Schulgebäude. Ludwig Finckh war aber ein zu ehrender Mediziner, der zu seiner Zeit mit dem Schriftsteller Hermann Hesse befreundet war, nach dem auch viele Schulen benannt werden. Bei dieser Erklärung merkt man schon, wofür Schulbildung taugt.
Ein Jahr war schnell vorüber und die Lehrerin war mit Max zufrieden. Er habe mitgearbeitet und sein Betragen sei in Ordnung. So stand es niedergeschrieben in den ersten zwei Zeugnissen, die er als Beweis seiner Anwesenheit erhielt. Das Betragen war der Punkt, der seinen Eltern am wichtigsten war. Die Eltern blamieren oder Respektlosigkeit zeigen, was man als Erziehungsmangel auslegen könnte; das war für sie wie ein rotes Tuch bei einem Stier.
Die Eltern und Max bummelten an einem Samstagmorgen in der Fußgängerzone im Einkaufsviertel der Stadt und die Nachbarn waren mit ihrem jüngeren Sohn dabei. Bei der großen Kirche im Zentrum gab es ein Spielwarengeschäft, das neben den normalen Schaufenstern noch ein Eckschaufenster hatte. Darin waren die neuesten Spielzeugautos ausgestellt. Eines davon hatte es dem Kleinen besonders angetan und zunächst forderte er nur.
»Ich will dieses Auto haben!«, und er drückte seine dicken Wurstfinger an die Scheibe.
»Nein«, entgegnete seine Mutter.
»Du hast schon reichlich Spielsachen, heute gibt es kein neues Auto.« Niemand konnte sich jetzt ausmalen, was für ein Theater folgen würde. Der Zwerg schrie auf der Straße nach dem neuen Auto, hängte sich in die Arme seiner Mutter und strampelte so mit seinen Gräten, dass sich sein Hemd bis an den Hals hochschob. Das Brüllen wurde immer lauter, bis er sich rücklings auf die Straße warf und seine Mutter nur noch sein Hemd in der Hand hatte. Er hörte sich an wie bei einer Folter auf der Streckbank im dunkelsten Verlies. Seine Mutter wurde jetzt auch energischer, und es entwickelte sich ein Wortwechsel zwischen diesen zwei Generationen in einer Lautstärke von mindestens einhundert Dezibel.
Der Vater dieses Brüllaffen stand daneben und fand dieses Theater auch noch lustig. Er lachte auf eine ganz schrille Art darüber, wie sich sein Gnom aufführte. Passanten blieben stehen, schüttelten den Kopf und manche wollten gar Geld spenden, da sie dachten, es wäre ein aufgeführtes Laienstück von Mitgliedern des Naturtheaters. Der verbale Kampf war später dann entschieden. Ein Bub ging beruhigt, mit seinem neuen Auto unter dem Arm, weiter. Zur Belohnung für sein Schweigen sollte er noch Cola und Pommes Frites bekommen. Was für ein Deal und großartiger Erfolg des kleinen Querulanten. Die Eltern von Max schämten sich für diese Aktion, obwohl sie nur als Außenstehende dabei waren. So etwas wollten sie mit ihren Kindern nicht erleben. Zur prophylaktischen Abschreckung wurden Maßnahmen aufgezählt, nach denen ihre Kinder bei einem solchen Benehmen nicht mehr sitzen könnten.
Die Krönung kam dann noch, als sich der Kleine die versprochenen Cola und Pommes Frites im Restaurant bestellen durfte. Der Bengel hatte schließlich Hunger und Durst nach seiner körperlichen Aktivität.
Der Kellner war mit einem schwarzen Anzug und weißem Hemd gekleidet, weil es ein sehr gediegenes Restaurant war. Er kam mit dem Bestellten zurück an den Tisch, servierte, wünschte einen guten Appetit und ging.
Etwas war jedoch an der Lieferung nicht in Ordnung.
»Hey du«, schrie der Gnom dem Kellner hinterher.
»Du blöder Seggel, das kannst du wieder mitnehmen und selbst fressen.« Seggel ist ein alter alemannischer Ausdruck. Er kann eine Liebkosung oder eine starke Beleidigung sein. In dem Zusammenhang meinte der Gnom allerdings eher die zweite Variante.
Diese Peinlichkeit an verbalem Ausdruck überstieg die Belastungsgrenze von Max’ Eltern. Sie zahlten, während sich der im innerlichen Aufruhr befindliche Kellner noch über Erziehung und Beleidigung mit den Nachbarn unterhielt. Die drei flüchteten in Richtung Parkplatz zum Auto. Franz sagte immer wieder: „Wenn das meiner wäre, Gnade ihm Gott.“ Gelegentlich gingen die Blicke nach hinten, um zu sehen, ob jemand kommt und schreit.
»Ihr seid dabei gewesen, Schande auch über euch.«
Blamieren hin oder her, der Kleine hat aber seinen Willen und sein Durchsetzungsvermögen in seinem Leben behalten. Er besitzt heute ein größeres Geschäft und hat fünfzig Angestellte.
Einige Zeit später waren die Eltern bei Bekannten eingeladen; Max und sein kleiner Bruder Alexander mussten bei diesem Ausflug mit. Die beiden saßen bestimmt fünf Stunden vor einem Aquarium. Zwei haben hinein und viele herausgeglotzt. Die Stille und das brave Verhalten der beiden Buben beeindruckten, und die Gastgeber attestierten den Eltern eine gute Erziehung. Das Lob gefiel ihnen natürlich. Mit ihren Kindern konnten sie sich in der Öffentlichkeit sehen lassen und Max hielt sich mit dem Wunsch nach einem Aquarium mit Fischen zurück. Sein Arsch sprach sich dagegen aus.
Der Sohn dieser Bekannten kam noch kurz vor ihrer Abfahrt dazu, sagte flüchtig „Hallo“ und verschwand auf sein Zimmer. In dieser Nacht erschoss er sich mit dem Jagdgewehr seines Vaters. Er hatte Angst, seinen Eltern zu beichten, dass er das Abitur wieder nicht geschafft hatte.
Diese beiden Ereignisse waren schon sehr gegensätzlich zueinander. Ein Gnom setzt seinen Willen gegenüber seinen Eltern durch, Respekt und Peinlichkeiten waren gänzlich irrelevant. Ein anderer hatte zu viel Respekt und Angst vor seinen Eltern und um ihnen eine Peinlichkeit zu ersparen, fand er ein tragisches Ende.
***
Nach dem Jahr der Eingewöhnung ging es für Max an eine richtige Schule, die Gerhart-Hauptmann-Schule. Sie war nicht weit von seinem Zuhause entfernt, so dass er sie leicht zu Fuß erreichen konnte. Man erklärte ihm damals, dass der Gerhart ein berühmter Schriftsteller und Dramatiker war. Na ja, zumindest verstand er jetzt schon die Hälfte von dem, was der Gerhart gewesen war. Diese Schule war riesig, im Gegensatz zu der bisherigen Eingewöhnungsschule. Die Klassenzimmer waren mit modernen Möbeln ausgestattet; es gab einen Werkraum und sogar einen richtigen Chemiesaal. So einer wie in einem Hörsaal einer Universität, in dem die Bänke von unten nach oben gehen. Um die Schüler in Bewegung zu versetzen, gab es eine gigantische Turnhalle mit allen Sportgeräten, die in der Lage waren, auch die kleinsten Muskeln zu fördern. Im Freien war ein Sportgelände mit Fußballplatz, Laufbahnen und einer Weitsprunganlage. Dies war jetzt etwas anderes, eine Nummer größer als die bisherige schulische Einrichtung. Für Max begann jetzt die richtige Schulzeit und der Welpenschutz war definitiv vorbei. In den Einzelfächern wurden Klassenarbeiten geschrieben, benotet und die Leistung im Zeugnis festgehalten. Willkommen im neuen Lebensabschnitt.
Mit Sicherheit gehörte Max nicht zu den überragenden Schülern in seiner Klasse. Er war eigentlich nur dabei. Die Hausaufgaben erledigte er zwar, aber kein Haar mehr und freiwillig ein Buch in die Hand zu nehmen, auf diesen Gedanken kam er nicht. Wie auch, es gab zu Hause keine Bücher, außer dem von Karl May.
Wenn Max zu Besuch bei den Großeltern mütterlicherseits mitgeschleift wurde, verkroch er sich an den langweiligen Besuchssonntagen an den Zeitungsständer. Akkurat sortiert war dieser, und die nicht allzu lustige Oma ermahnte:
»Bringe an den Zeitschriften ja nichts durcheinander, sonst komme ich mit dem Kochlöffel.«
Was für eine blöde Idee, wie kann man mit einem Kochlöffel Zeitungen sortieren? Die Lektüren wie Frau mit Herz, Neue Post und Echo der Frau waren so spannend wie der ganze Sonntag. Zu diesen Großeltern ging Max nicht so gerne. Bei jedem Besuch gab ihm diese Oma immer eine Tafel Zartbitterschokolade in die Hand. Es war die Schokolade mit dem Schwur der drei Musketiere:
„Eine für alle, alle mit einer.“
Max griff nach der Tafel Schokolade, doch die Oma hielt sie fest.
»Und wie sagt man zur Oma?«
»Danke, blöde Oma, für die Zartbitterschokolade, die du uns drei Kinder immer wieder schenkst. Du weißt genau, dass wir diese überhaupt nicht mögen und hör verdammt noch mal auf, meine Backen zusammenzukneifen und dann zu schütteln.«
Nein, das hat er nicht gesagt, denn Unhöflichkeit war ihm verboten. Es blieb also beim »Danke, Oma.«
Der Stiefvater seiner Mutter war ohnehin der schon beschriebene komische Kauz. Bei jedem Besuch hatte er die Namen der Kinder wieder vergessen, obwohl er nicht dement war. Eher gleichgültig, denn die Kinder interessierten ihn nicht. Sein lockeres Gebiss knackte beim Essen immer nach, als wenn er noch eine Erdnuss extra zum Wurstbrot nehmen würde, und dieses Geräusch konnte Max überhaupt nicht leiden. Immer wieder schaute er zu dem Alten rüber und hoffte, dass sich der Kauz vielleicht an seinem klapprigen Gebiss verschluckt. Der Besuch bei diesen Großeltern erledigte sich aber eines Tages, weil seine Eltern mit ihnen Streit bekamen. Zuerst dachte Max, er sei schuld, weil er die Oma zu Hause einmal fragte, ob sie ihm etwas mitgebracht hätte.
»Nein, ich habe dir nichts mitgebracht«, antwortete sie zornig, und dann rannte sie aus dem Haus. Der Grund war aber, dass Oma die neue Waschmaschine so mit Wäsche vollstopfte, dass diese den Geist aufgab und vor sich hin qualmte. Maria ärgerte sich sehr laut über diese Blödheit und dann war die Oma weg.
Als musikalisch konnte Max sein Zuhause nicht bezeichnen. Es wurde nie gesungen, keiner konnte Musiknoten lesen, geschweige denn ein Musikinstrument spielen. Erst in der Schule hatte er im Musikunterricht die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen, und zwar entweder eine sogenannte Melodica oder die übliche Blockflöte. Max entschied sich wie die anderen Schüler in seiner Klasse für die Blockflöte. Bedauerlicherweise konnte er darauf nie ein Lied spielen. Seine Hände waren nicht groß genug und sein kleiner Finger reichte nicht bis an das unterste Loch. Lieder mit diesem Loch gab es leider nicht. Um dennoch eine Note im Musikunterricht zu bekommen, stand er mit noch zwei anderen vor dem Musiklehrer und musste Jahr für Jahr denselben Mist vorsingen. „Wenn die bunten Fahnen wehen“.
Ihm war Singen immer peinlich und Max bewunderte die anderen in seiner Klasse, die voller Freude und Inbrunst lautstark alles mit ihrer Stimme gaben.
Nach wie vor hatte sich bei Max keine Eigeninitiative für das Lernen außerhalb des Schulunterrichts entwickelt. Wenn eine Klassenarbeit geschrieben wurde, bekam er es erst mit, wenn morgens die Tische auseinandergestellt waren. Das Überraschungsmoment lag so meistens nicht bei den Lehrern; ihm war es wichtiger, nach der Schule auf den Bolzplatz zu gehen.
In einer deutschlandweiten Schulreform wurden zwei Kurzschuljahre eingeführt, um einen gleichen Alters-Status in den Schulen zu bekommen. Ein Schuljahr hatte folglich nur sechs Monate. Für Max war es insoweit schlecht, als dass der Schulstoff eines ganzen Jahres in ein halbes Jahr gesteckt wurde. Er war ohnehin nicht der beste Schüler, und das freiwillige Lernen hatte er weiterhin nicht erfunden. Seine Schulnoten gingen nach unten. Speziell in Rechtschreibung schlich sich eine mangelhafte Note ein.
Es lag aber nicht allein an den Kurzschuljahren, dass er in seinen gesamten schulischen Leistungen abbaute. Familiäre Ereignisse belasteten ihn bis in den roten Bereich seiner Kinderseele, so dass seine Schulnoten noch schlechter wurden und die Versetzung in die nächste höhere Klasse stark gefährdet war. Was passierte, als Max zwischen elf und zwölf Jahre alt war?
Düstere Wolken zogen zu Hause auf. Das Verhältnis seiner Eltern zueinander wurde stetig schlechter, und selbstverständlich bemerkten die Kinder diese schleichende Veränderung. Die Eltern waren finanziell am obersten Anschlag der Belastbarkeit angekommen, was enorme Spannungen auslöste und damit das Vertrauen zueinander verloren ging. Sie hatten Schwierigkeiten, das laufende Darlehen für das Haus mit dem erhöhten Hypothekenzins zu bewältigen. Der Kredit für das Auto musste zudem noch abbezahlt werden und die höheren Unterhaltskosten mit drei Kindern schlugen auch zu Buche. Das Gehalt des Vaters und die bisherige Heimarbeit der Mutter reichten nicht mehr aus. Es war notwendig, dass mehr Geld in die Haushaltskasse kam, um den Lebensstandard halten zu können. Maria suchte nach weiteren Arbeitsmöglichkeiten und hatte zwei Stellen als Haushaltshilfe bei ganz sympathischen Lehrern angenommen. Die Klassenzimmer der Schule wurden außerdem noch von ihr geputzt, aber der größte Brocken war die zusätzliche angenommene Heimarbeit. Als Brocken konnte man es bezeichnen, weil Berge von verschiedenen Waren zu Hause abgeladen wurden.
Rita musste dadurch viele Aufgaben im Haushalt übernehmen und versorgte ihre jüngeren Brüder wie eine Mutter. Sie musste waschen, putzen, kochen und bei der Heimarbeit auch noch helfen. Eine Seite der Eckbank in der Küche enthielt Max’ Spielkiste. Der Inhalt war überschaubar und das Billigste vom Billigen. Beim Spielen mit seinen Freunden war Max schon aufgefallen, dass deren Spielzeug schöner war als seines. Wenn diese Freunde zum Spielen kamen, hatte er sich immer ein wenig geschämt.
Schlimmer als die billigen Spielsachen war aber, dass seine Mutter immer gereizter wurde.
»Zieht eure Schuhe aus, da habe ich gerade geputzt, macht mit den Spielsachen keine Miste, da habe ich gerade aufgeräumt und tobt nicht so laut herum, dafür habe ich gerade keine Nerven.«
Maria hatte schon die berechtigte Ahnung, dass sie das bis jetzt Erschaffene nicht mehr halten konnten. Sie arbeitete zwar Tag und Nacht, aber die großen Sorgen wuchsen ihr über den Kopf und die Angst gleich mit. Es war ohnehin kein hoher Lebensstandard, den sie hatten, wo hätte man etwas einsparen können? An allem wurde schon gespart. Es war so, dass der Vater eine Scheibe Leberkäse bekam und die drei Kinder teilten sich mit der Mutter zwei. Süßigkeiten für die Kinder waren so selten wie eine Sonnenfinsternis. Wenn Rita beim Wäschewaschen Kleingeld in Vaters Hosentasche fand, ist sie zum Milchgeschäft gegangen, um für sich und die Buben für 10 Pfennige eine kleine Waffeltüte mit Sahne zu kaufen. Die lautstarke Tante von der Bäckerei sammelte zu der Zeit enorme Bonuspunkte, weil sie manchmal Lakritz-Schnecken und andere Schlecksachen beim Besuch mitgebracht hatte. Entlastung hätte der Verkauf des Autos gebracht, aber Franz weigerte sich, seinen ganzen Stolz zu verkaufen. Jeder Nachbar hätte zudem sofort gesehen, was finanziell bei ihnen los war. Die Last der Schulden forderte jetzt ihren Preis.
Auch Franz veränderte sich. Er wurde auf alle Männer eifersüchtig, die auch nur in die Nähe des Hauseingangs kamen. Er untersagte Maria, die Haustür zu öffnen, wenn es klingelte. Egal, ob es der Milchmann, der Eiermann, der Postbote oder die Männer mit der Heimarbeit waren. Alle Angelegenheiten mussten über das Küchenfenster geregelt werden. Selbst die ganze Heimarbeitsware wurde von dort ins Haus gestopft. Maria sollte keinen Anlass geben, dass die verschiedenen Männer auch nur den kleinsten Hauch eines Flirts bekamen. Sie hatte gar keine Absicht, geschweige denn Zeit, um zu flirten, weil sie Tag und Nacht an der Heimarbeit saß und angefangen hat, zu sinnieren.
Warum Franz auf einmal solche Zweifel an der Loyalität zu seiner Frau hatte, wusste keiner.
Wie im Theater gab es dann Abend für Abend eine aufgeführte Inszenierung, ein Theaterstück mit dem Titel „Der betrogene Mann“. Ihre Kinder waren das Publikum und immer mit dabei, ganz vorn in der ersten Reihe. Über Monate wurde der erste Akt des Dramas aufgeführt. Lautstarke Vorwürfe, dass Maria nach anderen Männern Ausschau halten würde, haltlose Beschuldigungen, Rechtfertigungen und Uneinigkeit. Ein kostenloses Hörspiel für die umliegende Nachbarschaft. Franz ließ in der Küche seinen Dampf ab, und Maria stocherte verbal von der Stube aus dagegen. Die beiden waren an Starrköpfigkeit nicht zu überbieten; keiner lenkte dem Frieden zuliebe und auf Rücksicht zu den Kindern ein.
Es begann der zweite Akt des Ehedramas:
„Die betrogene Frau.“ Die Eifersucht ging von Maria als Revanche in die zweite Runde. Franz blieb jetzt bis zur Spätvorstellung des Ehedramas länger bei der Arbeit, und sein Abendbrot stand noch auf dem Küchentisch. Maria hatte den Verdacht, dass Franz ein Verhältnis mit der neuen Mitarbeiterin im Versand begonnen hatte und deshalb immer später nach Hause kam. Er war in diesem Zeitraum zum Versandleiter aufgestiegen, und als Abteilungschef attraktiver für die Arbeiterinnen am Verpackungstisch geworden.
Maria hing jeden Abend am Fenster und Franz kam einfach nicht nach Hause. Sie heulte über den Fenstersims ins Freie und ihre größeren Kinder gleich mit. Der Schwager wurde angerufen, der musste in der Firma nachschauen, wo der Franz bliebe und ob er vielleicht noch eine „Schachtel“ im Versand auspackte.
Die Theateraufführung ging in den dritten Akt und das Drama nahm an Heftigkeit zu. Die wortreichen Auseinandersetzungen wurden häufiger und heftiger. Es blieb nicht aus, dass Porzellan durch die Küche flog und bei den Kindern machten sich Angstzustände breit.
Es war nicht mehr das Zuhause, das sie aus früheren Zeiten kannten. Die Geborgenheit und Sicherheit waren verschwunden. Sie hatten einfach nur noch Angst. Jeden Abend lag Anspannung im Raum, wenn die Eltern aufeinandertrafen.
Konnte man sich in dieser Zeit nicht scheiden lassen?
Nein, damals konnte man sich nicht scheiden lassen - was hätten da die Nachbarn gesagt.
Rita und Max hatten mitgeholfen, damit ihre Mutter die Mengen an Heimarbeit abarbeiten konnte und gleich nach der Schule wurde mit der Arbeit begonnen. Die beiden zogen Gummis am Bund von Jogginghosen ein und ihre Mutter vernähte diese. Nicht selten saßen sie noch bis spät in der Nacht in der Stube, um die Arbeit zu erledigen. Aber trotz der Hilfe der Kinder wurde Maria immer depressiver. Sie weinte und schweigend arbeiteten die Kinder neben ihr.
Die stupide Arbeit war stinklangweilig und die Berge an Hosen schien kein Ende zu nehmen. Es gab aber einen Terminzwang und sie mussten es schaffen. Der kleine Bruder Alexander bekam von dieser schlimmen Zeit nichts mit, denn er war noch zu klein. Rita und Max kümmerten sich um ihn, so gut es ging.
Als Abwechslung zu den Jogginghosen gab es Wäscheklammern zu fertigen. Millionen von den halben Plastikteilen wurden durch das Küchenfenster hineingeschmissen.
Mit einer Vorrichtung spannte sich die eingelegte Feder in der Mitte, und die zwei Plastikhälften wurden mit dieser zu einer Wäscheklammer vereint. In der Stube ging es wie am Fließband in einer Fabrik zu. Einer holte Material, einer machte den Fertigungsprozess und einer verpackte die Wäscheklammern zu den vorgeschriebenen Verpackungseinheiten. Es fehlte nur noch eine Stempeluhr, um irgendwann Feierabend zu haben, damit sie schlafen gehen konnten. Trotz der Kinderarbeit verbesserte sich aber das Verhältnis der Eltern zueinander nicht. Manchmal dachten die Kinder, dass die Streiterei endlich zu Ende ging, aber dann begann es aufs Neue. Maria bohrte in der gleichen Wunde, immer und immer wieder. Selbst die Kinder hatten manchmal die Gedanken, dass sie endlich ihr Maul halten und den Vater in Ruhe lassen sollte. Es war eine schreckliche Zeit der Ungewissheit und der Angst.
Was passiert noch und wann?
Die Krönung der Heimarbeit kam aber noch.
Zusätzliche Starkstromleitungen wurden in der Waschküche verlegt und dann Maschinen des Arbeitgebers von Franz angeliefert. Dieses Mal nicht durch das Küchenfenster, sondern über die Gartentreppe in die Waschküche. Als Rita und Max diese Fabrikausstattung in ihrer Waschküche sahen, dachten sie, dass ihre Eltern nicht mehr alle Latten am Zaun haben.
In Stahlgitterboxen wurden Rohteile von Industriebürsten aus Stahl angeliefert. Die Drähte der Bürste mussten hydraulisch in eine runde Metallplatte gepresst werden und anschließend wurde die fertige Drahtbürste auf Pappe gelegt und mit einer durchsichtigen Plastikhaube verschweißt. Sicherlich brachte diese Art von Heimarbeit mehr Geld ein als das Einnähen eines Gummizugs an einer Hose, aber es stellte sich eine Frage:
Wer sollte diese Arbeit tun?
Maria war depressiv und stand neben sich. Rita und Max arbeiteten sich dann buchstäblich die Hände blutig und ihre Freizeit war jetzt restlos aufgebraucht.
Als Max einmal mittags keinen Bock darauf hatte, in der Waschküche zu arbeiten, ging er zu seiner Mutter.
»Ich gehe auf den Spielplatz zum Fußballspielen«.
»Ja«, sagte sie.
»Geh nur, lasst mich doch alle allein.«
Sie arbeitete weiter und konnte ihre Tränen nicht verbergen.
»Ich gehe dann«, sagte Max noch einmal an der Tür.
»Ja, geh, vielleicht werde ich mich dann heute noch aufhängen.«
Das traf Max voll ins Herz.
Er fing an zu zittern und war völlig geschockt.
Dieses ganze Elend wollte er aber heute nicht ertragen, sondern zumindest ein paar Stunden raus und Spaß haben. Max ging. Lange hielt er es aber beim Fußballspielen nicht aus. Die Gedanken und die Vorstellung, dass seine Mutter sich was antuen könnte, gingen nicht aus seinem Kopf. Wenn sie sich tatsächlich heute aufhängen würde, dann wäre er schuld, weil er gegangen war und sie allein gelassen hatte. Seine Mutter arbeitete noch, als er nach Hause kam. Er setzte sich neben sie und sie arbeiteten stumm weiter. Oft stand Max mit seiner Schwester in der Waschküche, um aus stacheligem Draht Industriebürsten zu fertigen. Um zumindest etwas Spaß zu haben, spielten sie zusammen Kaufladen.
»So, Frau Maier, was hätten Sie denn gerne?«
»Oh, bin ich schon dran, Herr Metzger? Ich bekomme etwas von der Presswurst.«
»Ja, sehr gerne, Frau Maier.«
»Soll ich sie Ihnen einpacken?
»Ja, das wäre sehr aufmerksam von Ihnen.«
Dann wurde die Bürste gepresst, verpackt und der Kundschaft übergeben. Man kann sich jetzt schon vorstellen, wie aufmerksam Max morgens in der Schule war.
Eines Abends war die Auseinandersetzung zwischen den Eltern so schlimm, dass Rita sich und die Buben in die Stube eingeschlossen hatte, während der Streit nicht aufhören wollte. Von der kleinen Küche über den Flur, dann bis in den ersten Stock hoch. Eine aktive Theatershow über zwei Stockwerke war in vollem Gange. Komisch war, dass keiner der Nachbarn bei dem Krawall die Polizei gerufen hatte. Es war furchtbar, wie sich die Eltern aufführten. Ihre Kinder saßen zusammengekauert in einer Ecke und befürchteten, dass einer der Eltern nach diesem Streit nicht mehr leben würde. Dann rumpelte es noch einmal heftig und es wurde ganz still.
Rita schloss die Tür auf und schaute nach. Ihre Mutter war die Treppe heruntergefallen, lag verkrümmt am Boden, jammerte vor sich hin. Franz kümmerte sich um sie. Die Angst war unerträglich.
»Mama, Mama, Mama, bitte nicht sterben!«
Sie knieten neben ihrer Mutter und heulten Rotz und Wasser. Körperlich war Maria zum Glück nicht viel passiert, sie hatte sich bei dem Sturz nichts gebrochen, aber dies musste der Schlusspunkt dieser Aufführungen sein!
Wo war der Respekt geblieben, den sie als Eltern immer von ihren Kindern gefordert hatten?
Rita und Max hatten Tage später den Verdacht, dass sich die Eltern nach dieser Eskalation des Streitens zusammengesetzt hatten und darüber sprachen, wie es mit ihnen in Zukunft weitergehen sollte.
In dieser Zeit der elterlichen Auseinandersetzungen konnte Max nachts nicht mehr schlafen. Als das Licht ausging und er seine Augen zumachte, hatte er das Gefühl, dass jemand neben seinem Bett stand und nach ihm griff. Er fühlte die Berührungen von kalten Händen, und das Böse war um ihn herum.
Der Teufel vielleicht?
Kam der, um ihn zu holen?
Er hatte furchtbare Angst in diesen Nächten. Sein Herz klopfte wie verrückt und er betete, dass dieses Böse verschwinden solle. Er zog sich die Bettdecke über den Kopf und traute sich nicht, unter das Bett zu schauen. Denn das war der Ort, an dem der Teufel auf seine Opfer wartete, und im Dunkeln kam er hervor und holte einen. Wenn nicht heute, dann vielleicht morgen.
Man brauchte sich deshalb nicht wundern, wie das Zeugnis von Max aussah. Dass er mit diesem noch versetzt wurde, bleibt bis heute ein Rätsel. Sport und bildhaftes Gestalten waren noch im Rahmen einer guten Note, aber der Rest von mangelhaften Bewertungen durchzogen und in der Rechtschreibung gab es sogar ein Ungenügend. Eine glatte Sechs mit Zusatzzahl, wenn es die gegeben hätte. Bei Diktaten wäre es einfacher gewesen, er hätte den Text gleich in Rot geschrieben und die damalige Klassenlehrerin die drei fehlerfreien Wörter mit Schwarz unterstrichen. Seine Mutter wurde von der Lehrerin zum Gespräch einbestellt. Es ging nicht nur um seine schlechten Schulnoten, sondern um das Grundsätzliche, was mit Max los war. Mit Rosenkohl wird zum Glück die Rechtschreibung nicht verbessert; dieses stand schon einmal fest. Deshalb ging seine Mutter gleich nach dem Schultermin in ein Geschäft, in dem es Zeitungen gab. Das war die pädagogische Lösung, um seine Schwachstelle in der deutschen Sprache zu beseitigen. Einfach genial. Maria nähte an ihrer Nähmaschine etwas zusammen und diktierte Max nebenbei einen Text aus dem politischen Teil der gekauften Tageszeitung. Wenn dies geholfen hätte, wäre sie heute durch das angemeldete Patent stinkreich.
***
Der Lieblingsspielplatz von Max war nicht weit von seinem Zuhause entfernt. Über eine große Hauptstraße, die von der Stadt hinaus aufs Land führte, ging es direkt steil eine Böschung hinunter und dort war sein Reich. Ein kleiner Bachlauf und ein fast stehendes Gewässer, direkt an den Bahnlinien des Güterbahnhofes. Dort war sein Paradies, der Ort gab ihm Ruhe, Kraft und viele schöne Stunden. Zuerst war er dort viel allein, um zu spielen, dann nahm er später seine Freunde mit. Die mit den schöneren Spielsachen und sie waren ganz begeistert. Es schwammen verschiedene Arten von Molchen, Kaulquappen und anderem Getier im Wasser. Eidechsen von Farbe und Größe, die sie noch nie so gesehen hatten. Blindschleichen, Ringelnatter und Schlingnatter. Verschiedene Wasserpflanzen, einfach ein Wunder der Natur. Das alles waren wunderbare Studienobjekte. Das erste Mal in seinem Leben studierte Max in Büchern. Bei seinem besten Freund zu Hause gab es die entsprechenden Exemplare. Auch sein Vater erkannte seine Freude an der Natur und schenkte ihm ein Aquarium. Max hatte das nicht erwartete und fand es ganz toll von ihm. So konnte er das eine oder andere Tier noch genauer erforschen. Später wurden diese Tiere unbeschadet wieder in die Freiheit entlassen. Man sollte es nicht glauben, aber ein Jahr später hatte Max in Deutsch eine Gesamtnote von einer Drei. Das viele Lesen und Lernen brachte einen Wandel und tat ihm gut. Darauf war er stolz. Noch stolzer wurde er, als er in Naturlehre eine Eins bekam. Wer hätte das jemals gedacht! Es war die Erkenntnis, dass Max gar nicht so dumm war, wie andere aussahen.
Mit seinen besten Freunden wurde immer abgewechselt, bei wem sie sich zum Spielen trafen. Es waren mehr die Intellektuellen, die alle nicht mit den Füßen spielen konnten. Beim Fußballspielen waren es andere Kameraden, die wiederum mit dem Kopf weniger bis gar keine Begabung hatten. Bei ihm zu Hause zu spielen, vermied Max trotzdem so gut es ging. Seine Mutter war immer noch sehr mit der Arbeit eingespannt und hatte für spielende Kinder nicht genug Nerven.
Max erkundete einen zweiten Lieblingsplatz und seine Freunde waren sehr gespannt, was er ihnen dieses Mal zeigen würde.
»Heute gehen wir in das Schlaraffenland.«
Große Augen machten die Jungs und zogen mit ihm los. Nur eine Viertelstunde ging es zu Fuß. Sein Opa Heinrich hatte in der Nähe von seinem Reihenhaus ein kleines Grundstück in einer Schrebergartenanlage gepachtet. Außer Gemüse und Obst hatte er auch noch einen Hasenstall. Jetzt erzählte Opa aber, dass die ganze Schrebergartenanlage zurück an die Stadt gegangen war. Deshalb hatten die Pächter schon teilweise ihre Gartenhäuser abgebaut und mitgenommen und wer keine Verwendung dafür hatte, ließ diese einfach stehen.
Es war ein gigantischer, großer Spielplatz. Die Beete, in denen das Gemüse und das Obst standen, waren schon etwas verwildert, weil sie niemand mehr pflegte; dadurch entwickelte sich aber eine Landschaft mit einem urwaldartigen Charme. Überall, wo man durchgelaufen ist, gab es etwas zu naschen. Sie fanden verschiedene Gemüse in oder auf der Erde und es duftete nach vielen Kräutern. An den Sträuchern waren noch reife Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, und verschiedene Bäume waren voll mit Früchten.
Es war wie im Schlaraffenland.
Dann schlossen die Jungs einen geheimen Pakt. Niemand von ihnen durfte jemals jemandem etwas über dieses Schlaraffenland erzählen; dieser Ort sollte geheim bleiben. Sie gründeten eine Bande, um das Schlaraffenland zu schützen. Es blieb beim Schwur, weil sich keiner traute, für eine Blutsbrüderschaft einen Tropfen Blut mit dem Messer aus der Haut zu schneiden. Ab dem Tag duldeten sie keine Besucher mehr, denn es sollte ihr Land bleiben. Pfeile und Bogen wurden gefertigt und es ging jeden Tag auf Streife, um Eindringlinge zu verjagen. Was die Jungs nicht wussten, war, dass es schon viele Proteste gegen diese geplante Bebauung gab und jeden Tag ein Artikel darüber in der Tageszeitung stand.
Trotzdem wurde dann eines Tages das ganze Gelände mit Stahlgittern umzäunt. Bagger und Lastwagen rollten an und das Schlaraffenland war kurze Zeit später dem Erdboden gleich gemacht.





























