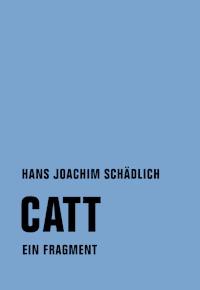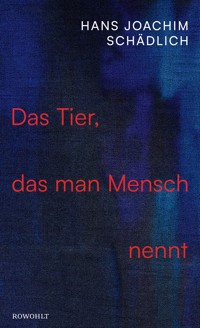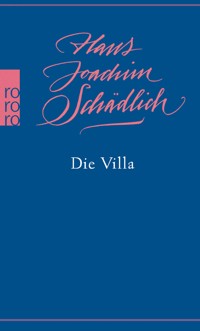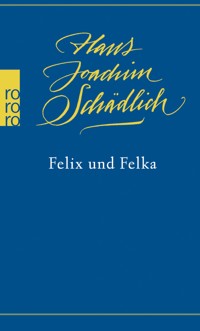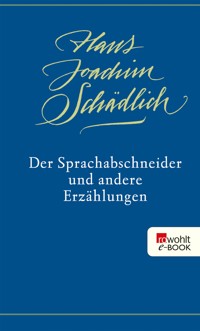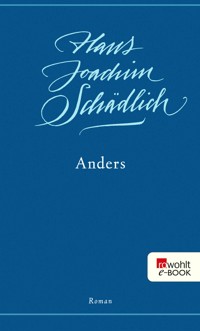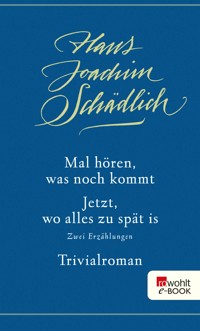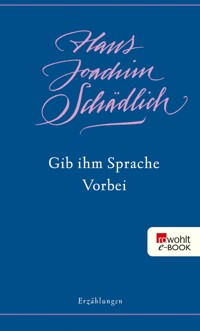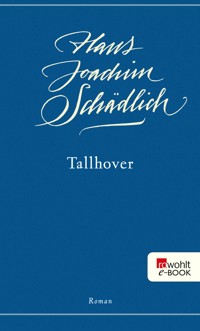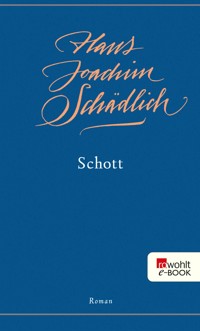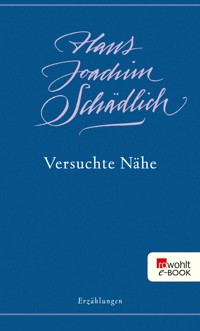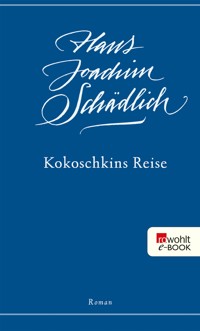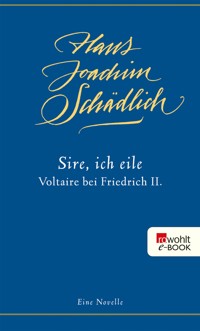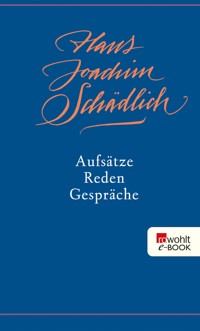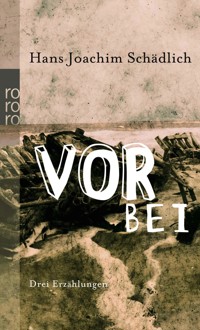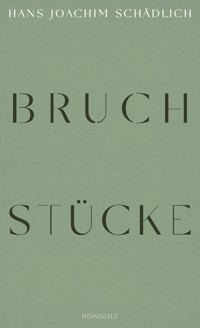
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hans Joachim Schädlich erzählt aus seinem Leben. Im Werk dieses Schriftstellers steht die Verknappung als Prinzip über allem, und so präsentiert sich sein Erinnerungs- und Gedenkbuch in Teilen, Facetten, Splittern. Im Zentrum stehen Begegnungen mit Zeitgenossen und Weggefährten, mit Verlegern, Wissenschaftlern, Personen der Zeitgeschichte und vor allem Autoren wie Max Frisch, Sarah Kirsch, Stefan Heym, Günter Grass. Neben den Menschen gibt es die Orte. Schädlich ist um die Welt gereist, oft zusammen mit seinem Verleger Ledig- Rowohlt. Und den Lesenden ermöglicht dieser Lebensrückblick Reisen in die Vergangenheit; in die DDR, die Schädlich vertrieb, und in die alte Bundesrepublik, in der er ein vielgerühmter Autor werden durfte, zu den Deutsch-Deutschen Dichtertreffen, an Wendepunkte der Geschichte und Literaturgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Bruchstücke
Über dieses Buch
«In Hans Joachim Schädlichs Prosa wird das 20. Jahrhundert entschlüsselt.» Süddeutsche Zeitung
Im Werk von Hans Joachim Schädlich steht die Verknappung als Prinzip über allem. Auch in seinem Erinnerungsbuch. Im Zentrum stehen Begegnungen mit Verlegern, Wissenschaftlern, Personen der Zeitgeschichte und mit Autoren wie Max Frisch, Sarah Kirsch, Stefan Heym, Günter Grass.
Hans Joachim Schädlich erzählt aus seinem Leben – ironisch, politisch, lakonisch.
Vita
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ostberlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u. a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. 2014 erhielt er für seine schriftstellerische Leistung und sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Hans Joachim Schädlich lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Krista Maria Schädlich
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-02390-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Krista Maria
Briefträger
Ich bin Briefträger.
Gestern habe ich beschlossen, meine Erlebnisse aufzuschreiben.
Heute fange ich damit an.
Jetzt.
Leute schreiben an Leute.
Ich trage es zu ihnen.
Mir schreibt niemand.
Einen Briefkasten habe ich.
Gelegentlich steckt ein Bote Werbeprospekte in meinen Briefkasten.
Der Bote grüßt mich.
Ich sage: Langweilig. Und leicht.
Er: Leicht, wenn die Briefkästen draußen sind. Aber wenn sie im Haus sind, schwer. Ich muß bei irgendwem klingeln: Werbung! Manche drücken auf den Türöffner.
Ich: Sie lesen gar nicht die Namen an den Briefkästen. Schmeißen nur die Werbung rein.
Er: Ich lese aber: Bitte keine Werbung.
Ich: Und?
Er: Schmeiß sie trotzdem rein.
Ich: Ich lese die Namen auf den Briefen und die Namen an den Briefkästen.
Er: Ihr Briefkasten ist voll. Geht nix mehr rein.
Ich: Dann lassen Sie es!
Er: Steht nicht dran: Keine Werbung!
Gestern bin ich auf der Straße in einen Haufen Hundescheiße getreten.
Ich mach Schluß mit dem Tagebuch.
Jetzt.
«Hier lang!»
Jane, Amerikanerin, zeitweilig wohnhaft in Westberlin, kann Wolfgang jederzeit in Ostberlin besuchen.
Wolfgang, DDR-Bürger, darf nicht in den Westen.
Jane und Wolfgang wollen nicht auf Dauer in Ostberlin sein. Wolfgang will mit Jane in den USA leben.
Aber wie kommt Wolfgang in den Westen?
Jane hat eine Idee. Wolfgang soll als amerikanischer Soldat (GI) verkleidet am Checkpoint Charlie nach Westberlin gehen. Der Checkpoint Charlie war seinerzeit in der Friedrichstraße der Grenzübergang durch die Berliner Mauer zwischen West- und Ostberlin. Auf östlicher Seite befand sich die DDR-Grenzübergangsstelle.
Jane besucht in Westberlin Clubs amerikanischer Soldaten. Sie erfährt, daß die DDR-Grenzer alliierte Soldaten nicht kontrollieren dürfen. Die alliierten Soldaten werden auf dem Weg nach Osten und auf dem Rückweg von den DDR-Grenzern nur gezählt.
Jane findet einen GI, der ungefähr Wolfgangs Figur hat. Er leiht ihr seine Ausgehuniform. Bei mehreren Besuchen schmuggelt sie die Uniformteile – Jacke, Hose, Hemd, Schirmmütze –, die sie in ihren Mantel einnäht, in den Osten.
Sie freundet sich mit dem Soldaten Ned an, der Wolfgang in Ostberlin besucht.
Jane besorgt eine amerikanische ID-Card auf den Namen José Rodriguez und klebt Wolfgangs Paßfoto hinein.
Am 6. April 1974 ist Jane bei Wolfgang in Ostberlin, Lichtenberg, Möllendorffstraße 27.
Es ist so weit. Heute soll Wolfgang als José Rodriguez nach Westberlin gehen. Der echte José Rodriguez soll Stunden nach Wolfgang zurück über den Checkpoint Charlie nach Westberlin gehen.
Mit Ned ist vereinbart, daß Wolfgang und er sich im Ostberliner Pergamonmuseum treffen.
In der Möllendorffstraße 27 ist die amerikanische Uniform in der Küche unter dem Abwaschtisch verstaut.
Jane holt die Uniform aus der Küche. Sie bügelt die Uniformhose, die Jacke. Wolfgang zieht die Uniform an. Jane setzt Wolfgang die Schirmmütze auf und die Sonnenbrille, die sie in einem Westberliner Geschäft für Theaterrequisiten gekauft hat. Jane ist zufrieden, Wolfgang ist nervös.
Unerwartet kommt Achim, Wolfgangs Freund, auf seinem Motorrad aus Greifswald.
Jane verabschiedet sich von Wolfgang und Achim. Sie will vor Wolfgangs Flucht in Westberlin sein.
Achim sieht plötzlich, daß Jane ihre Handtasche vergessen hat. Wolfgang, erschrocken, sagt:
«In der Tasche ist ihr Paß.»
Achim nimmt die Tasche, eilt aus der Wohnung und fährt mit dem Motorrad Jane hinterher. In der Chausseestraße erreicht er sie und gibt ihr die Handtasche.
Achim fährt zu Wolfgang zurück.
Wolfgang zieht seinen Parka über die Uniformjacke. Die Schirmmütze und die Sonnenbrille steckt er in eine weiße Plastiktüte.
Wolfgang fährt mit Achim auf dem Motorrad in die Nähe des Pergamonmuseums.
Um 16.00 Uhr ist Wolfgang mit Ned im Pergamonmuseum verabredet.
Auf einer unbelebten Treppe in das untere Stockwerk zieht Wolfgang seinen Parka aus. Er setzt die Schirmmütze und die Sonnenbrille auf. Den Parka steckt er in die weiße Plastiktüte. Er setzt sich auf eine Steinbank. Die Plastiktüte mit dem Parka stellt er neben die Bank. Wolfgang wartet.
Als er Ned sieht, steht er auf und geht zu ihm. Sie schlendern noch eine Weile durch das Museum und gehen schließlich zum Ausgang.
Auf der anderen Seite der Straße Am Kupfergraben steht Neds VW-Bus mit dem amerikanischen Kennzeichen JR-6570. Ned photografiert Wolfgang. Dann fahren sie ziellos durch Ostberlin. Ned will wissen, ob er verfolgt wird. Aber niemand folgt ihnen. Schließlich fährt er die Friedrichstraße entlang bis in die Nähe des Grenzübergangs.
Er sagt:
«Du mußt jetzt aussteigen und losgehen.»
Wolfgang steigt aus und geht los. Er schwitzt. Er geht an einem DDR-Grenzer vorbei. Seine ID-Card muß er nicht vorzeigen.
Zwischen der Ost-Grenzkontrollstelle und dem Checkpoint Charlie stehen verschiebbare Eisengitter. Für Wolfgang ein Labyrinth. Er, der die Wege nicht kennt, geht auf der Fahrbahn. Muß er nach rechts, muß er nach links? Ein DDR-Grenzer ruft ihm zu:
«Hier lang!»
Wenige Meter weiter das Military-Police-Häuschen der westlichen Alliierten. Auf einem großen Schild:
«You are entering the American Sector.»
Wolfgang durchfährt es blitzartig:
«Ich bin raus!»
Er biegt in die Kochstraße ein.
Ned, der auch zurück nach Westberlin gefahren ist, wartet dort auf ihn in seinem Bus. Sie fahren zum U-Bahnhof Potsdamer Platz. Am Straßenrand steht Jane mit ihrer Freundin Susan.
Sie lachen, sie weinen, sie umarmen einander.
Die DDR-Grenzer hatten in ihrer Grenzkontrollstelle alle alliierten Soldaten gezählt, die nach Ostberlin gegangen und nach Westberlin zurückgekehrt waren.
Bis kurz vor Mitternacht stimmten die Zahlen an diesem 7. April. Bis kurz vor Mitternacht José Rodriguez über den Grenzübergang gehen wollte.
Die DDR-Grenzer zählten plötzlich einen Mann zu viel. Sie hielten ihn für einen DDR-Flüchtling und nahmen ihn fest.
Nach Stunden mußten die Grenzbeamten erkennen, daß José Rodriguez richtig und ein anderer falsch gezählt wurde.
Sie mußten José Rodriguez gehen lassen und erfuhren nie, wer der andere gewesen war.
Hinterster Winkel
Kamenz, am östlichen Rand Sachsens gelegen, Geburtsstadt Gotthold Ephraim Lessings (1729–1781), des bedeutenden Dichters der Aufklärung, Ort der Verleihung des Lessing-Preises.
Im Amtszimmer des Oberbürgermeisters, Mitglied der PDS, das Foto eines sowjetischen Kampfjets an der Wand. «Eine Erinnerung an meine Zeit bei der Luftverteidigung der Nationalen Volksarmee», sagt der Oberbürgermeister.
Nach der Preisverleihung im Jahr 2003 ein Essen im Ratskeller.
Professor Heinz Ludwig Arnold, der die Laudatio gehalten hatte, steht auf und ruft in den vollbesetzten Saal:
«Wir tragen den Geist der Aufklärung noch in den hintersten Winkel der Republik.»
Fast eine Stunde
Alexander V. Isačenko (1911–1978), russisch-österreichischer Linguist, Autor slawistischer Standardwerde («Die russische Sprache der Gegenwart», 1962; «Geschichte der russischen Sprache». Zwei Bände, 1980 und 1989).
Studium der Slawistik in Wien bei Nikolai S. Trubetzkoy. 1933 Dissertation, 1939 Habilitation. Unterrichtete in Wien, Ljubljana, Bratislava und Olomouc.
Berufung an die Akademie der Wissenschaften der DDR in Ostberlin, wo er von 1960–1965 die Arbeitsstelle Strukturelle Grammatik leitete.
Nach einer Vortragsreise, die ihn nach London und Paris geführt hatte, wurde er bei seiner Rückkehr in die DDR von DDR-Grenzern im Bahnhof Friedrichstraße in erniedrigender Weise kontrolliert: Leibesvisitation, Durchsuchung der Wäsche, Durchsicht der Vortragsmanuskripte. Die Kontrolle dauerte fast eine Stunde.
Er verließ den Bahnhof und rief über den Bahnhofsvorplatz:
«Man kommt aus Europa und fährt in ein Arschloch.»
Nach Bremen
Die Mutter, Witwe, arbeitslos, arm, wußte nicht, wie sie dem Jungen sorglose Sommerferien bieten sollte.
Die Mutter sagte:
«Fahr doch zu Albert, unserem Buchhalter – als wir in Reichenbach noch die Firma hatten. Hat bei uns gewohnt, in der Mansarde. Nach dem Krieg, da war noch Geld da, hat er mir ewig auf der Tasche gelegen. Der kann dich mal paar Wochen durchfüttern.»
Der Junge sagte:
«Wo wohnt der.»
Die Mutter sagte:
«In Bremen, mit seinen alten Eltern.»
Der Junge sagte:
«Wie soll ich nach Bremen kommen?»
Die Mutter sagte:
«Von Westberlin, per Anhalter.»
Der Junge sagte:
«Wie soll ich in Westberlin jemanden finden, der nach Bremen fährt.»
Die Mutter sagte:
«Fährst zum Messegelände, wo die LKWs nachm Westen starten.»
Die Mutter packte dem Jungen Hemden, Unterwäsche, Strümpfe, die Badehose und Stullen und Äpfel in den Rucksack und sagte:
«Goethestraße.» Nummer soundso.
Als Reisegeld gab sie ihm fünf Mark.
Der Junge ging am nächsten Morgen zur Bushaltestelle und fuhr nach Fürstenwalde. Von Fürstenwalde mit dem Zug nach Erkner. Von Erkner mit der S-Bahn nach Westberlin, Bahnhof Zoo.
Der Junge fragte einen Bahnbeamten:
«Wie komme ich zum Messegelände?»
Der Bahnbeamte sagte:
«Du fährst mit der U-Bahn Richtung Ruhleben. Oder mitm Bus bis zum Haus des Rundfunks.»
Vom Rundfunk bis zum Messegelände ist es nicht weit. Dort standen LKWs.
Der Junge fragte einen Fahrer:
«Kann ich mitfahren nach Bremen?»
Der Fahrer sagte:
«Nach Bremen fahr ich nich. Aber bis Marienborn kannste mitkomm.»
Der Junge durfte vorn beim Fahrer sitzen.
Der Fahrer sagte:
«Vor der Grenzkontrolle in Marienborn mußte raus.
Sonst ziehen mir die Vopos die Hammelbeine lang.»
«Wie soll ich denn über die Grenze kommen.»
«In Marienborn gehste in die Kneipe. Da fragste.»
Der Junge stieg in Marienborn aus und ging in eine Kneipe. Da saß er, bis es dunkel wurde.
Am späten Abend sammelten sich Leute um einen Mann, der aussah wie ein Wanderer. Der Junge verstand nicht, was er flüsterte. Plötzlich standen die Leute auf und folgten ihm.
Leise fragte der Junge eine Frau:
«Wo geht ihr hin?»
«Rüber», flüsterte sie.
Der Junge ging einfach mit.
Der Marsch dauerte die ganze Nacht.
Niemand sprach ein Wort.
In der Morgendämmerung erreichten sie die Autobahn bei Helmstedt. Der ‹Wanderer› hatte die Grenzkontrolle zwischen Ost und West in weitem Bogen umgangen.
Der Junge war in der Bundesrepublik.
Auf einem Parkplatz standen LKWs. Er fragte einen Fahrer:
«Fährst du nach Bremen?»
«Ja.»
«Kann ich mitkommen?»
«Ja. Aber nur hinten.»
Der Junge kletterte auf den LKW und hockte sich auf leere Säcke.
Gegen Mittag kam der Wagen in Bremen an.
Der Fahrer ließ ihn irgendwo in der Stadt vom Wagen klettern.
Stundenlang lief er durch die Stadt und fragte viele Male die Leute:
«Wo ist die Goethestraße?»
Endlich hatte der Junge die Straße gefunden.
Der Junge klingelte an einem Mietshaus Nummer soundso bei Alberts Namen: Keiner da. Er klingelte noch einmal: Keiner da.
Es war schon später Nachmittag.
Niedergeschlagen zog er durch die Gegend. Bis er zu einer Polizeiwache kam.
Der Junge ging hinein. Zu dem Polizeibeamten sagte er: «Die Leute sind nicht da. Wo soll ich bloß bleiben.»
Der Beamte sagte:
«Du kannst hier in einer Zelle übernachten.» Er gab ihm eine Decke und führte ihn in die Zelle.
Der Beamte:
«Die Zellentür laß ich auf. Morgen früh gehste einfach.»
Der Junge legte sich auf die Pritsche, deckte sich zu und schlief sofort ein.
Am nächsten Morgen wanderte er wieder zur Goethestraße. Klingelte.
Da öffnete Albert die Tür und sagte:
«Um Gottes willen, wo kommst du denn her.»
«Von zu Hause. Hat dir die Mutter nicht geschrieben?»
«Ich hab nix bekommen.»
«Ich soll bei dir Ferien machen.»
«So? Na, dann komm mal rein.»
Die alten Eltern von Albert sahen ihn feindselig an.
«Was soll der Junge hier?»
Albert sagte:
«Das ist ein Sohn meines Chefs in Reichenbach. Will bei uns die Ferien verbringen.»
Alberts Vater sagte:
«Wir haben keinen Platz.»
Albert sagte:
«Ich stelle die Liege in den Korridor. Geht schon.»
Alberts Mutter sagte:
«Und essen?»
Albert sagte:
«Das wird schon reichen.»
Albert hatte ein funkelnagelneues Fahrrad.
Der Junge sagte:
«Darf ich damit fahren?»
Albert sagte:
«Wann du willst.»
Mit Alberts Rad unternahm er lange Radtouren.
Albert sagte:
«Hast du ’ne Badehose mit?»
Der Junge sagte:
«Ja.»
Albert ging mit ihm ins Freibad.
Unterwegs sah der Junge einen riesigen Bau.
Der Junge sagte:
«Was ist das?»
Albert sagte:
«Das Weserstadion.»
Der Junge sagte:
«Da will ich hin.»
Albert ging mit dem Jungen ins Weserstadion. Sie sahen ein Spiel von Werder Bremen gegen wer weiß wen.
Seine schönsten Sommerferien gingen zu Ende.
Alberts Mutter sagte:
«Endlich!»
Der Junge sagte zu Albert:
«Wie komme ich nach Berlin.»
Albert sagte:
«Ich bringe dich zum Freihafen. Dort findest du einen Lastwagen.»
Am Freihafen fragte der Junge einen Fahrer.
Der Fahrer sagte:
«Ja, kannst mitfahren. Aber nur, wenn du mir beim Laden hilfst.»
Der Junge half ihm beim Laden von Apfelsinenkartons. Die waren nicht schwer.
In Helmstedt mußte der Junge nicht vom Wagen runter.
Später, auf einem Parkplatz, sagte der Fahrer:
«Gegen Leute, die in den Osten wollen, haben die Vopos nix.»
Nicht schlecht
Der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung von 1984 bis 1996, Prof. Dr. Herbert Heckmann sagte:
«Ich war kein guter Schüler. Aber einmal wollte ich es meinem Vater zeigen.
Ich war fleißig, und am Ende des Schuljahres hatte ich in allen Fächern eine Zwei. Stolz zeigte ich meinem Vater das Zeugnis.»
Der sagte:
«Nicht schlecht. Aber es hätte besser sein können.»
Vergebens
In Templin, mitten in der ländlichen Uckermark, die Landesoberschule – das ehemalige Joachimsthalsche Gymnasium – mit Schüler-Wohnheimen und Lehrer-Villen.
In den Dörfern der näheren und weiteren Umgebung siedelten viele Neubauern, die im Rahmen der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone landwirtschaftlichen Besitz von 5–8 Hektar erhalten hatten. Es waren zumeist Flüchtlinge, die in Ostpreußen, Hinterpommern, Schlesien in der Landwirtschaft beschäftigt gewesen und vertrieben worden waren.
Die Kinder von Neubauern konnten nach dem Besuch der Grundschule in die Landesoberschule aufgenommen werden; sie lebten in den Wohnheimen (Heimschüler). Nur wenige Schüler kamen aus Templin (Stadtschüler).
Einen familiären Bildungshintergrund hatten die Kinder der Neubauern gewöhnlich nicht.
Besonders der Latein-Unterricht bereitete den meisten die größte Mühe.
Latein unterrichtete ein siebzigjähriger alter Gymnasiallehrer namens Dr. Hildebrand, der sich nicht mit den Nazis eingelassen hatte.
Er bemühte sich redlich, aber erfolglos.
Eines Tages schlug er einem Schüler das Lateinbuch auf den Kopf und sagte:
«Von einem Haufen Scherben versucht ein Gott vergebens, Frucht zu ziehen.»
Mai 1977
Eigentlich wollten Sarah Kirsch und ich ein Ferienhaus in Mecklenburg kaufen.
Mein Schwager, Landwirt in Mecklenburg, hatte ein passendes Anwesen gesucht und in der Nähe Schwerins gefunden.
Ich war mit Krista und Sarah dorthin gefahren.
Das Haus auf einem Hügel, in der Umgebung glitzernde Seen. Zum Grundstück gehörte ein kleiner Wald. Im Garten Bienenstöcke. In der Küche Zwiebelmuster-Porzellan; eine Küchenhexe mit Messingbeschlägen.
Oben alte Bauernmöbel.
Der Besitzer:
«Meine Mutter ist gestorben. Was soll ich mit der alten Bude. Ich hab ’ne schöne Neubauwohnung in Schwerin. Geben Sie mir dreitausend Mark, und wir sind uns einig.»
Krista war hingerissen. Von Zeit zu Zeit leben auf dem Land, fern der Großstadt.
Eine blaue Gartenbank vor dem Haus hatte es ihr besonders angetan.
Krista sagte:
«Da sehe ich mich als alte Frau sitzen. Um mich herum die Hühner. Wie ich Erbsen auspahle.»
Sarah Kirsch fing an zu mäkeln:
«Ziemlich niedrig, und der Fußboden ist brüchig.»
Ich sagte:
«Hier wachsen aus den Wänden schon Pilze.»
Zu dem Besitzer sagten Sarah und ich schließlich:
«Nein.»
Wir fuhren ab.
Krista im Auto verschnupft. Schweigen.
Irgendwann sagte Sarah:
«Halt mal an einem Gasthof an. Ich glaube, Krista braucht einen Schnaps.»
Krista: