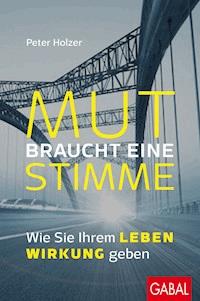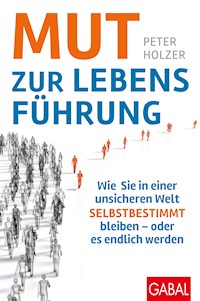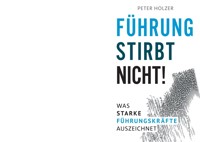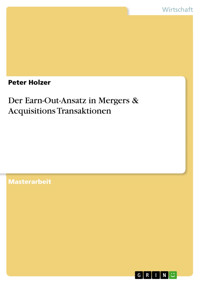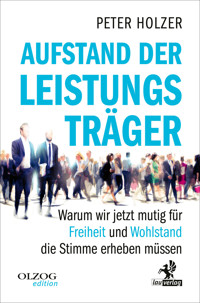
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lau-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Olzog Edition
- Sprache: Deutsch
Eine Krise jagt die nächste – und unser gewohntes Leben steht auf der Kippe. Verlässliche Stromversorgung, bezahlbare Preise, funktionierende Infrastruktur, sichere Arbeitsplätze: Was früher selbstverständlich war, gerät ins Wanken. Der Staat greift ein, verteilt großzügig Geld – und nimmt dabei denjenigen die Luft zum Atmen, die den Wohlstand überhaupt ermöglichen: den Machern in unserem Land, egal ob Unternehmer, Angestellte oder Arbeiter. In der Zurückhaltung der Leistungsträger sieht Peter Holzer ein Problem für Deutschland und stellt die Frage: Warum schweigen ausgerechnet die, die das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden? Was würde in einem Unternehmen passieren, wenn Führungskräfte, Mitarbeiter und Leistungsträger nicht mehr mit Herzblut für die gleiche Sache kämpfen? Der Zusammenbruch wäre vorprogrammiert. Mit der Erfahrung eines erfolgreichen Unternehmer-Coachs zeigt Peter Holzer, wie wir Deutschland als Unternehmen in der Krise neu denken können. Mit klaren Worten und mutigen Impulsen fordert er dazu auf, nicht länger auf Lösungen von oben zu warten, sondern Verantwortung zu übernehmen. Dieses Buch ist ein Appell an alle, die unser Land am Leben halten: Werden Sie aktiv, erheben Sie Ihre Stimme – für ein Deutschland, das auf Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft setzt. Denn die Zukunft beginnt mit denjenigen, die heute anpacken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
PETER HOLZER
AUFSTAND DERLEISTUNGSTRÄGER
PETER HOLZER
AUFSTAND DERLEISTUNGSTRÄGER
Warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstanddie Stimme erheben müssen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage
ISBN 978-3-95768-267-3
eISBN 978-3-95768-268-0
© 2025 by Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek
Lau-Verlag & Handel KG
Kirschenweg 10a
21465 Reinbek
E-Mail: [email protected]
www.lau-verlag.de
Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung: pl, Lau-Verlag, Reinbek
Umschlagabbildung: © iStock.com/IR_Stone
Satz und Layout: pl, Lau-Verlag, Reinbek
Inhalt
PROLOG Um zwei Uhr nachts klopft es an deine Tür
TEIL EINS Ein Land am Abgrund
1 Wo bleibt unser Führungsanspruch?
2 Deutschland, der Klimaretter?
3 Erst die Moral, dann das Fressen?
4 Diversity statt Teamgeist?
5 Fleiß und Ehrgeiz – sozial ungerecht?
6 Sinnvolle Inhalte oder geistiger Schrott?
7 Migration – Pulverfass oder Hoffnungsträger?
8 Kinder an die Macht?
9 Ist die Rente sicher?
10 Politiker oder Leistungsträger?
TEIL ZWEI Die Wurzel des Übels
1 Zerfall kommt von allein
2 Die drei tödlichen Geschwüre
3 Der Staat ist das Problem
4 Wir brauchen mehr Vitalkraft
5 Allein in der Schweigespirale
TEIL DREI Mut zur Führung
1 Bekennen wir uns zum deutschen Volk!
2 Horizont statt Apokalypse!
3 Dem Staat die Fesseln anlegen!
4 Politiker dienen den Bürgern!
5 Die Mehrheit bestimmt, wo’s langgeht!
6 Sozialstaat ist kein Lebensstil!
7 Wohlstand für alle statt Umverteilung!
8 Die Wirtschaft entfesseln!
9 Endlich wieder stolz sein!
TEIL VIER Du bist das Volk
1 Schau in den Spiegel!
2 Hör auf mit der Opfernummer!
3 Übernimm Verantwortung für dein Leben!
4 Sei anspruchsvoll!
5 Quäl dich!
TEIL FÜNF Verantwortung übernehmen
1 Wer sind die Leistungsträger?
2 Zeit für einen Aufstand
3 Schluss mit dem betreuten Leben und Denken
4 Unsere Freiheit steht auf dem Spiel
5 Excellenz – Made in Germany
EPILOG Die Nonne und der Bauer
Anmerkungen
Literatur
Für alle Leistungsträger, denen Freiheit, Sicherheit und Wohlstand am Herzen liegen.
PROLOGUm zwei Uhr nachts klopft es an deine Tür
Stellen Sie sich vor, es ist zwei Uhr in der Nacht – und es klopft an Ihre Tür. Was würden Sie denken? Wahrscheinlich: Bloß jemand, der Hilfe braucht, oder ein Betrunkener, der sich in der Tür geirrt hat. Also kein Grund zur Sorge.
Gedankensprung: Deutschland im Jahr 1938. Was hätten Sie da gedacht, wenn jemand nachts um zwei Uhr an Ihre Tür klopfte?
Im Jahr 1938 rechneten Sie sicherlich nicht mit einem Hilfesuchenden oder Betrunkenen. Es wurde Ihnen eher angst und bange, denn Deutschland stand unter der Diktatur der Nationalsozialisten. Aber wie konnte es damals so weit kommen? Es gab sicherlich viele Gründe; ein wesentlicher lag in den Bildungseinrichtungen unseres Landes. Hatte zuvor noch die feste Grundüberzeugung gegolten, dass Politik und Wissenschaft zwei streng getrennte Bereiche bilden, änderte sich dies plötzlich schlagartig. Die deutschen Universitäten, die zu den besten der Welt gehörten, wurden zu politischen Erfolgsgehilfen der Nazis. Dieser Gesinnungswandel vollzog sich schnell, da immer mehr Professoren und Studenten die politische Agenda des Dritten Reichs unterstützten. Wissenschaft und Politik gingen auf einmal Hand in Hand. Der kritische Diskurs wurde durch eine vermeintliche Wahrheit ersetzt.
Aus heutiger Sicht erscheint es unverständlich, wie so etwas möglich war. Dabei erleben wir heute erneut, wie Wissenschaft und Politik nicht mehr getrennt werden. Zum Glück haben wir es nicht mit einem menschenverachtenden Regime zu tun, das versucht, an die Macht zu kommen. Doch die Köpfe, die dahinterstecken, sind auf andere Art gefährlich: Es sind die Anhänger von sozialistischen Utopien, die mit ihren links-grün-woken Ideologien versuchen, Land und Leute zu infizieren. Die Symptome ähneln der Geschichte von damals: An den Universitäten haben die Linken die Sprachgewalt, während bürgerlich-konservative Stimmen zum Rückzug gezwungen werden. Universitäten sind kein reiner Ort der Wissenschaft mehr, sondern werden zu politischen Gesinnungs-Schlachtplätzen.
Das musste auch Bernd Lucke erfahren, Mitbegründer der Alternative für Deutschland (AfD). Nach seinem Ausscheiden zweifelte er nicht nur an der Verfassungstreue mancher Personen in der AfD, sondern beklagte auch, dass die AfD eine Partei geworden sei, die »ich nicht gegründet hätte […] und die ich nicht wähle«.1 Er wurde in der Folge wieder als Professor an der Universität Hamburg tätig. Seine Rückkehr in den Universitätsbetrieb wurde nicht nur von Protesten begleitet, sondern in mehreren Fällen verhinderten Demonstranten sogar, dass er seine Vorlesungen halten konnte.
In einem anderen Fall sollte die Biologin Marie-Luise Vollbrecht einen Vortrag mit dem Titel »Geschlecht ist nicht (Ge) schlecht: Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt« an der Berliner Humboldt-Universität halten. Doch der Vortrag wurde von der Universität abgesagt – aus Sorge vor Protesten und einer möglichen Eskalation. Die Hochschule erklärte später, die Meinungen der Biologin »stehen nicht im Einklang mit dem Leitbild der HU und den von ihr vertretenen Werten«. Gefährliche Zeichen.
Rückblickend können wir sagen: Zum Glück wurden die Nazis 1945 durch die Alliierten besiegt und entmachtet. Bis zur Wiedervereinigung 1990 existierten jetzt zwei deutsche Staaten auf deutschem Boden. In Westdeutschland die BRD in Zusammenarbeit mit den Westmächten und in Ostdeutschland die DDR unter Einfluss der Sowjetunion. Durch liberale Ideen wie die der Sozialen Marktwirtschaft ist in der Folge – nicht nur in Westdeutschland, sondern weltweit – Wohlstand entstanden. Alternative Systeme wie Sozialismus, Marxismus, Kommunismus versagten. Auch in der DDR.2
Dennoch verleugnen die Anhänger der linken/woken Bewegung den Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft und treiben unser Land in den Abgrund. Dabei verweigern sie den Diskurs. Sie stellen ihre Wahrheit als die einzig richtige dar. Werten alles Fremde ab, vor allem das Konservativ-Liberale. Es geht nicht mehr darum, dass im Diskurs das beste Argument gewinnt, sondern dass alle diejenigen, die Unerwünschtes aussprechen, mundtot gemacht werden.
Die bürgerliche Mitte lässt dies – zwar fassungslos, aber dennoch schweigend – geschehen. Die Mitte, das sind die Leistungsträger unseres Landes. Damit meine ich nicht eine vermeintliche Elite an der Spitze. Es geht um normale Menschen wie Sie und mich, die jeden Tag die Ärmel hochkrempeln und arbeiten. Wir sind die Leistungsträger.
Meine Frage an Sie: Sprechen Sie Ihre Meinung zu den Entwicklungen unserer Gesellschaft öffentlich aus? Beziehen Sie klar Stellung? Oder reden Sie Klartext nur noch hinter vorgehaltener Hand im vertrauten Kreis? Haben Sie etwa plötzlich doch Sorge, wer nachts um zwei Uhr an Ihre Tür klopfen könnte?
TEIL EINSEin Land am Abgrund
In vertrauten Gesprächen mit Leistungsträgern in den Unternehmen höre ich immer wieder: »Irgendetwas ist faul in unserem Land. Und die Politiker machen es nur noch schlimmer. Wenn wir so weitermachen, schafft sich Deutschland ab.« Laut aussprechen tun sie ihre Meinung jedoch nicht.
Was ist nur los mit unserem Land, das durch das Wirtschaftswunder zu einer der führenden Industrienationen wurde und dessen Mittelstand weltweit als innovationsstarkes Rückgrat der Wirtschaft gilt?
Um das herauszufinden, mache ich mit Ihnen im folgenden Teil 1 dieses Buches einen Streifzug durch verschiedene Themenwelten. In meinen Diskussionen mit Unternehmern und Führungskräften sind dies die Inhalte, die einen Großteil der Menschen, mit denen ich zu tun habe, intensiv beschäftigen. Die Meinungen dazu, was gut, was schlecht, was richtig und was falsch ist, liegen in unserer Gesellschaft teilweise weit auseinander.
1 Wo bleibt unser Führungsanspruch?
Wer jung, vital und gesund ist, braucht nicht auf Ernährung, Bewegung und Schlaf zu achten. Aber wehe, die Gesundheit ist verschwunden und die Folgen von unachtsamer Selbstverwahrlosung werden sichtbar. Dann ist auf einmal das Gequietsche groß. Reue zeigt sich. »Hätte ich mich doch früher darum gekümmert … Sport gemacht. Mit dem Rauchen aufgehört. Mich gesünder ernährt.« Sätze wie diese hat jeder Arzt schon mehrfach von seinen Patienten gehört und sich seinen Teil dazu gedacht.
Wenn wir etwas als selbstverständlich nehmen, wissen wir seinen Wert nicht mehr zu schätzen. Das gilt für unsere Gesundheit und auch für den Wohlstand unserer Gesellschaft; also den selbstverständlichen Zustand, dass es uns gut geht. Aber was heißt »gut gehen«? Manche fühlen sich schlecht, weil sie in Deutschland geboren wurden und in einem der reichsten Länder der Welt leben. Sie gehen davon aus, dass dieser Wohlstand nur möglich geworden ist auf Kosten von anderen Ländern und Menschen. Demnach hat der kapitalistische Westen andere Länder durch Kolonialisierung oder den Import von Rohstoffen ausgenutzt und sich bereichert. Mir sind Menschen begegnet, die sich dafür so schuldig fühlen, dass sie an manchen Tagen weinen. Ihr Verständnis von »gut gehen« ist von Sühne und Schuld geprägt: Dach über dem Kopf, etwas zu essen und ein warmes Bett – das muss reichen.
Es gibt genug Leute, die von solchen selbstkasteienden Meinungen überhaupt nichts halten. Die Fraktion von »Maß und Mitte« will gut leben, verzichtet hier und da auf Fleisch, fliegt aber dennoch in den Urlaub und setzt sich zur Wiedergutmachung Solarzellen auf das heimische Dach. Und dann gibt es noch das andere Extrem. Für diese anspruchsvollen Konsumjunkies bedeutet Wohlstand, im Überfluss zu leben. Für sie reicht dann nicht ein Fahrrad. Es braucht für jeden Anwendungsfall ein spezielles Bike: Mountainbike, Rennrad, Gravel Bike und eines für die Fahrt ins Büro. Die Smartwatch ist zwar erst zwei Jahre alt, aber es muss das neueste Modell her, nur weil sie endlich ein »always on display« hat.
Wir besitzen im Schnitt 10000 Gegenstände, von denen wir wahrscheinlich nur 100 regelmäßig verwenden. Aber es geht nicht nur um die Vielzahl an Gegenständen. Sie müssen auch schnell verfügbar sein. Für manch einen ist es ein inakzeptabler Zustand, wenn er das neue iPhone nicht gleich im Laden mitnehmen kann, sondern ein halbes Jahr darauf warten muss. Anhand dieser Anspruchshaltung wird deutlich, was wir im Großen und Ganzen unter Wohlstand im Jahr 2024 verstehen: alles, sofort und immer auf dem neuesten Stand.
Dabei sah die Welt vor rund 80 Jahren völlig anders aus. Deutschland lag in Schutt und Asche. Die Alliierten haben Hitler in seine Schranken verwiesen und das deutsche Volk auf die Knie gebombt. Hunger, Obdachlosigkeit, Vertreibung, Tod und Trauer prägten unser Land. Dennoch krempelten Männer und Frauen die Ärmel hoch, räumten die Trümmer beiseite und bauten unser Land wieder auf. Man wusste: Wir schaffen das nur gemeinsam. In der Folge ist aus dem Nichts das Wirtschaftswunder erwachsen. Deutschland entwickelte sich zu einer weltweit führenden Industrienation.
Ludwig Erhard brachte die Aufbruchstimmung auf den Punkt: Wohlstand für alle. Dabei setzte er auf das Leistungsprinzip: Von nix kommt nix. So wurde der Raum geschaffen für Freiheit und unternehmerisches Handeln. Für all diejenigen, die nicht mit anpacken konnten, etablierte er die Soziale Marktwirtschaft, um die Bedürftigen durch den Staat zu schützen.
Der Aufbruch kam nicht über Nacht, sondern war ein anstrengender Weg. Die Währungsreform verbrannte das Geld vieler Menschen. Die Arbeitslosigkeit lag 1950 noch bei über 10 Prozent. Doch dann kam die Trendwende und es ging den Menschen zunehmend besser. Unter dem Motto »Samstags gehört Vati mir« erkämpften die Gewerkschaften Ende der 50er-Jahre die 40-Stunden-Woche. Vollbeschäftigung sorgte für Arbeitermangel, sodass es 1955 das erste Abkommen mit Italien gab, um ausländische Arbeitskräfte anzuwerben. Im gleichen Jahr rollte der millionste VW Käfer vom Wolfsburger Band. Er strahlte als weltweit bekanntes Symbol für die deutsche Erfolgsgeschichte.
Was zu Ende gehen kann, geht auch zu Ende
Das ist unsere Erfolgsgeschichte, noch nicht mal einhundert Jahre alt. Aber es ist nicht unsere Erfolgszukunft für die kommenden einhundert Jahre. Denn die Qualität unserer Zukunft müssen wir uns im Hier und Jetzt erarbeiten. Vergangene Erfolge sind dabei kein Garant dafür, dass es morgen genauso gut laufen wird.
Kennen Sie die das Werk Buddenbrooks. Verfall einer Familie von Thomas Mann? Er erhielt dafür 1929 den Nobelpreis für Literatur. Er beschreibt dort, wie eine wohlhabende Kaufmannsfamilie peu à peu über vier Generationen zerfällt. Dieses Motiv ähnelt einem Gedanken von Otto von Bismarck (1815–1898): »Die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt.«
Davon inspiriert erzählt man sich in Unternehmerkreisen noch heute eine kompaktere, mahnende Warnung: »Die erste Generation baut auf; die zweite verwaltet und die dritte fährt es vor die Wand.« Ob Rockefeller, Guggenheim oder zahlreiche Beispiele aus mittelständischen Unternehmen: Immer wieder zeigt sich, dass die Gründer mit guter Arbeitsmoral und bodenständiger Haltung etwas aufbauen – den späteren Generationen jedoch der Unternehmergeist abhandenkommt und das Vermögen dadurch zerstört wird. An der Warnung ist in der Wirtschaft zumindest etwas Wahres dran. Wissen Sie, wie viele Familienunternehmen es in die vierte Generation schaffen? Es sind lediglich vier Prozent. Aber lässt sich diese schlechte Quote auch auf eine Gesellschaft übertragen?
Wenn wir den Gedanken fortsetzen, ergibt sich Folgendes: Die erste Generation baut in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg etwas auf. In den Dekaden 1970 bis 2020 hat die zweite Generation das Erreichte verwaltet. Und nun liegt es an der dritten Generation, was wir aus unserem Land, aus unserer Gesellschaft machen.
Die Frage ist: Was können wir überhaupt aus unserer Gesellschaft machen? Bevor wir das diskutieren, lassen Sie uns noch einen grundlegenden Gedanken klären. Auch wenn manche Menschen anscheinend etwas anderes annehmen – aber die Erde ist kein warmer Schoß, in dem wir wohlbehütet vor uns hinleben können und ein Geburtsrecht auf Wohlstand und Schlaraffenland haben.
Im Gegenteil: Wir fliegen auf einem winzigen Planeten durch ein unendliches, sich ausbreitendes Universum. Die Durchschnittstemperatur im Weltall beträgt minus 270 Grad. Es ist also verdammt kalt da draußen. Ohne unsere hauchdünne Atmosphäre und die darin enthaltenen Treibhausgase würde es keinen Treibhauseffekt geben und wir würden sofort auf der Erde erfrieren. Das Magnetfeld schützt uns außerdem vor den tödlichen Sonnenstürmen, indem es die gefährliche Strahlung an die Pole umleitet. Wir bewundern diese tödlichen Feinde als beeindruckende Polarlichter. Doch es wird der Tag kommen, an dem aus dem magnetischen Nordpol der Erde der magnetische Südpol wird. Solche Polsprünge finden alle paar Tausend Jahre statt. Wahrscheinlich ist, dass durch den vorübergehenden Wegfall des Magnetfelds auch der Schutz vor der gefährlichen Strahlung ausfällt. Ob und wenn ja, welche Auswirkungen das auf unser Leben haben wird, ist unklar.1 Auf ganz lange Sicht ist das auch egal. Denn in ein paar Milliarden Jahren wird sich die Sonne so stark ausdehnen, dass sie unsere Erde schlichtweg verglühen lassen wird.
Kurzum: Das Leben ist lebensgefährlich und endet garantiert tödlich. Unser aller Lebenszeit ist begrenzt. Für Sie persönlich und für uns alle als Gesellschaft ist es also durchaus eine sinnvolle Entscheidung, wenn wir anspruchsvoll sind. Heißt: etwas Gutes aus dieser kurzen Zeit machen. Gut im Sinne von: uns ein gutes Leben ermöglichen – und für die zukünftigen Generationen Rahmenbedingungen hinterlassen, in denen es ihnen mindestens genauso gut gehen kann wie uns.
Führungsanspruch: Bildung
Als Land der Dichter und Denker bleiben uns nur unsere Köpfe als Potenzial; denn Bodenschätze fehlen unserem Land. Um aus unseren Köpfen etwas Wertvolles zu machen, brauchen wir exzellente Bildung. Und genau da krankt es bereits seit vielen Jahren. Die Bertelsmann-Stiftung diagnostiziert in ihrem »Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme« einen gefährlichen Personalmangel in unseren Kitas. Demnach fehlen mehr als 100000 Vollzeitangestellte, sodass die Kitas keinen nennenswerten Beitrag zu Deutschlands Bildung leisten können.
In den Schulen sieht es nicht besser aus. Die Kultusministerkonferenz geht davon aus, dass bis 2035 rund 24000 Lehrer fehlen. Andere Vorhersagen sprechen sogar von mindestens 158000 fehlenden Lehrern. Da es hierfür keine Knopfdrucklösung gibt, wird improvisiert: größere Klassenverbände, Nebenfächer streichen, Distanzunterricht. Das mag zwar die Symptome kurzfristig lindern, löst jedoch nicht unser qualitatives Bildungsproblem.
Ernüchternd finde ich: Seit 2001 wissen wir bereits, dass wir eine Bildungskrise haben. Damals rüttelte der Pisa-Schock die deutsche Bildungspolitik wach. Doch der anfängliche Reformwille versumpfte längst wieder im bürokratischen Treibsand. Besonders tragisch: Es trifft die sowieso schon sozial benachteiligten Familien. Untersuchungen zeigen, dass besonders die Kinder schulisch abstürzen, deren Eltern als sozial schwach gelten – also über wenig Geld und wenig Bildung verfügen. Insgesamt ein besorgniserregender Trend. Denn wenn ein immer größer werdender Teil unserer Gesellschaft keine gute Bildung erhält, fehlen diese Menschen im qualifizierten Arbeitsmarkt. Welche unangenehmen Auswirkungen dies auf soziale Spannungen und unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit hat, lässt sich ansatzweise bereits heute erahnen.
Schnelle und einfache Lösungen gibt es für diese Missstände nicht. Das Berufsbild des Lehrers müsste im Ansehen gewinnen, mehr Menschen müssten diesen Job ergreifen – und dennoch bleibt am Ende der hohe Einfluss der Eltern und deren Werte und Haltungen auf die Entwicklung des Kindes. Dagegen erscheint der marode Zustand der Schulen als Lappalie. Laut Kreditanstalt für Wiederaufbau lag der schulische Investitionsstau bei 45,6 Mrd. EUR im Jahr 2021. Doch die deutschen Kommunen investieren gerade mal 9,8 Mrd. EUR pro Jahr. Es braucht also ebenfalls Geduld, bis unsere Schüler wenigstens an einem optisch ansprechenden Ort lernen können. Und so müssen unsere Schüler weiterhin verwahrloste Toiletten, veraltete Sporthallen und akuten Lehrermangel ertragen – und wir verpassen Jahr für Jahr die Chance, mehr mutige Unternehmer und neugierige Arbeitnehmer auszubilden.
Führungsanspruch: Unternehmertum
Denn unser Wohlstand hängt von genau diesen beiden Berufsgruppen ab. Mutige Unternehmer, die etwas wagen und gesellschaftliche Probleme lösen, indem sie Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Und neugierige Arbeitnehmer, die ihnen helfen, dass ihre Mission erfolgreich wird. Aber das gesellschaftliche Ansehen der Unternehmer ist im Sinkflug. Laut einer Umfrage von Forsa im Auftrag des Beamtenbundes DBB liegt es im Jahr 2021 bei 40 Prozent – und ist 21 Prozentpunkte schlechter als bei der ersten Erhebung im Jahr 2007. Interessanterweise schneiden Lehrer mit knapp über 60 Prozent deutlich besser ab.
Hilfe unerwünscht
Ich sitze mit einem Unternehmer beim Abendessen. Ein anspruchsvolles Projekt liegt hinter uns. »Ich freue mich, dass wir einen Ruck durch meine Mannschaft bekommen und in den letzten zwei Jahren viel bewegt haben«, fasst er seine Gemütslage zusammen. Er legt die Gabel zur Seite, trinkt einen Schluck Wein und hält inne. Dann erzählt er: »Ich hatte eine Menge Glück, aber habe auch wahnsinnig viel gearbeitet, um heute sagen zu können: Ich bin reich. Ich möchte gerne zurückgeben und Probleme der Gesellschaft mit meinen Möglichkeiten lösen.«
Ich bemerke einen leichten, feuchten Glanz in den Augen des Unternehmers, den ich als harten, aber fairen Menschen kennengelernt habe. Er spricht weiter: »Zum Beispiel wollte ich eine Kindertagesstätte neben meiner Firma bauen. Sie sollte vor allem meinen Angestellten dabei helfen, Arbeit und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Ich hätte alles gezahlt.Aber der Staat will es einfach nicht.«
Ich schaue ihn fragend an. Er fährt fort: »Die Auflagen sind so absurd hoch. Ständig kam einer und verwies auf diese und auf jene Auflage. Die Krönung war, dass wir jeden Tag von jedem Essen, das ausgegeben wird, eine eingeschweiβte Probe in ein Labor hätten schicken müssen. Damit war ich raus und habe diesen Traum beerdigt.«
Es ist schon komisch. Menschen, die etwas wagen, die etwas bewegen wollen in unserem Land, genießen nicht nur wenig Ansehen, sondern bekommen auch noch Steine in den Weg gelegt. Das Beispiel ist nur eines von vielen, die unser übergriffig wuchernder Bürokratie-Staat täglich produziert: Gesetze, Richtlinien, Formulare, Verbote. Dabei sollten wir unternehmerisches Engagement nicht bremsen, sondern eher beflügeln.
Wenn Sie wissen wollen, was die Kultur eines Unternehmens auszeichnet, holen Sie sich entweder externe Beobachter ins Haus oder Sie fragen die Mitarbeiter, die noch ganz frisch an Bord sind. Denn beiden Gruppen fallen die typischen Charaktermerkmale auf; also die Verhaltensweisen, die besonders ins Auge stechen und von den persönlich erfahrenen Normen anderer Unternehmen abweichen.
Um zu wissen, wie Deutschland aktuell tickt, fragen wir am besten auch externe Beobachter. So geschehen im Rahmen einer neuen internationalen Vergleichsstudie, welche die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung für alle 38 Industrieländer erstellt hat.2 Bezogen auf Unternehmertum ist das Ergebnis für Deutschland beschämend. Für ausländische Unternehmer hatte der Standort Deutschland im Jahr 2019 noch auf Platz 6 gelegen. Doch nun ging es runter auf Rang 13. Ein wesentlicher Grund: Deutschland knüpft die Visumsvergabe für Unternehmer an ein Mindestkapital und gehört damit in Europa zu einer Minderheit. Laut OECD sorgen außerdem unattraktive Rahmenbedingungen für die schlechte Platzierung Deutschlands, wie strenger Kündigungsschutz, regulatorische Hindernisse oder der langsame Ausbau des Glasfasernetzes.
Führungsanspruch: Innovationen
Damit wir unseren Wohlstand erhalten, brauchen wir Unternehmer und Gründer. Auch wenn es eine Banalität ist, müssen wir sie in der heutigen Zeit anscheinend noch einmal laut und klar formulieren: Geld fällt nicht vom Himmel. Wir müssen es verdienen. Dazu brauchen wir Schaffens- und Innovationskraft und vor allem unternehmerisches Engagement, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Ein Blick in die Patentanmeldungen zeigt: Es gibt Handlungsbedarf. 2017 wurden beim Deutschen Patent- und Markenamt 67724 Patente angemeldet; 2021 waren es nur noch 58568. Das vermehrte Arbeiten von zu Hause als Folge der Coronazeit bremst den Austausch der Menschen und damit die Innovationskraft – und gefährdet so die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts. Die Gefahr ist kein plötzlicher Tod; sie wirkt eher wie ein Gift, das unseren Wohlstand in kleinen, kaum merklichen Schritten verseucht.
Im Jahr 2022 startete die erneute Diskussion darüber, »Besserverdienende« noch höher zu besteuern. Dabei leisten die oberen 30 Prozent der Einkommenszahler bereits rund 80 Prozent der Steuerlast. Es wird Namenskosmetik betrieben, indem Hartz IV in Bürgergeld umbenannt wird. Die Anforderungen an die Bezieher der Nothilfe wurden im gleichen Atemzug reduziert. Der Begriff »Bürgergeld« suggeriert dabei fast schon ein Geburtsrecht: Jeder Bürger hat ein Anrecht auf das Bürgergeld. Das stimmt auch und ist das Gute an einer sozialen Marktwirtschaft. Wir sollten nur betonen, dass es eine Hilfe ist, welche die Gemeinschaft dann leistet, wenn wirklich jemand in Not ist. Für alle anderen gilt: Strengt euch an. Doch um eine leistungsmotivierte und unternehmerisch denkende und handelnde Bevölkerung auszubilden – und als Einwohner dieses Landes das auch gut zu finden –, braucht es vor allem eines: gute Bildung.
Führungsanspruch überdenken
Ich habe mich in diesem Kapitel auf die drei Themen Bildung, Unternehmertum und Innovation fokussiert. Meine Überzeugung: Hier muss Deutschland führend sein. Heißt: im weltweiten Wettbewerb zur absoluten Top-Elite gehören. Wie ist Ihre Haltung dazu? In welchen Themenwelten sollte unser Land Ihrer Meinung nach Führungsanspruch haben? Wie stehen Sie zum Begriff »Top-Elite«? Motiviert er Sie – oder wird Ihnen eher übel, wenn Sie Elite hören? Warum reagieren Sie so auf diesen Begriff?
2 Deutschland, der Klimaretter?
Wenn der Strom ausfällt, bricht alles zusammen: Telefon, Internet, Radio, Fernsehen, Licht, Kühlschrank, Öffentlicher Nahverkehr, Tankstellen, E-Autos, Supermärkte, Kassen, Melkbetriebe …
Machen wir uns nichts vor: Dann landen wir nach wenigen Stunden im Chaos. Unser modernes Leben ist abhängig vom Strom wie unser Körper von Luft und Blut. Im Jahr 2012 erschien das Buch Blackout von Marc Elsberg. Darin wird eindrucksvoll beschrieben, was uns droht, wenn der Strom über längere Zeit ausfällt.
Folgen der Energiewende
Unrealistisches Horrorszenario? Leider nein, denn unsere Versorgungssicherheit mit Strom gerät als Folge einer verkorksten Energiewende zunehmend unter Druck und nimmt bedrohliche Ausmaße an.
Außerdem zwingt der hohe Energiepreis unsere Wirtschaft in die Knie. Hotels wissen nicht, wie sie durchs Jahr kommen. Bäckereien wissen nicht, wie sie die hohen Strompreise auf den Brotpreis umlegen sollen. Noch größer sind die Sorgen bei den energieintensiven Aluminium-, Glas-, Keramik-, Zement- und Stahlproduzenten.
Auch die arbeitsplatzstarke Autoindustrie gerät unter Druck. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), kommentierte die Situation im Handelsblatt: »Die Hälfte unserer Mitglieder hat deshalb bereits geplante Investitionen gestrichen oder verschoben – und mehr als ein Fünftel verlagert nun ins Ausland.«
Und warum das alles? Weil wir unser Klima retten müssen. Doch ist das Klima überhaupt noch zu retten?
Keine eindeutige Wahrheit
Eine Diskussion, die schnell für Zündstoff sorgt. Denn es gibt keine eindeutige Wahrheit. Kein Wunder, dass die Meinungen stark auseinanderklaffen.
Am einen Extrem stehen die sogenannten Klimaleugner. Sie zweifeln daran, dass der Mensch etwas mit der Klimaveränderung zu tun hat. Schwankungen und gar extreme Klimaumschwünge gab es in der Geschichte unseres Planeten schließlich schon immer. Ihre Devise lautet also: keine Panik und einfach weiterleben.
Am anderen Extrem stehen die Weltuntergangsanhänger. Sie warnen vor Klimakipppunkten. Würden diese überschritten, würde sich die Entwicklung nicht mehr zurückdrehen lassen – mit angeblich katastrophalen Folgen für die Menschheit.
Eine Gruppe aus diesem Spektrum bezeichnet sich selbst als »Letzte Generation«. Einige Anhänger sind bereit, im Namen der Klimarettung gegen Recht und Ordnung zu verstoßen und dafür auch ins Gefängnis zu gehen.
Wo stehen Sie mit Ihrer Meinung in diesem Meinungsspektrum?
Auf der Suche nach Wahrheit
Der Klimaforscher Martin Claußen, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie und Professor für Meteorologie an der Universität Hamburg, mahnt zu Maß und Mitte: »Für ganz wichtig halte ich es, den Klimawandel ernst zu nehmen. Das Dümmste wäre, ihn einfach zu leugnen. Aber man sollte auch nicht in Panik verfallen. Weder Leugnen noch Panik sind gute Ratgeber.«3
Die Folgen, wenn die Erderwärmung 1,5 Grad überschreitet, hat der Weltklimarat detailliert beschrieben: Zunehmende Hitzewellen und Starkniederschläge, in der Folge schlechtere Ernten, weniger Erträge in der Fischerei und so mehr Armut und Hunger auf der ganzen Welt. An manchen Orten wird Wasser knapp; andere Landstriche werden unbewohnbar, wenn der Meeresspiegel steigt. Die Konsequenzen könnten eines Tages so schlimm sein, dass das Überleben der Menschheit grundsätzlich in Gefahr gerät.
Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Aber was heißt reduzieren? In der Literatur kann man sich in unterschiedlichsten Quellen und Berechnungen verlieren. Nehmen wir den Weltklimarat IPCC als Orientierung. Er konkretisiert das Ziel in seinem Sechsten Sachstandsbericht: Die globalen CO2-Emissionen müssen gegenüber 2019 um 48 Prozent bis 2030 sinken. Wenn wir vereinfacht annehmen, dass die Uhr im Jahr 2023 anfängt zu ticken, haben wir dazu acht Jahre Zeit. Heißt: Pro Jahr muss der CO2-Ausstoß um 6 Prozent runter. Ist das machbar?
Acht Jahre Dauer-Lockdown?
Studien schätzen, dass während des Corona-Lockdowns der weltweite CO2-Ausstoß um 4 bis 8 Prozent gesunken ist.4 Die Wirtschaft stand zum Großteil still. Während sonst zu Spitzenzeiten 19000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft unterwegs sind, blieben viele Flieger am Boden. Geschäftsreisen, Urlaub, Familienbesuche – alles fand überwiegend von zu Hause per Videokonferenz statt. Restaurants, Hotels, Sportclubs, Konzerte, Sportevents – das gesamte öffentliche Leben kam beinahe zum Erliegen.
Wenn wir auf die Panikmacher hören würden, müssten wir die Welt für die nächsten acht Jahre in einen Dauer-Lockdown zwingen. Der Wohlstand würde schmerzhaft einbrechen, vor allem für die sowieso sozial schwachen Bevölkerungsteile. Die Auswirkungen auf Bildung, psychische Störungen, häusliche Gewalt will ich mir gar nicht vorstellen. Wir würden in Sodom und Gomorrha enden.
Wir befinden uns also in einem Dilemma. Wenn wir nichts tun, werden die Auswirkungen des Klimawandels weltweit für Probleme sorgen und – direkt oder indirekt – jedes Land betreffen. Eine Notbremse, indem wir so gut wie gar kein CO2 mehr ausstoßen, ist ebenso inakzeptabel. Was also tun?
Deutschland, der Klimaretter?
Ich habe den Eindruck, Deutschland fühlt sich verantwortlich dafür, die Welt zu retten, und spielt sich als »Klimaretter« auf. Allein der Begriff drückt den Hochmut aus, mit dem wir als Menschen auf die Natur herabschauen. Der Mensch ist niemals in der Lage, das Klima zu »retten«. Er kann es beeinflussen – und wird der Gewalt des Klimas ausgeliefert sein; wie auch immer es sich verändert.
Deutschland hat sich entschieden, massiv in seine Wirtschaft einzugreifen. Ausstieg aus der Kohleenergie. Ausstieg aus der Atomenergie. Stattdessen Investitionen in grüne Energie: Windkraft und Solar sollen es richten. Doch der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt nur schleppend voran. Bis 2030 will die Bundesregierung, dass 80 Prozent des Stroms grün gewonnen werden.
Dazu müssten 1500 bis 2000 Windräder pro Jahr aufgestellt werden. Die letzten drei Jahre waren es nie mehr als 500 Windräder. Die Gründe dafür sind vielfältig. Mal liegt es an einer lähmenden Bürokratie. Mal sind es die Bürger, die gerne nach der Energiewende rufen, aber dann das Windrad lieber nicht in Sichtweite haben wollen.
Lohnt sich der ganze Aufwand für Deutschland eigentlich, wenn wir weltweit gesehen mit unter 3 Prozent nur ein kleines Licht unter den CO2-Verursachern sind? Größter Emittent ist China mit rund 30 Prozent Anteil am globalen Ausstoß. Ohne China wird uns die weltweite Energiewende also nicht gelingen. Zur Einordnung: Im Jahr stieß das Land stieß 10,6 Milliarden Tonnen CO2 aus. Das sind 16-mal so viel wie Deutschland.
Die Regierung Chinas braucht eine Menge Strom, um das Wirtschaftswachstum sicherzustellen. Sie hat angekündigt, in den nächsten Jahren noch mehr CO2 auszustoßen. Ab 2030 soll es dann weniger werden, um im Jahr 2060 klimaneutral zu werden (Deutschland will das bereits 2045 schaffen). China setzt dabei nach wie vor auf Kohle. Mehr als 200 Kohlekraftwerke befinden sich derzeit im Bau oder in der Planung. Noch immer kommen 60 Prozent des Stroms aus der Kohleverbrennung.
Gleichzeitig legt China ein beeindruckendes Tempo im Ausbau der erneuerbaren Energien vor: 50 Prozent der neu installierten Kapazitäten im Jahr 2020 wurden in China realisiert. China ist also Freund und Feind für ein lebensfreundliches Klima zugleich.
Deutschland, der Industrie-Zerstörer?
Die Kurswende in der Energiepolitik kann also nur gelingen, wenn andere Großnationen – insbesondere China, USA und Indien – den Weg mitgehen.
Wenn Deutschland dennoch eine Vorreiterrolle einnehmen will, müssen wir uns etwas einfallen lassen, um andere Länder mit auf die Reise zu nehmen. Als Land der Ingenieure und Denker ist die Antwort klar: geniale Innovationen, die CO2-neutral(er) funktionieren und unbedingt auch einen günstigen Strompreis sicherstellen. Doch die deutsche Energiewende ist bisher alles andere als ein Exportschlager. Unser Strompreis ist im Schnitt 174 Prozent teurer als im Rest der Welt – 31,80 Cent pro Kilowattstunde im Gegensatz zu 11,62 Cent im internationalen Schnitt.5
Wir müssen reden
Es ist kurz nach sieben. Drauβen ist es noch dunkel. Ich trinke einen Kaffee und lese meine Mails. »Guten Morgen, Herr Holzer. Wir müssen reden. Wann passt es Ihnen kurzfristig?« Das klingt nach akutem Handlungsbedarf, denke ich mir und antworte mit ein paar Terminvorschlägen.
Mittags rufe ich den Unternehmer an. »Wir können das Projekt leider nicht wie geplant in Angriff nehmen. Ich bin die Zahlen noch mal durchgegangen. Das macht einfach keinen Sinn. Vor Corona hatten wir einen Strompreis von 15 Cent. Aktuell liegen wir bei fast 45 Cent. Ich weiβ nicht, wie lange wir das noch durchhalten. Und ein Projekt mit Ihnen anzufangen, um es dann wegen einer Insolvenz abzubrechen, macht für uns beide keinen Sinn.«
Der Unternehmer konnte sein Unternehmen bisher noch am Leben halten und mittlerweile einen Stromkontrakt mit besseren Konditionen abschließen. Aber der Preis ist immer noch zu hoch und in Kombination mit den explodierenden Rohstoffpreisen bleibt ihm nach wie vor kaum Luft zum Atmen. Wie lange das noch gut geht? Über 100 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Leider lässt sich das Unternehmen nicht so einfach ins Ausland versetzen. Dort würde es finanziell deutlich mehr Spaß machen.
So ziehen die USA wie gewohnt durch Deutschland und betreiben Standortmarketing. Sie versuchen, abwanderungswillige Unternehmen mit billiger Energie und niedrigen Steuern für einen Umzug über den großen Teich zu gewinnen. Das Handelsblatt zitiert den Gouverneur von Oklahoma, Stitt: »Sind Sie ein Unternehmen aus Deutschland und erwägen eine US-Präsenz? Dann ist Oklahoma zu 100 Prozent der richtige Standort. Wir befinden uns genau in der Mitte der USA. Die Löhne sind 40 Prozent niedriger als in Kalifornien. Und die Menschen arbeiten hart.«
Über 60 deutsche Unternehmen seien demnach dem Angebot aus Oklahoma gefolgt, darunter Lufthansa, Aldi, Fresenius und Siemens.6 Bei Klimapolitik geht es nicht nur um die Natur. Es geht auch um knallharte wirtschaftliche Interessen. Eine Neuverteilung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse. Denn Unternehmen, die einmal abgewandert oder insolvent sind, sind weg. Mit ihnen die Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen in dem Land, in dem sie einmal waren.
Energiekrise: teuer und schmerzhaft
Hohe Energiepreise. Drohende Arbeitslosigkeit. Eine schmerzhafte Inflation. Probleme, die vor allem die sozial Schwächeren treffen. Dabei ist die Sorge, dass der Klimawandel zu einer Temperaturerhöhung führt und unser Leben bedroht, gar nicht das größte Risiko.
Forscher fanden heraus, dass nur 0,5 Prozent der weltweiten Todesfälle auf Hitze zurückzuführen sind. Viel gefährlicher ist jedoch genau das Gegenteil: Denn 7 Prozent der Todesfälle gehen auf Kälte zurück. Konkrete Zahlen gibt es aus den USA: Pro Jahr sterben circa 9000 Menschen wegen Hitze und 144000 aufgrund von Kälte.7
Als ich davon gelesen hatte, dachte ich, dass mit Kälte auch wirklich extreme Kälte gemeint ist. Dem ist jedoch nicht so. Jedes Jahr sterben in den USA 12000 Menschen an extremer Kälte, jedoch 132000 an moderater Kälte. Ähnliche Ergebnisse aus London: Über 70 Prozent der kältebedingten Todesfälle ereignen sich an Tagen mit mehr als 5 Grad Celsius.
Welche Auswirkungen haben die hohen Energiekosten auf solche Zahlen? Werden es sich die Armen aufgrund der verkorksten Energiewende nicht mehr leisten können, ausreichend zu heizen, und deswegen durch schleichende Unterkühlung mehr Menschen sterben? Oder wären der Klimawandel und die steigenden Temperaturen sogar ein Segen, da weniger Menschen an Kälte sterben?
Wissenschaft und Politik
Der Klimawandel scheint nicht mehr aufhaltbar. Lohnt es sich also, den hohen Anspruch zu verfolgen, den Klimawandel stoppen zu wollen? Oder wäre es nicht sinnvoller, die Ressourcen so zu investieren, dass wir uns den neuen Lebensbedingungen unter dem Klimawandel anpassen?
Schwierige Fragen, welche die Wissenschaft nicht beantworten kann. Die Klimaforschung geht lediglich auf die Suche nach der Wahrheit. Ihre Werkzeuge sind: Wissenschaft, Rationalität und systematisches Vorgehen.
Wie wir mit dem aktuellen Wissensstand umgehen, muss die Klimapolitik entscheiden. Ihre Werkzeuge sind: Kompromisse. Subjektive Meinungen. Und eine Wahrheit, die immer verhandelbar ist.
Beängstigende Debatte
Das kann mittlerweile gefährliche Züge annehmen. In den Medien wird gerne über Horrorszenarien wie die eingangs erwähnten Klimakipppunkte berichtet; also Situationen, in denen es zu einer nachhaltigen Veränderung des Klimas kommt, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft ist das riskant.
Der Klimaphysiker Thomas Stocker sagt dazu: »Wir diskutieren immer noch auf der Basis von relativ wenig Evidenz. Ich habe einmal erlebt, wie in einer Debatte über Kippelemente sogar der gewaltsame Widerstand propagiert wurde. Die Rechtfertigung war, dass nur damit die dringende Transformation der Gesellschaft angestoßen würde, um das Überschreiten von Kipppunkten abzuwenden. Während der Debatte hat niemand widersprochen. Das fand ich sehr beängstigend. Ich hatte an dieser Debatte virtuell teilgenommen und den Standpunkt vertreten, dass wir noch nicht genug über Kippelemente wissen, aber die Stimmung war in dieser einen Diskussion so aufgeheizt, dass ich und andere, die zur Zurückhaltung gemahnt haben, gar nicht mehr zu Wort kamen.«8
Unsere Ressourcen sind begrenzt. Auch unseren Politikern sollte klar werden, dass wir Geld nicht unendlich drucken können. Heißt: Wenn wir in den Klimaschutz investieren, investieren wir weniger Geld in andere Bereiche. Wo sollen wir Geld wegnehmen? Rente, Krankenversicherung, Sozialstaat, Infrastruktur, Verteidigung …?
Um das Klima vermeintlich zu retten, ist die Dekarbonisierung der deutschen Industrie also keine Lösung mit Erfolgsgarantie. Auf der einen Seite ist sie zwar gut fürs Klima, aber auf der anderen Seite – zumindest in der langen Übergangsphase – schlecht für den Arbeitsmarkt.
Wie hoch ist der Nutzen, wenn Deutschland versucht, das Klima »zu retten«? Lohnt sich der Preis, den wir als Gesellschaft bezahlen (Arbeitsplätze verlieren, Abwanderung der Industrie, Wohlstand gefährden …) – oder wird er zu hoch und bedroht unsere Gesellschaft durch andere Gefahren?
Wille, Mut und klare Regeln
Das Thema ist komplex. Eines ist jedoch gewiss: Auch wenn Sie im Bioladen einkaufen und E-Auto fahren – das Klima werden Sie damit nicht retten.
Die Lösung wird nur gelingen, wenn die gesamte Menschheit – weltweit – an einem Strang zieht. Ohne die USA, China und Indien wird es keine grüne Zukunft geben. Zu glauben, dass dies durch moralische Belehrung oder freiwillige Einsicht gelänge, ist naiv. Auch wenn Klimaereignisse wie Überflutungen oder Stürme zunehmen, ist fraglich, ob diese überhaupt in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen und, wenn dem so wäre, so wahrgenommen werden. Außerdem ist die Welt voller Interessenkonflikte.
Wer heute mit traditionellen Methoden Geld verdient, sieht seine Felle davonschwimmen, wenn neue Technologien der neue Standard werden. Schwellenländer geben den Industrieländern die Schuld an der aktuellen Misere – und fordern von ihnen Lösungen, während sie für sich in Anspruch nehmen, erst mal Wohlstand aufzubauen – auch wenn die Methoden dafür umwelttechnisch »dreckig« sind.
Wir werden den Weg nur schaffen, indem wir grenzübergreifend kooperieren. Dazu braucht es den gemeinsamen politischen Willen. Mut. Und vor allem klare Regeln, Zölle, Klimapreise und Strafen, um die gesamte Menschheit auf Kurs zu bringen. Zu meinen, es wäre ausreichend, die europäischen Unternehmen mit umfangreichen Gesetzen zu umweltfreundlichem Verhalten in der ganzen Welt zu zwingen, ist ein Holzweg.
Schon heute sieht man, dass das Lieferkettengesetz dazu führt, dass ausländische Produktionsstätten den hohen europäischen Anforderungen nicht gerecht werden können und die Verträge beenden. Diese Lücken werden durch Unternehmen aus nicht europäischen Ländern gefüllt, die niedrigere Ansprüche erfüllen müssen. Am Ende haben wir vielleicht das gute Gefühl, moralisch sauber zu handeln. Doch die Produkte, die wir kaufen, sind aufgrund neuer Produktionsbeziehungen »dreckiger« als zuvor.
Es liegt also ein anstrengender Weg vor uns, dessen Verlauf ungewiss ist. Sicher ist jedoch: Deutschland wird mit moralischem Zeigefinger und der bisher desaströsen Energiewende das Klima nicht retten. Es bleibt die Hoffnung auf Technologiesprünge, die uns den Weg in eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt, indem wir es schaffen, mit umweltfreundlichem Verhalten mehr Geld zu verdienen als mit umweltschädlichem.
Behalten Sie Ihre Skepsis!
Alles in allem löst die Art und Weise, wie wir als Menschheit den Planeten vergewaltigen, ambivalente Gefühle in mir aus. Auf der einen Seite Resignation: Klimarettung schaffen wir nicht. Und gleichzeitig Motivation und pragmatische Zuversicht: So schlimm ist es noch nicht – und wir werden es schaffen, wenn der Anpassungsdruck immer höher wird.
Meine Stimmung hängt meist davon ab, welche Nachrichten ich gerade lese. Denn was ist die Wahrheit? Das ist nicht immer leicht zu beantworten. Auf jeden Fall sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass die Mehrheit nicht automatisch richtig liegt. Nur weil viele Menschen etwas glauben, heißt nicht, dass es auch stimmt.
Auch sollten Sie nicht blind jeder vermeintlichen Autorität alles glauben. Hinterfragen Sie die Dinge. Das ist nicht falsch, sondern die Basis von Wissenschaft. Alle Forscher wissen, dass sie nie die absolute Wahrheit finden. Sie versuchen nur, sich ihr systematisch zu nähern. Und wenn sie sie gefunden haben, ist es nur eine temporäre These, die so lange als richtig gilt, bis sie widerlegt wurde.
Halten Sie also nicht fanatisch an Ihren Überzeugungen fest, sondern leben Sie eine gesunde Streitkultur, in der Sie Ihren Standpunkt souverän vertreten – aber auch flexibel bleiben, um dazuzulernen, und Ihren Standpunkt bei Bedarf zu ändern.
Behalten Sie also Ihre Skepsis – und bleiben Sie zuversichtlich.
3 Erst die Moral, dann das Fressen?
Ohne die Industrialisierung säßen wir noch im Mittelalter, würden mit dem Pferd durch die Gegend reisen und gelegentlich einen teuren Brief schreiben. Wir würden nicht im Wohlstand und der bequemen Kunstwelt leben, die wir heute in Europa genießen können.
Denn der Wohlstand, in dem wir heute leben, ist nicht vom Himmel gefallen. Wir – genauer gesagt: die älteren Generationen – haben ihn nach dem Zweiten Weltkrieg hart erarbeitet. Die Automobilwirtschaft ist im Jahr 2020 der mit Abstand bedeutendste Industriezweig unseres Landes. Sie hat zu diesem Wohlstand eine Menge beigetragen und ist nach wie vor eine tragende Säule, um unser gutes Leben zu ermöglichen.
Hier finden 786000 Menschen ihren Arbeitsplatz; wenn wir die indirekt mit der Autowirtschaft verbundenen Unternehmen hinzurechnen, sind es über 2 Millionen Menschen. Die Branche erwirtschaftet einen Umsatz von rund 411 Milliarden Euro; das entspricht fast 13 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Zur Einordnung: Auf Platz 2 folgt die Maschinenbaubranche mit 256 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 waren Kraftwagen und Kraftwagenteile mit 244 Milliarden Euro die wichtigsten Exportgüter unseres Landes. Sie machten einen Anteil von 15,5 Prozent aus.
Machen wir uns eine Banalität bewusst: Dieser Wohlstand ist das Fundament, auf dem wir einen umfassenden Sozialstaat aufgebaut haben. Dadurch bekommt der kalte Kapitalismus ein warmes Herz. Denn der Sozialstaat will für soziale Gerechtigkeit sorgen, indem er Menschen in Krisen beisteht oder das Einkommen je nach Lebensphase ausgleicht. Wie das geht? Gesundheitsversorgung, Arbeitslosengeld, kostenlose Bildung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlte Elternzeit, Rente, öffentlicher Nahverkehr, Müllabfuhr, sozialer Wohnungsbau. Der Sozialstaat ist der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft trotz aller Unterschiede zusammenhält. Ich bin mir sicher: Ohne den Sozialstaat würden wir längst im Bürgerkrieg enden.
Wir sind also gut beraten, als Land wirtschaftlich stark zu bleiben, um uns den Sozialstaat auch in Zukunft leisten zu können. Doch ob das gelingt, ist zumindest fraglich. Bereits die Coronakrise hat die Ausgaben auf ein neues Rekordlevel katapultiert: Über eine Billion Euro wurden für sozialpolitische Zwecke verwendet. Die Finanzierung des Sozialstaats wird noch mehr unter Druck geraten, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung zufolge wählen bereits heute viele aus dieser Altersgruppe einen frühzeitigen Abschied aus dem Berufsleben, nämlich mit 63 oder 64 Jahren. Das sind bedrohliche Szenarien. Der Sturm der Massen auf die Rente steht uns noch bevor.
Vollbremsung
Und nun machen Sie sich klar, was gerade passiert: Unser Land, das sich in der zuvor beschriebenen bedrohlichen Lage befindet, zwingt einen seiner bedeutendsten Wirtschaftszweige in die Knie – völlig ohne Not! Einen Zweig, der nicht nur wesentlich den Wohlstand des Landes sichert, sondern auch noch technologisch führend war – und zwar weltweit. Und das passiert derzeit nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, indem das europäische Parlament neue Fahrzeuge mit Verbrennermotor ab 2035 verboten hat. Gleichzeitig soll dadurch alles noch früher auf eine Karte gesetzt werden: auf das E-Auto.
Man könnte meinen, es wäre eine Komödie. Die deutschen Autohersteller, die mit über 100 Jahren Erfahrung die Verbrennertechnologie dominieren, sollen nun auf E-Autos umschwenken, deren Pioniere in China und den USA sitzen; sie werden betrieben mit Batterien, die vor allem von Koreanern und Chinesen gefertigt werden und mit Software ausgestattet sind, die von den Technologieschmieden aus China und den USA stammen.
Dabei rechnen die EU-Bürokraten das E-Auto schön, indem sie definiert haben, dass der Ökofaktor nur am Auspuff gemessen wird: Beim Fahren emittiert ein E-Auto per Definition null Gramm CO2. Das würde stimmen, wenn der getankte Strom zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen käme. Er kommt jedoch immer noch zu rund 36 Prozent aus Kohle.
Darüber hinaus davon auszugehen, dass die Batterieproduktion ohne Folgen für unsere Umwelt bleibt, ist naiv. Man schätzt, dass 70 Prozent der weltweiten Lithium-Vorkommen in Bolivien, Chile und Argentinien lagern. Welche fatalen Auswirkungen der Abbau dort jetzt schon auf die Natur sowie die indigene Bevölkerung hat, können Sie im Internet nachlesen. Außerdem ist das E-Auto preislich nach wie vor ein Luxusgut, das sich die breite Bevölkerung schlichtweg nicht leisten kann. Wer mit zwei Kindern auf dem Land wohnt, braucht einen Kombi mit attraktiver Reichweite. Doch im günstigen E-Preissegment muss man sich mit wenig Platz und Reichweiten um die 250 Kilometer zufriedengeben.
China geht andere Wege
Währenddessen machen die Chinesen ihr eigenes Ding. 2022 verursachte China voraussichtlich 11,4 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen. Das entspricht rund einem Drittel des weltweiten CO2-Ausstoßes (zum Vergleich: USA: 14 Prozent, EU27: 8 Prozent, Indien: 7 Prozent).9 Gleichzeitig ist das Land für mehr als die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs verantwortlich. Zwar baut China massiv die Wind- und Sonnenenergie aus. Im Vergleich zu Deutschland installierte es das 20-Fache an Leistung aus neuen Solaranlagen. Doch nach wie vor gewinnt das Land rund 60 Prozent seiner Energie aus Kohle. Seit 1965 ist der Kohleverbrauch um das Sechzehnfache gestiegen. Er lag 2019 bei 81,7 Exajoule. Zum Vergleich: Deutschland verbrauchte im gleichen Jahr 2,3 Exajoule.
Die Stromausfälle der jüngeren Vergangenheit haben die Prioritäten des Landes klar sortiert: Energiesicherheit steht vorne. Laut einer Studie hat China im Jahr 2022 im Schnitt den Neubau von zwei großen Kohlekraftwerken pro Woche genehmigt. Die im Jahr 2022 in Bau befindliche Kohlekraftwerkskapazität in China ist im Vergleich zur gesamten restlichen Welt sechsmal so hoch. Es sieht also nicht nach einer Trendwende aus, sondern eher danach, dass die Chinesen günstige Energie in ausreichender Menge im Fokus haben.
Keine Frage: Wir müssen unsere Autos sauberer bekommen. Unsere Welt wird elektrisch werden. Das ist gut und richtig so. Doch ob die überstürzte Fokussierung auf E-Autos, ob der planlose Umbau unserer Industrie der richtige Weg ist, sollte Deutschland ergebnisoffen diskutieren. Vielleicht wäre eine technologieoffene Übergangsphase in das Zeitalter der E-Mobilität sinnvoller. Denn es geht nicht nur um das pseudo-gute Gefühl, möglichst bald mit einem E-Auto vermeintlich umweltfreundlich durch München oder Berlin zu fahren. Sondern auch darum, den Technologiewandel sozialverträglich und wohlstandssichernd zu gestalten. Von den Fragen der ausreichenden Stromversorgung (siehe voriges Kapitel »Deutschland der Klimaretter?«) ganz zu schweigen.
Deutschland muss man sich leisten können
Keine Frage: Irgendjemand muss auf der Welt anfangen, den Weg in eine nachhaltige Wirtschaft zu beschreiten. Doch das kann nur gelingen, wenn der Weg durch eine finanzkräftige und erfolgreiche Wirtschaft finanzierbar ist. Denn wenn Unternehmen nicht profitabel sind, können sie keine Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen. Es braucht also eine wirtschaftsfreundliche Gesinnung. Doch Deutschland greift so tief in die Taschen der Unternehmen wie kein anderes Land in Europa. Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung beziffert die effektive Steuerbelastung in Deutschland auf durchschnittlich 28,8 Prozent; der EU-Schnitt liegt bei 18,8 Prozent. Noch teurer ist es für Unternehmen nur noch in Japan (34,1 Prozent) und Spanien (29,0 Prozent).
Neben den Steuern spielen die hohen Energiekosten eine entscheidende Rolle dabei, ob sich Unternehmen den Standort Deutschland noch leisten können. Gerade für energieintensive Branchen waren die Jahre seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine schwierig. Für das Chemieunternehmen Lanxess verfünffachten sich die Energiekosten: von 200 Millionen Euro auf mehr als eine Milliarde. Ist das viel? Bewerten Sie das selbst. Der Umsatz des Unternehmens liegt bei 8 Milliarden … Andere Länder wittern ihre Chance und werben darum, dass deutsche Unternehmen ihre Standorte ins Ausland verlagern. Ob wir mit unseren Rahmenbedingungen dadurch etwas gewonnen haben im Hinblick auf Nachhaltigkeit und weniger Umweltbelastung? Mitnichten. Die Anforderungen in Deutschland in Bezug auf Umweltschutz sind deutlich höher als in manchem Land, das sich nun als Alternative anbietet. Im Ergebnis würde die Produktion nach der Abwanderung deutlich umweltschädlicher stattfinden.
Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber die Schmerzensschreie aus chemischer Industrie, Automobilindustrie, metallverarbeitendem Gewerbe, Glasindustrie und Papierindustrie sollten wir ernst nehmen. Aber auch Hilferufe der zahlreichen Landwirte sollten wir ernst nehmen. Sie versorgen uns mit Fleisch, Gemüse, Korn und Milch.
Doch Regulatorik, steigende Kosten für Personal, Futter und Energie machen das Überleben der Bauern immer schwerer. Obendrauf werden sie auch noch ständig aus der Gesellschaft mit Vorwürfen überschüttet: Schuld am Insektensterben, Verseuchen des Grundwassers, Klimawandel durch das ganze Methangas der Rinder. Die Reihe an Vorwürfen ist lang.
Wir können froh sein, dass so viele Bauern trotz dieser harten Bedingungen jeden Tag für uns arbeiten. Die Hintergründe sind den Bürgern meist nicht bewusst. Wir sehen nur die einfache Wahrheit: Butter ist im Jahr 2024 so teuer wie noch nie. Das liegt jedoch nicht an den Bauern; denn die bekommen nach wie vor nur ihre rund 46 Cent pro Liter Milch. Lebensmittel sind kein Luxusgut, sondern Voraussetzung, um zu überleben. Doch schon jetzt leidet jeder sechste Bundesbürger massiv unter den Folgen der Inflation.
Worauf es ankommt
Der Unternehmer und ich betreten den Besprechungsraum. »Das ist echt beeindruckend, was Sie hier mit Ihrer Mannschaft leisten«, sage ich. Er nickt und erzählt: »Als Familienunternehmen blicken wir auf eine lange Tradition zurück. Aber wir haben es schwer am Standort Deutschland.«
»Warum?« will ich wissen. »Für Sie als Schmiede müsste das Geschäft doch boomen. Der Ausbau der Windkraft braucht schlieβlich unzählige Mengen an hochbelastbaren Stahlteilen.«
»Ja, das stimmt. Aber der Ausbau der Windkraft in Deutschland kommt nur zäh voran. Auβerdem wird ein Groβteil der Bauteile aus China importiert. In unserem Geschäft ist operational excellence, also das Beherrschen des Schmiede-Handwerks, nicht mehr kriegsentscheidend. Viel wichtiger sind zwei Dinge: Experten, die wissen, wie man Energie am Spotmarkt günstig einkaufen kann. Und Experten, die sich im Fördermittel-Dschungel der EU auskennen«, seufzt er.
Zeitenwende der anderen Art
Ich verstehe nicht, wie es in Deutschland zu solchen wirtschaftsfeindlichen Rahmenbedingungen kommen konnte. Wir brauchen eine Diskussion in unserem Land – was das Fundament unserer Gesellschaft ist und was wir darauf aufbauen wollen. Vielleicht braucht es dazu auch eine Vermittlung von grundlegendem Wissen über den Zusammenhang von Wirtschaft, Wohlstand und Sozialstaat. Denn sprechen wir die banale Wahrheit aus: Wenn Unternehmen einmal pleite sind oder ihren Standort ins Ausland verlagert haben, kommen sie nicht ohne Weiteres morgen zurück. Gleiches gilt für qualifizierte Arbeitsplätze, die mit jeder Standortschließung verloren gehen. Hohe Energiepreise, hohe Steuern und lähmende Bürokratie – all das sind Sargnägel für unseren Wohlstand und unseren Sozialstaat.
Wollen wir hoffen, dass es wieder mehr wirtschaftsfreundliche Politiker gibt, die sich trauen, Klartext zu sprechen. Wenn wir als Nation umweltfreundliche Standards in der Welt etablieren und für die Einhaltung von Menschenrechten eintreten wollen, müssen wir dafür sorgen, dass unser Wohlstand langfristig gesichert ist.
Wir brauchen Politiker, die nicht versuchen, ihre grünideologischen Zukunftsvorstellungen mit der Brechstange zu erzwingen. Sondern die verstehen, dass der grüne Umbau einer Wirtschaft dann gelingt, wenn die Wirtschaft mit dem grünen Weg langfristig mehr Geld verdient. Wenn Umweltschutz und Geldverdienen keine Widersprüche, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille sind.
So hat einer meiner Kunden beispielsweise in ein neues Betonwerk investiert. Das kostete zunächst Geld, sorgt aber dafür, dass nun beim Bau der Projekte Beton eingespart wird. Unterm Strich hat sich die Investition nach zwei Jahren bereits rentiert. So gelingt die Zeitenwende auf eine wirtschaftsfreundliche Art, die den Wohlstand von uns Bürgern sichert.
Gelingt uns das nicht, verlieren wir auf dem Weg in eine gute Zukunft die Bürger, die durch falsche politische Weichenstellungen als Erste finanziell unter die Räder kommen. Und ohne deren Rückhalt und ihre Unterstützung wird es keinen friedlichen Weg von Maß und Mitte geben. Wenn die Menschen keine zuversichtliche Perspektive sehen, wählen sie die politischen Extreme. Wie Bertolt Brecht schon 1928 treffend formulierte: »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.«
4 Diversity statt Teamgeist?
Spitzenleistung. Wenn Sie dieses Wort hören, was regt sich da in Ihnen? Finden Sie das super und haben gleich Bock darauf, Gas zu geben? Oder schreckt es Sie eher ab, da es nach harter Arbeit klingt? Aus meiner Erfahrung spaltet das Wort – zum Unmut von zahlreichen Führungskräften, Geschäftsführern und Unternehmern.
Im Jahr 2012 schrieb der Milliardär und Schraubenkönig Würth einen ungewöhnlich offenen Brief an seine Außendienstmitarbeiter. Darin bemühte er das Sprichwort »Morgenstund hat Gold im Mund« und fragte: »Sind Sie um 7.30 Uhr beim ersten Kunden?« Er führte weiter aus, dass ein Gros der Mitarbeiter ihre Arbeitszeit nur zu 60 bis 70 Prozent nutzen würde. Wegen der »miserablen Umsatzzuwachsrate« in Höhe von 3,3 Prozent während des ersten Halbjahrs könne der Firmengewinn so unter Druck geraten, »dass wir uns von Außendienstlern, die vielleicht nicht mehr als ihre eigenen Kosten verdienen, trennen müssten«, hieß es in dem Schreiben. Der IG Metall gefiel das Schreiben nicht und forderte, dass ein Betriebsrat eingeführt werde, um die Interessen der Mitarbeiter zu vertreten.
Für Norbert Heckmann, Vorsitzender der Würth-Geschäftsführung, ist das Ziel klar: Kunden begeistern! »Daher ist die Führung leistungsbezogen und darauf aus, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu generieren, getreu unserer Kulturregel ›Je größer der Erfolg, umso höher die Freiheitsgrade‹.« Jährlich befrage das Unternehmen seine Mitarbeiter anonym. Das Ergebnis: eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit im Außendienst.
Zeitsprung ins Jahr 2022. Elon Musk schreibt eine E-Mail an seine Mitarbeiter bei Tesla. »Jeder, der remote arbeiten möchte, muss mindestens (und ich meine *mindestens*) 40 Stunden pro Woche im Büro arbeiten oder Tesla verlassen. […] Darüber hinaus muss das ›Büro‹ ein Hauptbüro von Tesla sein, keine entfernte Zweigstelle, die nichts mit den beruflichen Verantwortlichkeiten zu tun hat.« Wer beispielsweise verantwortlich für HR im Fremont-Werk sei, könne sein Büro nicht in einem anderen Bundesstaat haben.
Der Shitstorm der Entrüstung war damals wie heute groß. Die Kritik ist eindeutig: So kann, so darf man nicht mit Mitarbeitern sprechen. Die Frage lautet: Warum denn nicht? Würth und Musk führen ihre Unternehmen an. Sie können also frei entscheiden, wie sie führen und was sie von ihren Mitarbeitern fordern, solange sie nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Der Zeitgeist ist kein Recht, sondern nur eine mögliche Meinung, die man teilen kann, aber nicht teilen muss. Nachdem Musk auf Twitter gefragt wurde, was mit Mitarbeitern sei, die es für antiquiert halten, zur Arbeit ins Büro zu kommen – schrieb er: »Sie sollen woanders so tun, als würden sie arbeiten.«
Genauso frei in der Haltung wie die beiden Unternehmer sind auch ihre Mitarbeiter. Niemand muss sich den Anforderungen von Würth und Musk beugen. Erst recht nicht in einer Zeit, in der Fachkräftemangel herrscht und Mitarbeiter sich aussuchen können, wo sie einen neuen Job anfangen.
Alles und noch viel mehr