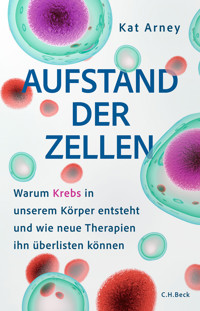
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Krebs beginnt, wenn Zellen rebellieren, wenn sie außer Kontrolle geraten und in eine chaotische Parodie normalen Lebens ausarten. Dieselben Gene, die Tumore befördern, sind auch für jede andere Funktion von Leben verantwortlich. Krebs ist keine Krankheit, die wir selbst durch unseren modernen Lebensstil über uns gebracht haben. Tatsächlich war er unser Begleiter von allem Anfang an: Tödliche Tumore finden sich in ägyptischen Mumien und in Fossilien von Dinosauriern. Aber die Forschung macht unaufhaltsame Fortschritte, und Wissenschaftlern gelingt es zunehmend, die Zellrebellion des Krebses genau zu verstehen und wirksame Therapien zu seiner Behandlung zu entwickeln.
Dieses Buch ist keine Geschichte über Krebs. Es handelt vielmehr vom Leben. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Krebs keine moderne menschliche Krankheit ist, sondern in grundlegenden Prozessen der Biologie verankert. Wir werden sehen, dass die Wurzeln dieser Rebellion bis zu den Ursprüngen des vielzelligen Lebens zurückreichen, als die organisierten Strukturen geschaffen wurden, aus denen regelbrechende Zellen hervorgehen.Ein Jahrhundert Forschung im Blick, verfolgen wir, wie die Wissenschaft die genetischen Geheimnisse von Krebs ergründet hat – mit revolutionären, aber auch irreführenden Erkenntnissen. Wir werden begreifen, wie dieselben evolutionären Kräfte, die die spektakuläre Vielfalt des Lebens auf der Erde formen, auch auf der Ebene der entarteten Zellenwirken, und dass wir lernen müssen, mit ihnen statt gegen sie zu arbeiten, wenn wir den Krebs besiegen wollen. Und obwohl wir unsere Biologie nicht leugnen können – niemand lebt ewig –, freuen wir uns auf eine Zukunft, in der jeder, dem die Diagnose Krebs gestellt wird, gesagt bekommt: «Machen Sie sich keine Sorgen. Wir können etwas dagegen tun.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Kat Arney
AUFSTAND DER ZELLEN
Warum Krebs in unserem Körper entsteht und wie neue Therapien ihn überlisten können
Aus dem Englischen von Jens Hagestedt und Ursula Held
C.H.Beck
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
Motto
EINLEITUNG
//1//: GANZ VON VORNE
Alt oder neu
Ob klein, ob groß
Groß und gefährlich?
Krebsresistenz
Ist das «moderne» Leben schuld?
//2//: DER PREIS DES LEBENS
Mogelnde Amöben
Eine dornige Angelegenheit
Zellen-Meeting
Ein Rückfall?
Geschummelt wird immer
//3//: SCHUMMELNDE ZELLEN
Zellen unter der Lupe
Dem Lebensrezept auf der Spur
Vom gehörnten Hasen zum Krebsgen
//4//: ALLE GENE AUF EINMAL
Von
Broca
zu
BRCA
Mäuse und Menschen
Mutationen-Patchwork
Was ist schon normal?
Niemand ist ohne Fehler
Wann ist es Krebs?
//5//: WENN ZELLEN AUF DIE SCHIEFE BAHN GERATEN
Gruppenzwang
Und was ist mit Kindern?
Brüste, Darm und Pech
Ewige Jugend
//6//: EGOISTISCHE MONSTER
Willkommen in der Resistenz
Bäume und Stämme
Darwins Rache
Der Schmelztiegel der Evolution
Am Todesrad drehen
//7//: DEN PLANETEN KREBS ERKUNDEN
Die Wunde, die nicht verheilt
Eine Geschichte von Affen und Metastasen
Aus größerem Abstand betrachtet
//8//: ÜBERLEBEN DER VERRÜCKTESTEN
Zwei werden eins
Arme Teufel
Hundeleben
Von Muscheln bis zu kannibalischen Hamstern
//9//: DIE MEDIKAMENTE WIRKEN NICHT
Was kommt nach
Whac-A-Mole
?
Den Cocktailschrank öffnen
Josh
Der Circos kommt in die Stadt
Es ist Zeit, dass wir weiterkommen
//10//: GAME OF CLONES
Von Molekülen zur Mathematik
Trotz Fleiß kein Preis
Rebellion Extinction
Ein Spiel auf Leben und Tod
Aus Misserfolgen lernen
//11//: GAME OVER
Ein Wetterumschwung
Den Drachen wecken
Auf der Jagd nach Heilung
DANK
GLOSSAR
WEITERFÜHRENDE LEKTÜRE
LITERATUR
Einleitung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
REGISTER
Zum Buch
Vita
Impressum
Motto
Dem Leben, der Liebe und dem Verlust.
Drehend und drehend im sich weitenden Kreisel
Kann der Falke den Falkner nicht hören;
Alles zerfällt, die Mitte hält es nicht.
Ein Chaos, losgelassen auf die Welt
W.B. Yeats (übersetzt von Mirko Bonné)
EINLEITUNG
«Krebs entsteht, wenn eine Zelle Mutationen aufnimmt und sich unkontrolliert vermehrt.»
Ich kann nicht sagen, wie oft ich diesen oder einen ähnlichen Satz während meiner Tätigkeit als Wissenschaftsjournalistin niedergeschrieben habe. Auch in den zwölf Jahren, die ich im Kommunikationsteam der weltweit führenden gemeinnützigen Organisation für Krebsforschung verbracht habe, hat er mich ständig begleitet. Kein einziges Mal habe ich darüber nachgedacht, was er wirklich bedeutet. Oder dass er auch falsch sein könnte.
Krebs betrifft uns alle. Selbst wenn Sie das Glück hatten, die Auswirkungen dieser Krankheit nicht unmittelbar zu erleben, ob bei sich selbst oder bei jemandem, der Ihnen nahesteht, bleibt Krebs doch ein weltweites Gesundheitsproblem, das jedes Jahr Millionen Menschen das Leben kostet. Wissenschaftler und Ärzte forschen seit jeher an möglichen Ursachen, Folgen und Therapien, doch erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten nennenswerte Fortschritte erzielt werden. Heute lebt etwa die Hälfte der Menschen, bei denen Krebs festgestellt wird, zehn Jahre oder länger nach der Diagnose – eine Zahl, die für Deutschland genauso wie für Großbritannien gilt und in Zukunft wohl noch steigen wird. Optimisten würden sagen: Das Glas ist halbvoll.
Wir wissen inzwischen, wie man Krebs heilen kann. Oder besser gesagt: Wir wissen, wie man bestimmte Krebsarten heilen kann. Im besten Fall wird ein Tumor so schnell wie möglich erkannt und durch eine sorgfältige Operation entfernt, bevor er Metastasen gebildet und sich im Körper ausgebreitet hat. Daneben kann eine Strahlentherapie Erfolg bringen, genauso wie eine Hormontherapie, die zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, Brust- und Prostatakrebs in Schach hält. Viele Formen von Blutkrebs sprechen – besonders bei Kindern – erstaunlich gut auf eine Chemotherapie an. Medikamente können sogar fortgeschrittenen Hodenkrebs vollständig heilen. Erstaunliche Ergebnisse zeigt derzeit eine neue Generation von Immuntherapien, doch wirken diese bisher nur bei knapp einem Fünftel der mit ihnen behandelten Patienten. Hat die Krankheit ihren unerbittlichen Marsch durch den Körper angetreten, geht es für die Leidenden oft nicht mehr um die Frage «Werde ich wieder gesund?», sondern: «Wie lange habe ich noch?».
Damit befinden wir uns weiterhin in fast derselben Situation wie 1971, als Richard Nixon den «Krieg gegen den Krebs» ausrief. Der amerikanische Präsident wollte damit eine Ablenkung vom Vietnamkrieg schaffen und zugleich aus dem durch die Apollo-Mondlandungen beflügelten Pioniergeist Kapital schlagen. Er versprach Millionen Dollar, wenn es gelänge, innerhalb eines Jahrzehnts eine erfolgreiche Krebstherapie zu entwickeln. Doch in einer bedauerlichen Parallele zur Situation in Vietnam hatte Nixon seinen Feind völlig unterschätzt. 1986 kam eine Statistik von John Bailar zu folgendem Ergebnis: Trotz einzelner Erfolge blieb die überwiegende Mehrheit der Krebserkrankungen im Spätstadium weiterhin unheilbar. Den «Krieg gegen den Krebs» bewertete Bailar als «eindeutigen Misserfolg».
Obgleich man bei der Behandlung bestimmter Krebsarten, insbesondere beim malignen Melanom, inzwischen nicht mehr ganz so im Dunkeln tappt, zeigt ein genauerer Blick auf aktuelle Statistiken dasselbe Muster. Immer mehr Menschen bekommen die Diagnose Krebs in einem frühen Stadium, in dem eine wirksame Behandlung viel wahrscheinlicher ist. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Überlebenden. Bei fortgeschrittenem metastasierendem Krebs aber wird die Überlebensrate weiterhin eher in Monaten oder wenigen Jahren als in Jahrzehnten angegeben.
Das große Problem besteht darin, dass die Präzisionsinstrumente der Chirurgie und Strahlentherapie gegen eine wild wuchernde Krankheit so gut wie nutzlos sind. Und die Chemotherapie ist eine stumpfe Waffe, die auf dem Prinzip basiert, Krebszellen schneller abzutöten als gesunde Zellen. Selbst wenn sie wirkt, kehren die Tumoren fast unweigerlich zurück – Wochen, Monate oder sogar Jahre später – und jede neue Behandlungsrunde ist ein brutalerer Angriff auf die Gesundheit, mit geringeren Erfolgsaussichten. Das halbvolle Glas ist offenbar schwer zu füllen.
Um die Jahrhundertwende züchteten Wissenschaftler des Londoner «Imperial Cancer Research Fund» Krebszellen von Mäusen und versuchten, hinter das Geheimnis ihrer rasanten Vermehrung zu kommen. Man staunte über die scheinbar unerschöpfliche Regenerationsfähigkeit der Laborzellen. Studienleiter Ernest Bashford schrieb 1905 im wissenschaftlichen Jahresbericht der Wohltätigkeitsorganisation: «Der künstlich vermehrte Mäusetumor hat eine Gewebemenge hervorgebracht, die eine Maus von der Größe eines Bernhardiners überwältigen würde.»
Heute haben wir ein umfassenderes Bild davon, was passiert, wenn Zellen ihre molekularen Fesseln abwerfen: In der zivilisierten multizellulären Gesellschaft tauchen mit einmal Betrüger auf, die der normalen Entwicklung spotten und sich unkontrolliert vermehren. Aus einer Zelle werden zwei, aus zwei Zellen werden vier, aus vier werden acht, und am Ende ist da ein millionenstarker Mob. Aber dabei bleibt es nicht. Die Rebellen dringen in das umliegende, gutartige Gewebe ein und korrumpieren es, indem sie unsere Körperpolizei, das Immunsystem, zum Wegschauen zwingen. So gelangen sie unbemerkt in den Blutkreislauf, wandern durch Arterien und Venen und bilden Splittergruppen und Schläferzellen. Jede von ihnen wird von häretischen Versionen unserer eigenen Gene angetrieben – der genetischen Gebrauchsanweisung, die den Zellen sagt, wann sie sich teilen, was sie werden und wann sie sterben sollen.
Ein «Heilmittel gegen Krebs», so nimmt man seit Langem an, führt über das Verständnis der fehlerhaften Gene und Moleküle in Tumorzellen – deren Analyse beschäftigt seit fast einem Jahrhundert eine kleine Armee von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und hat unzählige Milliarden Dollar verschlungen. Forscher haben DNA aus den Tumoren und dem gesunden Gewebe Tausender Krebspatienten auf der ganzen Welt extrahiert, gelesen und analysiert: endlose Buchstabenfolgen, die das Rezeptbuch des Lebens ergeben und Tippfehler enthalten, die vermutlich dafür verantwortlich sind, dass Krebs wächst und sich ausbreitet. Aber anstatt Klarheit zu schaffen, enthüllen diese Informationen mehr denn je das in Tumoren vorherrschende genetische Chaos.
Wir können die Narben sehen, die Tabakrauch oder das ultraviolette Licht der Sonne im Genom hinterlassen haben. Es gibt Hinweise darauf, dass die biologischen Abwehrmechanismen, die unsere Zellen schützen sollen, zuweilen versagen oder sich sogar gegen uns wenden. Daneben finden sich seltsame Spuren mit unbekannten Ursachen, die eines Tages auf schädliche Umweltchemikalien oder neue molekulare Prozesse zurückgeführt werden könnten. Die DNA-Analyse hat Relikte größerer und kleinerer Schäden aufgedeckt, von einer Handvoll Tippfehlern bis hin zu Szenen einer gewaltigen genetischen Katastrophe, bei der ganze Chromosomen zerschmettert und wieder zusammengefügt wurden. Um die Dinge noch verwirrender zu machen, stellt sich nun heraus, dass bei Menschen im mittleren Alter selbst vollkommen gesundes Gewebe ein Durcheinander mutierter Zellen ist. Viele dieser Mutationen würde man normalerweise als krebsartig einstufen.
Zudem haben die Studien zutage gefördert, dass die genetischen Veränderungen, die eine einzelne Zelle in einen Tumor verwandeln, keineswegs konsistent oder festgelegt sind. Das eine «Krebsgen» gibt es nicht, genauso wenig wie die eine «Krebstherapie». Man findet je nach Person große Unterschiede in der genetischen Zusammensetzung von Tumoren, und sogar bei den Gendefekten innerhalb der Miniaturlandschaft eines einzelnen Tumors kommen Variationen vor. Jeder Krebs ist ein aus verschiedenen Zellgruppen bestehendes genetisches Patchwork, und jede dieser Zellgruppen kann Genveränderungen aufweisen, die sie immun gegen die Behandlung machen. Sobald ein Krebs eine bestimmte Größe und Vielfalt erreicht hat, ist ein Rückfall unvermeidlich.
Wissenschaftler sehen im Fortschreiten von Krebs immer mehr einen Mikrokosmos der Evolution: Zellen nehmen neue Mutationen auf und werden, während sie wachsen und sich ausbreiten, einer natürlichen Selektion unterzogen, die an Darwins Baum des Lebens erinnert. An dieser Stelle entdecken wir eine weitere unangenehme biologische Wahrheit über Krebs: Die gleichen Prozesse, die die Evolution des Lebens auf diesem Planeten vorangetrieben haben, sind auch in unserem Körper am Werk.
Erschwerend kommt hinzu, dass der selektive Druck zum Teil bei vermeintlich lebensrettenden Therapien auftritt, die medikamentensensitive Krebszellen abtöten, resistente Zellen hingegen gedeihen lassen. Und was den Krebs nicht umbringt, macht ihn stärker: Kehrt er zurück, ist er nicht mehr aufzuhalten. Kein Wunder, dass unsere derzeitigen Behandlungsansätze gegen ein so bösartiges Monster machtlos sind.
Wir brauchen dringend eine neue Herangehensweise, wenn wir verstehen möchten, wie Krebs entsteht und wie wir ihn auf der Grundlage dieser evolutionären Zusammenhänge verhindern und behandeln können. Dazu sollten wir die entarteten Zellen, die sich zu einem Tumor entwickeln, und die Landschaft, in der sie leben, nicht länger als feste Einheiten, sondern als Populationen betrachten, die sich im Laufe der Zeit verändern und daher nicht anhand einer Liste von Mutationen beschrieben werden können. Vom deutschen Biologen Richard Goldschmidt stammt der Ausdruck «hopeful monsters» («vielversprechende Monster») zur Beschreibung von prähistorischen Organismen, die sprunghaft neue Eigenschaften entwickelt haben. Krebszellen sind «egoistische Monster», die innerhalb der Lebenszeit eines Patienten eine chaotische, rasante Entwicklung hinlegen. Und so wie Hungersnöte oder Fressfeinde als Selektionsfaktoren zur Ausformung der Arten beitragen, so reagieren auch Krebszellen auf selektiven Druck, da sie im Ökosystem des Körpers das Drama der Evolution aufführen.
In dieser «schönen neuen Welt», in der jeder Krebs genetisch einzigartig ist und sich individuell aus dem Chaos entwickelt, sind die bisherigen in Arzneimittelforschung und klinischen Studien angewandten Methoden nicht mehr zielführend. Das Ganze ist zu einem hoffnungslos bürokratischen Geschäft geworden, bei dem eine immer ausgefeiltere Maschinerie einer schrumpfenden Rendite gegenübersteht. Wollen wir einem derart gerissenen Gegner wie dem Krebs beikommen, müssen wir um einiges schlauer vorgehen. Immerhin entschlüsseln wir nun sein geheimes Evolutionsskript und schauen auf die Ökologie der Landschaft, in der die Ausreißerzellen leben. Und es wächst die Hoffnung, dass wir anhand dieses Wissens ihre nächsten Schritte vorhersagen und vereiteln können, indem wir die Prozesse der Evolution geschickt manipulieren, um das ausufernde Tumorwachstum zu steuern.
Während ich im Januar 2019 an der ersten Fassung dieses Buches arbeitete, blitzte in meinem Twitter-Feed die Meldung auf, ein israelisches Biotechnologieunternehmen hätte ein Krebsmedikament entwickelt, das innerhalb eines Jahres verfügbar sein sollte. Trotz gutgläubiger Retweets und Medienberichte war die Therapie nur an Mäusen getestet worden, und es gab keinerlei klinische Daten, die die Behauptungen stützten. Alles deutete darauf hin, dass die Ankündigung wohl eher der Gesundheit des Unternehmens als jener von Krebspatienten zugutekommen würde. Ein Jahr später befand sich das «Wundermittel» weiterhin in der Entwicklung und kein einziger Patient war behandelt worden.
Ärgerlicherweise erhalten Artikel, die solche überbewerteten Wundermittel und anderen Unsinn entlarven, in der Regel ein Vielfaches weniger an Klicks als die ursprüngliche Berichterstattung. Das ist bei weitem kein modernes Problem. Im Jahr 1904 schrieb Sir D’Arcy Power, Chirurg am St. Bartholomew’s Hospital in London, einen wütenden Artikel im British Medical Journal, in dem er sich über ein Quacksalber-Krebsmittel eines deutschen Arztes namens Dr. Otto Schmidt ausließ. Er merkte an, dass Schmidts unwirksame Behandlung «eine doch größere Verbreitung fand als beabsichtigt, da eine ausführliche Darstellung in der Daily Mail erschien».
Wir wollen glauben, dass Krebs heilbar wird. Und damit meinen wir seine vollkommene Ausrottung. Wir wollen die Gewissheit haben, dass all die Zeit, das Geld, die Anstrengungen, das Leiden und die Krebstoten uns der Entdeckung einer erfolgreichen Therapie näherbringen. Und so lassen wir uns leicht verführen, wenn die Rede von intelligenten Medikamenten und Wundermitteln ist. Wenn wir uns nun daranmachen, Krebs im Zusammenhang mit Evolution und Ökologie zu sehen, erfordert dies eine neue Denkweise, und das nicht nur innerhalb der Scientific Community und der medizinischen Forschung, sondern auch aufseiten der Patienten und der Öffentlichkeit. Denn es könnte sein, dass die lang ersehnte Lösung nicht ganz so aussieht wie erwartet.
Dieses Buch ist keine Geschichte über Krebs. Es handelt vielmehr vom Leben. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Krebs keine moderne menschliche Krankheit ist, sondern in grundlegenden Prozessen der Biologie verankert. Wir werden sehen, dass die Wurzeln dieser Rebellion bis zu den Ursprüngen des vielzelligen Lebens zurückreichen, als die organisierten Strukturen geschaffen wurden, aus denen regelbrechende Zellen hervorgehen. Ein Jahrhundert Forschung im Blick, verfolgen wir, wie die Wissenschaft die genetischen Geheimnisse von Krebs ergründet hat – mit revolutionären, aber auch irreführenden Erkenntnissen. Wir werden begreifen, wie dieselben evolutionären Kräfte, die die spektakuläre Vielfalt des Lebens auf der Erde formen, auch auf der Ebene der entarteten Zellen wirken, und dass wir lernen müssen, mit ihnen statt gegen sie zu arbeiten, wenn wir den Krebs besiegen wollen. Und obwohl wir unsere Biologie nicht leugnen können – niemand lebt ewig –, dürfen wir uns auf eine Zukunft freuen, in der jeder, dem die Diagnose Krebs gestellt wird, gesagt bekommt: «Machen Sie sich keine Sorgen. Wir können etwas dagegen tun.»
//1//
GANZ VON VORNE
Es beginnt mit einer einzelnen Zelle.
Wahrscheinlich schwammen vor etwa 3,8 Milliarden Jahren viele ganz ähnliche Zellen in der Ursuppe, doch nicht alle hatten so viel Glück wie LUCA[1]. Dieser aus der heißen, dunklen und sauerstofffreien Umgebung eines «Schwarzen Rauchers», einer hydrothermalen Tiefseequelle, hervorgegangenen bakterienähnlichen Zelle ist es irgendwie gelungen, alle für ein unabhängiges Leben erforderlichen Komponenten anzusammeln: eine Reihe von molekularen Mechanismen und genetischen Anweisungen, die ihr eine autonome Energieerzeugung, Selbsterhaltung und vor allem Reproduktion ermöglichten.
Aus einer Zelle wurden zwei. Aus zwei wurden vier. Aus vier wurden acht, und so weiter. Und jetzt, Milliarden Jahre später, sind da wir. Jede Zelle in Ihrem Körper, jede Zelle in dem Baum vor Ihrem Fenster, jede Zelle der in seinen Zweigen zwitschernden Amsel, ja jede Zelle der in Ihrer Toilettenschüssel lauernden Bakterienkolonien lässt sich über eine ununterbrochene Kette von Zellteilungen bis zu LUCA zurückverfolgen. Der Kernprozess der Replikation ist der Motor, der die Fülle des Lebens auf der Erde antreibt. Er macht aus einer Eichel eine Eiche, aus einem Klumpen Hefeteig ein fluffiges Brot, aus einer befruchteten Eizelle ein Baby und aus einer Krebszelle einen tödlichen Tumor.
Alt oder neu
Erhält jemand die Nachricht, dass er an Krebs erkrankt ist, kommt schnell die Frage auf: «Warum ich?» Meine Frage hingegen lautet: «Warum wir?»
Angesichts der Schlagzeilen über stetig steigende Krebsraten tappt man leicht in die Falle und nimmt an, Krebs sei eine neuartige, durch unseren ungesunden modernen Lebensstil verursachte Krankheit. Doch allein die Tatsache, dass Krebs bei fast allen vielzelligen Arten auftritt, widerlegt diese Annahme als unwahr.
Im Oktober 2010, während meiner Tätigkeit im Kommunikationsteam der Wohltätigkeitsorganisation Cancer Research UK, wies die Universität Manchester auf eine in der Zeitschrift Nature Reviews Cancer veröffentlichte Studie von Rosalie David und Michael Zimmerman hin: Das Forscherteam kommt darin zu dem Schluss, da man bei ägyptischen Mumien und anderen menschlichen Überresten des Altertums selten Krebs finde, müsse es sich um eine fast ausschließlich moderne Erfindung handeln, für die wir also selbst verantwortlich seien. Natürlich war diese Geschichte ein gefundenes Fressen für die Medien, sie tauchte bald in Zeitungen und im Internet auf und veranlasste mich, einen Beitrag für den Blog von Cancer Research UK zu schreiben, in dem ich ausführte, wie irreführend und falsch diese Behauptungen sind.
Denn zunächst einmal ist «selten» nicht gleichbedeutend mit «nicht vorhanden». Wir können nicht wissen, ob der Anteil der in archäologischen Aufzeichnungen auftauchenden Krebserkrankungen ein genaues Abbild der Gesundheit der jeweiligen Bevölkerung gibt. Die Berechnung genauer Krebsinzidenzen für längst verstorbene menschliche Populationen ist nahezu unmöglich, denn im Vergleich zur Anzahl der Menschen, die jemals gelebt haben, ist der Anteil an geborgenen Überresten verhältnismäßig gering. Außerdem betrifft die Krankheit vor allem ältere Menschen, die Krebsinzidenz steigt ab dem 60. Lebensjahr stark an. Moderne Bevölkerungen entgehen zum Glück vielen Risiken – Infektionskrankheiten, Mangelernährung, Müttersterblichkeit und generell schlechten Lebensumständen –, die unsere Vorfahren früh sterben ließen. Mit der weltweit deutlich gestiegenen durchschnittlichen Lebenserwartung hat sich auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein Alter zu erreichen, in dem die Krebshäufigkeit zum Problem wird.
Im alten Ägypten konnte man mit einem gewissen Wohlstand und guter Ernährung 50 Jahre oder älter werden, die arme Bevölkerung aber konnte froh sein, wenn sie es bis zu einem Alter von knapp 30 schaffte. Im England des 15. Jahrhunderts durften die meisten Männer damit rechnen, rund 50 Jahre alt zu werden, während Frauen, vermutlich aufgrund der hohen Müttersterblichkeit, nur etwa 30 Jahre erreichten. Archäologen können zwar das ungefähre Alter von menschlichen Überresten anhand des Zustands von Zähnen und Knochen oder beiliegenden Artefakten schätzen, aber es ist sehr schwierig, eine altersstandardisierte Krebsinzidenz für Menschen zu erstellen, die vor vielen tausend Jahren aus dem Leben geschieden sind.
Hinzu kommt, dass die meisten archäologischen Funde kaum mehr als Skelette sind. Es gibt zwar Krebsarten, die Spuren im Knochen hinterlassen, andere bleiben jedoch eher auf die sich schnell zersetzenden inneren Organe beschränkt. Die Tatsache, dass man in mumifizierten Körpern mit erhaltenem Weichgewebe Tumoren entdeckt hat, lässt für mich nicht unbedingt auf ein «seltenes» Vorkommen schließen. Die Krankheit trat immerhin so häufig auf, dass sie von Ärzten im alten Ägypten, in Rom und Griechenland erwähnt wurde. So schrieb der im 2. Jahrhundert tätige griechische Arzt Galen: «Wir haben in den Brüsten oft Tumoren gesehen … Diese Krankheit haben wir oft im Anfangsstadium geheilt, wenn sie aber ein beträchtliches Ausmaß erreicht hat, kann sie niemand ohne Operation heilen.» Tatsächlich sind mehr als 275 Krebsfälle bei Personen dokumentiert, die vor Beginn des 20. Jahrhunderts lebten. Dazu gehören neben häufig auftretenden Krebsarten auch seltene Tumoren bei Kindern. Und das sind nur die Fälle, von denen wir wissen. Wie viele von Galens Brustkrebspatientinnen sind unserer Aufmerksamkeit entgangen, weil wir keine physischen oder schriftlichen Spuren ihrer Existenz haben?
Die Antike war ganz sicher kein gesunder Ort. Wie wir in den nächsten Kapiteln sehen werden, kann der moderne Lebensstil durchaus das Krebsrisiko erhöhen, doch zugleich steckt schon die natürliche Umwelt voller krebserregender Stoffe – seien es Viren und andere Infektionskrankheiten oder auch Schimmelpilze in Lebensmitteln und natürlich vorkommende Chemikalien in Pflanzen (auch wenn diese «bio» sind). In vielen Teilen der Welt tritt als Folge natürlicher Prozesse radioaktives Radongas aus dem Boden aus, vor allem in Gebieten, die reich an Vulkangestein sind. Man vermutet hier unter anderem einen Zusammenhang mit dem ungewöhnlich hohen Krebsvorkommen, das man in den sterblichen Überresten einer Gruppe von Dorfbewohnern vorfand, die vor etwa tausend Jahren im amerikanischen Südwesten lebten. Allein unsere Sonne taucht uns täglich in krebserregende ultraviolette Strahlung. Im Ruß und Rauch von offenen Feuern, die Menschen schon vor mehr als hunderttausend Jahren als Wärmequelle und zur Nahrungszubereitung genutzt haben, sind reichlich karzinogene Verbindungen vorhanden, deren schädliche Auswirkungen sich in geschlossenen Räumen wie Höhlen oder Küchen potenzieren. Die meisten Krebserkrankungen im Kindesalter hingegen haben nur sehr wenig mit Umweltfaktoren zu tun, sondern sind vielmehr die Folge von außer Kontrolle geratenen Entwicklungsprozessen (S. 136).
Um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie Krebs die Menschheit im Laufe unserer Geschichte heimgesucht hat, habe ich mich mit Casey Kirkpatrick getroffen, einer der Mitbegründerinnen der «Paleo-oncology Research Organization» (PRO) – einer kleinen, aber engagierten Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die zum Thema Krebs im Altertum forschen. Damit treten sie in die Fußstapfen der ersten Paläopathologen, etwa dem Ägyptologen und Arzt Eugen Strouhal und der amerikanischen Anthropologin Jane Buikstra, deren recht junge Wissenschaft sich mit Krankheiten vergangener Epochen befasst. Die Forscherinnen der PRO gehen die Fragestellung sehr systematisch an und haben als eines ihrer ersten Projekte die «Cancer Research in Ancient Bodies Database» (CRAB) geschaffen. In dieser Datenbank sind alle Informationen gesammelt, die sie über Krebserkrankungen bei vor dem 20. Jahrhundert lebenden Menschen finden konnten.
Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gab es etwa 275 Einträge – deutlich mehr als 2010, als der Artikel von Zimmerman und David erschien. Das mag nicht nach besonders viel klingen, sicherlich gab es aber viele weitere Krebserkrankungen, die unbemerkt geblieben sind. Es ist schließlich ausnehmend schwierig, eine Diagnose zu stellen, wenn der Betroffene schon seit mehr als tausend Jahren tot ist und man oft nur ein paar Knochenstücke als Anhaltspunkt hat.
Die wichtigsten Instrumente zur Diagnose von Krebs in Funden aus der Antike sind Röntgenaufnahmen und CT-Scans. So veröffentlichte der englische Ägyptologe Flinders Petrie Anfang 1896, nur vier Monate nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen, das erste Röntgenbild einer Mumie. (Er war aber eher auf der Suche nach unter den Leichentüchern versteckten Juwelen oder Amuletten, nicht nach Tumoren.) Die ersten Krebserkrankungen bei Mumien wurden in den 1950er Jahren entdeckt, dann trat in den 1970er Jahren mit der Entwicklung des dreidimensionalen CT-Scans ein Wendepunkt ein. Archäologen konnten Mumien nun virtuell «auspacken» und sich ihr Inneres ansehen, was zur Identifizierung vieler weiterer Fälle führte.
Entdeckt man einen auffälligen Knoten oder eine abnormale Struktur in einem antiken Skelett oder einer Mumie, bedeutet das nicht automatisch, dass es sich um Krebs handelt: Es könnte genauso ein gutartiger Tumor, eine Zyste oder eine von vielen anderen möglichen Krankheiten vorliegen. So wäre etwa Fluorose denkbar: Aufgrund hoher Fluorwerte in der Umwelt, besonders in der näheren Umgebung von Vulkanen, wandelt sich bei dieser Krankheit Weichgewebe in Knochengewebe um. Oder es könnte sich um eine sogenannte Pseudopathologie handeln, bei der der normale Knochenabbau den Anschein einer Krankheit erweckt. Trotzdem gibt es verräterische Hinweise auf eine Krebserkrankung.
Bestimmte Krebsarten sehen sehr charakteristisch aus – Casey Kirkpatrick und ihre Kolleginnen sprechen hier von spezifischen «pathognomischen» Zeichen. Doch nicht immer ist die Diagnose so eindeutig. Zwar können CT-Scans und Röntgenaufnahmen zeigen, dass eine Art von Krebs vorliegt, doch ist es mitunter schwierig, diese zu spezifizieren. Daher kann ein Paläopathologe bestenfalls eine Auswahl an Optionen anbieten, aber keine definitive Antwort liefern. Das Myelom – eine Krebserkrankung, die weiße Blutkörperchen im Knochenmark befällt – hinterlässt in den Knochen die gleichen Spuren wie Tumore, die sich von anderen Stellen im Körper aus ausgebreitet haben, während Leukämien und Lymphome, beides Blutkrebserkrankungen, in den aufgefundenen Überresten im Grunde nicht zu unterscheiden sind. Besteht bei einem heutigen Patienten ein Krebsverdacht, wird er für eine genauere Diagnose einer Reihe systematischer Tests und Scans unterzogen, bei sterblichen Überresten aber gibt es keinen vergleichbaren standardisierten Ansatz. Das PRO-Team arbeitet hier an neuen Methoden.
Zudem lässt sich nicht so leicht herausfinden, wie sich Krankheiten in der Vergangenheit im Körper manifestiert haben. In unseren modernen Gesellschaften findet man große Unterschiede bei den Ursachen, Häufigkeiten und Arten von Krebs, und es kommt selten vor, dass ein heutiger Bewohner eines wohlhabenden Lands an Krebs stirbt, ohne eine Behandlung erhalten zu haben. 4000 Jahre alte Ägypter, Inuit aus dem dritten Jahrhundert oder präkoloniale peruanische Dorfbewohner lassen sich daher kaum mit modernen Menschen der westlichen Welt vergleichen. Einige Forscher versuchen, realistischere Vergleiche mit weniger entwickelten Kulturen und Bevölkerungsgruppen anzustellen, die keinen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben, doch gestaltet es sich manchmal schwierig, in diesen Teilen der Welt genaue Daten und Statistiken zu sammeln.
Die Schwierigkeit der Diagnose hat zu langanhaltenden Diskussionen darüber geführt, ob auffällige Knoten und Beulen, die in sterblichen Überresten des Altertums gefunden wurden, echte Beispiele für Krebs sind oder eher auf andere Weise verursacht worden sein könnten. Eines der bekanntesten (und strittigsten) Beispiele ist die Ausbuchtung am Kieferknochen des Kanammenschen, einem versteinerten Fragment eines Urmenschen, das der Fossilienjäger Louis Leakey und sein Team 1932 am kenianischen Ufer des Viktoriasees ausgegraben haben. Das genaue Alter des Fossils und seine Position im Stammbaum unserer Vorfahren sind umstritten, doch geht man davon aus, dass es mindestens 700.000 Jahre alt ist. Ebenso uneins ist man sich über die Eigenschaft der aus seiner Oberfläche herausragenden Masse. Wenn es sich, wie mancherorts behauptet, um die Überreste eines Knochentumors oder eines Burkitt-Lymphoms handelt, dann ist dieser Knoten einer der ältesten Homininen-Krebserkrankungen, die wir kennen. Nach Ansicht anderer Experten könnte es sich aber auch einfach um einen überwucherten Knochen handeln, der von einem schlecht verheilten Kieferbruch herrührt.
Weitere nicht gesicherte Beispiele sind ein augenscheinlicher Wirbelsäulentumor im versteinerten Skelett eines jungen Australopithecus – einer unserer frühen Primaten-Vorfahren, der vor fast zwei Millionen Jahren in Ostafrika lebte – und ein seltsames Gewächs in einer Rippe eines 120.000 Jahre alten Neandertalers aus dem heutigen Krapina in Kroatien. Letzteres ist höchstwahrscheinlich Symptom einer nicht krebsartigen Erkrankung namens fibröse Dysplasie, bei der gesunder Knochen allmählich durch schwaches Bindegewebe ersetzt wird.
Eine eindeutigere Diagnose stammt von einem Zehenknochen aus dem südafrikanischen Swartkrans, der «Wiege der Menschheit», in der unsere Spezies vermutlich zum ersten Mal auftauchte. Obwohl es unmöglich ist, dem mehr als 1,6 Millionen Jahre alten Knochen eine genaue Menschenart zuzuweisen, gehörte er sehr wahrscheinlich zu einem unserer frühen Verwandten. Unser früher Vorfahr war offenbar von einem aggressiven Knochenkrebs betroffen, der als Osteosarkom bekannt ist, in der Regel Jugendliche trifft und weder mit Umweltfaktoren noch dem Lebensstil in Verbindung gebracht wird. Es ist bis dato der älteste bekannte identifizierbare Krebs bei einem homininen Fossil, aber das könnte sich in Zukunft ändern, wenn mehr Knochen entdeckt werden und sich die Diagnosetechniken verbessern.
Es gibt viele weitere, über die ganze Welt verteilte Beispiele für mögliche Krebsfälle aus der Urzeit. So entdeckte man einen gutartigen Tumor im 250.000 Jahre alten Kieferknochen eines erwachsenen Homo naledi, einer ausgestorbenen Art der Gattung Homo, die 2015 durch einen großen Knochenfund im Höhlensystem Rising Star in Südafrika eingeführt wurde. Es gibt einen Schädelknochen eines Homo heidelbergensis, einem Vorfahren der Neandertaler, der möglicherweise vor bis zu 350.000 Jahren an einem Hirntumor starb. Und dann ist da die Lemdubu-Frau – eine stämmige Frau mit kräftigem Kiefer, die vor etwa 18.000 Jahren in einer Höhle in Indonesien begraben wurde. Ihre Knochen sind mit Löchern übersät, die genau wie die durch metastasierenden Krebs verursachten Hohlräume aussehen. Nur schade, dass man zu alten versteinerten Skeletten keine Patientenakte bekommt, sodass wir vielleicht nie die Wahrheit über diese längst verstorbenen Seelen erfahren werden.
Hier könnten neue molekularbiologische Techniken für Fortschritte sorgen. Da die Techniken zur DNA-Erkennung empfindlicher und um einiges günstiger geworden sind, können Forscher inzwischen kleinste DNA-Fragmente aus historischen Überresten analysieren. Prominent angewendet wurde diese Methode an der Mumie des italienischen Renaissance-Herrschers Ferdinand I. von Aragon, König von Neapel, in dessen Becken sich ein außergewöhnlich gut erhaltener Tumor befand. Nach der mikroskopischen Untersuchung der geborgenen Krebszellen vermutete man, dass diese ihren Ursprung im Darm oder in der Prostata hatten. Am Ende ergaben genetische Tests, dass die Zellen eine Mutation im sogenannten KRAS-Gen aufwiesen, die bei Darmtumoren häufig, bei Prostatakrebs jedoch so gut wie unbekannt ist. So erhielt Ferdinand I. ganze fünfhundert Jahre nach seinem Tod eine genaue Diagnose.
Genetische Verfahren sind jedoch nur begrenzt einsetzbar, da sie eine DNA-Probe aus einem konservierten Organ oder aus einem bereits in den Knochen metastasierten Tumor erfordern. Hinzu kommt ein eingeschränkter Nutzen, da wir inzwischen wissen, dass offenbar auch normale Zellen «krebsartige» Mutationen enthalten können (S. 109). Alternativ lässt sich im Rahmen der «Proteomik» nach fehlerhaften Proteinmolekülen suchen, die wahrscheinlich ein zuverlässigerer Indikator für Krebs sind. Die Identifizierung von Proteinen ist technisch anspruchsvoller und teurer als die einfachere DNA-Sequenzierung, sodass die Proteom-Analyse meist den herausragenden Stücken einer paläopathologischen Sammlung vorbehalten ist. Die Kosten sinken jedoch ständig, sodass das Verfahren in Zukunft wahrscheinlich häufiger eingesetzt wird.
Der zunehmenden Verfügbarkeit von Werkzeugen steht eine begrenzte Zahl archäologischer Funde gegenüber. Statistisch perfekt ausgewogene Populationen von Skeletten lassen sich nicht herbeizaubern – man muss mit dem arbeiten, was man bekommt. Zudem gilt das 1992 von dem Anthropologen James Wood und seinen Kollegen eingeführte «osteologische Paradox», welches besagt, dass ein archäologischer Knochenfund niemals wirklich repräsentativ für die Pathologie der betreffenden Population sein kann. Dies liegt zum Teil daran, dass manche Menschen relativ plötzlich einer Krankheit erliegen, die in ihren sterblichen Überresten keine Spuren hinterlässt, und zum Teil daran, dass man den Gesundheitszustand einer Person ausschließlich zum Zeitpunkt des Todes beurteilt. Untersucht man beispielsweise das Skelett eines vor zweitausend Jahren verstorbenen fünfzehnjährigen Mädchens, erlaubt dies keinerlei Rückschlüsse auf die Gesundheit ihrer älter gewordenen Altersgenossen. Wir wissen jedoch, dass in vielen Jahrtausende alten Kulturen überall auf der Welt viele verschiedene Krebsarten gefunden wurden – darunter auch solche, die nach heutigen Maßstäben als sehr seltene Tumorarten gelten würden.
Es gibt andere, weniger greifbare Einflussfaktoren, warum Forscher in archäologischen Aufzeichnungen eher auf bestimmte Individuen und Krankheiten stoßen. Starb ein Mensch sehr plötzlich an einem schnell wachsenden Krebs, könnte dieser nie diagnostiziert worden sein und auch keine Spuren an seinen Knochen hinterlassen haben. Und selbst wenn eine Autopsie durchgeführt wurde, war Krebs doch in vielen Kulturen mit einem Stigma behaftet, da man glaubte, er sei sündhaft oder ansteckend. Daher wollten Familien möglicherweise nicht, dass die Todesursache dokumentiert wurde. Außerdem wirken sich kulturelle Traditionen rund um Tod und Bestattung darauf aus, auf welche Überreste Archäologen viele Jahre später stoßen. So bestatten manche Gesellschaften verstorbene Säuglinge in den Wänden oder Böden von Häusern. Andere trennten die Gräber für männliche und weibliche Verstorbene oder begruben Pest- oder Lepratote an einem gesonderten Ort.
Letztendlich handelt es sich um ein Zahlenproblem. Findet man in einem bestimmten Gebiet drei Skelette mit Anzeichen von Krebs, könnten dies 3 Prozent der Bewohner eines hundertköpfigen Dorfes, 0,3 Prozent einer Stadt mit tausend Einwohnern oder 10 Prozent einer Gruppe von 30 Personen sein. Es mag sein, dass Krebs in historischen und prähistorischen Populationen tatsächlich selten auftrat. Oder aber er war viel häufiger, als wir annehmen, da Wissenschaftler nicht systematisch nach entsprechenden Spuren gesucht haben. Es bleibt spannend: Womöglich bringen DNA- oder Proteinanalysen neue Hinweise, genauso wie ein methodischerer Ansatz bei der Suche nach Krebssymptomen mittels Röntgen- oder CT-Aufnahmen. Eins wird jedenfalls deutlich: Je gründlicher man nach Anzeichen auf Krebs in antiken Überresten sucht, desto mehr findet man.
Auch wenn einige der auffälligsten Beispiele für Krebs in der Antike von Mumien stammen, die grundsätzlich besser erhalten sind als andere Skelettüberreste, wissen wir immer noch nicht genau, wie gut Tumoren während des Mumifizierungsprozesses erhalten bleiben. Man kann schließlich nicht einfach ein Skalpell zücken und eine Mumie obduzieren. Um in ihr Inneres zu schauen, verlassen sich Forscher daher auf CT-Aufnahmen. Casey Kirkpatrick hat jedoch den Verdacht, dass mumifizierte Tumoren mit dieser Methode nicht immer erkennbar sind und den Forschern möglicherweise Erkrankungen entgehen. Mit ihrer Kollegin Jennifer Willoughby ersann sie daher ein ungewöhnliches Experiment.
Die beiden schlossen sich mit einer Forschungsgruppe in einem nahegelegenen Krankenhaus zusammen, die sie mit an verschiedenen Krebsarten verstorbenen Mäusen versorgten. Und dann gingen sie daran, die kleinen Tiere auf jede erdenkliche Weise zu mumifizieren. Einige landeten im Sumpf, zur Nachbildung von Moorleichen. Andere wurden in Eis eingeschlossen oder in heißem Sand begraben. Ein paar Mäusen ließen Kirkpatrick und Willoughby gar ein vollständiges altägyptisches Ritualbegräbnis angedeihen, entfernten sorgfältig ihre winzigen inneren Organe und füllten die kleinen Körper mit Natron und Naturharzen, bevor sie sie bandagierten.[2] Nach Abschluss der Mumifizierung wurden die Mäuse in ein CT-Gerät gelegt, weil die Forscherinnen sehen wollten, wie gut ihre Tumoren durch den Prozess erhalten geblieben waren. Tatsächlich zeigten sich bei allen mumifizierten Mäusen deutliche Anzeichen von Krebs, was darauf hindeutet, dass bei der CT-Untersuchung menschlicher Mumien wahrscheinlich kaum solide Tumoren übersehen werden. «Krebs ist keine moderne Krankheit», betont Kirkpatrick. «Er ist in der gesamten Menschheitsgeschichte aufgetreten. Ursachen können Karzinogene in der Umwelt, aber auch genetische Faktoren und Infektionen sein. Wir können ihm kaum entkommen. Ich finde, wir sollten die Öffentlichkeit offen darüber informieren, insbesondere wenn Krebskranke zusätzlich unter dem Gedanken leiden, dass sie ihre Erkrankung selbst verschuldet haben.»
Ob klein, ob groß
Krebs betrifft nicht nur Menschen – eine Tatsache, die mir nur allzu bewusst ist, seit Sheba, unser heißgeliebter Welsh Springer Spaniel, an Leukämie gestorben ist. Von mancher Seite wird argumentiert, es sei der künstliche Druck der Domestizierung, der Tumoren nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Haustieren auftreten lasse, und man müsse daher auch hier von einer «modernen Erkrankung» sprechen. Betrachten wir Krebs jedoch als eine unvermeidliche Folge der Vielzelligkeit, so kann nicht verwundern, wenn die Erkrankung bei sämtlichen Arten zu finden ist. Und mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen ist genau das der Fall.
Im Jahr 2014 veröffentlichten der kroatische Genetiker Tomislav Domazet-Lošo und seine Kollegen von der Universität Kiel eine verblüffende Arbeit über Tumoren bei zwei verschiedenen Arten von Süßwasserpolypen (Hydren) – den einfachsten Organismen, von denen derzeit bekannt ist, dass sie Krebs entwickeln. Die Hydra ist kaum mehr als ein Schlauch mit Tentakeln und besteht aus zwei Zellschichten, die aus drei verschiedenen Stammzellengruppen aufgebaut sind. Zwei von ihnen bilden die Innen- und Außenschicht des Röhrchens, während die dritte Gruppe aus sogenannten interstitiellen Zellen besteht, die multipotent sind und nicht nur Teile des Polypenkörpers nachbilden können, sondern auch Keimzellen hervorbringen, die schließlich zu Eiern und Spermien werden. Und eben aus diesen Stammzellen, die irgendwo auf ihrem Weg zur Eizellenbildung unterbrochen werden, wächst ein Tumor. Das gesundheitliche Befinden eines Süßwasserpolypen lässt sich schwer klären, doch hat der Krebs offenbare Auswirkungen und führt zu einem starken Abfall von Wachstumsrate und Fruchtbarkeit. Dabei haben Domazet-Lošo und sein Team die Situation in keiner Weise beeinflusst: Es gab weder genetische Eingriffe, noch wurden etwa schädliche Chemikalien ins Wasser gegeben. Die Tumoren traten spontan auf. Wenn aber nun schon ein primitiver Organismus wie ein Süßwasserpolyp Krebs entwickeln kann, wie sieht es dann bei anderen Tieren aus?
Diese Frage beschäftigt Amy Boddy, Assistenzprofessorin am Department of Anthropology der University of California in Santa Barbara, die im Bereich der «vergleichenden Onkologie» forscht: Zusammen mit ihrem Team hat sie eine beeindruckende Menge an Daten über die Tumorhäufigkeit bei einer Vielzahl von Arten zusammengetragen.
«Besonders schwer ist es, überhaupt eine geeignete Definition von Krebs zu finden, wenn man es mit so extrem unterschiedlichen Organismen zu tun hat. Wir können davon ausgehen, dass Krebs bei einem Hund oder einer Maus einem menschlichen Tumor erkennbar ähnlich ist. Aber was ist mit auffälligen Zellen in einer Muschel oder einer eigenartigen Ausbuchtung an einem Pilz? Wenn man über Konzepte von Krebs bei anderen Organismen spricht, wird einem klar, dass wir nicht viel über die Krankheit wissen», sagt Dr. Boddy. «Als wir unsere erste Übersicht zu Krebs bei den unterschiedlichsten Lebewesen schrieben, kam eine große Diskussion dazu auf, was man als Krebs einstufen sollte, denn die medizinische Definition ist stark auf den Menschen ausgerichtet.»
Bei der Bestimmung von invasivem Krebs beim Menschen kommt es darauf an, ob Tumorzellen die Basalmembran durchbrochen haben – diese ist eine dünne Schutzschicht aus molekularer «Frischhaltefolie», die unsere Gewebe und Organe umhüllt. Viele Organismen verfügen über keine solche Barriere und werden trotzdem von sich unkontrolliert vermehrenden Zellen befallen. Pflanzen entwickeln große Wucherungen, die als Gallen bekannt sind und in der Regel durch eine Infektion mit Bakterien, Viren oder Pilzen hervorgerufen werden, manchmal aber auch das Werk von Gallwespen sind. Und dann sind da noch weitere seltsame Phänomene wie die Verbänderung oder Fasziation bei Kakteen, die wir im nächsten Kapitel kennenlernen.
Tumorähnliche Massen finden sich in Rotalgen, und sogar in Pilzen hat man nicht-invasive Wucherungen entdeckt. Selbst einfache Schimmelpilze beginnen manchmal abnormal zu wachsen. Obwohl diese Geschwulste ein Symptom für eine übermäßige Zellvermehrung sind, ist es nicht ganz richtig, sie als Krebs zu bezeichnen, da die starren Zellwände und die robusten inneren Strukturen von Pilzen und Pflanzen verhindern, dass sich entartete Zellen im Organismus ausbreiten.
Richten wir den Blick auf Tiere, so taucht Krebs bei fast allen Arten auf. Eine kürzlich veröffentlichte Liste mit nachweislich von Krebs befallenen Tieren erstreckt sich über mehr als 20 Seiten. Die Aufstellung der Meerestiere, bei denen Tumoren gefunden wurden, liest sich wie die Speisekarte eines skurrilen Sushi-Restaurants: Herzmuscheln, Venusmuscheln, Krabben, Welse, Höhlenfische, Kabeljau, Korallen und Islandmuscheln. Riffbarsche, Kaiserfische, Buntbarsche und Goldfische. Stinte, Lachse, Doraden und Seedrachen … und so geht es noch lange weiter.
Tumoren treten bei Fröschen, Kröten und anderen Amphibien auf und wurden bei Reptilien wie Schlangen, Schildkröten und Eidechsen entdeckt. Viele Vogelarten zeigen Krebserkrankungen, ob es sich nun um Sittiche, Pinguine, Kakadus, Kasuaren, Rotschnabel-Pfeifgänse oder Wellensittiche handelt. Und dann ist da gar der seltsame Fall eines dreibeinigen Rotkehlchens mit einer Krebsgeschwulst im Bauch, das irgendwann im Jahr 1919 in den Besitz des Hobby-Ornithologen Henry Kelso Coale aus Chicago gelangte. Ob Erdwölfe, Wale, Wallabys, Paviane, Dachse, Bongos oder Zebras – fast alle unsere Säugetierkollegen sind von den unterschiedlichsten Krebsarten betroffen.
Wie bei den Krebsfunden in menschlichen Überresten des Altertums gibt es Hinweise darauf, dass auch der Krebs bei Tieren weit in die Vergangenheit zurückreicht.
Im Jahr 2003 durchkämmte ein Team des Northeastern Ohio Universities College of Medicine unter der Leitung von Bruce Rothschild die Museen Nordamerikas mit einem tragbaren Röntgengerät und machte Aufnahmen von mehr als 10.000 Dinosaurierknochen. Obwohl sie nur bei einer einzigen Dinosauriergruppe, den Hadrosauriern, auf Krebs stießen, fanden sie doch erstaunliche 29 Tumoren bei 97 Vertretern dieser pflanzenfressenden Entenschnabelsaurier, welche vor etwa 70 Millionen Jahren die Erde bevölkerten. Sogar im versteinerten Beinknochen einer vor etwa 240 Millionen Jahren in den Meeren der Triaszeit schwimmenden Urschildkröte entdeckten die Forscher einen Tumor. Hinweise auf Krebs zeigten sich auch bei anderen Dinosaurierarten, darunter bei einem riesigen Titanosaurus, wobei manche Beobachtungen der Studie umstritten sind.[3]
Die Untersuchungen zu Krebserkrankungen bei verschiedenen Lebewesen haben auch die beliebte, aber falsche Annahme widerlegt, dass Haie keinen Krebs bekommen. Dieser seltsame Gedanke kam in den 1970er Jahren auf, als Judah Folkman und Henry Brem von der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore feststellten, dass Knorpel, also die schützende Schicht zwischen Knochenenden, das Einwachsen neuer Blutgefäße in Tumoren verhinderte. Haie sind Knorpelfische: Ihr Skelett besteht vollständig aus Knorpel, und man vermutete daher, dass sie möglicherweise resistenter gegen Krebs sind als andere Tiere.
Laborexperimente deuteten darauf hin, dass Haiknorpel das Wachstum von Tumorblutgefäßen effektiv stoppte, zugleich scheiterten Versuche, auf chemischem Wege Tumoren bei den Tieren zu induzieren. Dass man bei keinem in freier Wildbahn lebenden Hai Krebs festgestellt hatte, schien die Theorie zu bestätigen. Und von da war es nur noch ein kurzer Weg zu der Annahme, Haiknorpel könne Krebs verhindern oder sogar heilen. Beflügelt durch die Veröffentlichung des amerikanischen Bestsellers Sharks Don’t Get Cancer von William Lane im Jahr 1992 wurde eine viele Millionen Dollar schwere Branche ins Leben gerufen. Haie wurden gefangen, gezüchtet und millionenfach abgeschlachtet, um Knorpelpillen für verzweifelte Krebspatienten herzustellen, obgleich mindestens drei klinische Studien bewiesen hatten, dass sie unwirksam waren.
Dabei stimmte schon die grundlegende Annahme nicht, denn tatsächlich wurden bei mehreren Haiarten Tumoren entdeckt, darunter auch in den mächtigen Kiefern eines Weißen Hais, der 2013 vor der Küste Australiens gesichtet wurde. In einem Artikel über diese Entdeckung schrieb der Meeresbiologe David Shiffman: «Haie bekommen Krebs. Und selbst wenn sie keinen Krebs bekämen, würde der Verzehr von Haiprodukten Krebs nicht heilen, genauso wenig wie ich durch den Verzehr von Michael Jordan ein besserer Basketballspieler würde.»
Haiknorpel wird also sehr wahrscheinlich keine Krankheiten verhindern oder heilen, doch kann der Vergleich von Krebs bei verschiedenen Arten nützliche Erkenntnisse über die Vorgänge im menschlichen Körper liefern. Richtig interessant wird es, wenn wir nicht fragen, ob ein bestimmter Tumor bei einer Tierart auftritt (was ja durchaus zu erwarten ist, wenn Krebs unweigerlich mit vielzelligen Organismen in Verbindung steht), sondern wie oft er auftritt.
Es mag überraschen, aber wir können nicht nur eindeutig feststellen, dass Krebs keine auf den Menschen begrenzte Krankheit ist, sondern auch, dass wir nicht einmal die am häufigsten betroffene Spezies sind. Die Annahme, Menschen würden häufiger an Krebs erkranken als andere Arten, ist weit verbreitet, basiert jedoch auf völlig unzureichenden Informationen. So wie wir keine Ahnung von der Krebshäufigkeit in vergangenen menschlichen Gesellschaften ohne systematische Datenerhebung haben, hat sich auch noch niemand wirklich methodisch mit der Tumorinzidenz bei verschiedenen Arten befasst.
Natürlich kann man sämtliche Arten auflisten, bei denen diese oder jene Krebsart entdeckt wurde, eine ganz andere Aufgabe aber wäre die Klärung der Frage, ob eine davon besonders selten oder häufig vorkommt. Amy Boddy und ihre Kollegen in Santa Barbara sind zu Tier-Epidemiologen geworden, die Daten aus Zoos durchforsten und so viele Informationen wie möglich über Wildpopulationen sammeln, um daraus abzuleiten, wie häufig die Krankheit bei verschiedenen Arten tatsächlich sein könnte. «Zootiere haben im Vergleich zu Tieren in freier Wildbahn eine ungewöhnlich lange Lebensspanne, und für manche verfügen wir nur über recht kleine Stichproben», räumt sie ein. «Aber unsere vorläufigen Daten deuten darauf hin, dass die Krebsrate bei kleinen Säugern im Vergleich zum Menschen recht hoch ist – wir sehen ziemlich viele Tumoren bei Frettchen, und auch kleine Mausmakis erkranken offenbar häufig an Krebs.»
Dr. Boddy erklärt, dass bei Tieren, die einen «genetischen Flaschenhals» hinter sich haben, deren Population sich also an einem bestimmten Punkt drastisch reduziert hat, offenbar mit größerer Häufigkeit Krebs auftritt. Dabei sind sich die überlebenden Individuen genetisch ähnlicher als vor dem Flaschenhals-Ereignis. Besonders auffällig ist dies bei Goldhamstern, da die Mehrheit der weltweit als Haustier gehaltenen Hamster von einem einzigen Wurf abstammt, der 1930 in der syrischen Wüste gefunden wurde. Die Tiere weisen ungewöhnlich hohe Raten spontan auftretender Tumoren auf.
Auch andere reinrassige und domestizierte Arten sind anfälliger für Krebs. Bei Hunden ist das Krebsrisiko in etwa so hoch wie bei Menschen, wobei einzelne Tumorarten bei bestimmten Rassen häufiger, bei anderen weniger häufig auftreten. Bis zu einem Drittel der Hennen in Legebetrieben erkranken aufgrund des enormen Legedrucks an Eierstockkrebs.
Auch wir Menschen sind im Laufe unserer Geschichte in prekäre Situationen geraten. Es gibt solide Belege dafür, dass die Population unserer Vorfahren vor etwa einer Million Jahren auf weniger als 20.000 fortpflanzungsfähige Individuen zusammengeschrumpft ist, was unsere Spezies an den Rand des Aussterbens brachte – dies könnte eine Rolle bei unserer heutigen Anfälligkeit für Krebs spielen.
Forscher haben zudem herausgefunden, dass Vögel und Reptilien, die ja beide von den Dinosauriern abstammen, im Vergleich zu den behaarten Vertretern im Stammbaum des Lebens weitaus seltener an Krebs erkranken. Der Grund hierfür ist derzeit ein Rätsel, Amy Boddy hat dazu aber ein paar Ideen.
«Ich vermute, es hat mit der Schwangerschaft und der Plazenta zu tun», sagt sie und erklärt, im Gegensatz zu eierlegenden Vögeln und Reptilien müssen Säugetiere die Fähigkeit haben, ein invasives Gewebe voller Blutgefäße zu erzeugen, das sich in die Gebärmutterwand einnistet und der Mutter Sauerstoff und Nährstoffe entzieht, um den wachsenden Fötus zu versorgen. Zellen aus der Plazenta und dem Fötus gelangen auch in den Blutkreislauf der Mutter und können sogar mit ihrem Körpergewebe verschmelzen – ein Prozess, der als Mikrochimärismus bekannt ist. Ein ganz ähnliches Repertoire an biologischen Tricks verwendet auch ein sich ausbreitender Krebs, und viele Tumoren kapern dieselben Gene und Moleküle wie die Fremdzellen, um im Körper Fuß zu fassen.
Eine Zeit lang nahm man an, dass mit invasiveren, also tief in das mütterliche Gewebe eindringenden Plazenten ausgestattete Säugetiere – einschließlich Menschen – anfälliger für Krebs seien als solche mit oberflächlicheren Systemen, wie Pferde oder Kühe, während das Krebsrisiko von Katzen und Hunden mit ihren schwach invasiven Plazenten irgendwo dazwischen liege. Doch nachdem Dr. Boddy und ihr Team weitere Daten von verschiedenen Arten zusammengetragen hatten, ließ sich diese Theorie nicht aufrechterhalten. Zudem fehlen noch Informationen zu den Krebsraten bei Beuteltieren ohne Plazenta, die winzige lebende Junge zur Welt bringen und in ihrer Brusttasche austragen, und auch zu eierlegenden Kloakentieren wie dem Schnabeltier gibt es keine Daten. Dennoch glaubt Amy Boddy an einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, eine Plazenta zu bilden, und einer höheren Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken.
«Ich glaube, es gibt da eine Verbindung», sagt sie und weist darauf hin, dass die Zellen des Fötus jenen der Mutter genetisch ähnlich, aber nicht mit ihnen identisch sind – eine Situation, die das Risiko birgt, eine tödliche Abstoßung durch das Immunsystem auszulösen. «Wir hätten uns auch so entwickeln können, dass alles in der Gebärmutter verschlossen bleibt, stattdessen haben wir diese invasive Plazenta entwickelt, die in jede Faser des mütterlichen Gewebes eindringt. Ich denke daher, dass es Säugetieren möglicherweise schwerfällt, Tumoren zu erkennen, die eine leicht mutierte Version von uns selbst sind.»
Groß und gefährlich?
Wenn Krebs eine unvermeidliche Folge des vielzelligen Lebens ist und wahrscheinlich in jeder Zellpopulation auftritt, dann sollte daraus eigentlich folgen, dass ein Krebsbefall umso wahrscheinlicher ist, je mehr Zellen ein Tier hat. Mehr Zellen bedeuten mehr Zellteilungen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass bei einer dieser Teilungen etwas schiefgeht. Größe bedeutet hier also auch großes Risiko, wobei sich das Problem noch verschärft, wenn Tiere sehr lange leben.
«Innerhalb einer Art ist die Krebsrate umso höher, je größer das Individuum ist – zum Beispiel haben größere und beleibtere Menschen ein höheres Risiko als kleinere, schlankere. Dasselbe gilt bei Hunden», erklärt Dr. Boddy. «Man kann dies einfach als eine Frage der Wahrscheinlichkeit betrachten, die auf eine größere Zellenzahl zurückzuführen ist, aber es könnte auch sexuelle Selektion eine Rolle spielen. Wer schnell heranwächst, erreicht früher Paarungsreife.»
Als Beispiel erzählt Amy Boddy mir von den Paarungsgewohnheiten der Spiegelkärpflinge – farbenfrohen kleinen Fischen, die in Mittelamerika beheimatet, inzwischen aber überall auf der Welt in Aquarien zu finden sind. Manche männliche Spiegelkärpflinge tragen einen Gendefekt, der sie ungewöhnlich groß und damit besonders attraktiv für Weibchen werden lässt. Leider macht die Mutation die Männchen aber zugleich anfällig für die Entwicklung von Melanomen. Bis sie einen ihre Gesundheit beeinträchtigenden Krebs entwickeln, ist es zu spät: Die ausgewachsenen Fische haben sich gepaart und ihr fehlerhaftes Gen an die nächste Generation weitergegeben.
Ähnlich verhält es sich bei den Weißwedelhirschen. Die Männchen investieren viel Zeit und Testosteron in das Wachstum eines beeindruckenden Geweihs (je größer, desto besser, zumindest nach Ansicht der Weibchen). Diese Anstrengung geht jedoch mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von raumfordernden fibrösen Tumoren einher, die in den Schädel drücken, das Gehirn schädigen und gar zum Tod führen können.
Weitet man aber den Blick, wird es merkwürdig: Es besteht offenbar ein Zusammenhang zwischen größerer Körpergröße und erhöhtem Krebsrisiko, solange man Individuen derselben Art vergleicht – doch er verschwindet, sobald man den gesamten Stammbaum des Lebens betrachtet. Die Krebsrate bei großen, langlebigen Tieren wie Walen und Elefanten liegt in etwa so hoch wie jene von kleinen, kurzlebigen Lebewesen wie Mäusen. Dies ist eine bemerkenswerte Beobachtung, wenn man bedenkt, dass ein 200 Tonnen schwerer Blauwal zehn Millionen Mal größer ist als eine 20 Gramm schwere Maus: Ein mausgroßes Stück Blauwalfleisch muss damit mindestens zehn Millionen Mal krebssicherer sein als eine Maus.
Mit einer höheren als für unsere Größe erwartbaren Krebsrate sind wir Menschen ein eindeutiger Ausreißer. Nimmt man jedoch unsere schlechten Angewohnheiten (insbesondere das Rauchen) aus der Gleichung heraus, sind wir im Vergleich zu kleineren Lebewesen offenbar bemerkenswert resistent gegen Krebs, zugleich aber viel anfälliger für die Erkrankung als die Riesen der Säugetierwelt. Die Beobachtung, dass das Krebsrisiko nicht mit der Körpergröße korreliert, ist als «Petos Paradoxon» bekannt, benannt nach dem britischen Statistiker Richard Peto, der es 1976 erstmals bemerkte. Seine Beobachtung liefert einen faszinierenden Beitrag zu der Frage, warum manche Menschen – oder andere Organismen – irgendwann in ihrem Leben an Krebs erkranken und andere nicht. Der scheinbare Widerspruch lässt sich leicht auflösen, wenn man etwas strategisch denkt.
Tiere unterscheiden sich nicht nur in ihrer Größe, sondern auch in ihrer Lebenserwartung. In der freien Natur ist eine Maus ständiger Gefahr in Form von Fressfeinden ausgesetzt und kann froh sein, wenn sie ein Jahr alt wird. Und selbst im sicheren Umfeld eines Labors werden Mäuse kaum älter als zwei Jahre. Im Gegensatz dazu erreicht der Grönlandhai – das älteste bekannte Wirbeltier – erst im hohen Alter von 150 Jahren die Geschlechtsreife. Anhand einer Datierungstechnik, die in den Augenlinsen der Tiere nach Auswirkungen der Atombombenversuche der 1950er Jahre sucht, gelangte man zu der Annahme, dass der älteste der bisher getesteten Grönlandhaie knapp 500 Jahre alt war und wohl schon durch die kalten arktischen Meere geglitten war, als Queen Elizabeth I. auf dem englischen Thron saß. Afrikanische Elefanten werden meist 60 bis 70, Meerschweinchen nur sechs bis acht Jahre alt. Die Lebenserwartung des Menschen liegt im globalen Durchschnitt bei inzwischen 70 Jahren, während die mit uns verwandten Schimpansen auf 50 Jahre kommen. Mausmakis, die sich größenmäßig am anderen Ende des Primaten-Spektrums befinden, haben eine durchschnittliche reproduktive Lebensspanne von etwa fünf Jahren, im Zoo lebende Exemplare können jedoch bis zu 15 Jahre alt werden.
Die Erklärung für Petos Paradoxon ist ein evolutionärer Kompromiss zwischen Wachstum, Langlebigkeit und Fortpflanzung. Einfach ausgedrückt: Entweder hat sich ein Lebewesen dahin entwickelt, dass es schnell lebt und jung stirbt – dann ist es nur ein paar kurze, gefährliche Jahre auf der Welt, in denen es sich so viel wie möglich fortpflanzt. Oder aber es hat sich zu einem Spätzünder entwickelt, der groß wird, eher frisst als gefressen wird und später im Leben Nachkommen hat, um die es sich lange kümmert.
Würden alle Menschen an Krebs erkranken, bevor eine Möglichkeit zur Fortpflanzung bestünde, wären wir als Spezies natürlich nicht weit gekommen. So funktioniert nun mal die natürliche Auslese. Doch es kostet viel Energie und Ressourcen, einen großen Körper über Jahrzehnte in einem gesunden, krebsfreien Zustand zu halten. Daher haben sich Arten dahin entwickelt, dass sie während ihrer – mehr oder weniger langen – Fortpflanzungsphase gesund bleiben, und erst dann an Krebs erkranken, wenn sich die Anstrengungen zur Gesunderhaltung des Körpers biologisch nicht mehr lohnen. Es ergibt daher Sinn, dass 90 Prozent aller Krebserkrankungen bei Menschen über 50 auftreten: Die Blütezeit unseres Lebens überstehen wir meist bei guter Gesundheit, sobald aber die Kinder geboren und erwachsen sind, werden die Karten neu gemischt.[4]
Ultimativ verkörpert wird die Strategie «Lebe schnell, stirb jung» von der in Australien lebenden Breitfußbeutelmaus. Im August, wenn in Down Under gerade Winter ist, paaren sich die Männchen etwa zwei Wochen lang in hektischen, bis zu vierzehn Stunden dauernden Kopulationen mit so vielen Weibchen wie möglich. Gegen Ende der Paarungszeit aber bekommen die kleinen Kerle Probleme: Ihnen fällt das Fell aus, ihre inneren Organe sind geschwächt, Infektionen haben leichtes Spiel. Innerhalb weniger Wochen sind alle Männchen tot, da sie ihre gesamte Energie in die Fortpflanzung gesteckt haben: Sie sind buchstäblich mit einem Knall verglüht.
Ihren Partnerinnen ergeht es nur wenig besser, denn die Mütter sterben in der Regel, nachdem ihre Jungen entwöhnt sind, sodass die Waisen bis zum nächsten Jahr, wenn der Zyklus von vorn losgeht, auf sich allein gestellt sind. Im Vergleich zum menschlichen Lebensstil mag diese Fortpflanzungsstrategie arg seltsam erscheinen, aus evolutionärer Sicht ist sie jedoch absolut einleuchtend. Breitfußbeutelmäuse ernähren sich von Insekten, die meist in jährlich wiederkehrenden Schwemmen auftreten. Die Paarungswut findet in der Phase des größten Nahrungsangebots statt, sodass die Weibchen gut genährt sind, wenn sie ihre Jungen säugen. Die Männchen dagegen sind kaum mehr als austauschbare Spermienlieferanten.
Am anderen Ende des Spektrums gibt es mittlerweile faszinierende Entdeckungen dazu, wie es den «Spätzündern» der Natur gelingt, Krebs so lange abzuwehren. Dank der Fortschritte in der DNA-Sequenzierung können wir inzwischen im Genom dieser Tiere stöbern und herausfinden, was sie am Leben erhält.
Ein bekanntes Beispiel für ein langlebiges, krebsresistentes Säugetier ist der Nacktmull. Die kleinen Sandgräber leben in großen Kolonien unter der afrikanischen Wüste und bauen immerfort Tunnel – und das nicht nur auf der Suche nach leckeren Pflanzenwurzeln, sondern auch zum Abwetzen ihrer lebenslang wachsenden Zähne. Abgeschirmt von der subsaharischen Sonne herrscht in ihren Höhlen konstant 30 °C, sodass sie keinerlei Anstrengung aufbringen müssen, um die allen Säugetieren gemeinsame hohe Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Nacktmulle empfinden offenbar keine Schmerzen, sie können bei gefährlich niedrigen Sauerstoffwerten überleben, werden nicht von Raubtieren belästigt und wagen sich nur selten in die sengende Sonne. Ungewöhnlich für Nagetiere ist das eusoziale Verhalten der Nacktmulle: Sexuell aktiv sind nur das einzige dominante Weibchen, die Königin der Kolonie, und eine Handvoll glücklicher Deckmännchen, während der Rest aus nicht fortpflanzungsfähigen Arbeitern besteht, die für das Graben, die Instandhaltung und die Bewachung des verschlungenen Tunnelnetzes verantwortlich sind.
Zunächst war es diese ungewöhnliche Sozialstruktur der Nacktmulle, welche die Aufmerksamkeit der Forscher weckte, bald aber machte man noch eine andere interessante Beobachtung in ihren Labor-Kolonien: Die Tiere starben einfach nicht. Im Jahr 2002 veröffentlichten New Yorker Forscher einen Bericht über einen Labor-Nacktmull, der es auf mindestens 28 Jahre gebracht hatte und damit den bisherigen Nagetier-Rekordhalter in puncto Langlebigkeit, ein 27 Jahre altes Stachelschwein, ausgestochen hatte. Dieser Rekord wurde 2010 wiederum von einem Nacktmull mit dem Spitznamen «Old Man» gebrochen, der 32 Jahre alt wurde, bevor er schließlich in die ewigen Jagdgründe einging. Die meisten Nacktmulle erreichen ein Alter von über 25. Krebserkrankungen sind bei ihnen so gut wie unbekannt: Bei mehr als tausend in Gefangenschaft gehaltenen Tieren sind nur eine Handvoll Fälle dokumentiert.
Es ist immer noch nicht ganz klar, wie Nacktmullen ein so langes und krebsfreies Leben gelingt. Vielleicht liegt es an ihrer kalorienarmen Lebensweise bei niedrigen Temperaturen, die offenbar die Produktion freier Radikale reduziert – das sind schädliche Chemikalien, die bei der Energieerzeugung in den Zellen entstehen. Ein möglicher Grund könnten aber auch veränderte Anteile an Hormonen und anderen das Zellwachstum antreibenden Molekülen sein, oder aber die polyphenolreiche vegetarische Ernährung der Tiere. Im Jahr 2013 entdeckten Wissenschaftler, dass Nacktmulle eine ungewöhnlich große Menge des «Zellklebers» Hyaluronan produzieren. Sie vermuteten, dass dies dazu beiträgt, die Verbindung und Kommunikation zwischen den Zellen zu verstärken, wodurch verhindert wird, dass diese außer Kontrolle geraten und kanzerös werden.
Bestimmte an der Energieproduktion beteiligte Gene sind bei Nacktmullen viel aktiver und in viel mehr Kopien vorhanden als bei Mäusen. Möglicherweise dämpft diese zusätzliche Dosis DNA die karzinogene Auswirkung genetischer Schäden und sorgt so dafür, dass Nacktmulle bis ins hohe Alter leistungsfähig bleiben. Und es gibt weitere wichtige Unterschiede bei den an der Reaktion auf DNA-Schäden und anderen altersbedingten Prozessen beteiligten Genen. So sind Nacktmullzellen stress- und schadensresistenter als Zellen anderer kleiner Nagetiere. Eine 2019 veröffentlichte Studie zeigte, dass Nacktmulle im Vergleich zu Mäusen zudem über ein höchst ungewöhnliches Repertoire an Immunzellen verfügen – auch das könnte dazu beitragen, dass sie so lange gesund bleiben.
Als ob das nicht genug wäre, besitzen die kleinen Sandgräber einen Schutz gegen übermäßiges Zellwachstum: Es wird ganz einfach nicht toleriert. In der Biologie gibt es ein Phänomen, das als Zellkontakthemmung bekannt ist: Die Zelle schützt gewissermaßen ihre «Distanzzone», indem die Zellvermehrung gestoppt wird, sobald es zu eng wird. Nacktmullzellen haben eine besonders ausgeprägte Zellkontakthemmung und stellen ihr Wachstum ein, sobald ihnen eine andere Zelle zu nahe kommt, wodurch jegliche Anhäufungen verhindert werden, die eine Tumorbildung ankündigen könnten.
Die den Nacktmullen ähnlichen, aber nicht mit ihnen verwandten Blindmäuse erfüllen Petos Paradoxon auf andere Weise. Obwohl diese Nagetiere etwa so groß sind wie normale Ratten, leben sie fünfmal so lange und haben eine sehr niedrige Krebsrate. Damit können sie bis zu 20 Jahre alt werden. Diese Langlebigkeit lässt sich offenbar darauf zurückführen, dass Blindmauszellen potenziell krebserregende DNA-Schäden fünfmal effizienter reparieren können als die Zellen einer normalen Ratte – eine Eigenschaft, die sich möglicherweise entwickelt hat, um die Tiere gegen die stark schwankenden Sauerstoffwerte zu wappnen, denen sie in ihren unterirdischen Höhlen ausgesetzt sind.
Noch eine andere Antwort haben Wasserschweine – diese herrlich entspannten südamerikanischen Riesenmeerschweinchen mit dem Ruf, die freundlichsten Tiere im Zoo zu sein. Ihr ungewöhnlich großer Körper ist offenbar das Ergebnis einer übermäßigen Aktivität des Hormons Insulin, das Zellwachstum und Stoffwechsel steuert. Als die Könige unter den Nagetieren müssen sie eine Möglichkeit gefunden haben, Krebs zu unterdrücken (denn wir erinnern uns: Je größer der Körper, desto mehr Zellen und desto höher das Krebsrisiko). Bei der Untersuchung des Genoms von Wasserschweinen hat sich herausgestellt, dass diese Tiere im Vergleich zu anderen Nagetieren überdurchschnittlich viele schädliche genetische Mutationen aufweisen, aber offenbar auch besonders wachsame Immunzellen haben, die entartete Zellen aufspüren und zerstören, bevor sie zu einem Tumor heranwachsen können.
Bei Elefanten ist es noch einmal eine ganz andere Geschichte. Anstatt zu versuchen, potenziell kanzeröse Schäden an ihrer DNA zu beheben oder ihr Immunsystem zu stärken, haben sie mehrere Kopien eines Gens entwickelt, das ein Molekül namens p53 kodiert. Dieses wird auch «Wächter des Genoms» genannt und veranlasst Zellen, beim ersten Anzeichen eines Defekts zum Wohle der Gesamtheit abzusterben. Angesichts der Größe von Elefanten ergibt dieses Vorgehen Sinn: Der Riese kann durchaus Zellen entbehren und fährt gut damit, sich zweifelhafter Exemplare sofort zu entledigen.
Auch mit den Genen des 100 Tonnen schweren Grönlandwals haben sich Wissenschaftler eingehend beschäftigt. Mit einer Lebenserwartung von 200 Jahren und einer relativ geringen Krebsrate ist er wohl der Topkandidat für das langlebigste Säugetier der Welt. Dieser Rekord könnte damit zusammenhängen, dass die Wale bestimmte Gene zur Reparatur von DNA-Schäden hinzugewonnen haben oder auch die Kontrolle über die Zellvermehrung perfektionieren konnten.
Die «Große Bartfledermaus», entgegen ihrem Namen ein eher winziges Tier, bringt weniger als 10 Gramm auf die Waage – ein Zehnmillionstel des Gewichts eines mächtigen Grönlandwals. Doch für ein so kleines Lebewesen lebt die Bartfledermaus erstaunlich lang: Das älteste dokumentierte Individuum wurde sage und schreibe 41 Jahre alt. Sie ist damit die Gewinnerin der Altersolympiade; doch auch alle anderen Fledermausarten haben im Vergleich zu bodennahen Nagetieren ähnlicher Größe eine ungewöhnlich lange Lebensspanne. Dass sie perfekte Flieger sind, ist hier sicherlich ein eingebauter Vorteil, denn so können sie Fressfeinden mühelos entwischen. Zugleich besitzen sie aber offenbar nützliche molekulare Anpassungen.





























