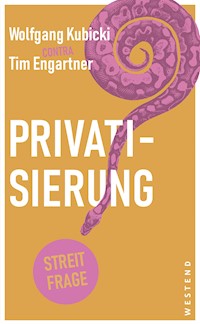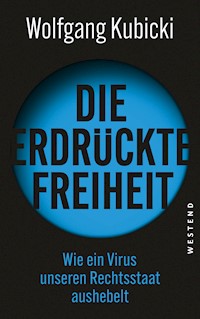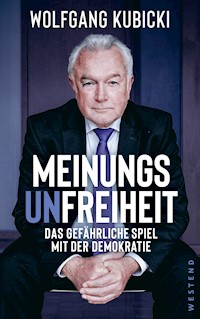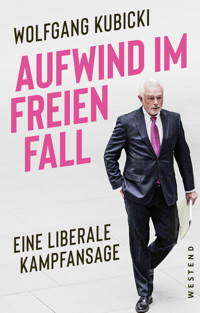
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Sprache: Deutsch
Das Erstarken der politischen Ränder, Identitätspolitik, Migration, die Einschränkungen der Meinungsfreiheit und die Corona-Politik haben das Vertrauen in die Demokratie ausgehöhlt: Wolfgang Kubicki packt die drängendsten politischen Themen unserer Zeit bei der Wurzel und zeigt schonungslos auf, welche politischen Entscheidungen zum Verlust des Freiheitsgefühls geführt haben. Sein neues Buch ist eine liberale Kampfansage, ein Aufruf zur Rückkehr zu echten demokratischen Werten und zum Kampf für die Freiheit - auch wenn sie mit unbequemen Debatten verbunden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Wolfgang Kubicki
Aufwind im freien Fall
Eine liberale Kampfansage
Impressum
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-122-4
1. Auflage 2025
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagmotiv: © Ullstein Bild / Popow Autorenfoto: © Tobias Koch
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Titelbild
1 Einleitung
2 Die demokratische Positionsbestimmung
Ein Jahrzehnt der Umwälzungen
Die Stärkung der politischen Ränder
Meinungsfreiheit im Absturz
Corona und die Demokratieabnutzung
Elitenversagen
Autoritäre Herausforderungen und die feministische Außenpolitik
Ein fetter, kein starker Staat
Die marktwirtschaftliche Absicherung unseres Gemeinwesens bröckelt
3 Die Positionsbestimmung des Liberalismus
Das schwindende Freiheitsgefühl
Problematische Konjunktur des »Wir«
Solidarität als Staatsaufgabe? – Wenn Haltung die Demokratie zerstört
Der Rauswurf der Freien Demokraten und die Ursachen
APO und das Ende der Freiheit?
4 Mut zur Freiheit
Demokraten weichen nicht
Haltung beweisen, nicht behaupten
Liberalismus ist nichts für Schwächlinge
Rückkehr zur demokratischen Ordnung
5 Die Freiheit, die ich meine
Nachwort
Anmerkungen
Navigationspunkte
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
Meine Partei hatte schon einmal einen freien Fall erlebt. Der Rauswurf aus dem Bundestag am 22. September 2013 war bis zum damaligen Zeitpunkt die schlimmste politische Niederlage der FDP seit ihrer Gründung gewesen. Das damalige parlamentarische Ende kam nicht von ungefähr, die Partei wirkte zerstritten und politisch hilflos – und der Eindruck traf zu. Es gab für die Wählerinnen und Wähler denklogisch kaum einen Grund, uns zu unterstützen. Weil viele meiner Parteifreunde nicht mit dem Ende gerechnet hatten, weil sie dachten: »Es wird schon gut gehen, wie immer«, war der Schock umso größer.
Es folgten die »Schattenjahre«, in denen man über die Landesparlamente versuchte, die bundesweite Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, Jahre, in denen die Wahlklatschen zuerst nur so einprasselten, wir aber trotz allem nicht die Nerven verlieren durften. Es war eine Phase, in der die Freiheit auch im Deutschen Bundestag keinen guten Stand mehr hatte, in der schwerwiegende politische Weichenstellungen vorgenommen und massive Fehler begangen wurden, die zu Unfreiheiten führten, mit denen die Freien Demokraten später umgehen mussten.
Nach dem freien Fall kam der Aufwind. Die Bürgerschaftswahlen in Hamburg und Bremen 2015 waren wichtige Etappen zum Wiederaufstieg. Es folgten Monate der inneren Sammlung, auch der Genugtuung. Wir waren plötzlich wieder im Spiel, medial angefragt. Man wollte die Stimme der Freiheit plötzlich hören. Der 24. September 2017 wurde ein Triumph, und wir kehrten mit 10,7 Prozent zurück in den Bundestag. Viele hatten uns diese Reise nicht zugetraut, auch manch ein Parteifreund nicht.
Der 23. Februar 2025 markiert wieder einen Wendepunkt. Wer glaubt, die FDP sei jetzt endgültig im freien Fall, unterschätzt, wie groß das Freiheitsbedürfnis in Deutschland sein kann. Doch wer glaubt, der Aufwind komme bestimmt, der hat keinen blassen Schimmer davon, wie entbehrungsreich, wie anstrengend und mental belastend vier außerparlamentarische Jahre sein können.
Aktuell stehen die Bundesrepublik Deutschland und die Freien Demokraten an einer Wegscheide. Das Land ist reformüberfällig, infrastrukturell kaputt, zu feist und international nicht mehr satisfaktionsfähig. Es gibt in der Innenpolitik Tendenzen der Unfreiheit, wenn wir etwa auf die Einschränkungen der Meinungsfreiheit schauen. Die Corona-Pandemie wirkt noch immer gesellschaftlich nach. Ökonomisch haben wir uns von Ludwig Erhards Erfolgsrezept der sozialen Marktwirtschaft de facto losgesagt.
Die Freien Demokraten sind in der Außerparlamentarischen Opposition (APO) angekommen und müssen sich wieder freischwimmen, müssen Fehler der Vergangenheit aufarbeiten und eine Zukunftsagenda entwickeln. Allen Beteiligten sollte bewusst sein, welche Reise vor uns steht.
Es wird Zeit, eine Positionsbestimmung vorzunehmen, für das Land und für den politischen Liberalismus. Dies ist mein Beitrag dazu – eine liberale Kampfansage.
Ich werde mich zuerst in Kapitel 2 der Frage widmen, wie es um unsere Demokratie bestellt ist. Die wichtigsten Themen – als Beispiele Migrationspolitik, Meinungsfreiheit, Corona-Nachlauf oder auch unsere Außenpolitik – möchte ich daraufhin abklopfen, ob die Politik in den vergangenen Jahren das Beste aus unserem Land gemacht hat. Einen besonderen Blick werde ich dabei auf die Wirkung unserer Eliten aus Politik, Kirche oder Justiz richten. Ich habe nicht vor, hierbei irgendjemanden vor Kritik zu verschonen. Denn ich bin der Überzeugung, dass es nur mit einer rückhaltlosen Analyse möglich ist, künftig Fehler auch im Umgang mit politischen Extremismen zu vermeiden und wieder eine Stärkung der Resilienz unseres Gemeinwesens anzugehen. Dass sich unsere demokratische Kultur aktuell nicht von ihrer besten Seite zeigt, dass sie die Bindung zu relevanten Teilen der Gesellschaft verloren hat, ist ebenso unstrittig wie besorgniserregend.
Anschließend nehme ich in Kapitel 3 eine liberale Positionsbestimmung vor. Das Freiheitsgefühl der Menschen hat in den vergangenen Jahren massiv gelitten. Wer glaubt, dass ein demokratisches Gemeinwesen das einfach so wegsteckt, irrt. Wir befinden uns in einer problematischen Phase der Freiheit, wie wir sie immer geschätzt und verteidigt haben. Corona hat eine massive Veränderung auch des juristischen Blickes auf die individuelle Freiheit bewirkt und einen Trend zu kollektiveren Auslegungen des Grundgesetzes befördert. In diesem Kapitel wende ich mich außerdem dem Rauswurf der Freien Demokraten aus dem Bundestag zu und beantworte die Frage, wie ihre Rolle in der APO aussehen wird.
In Kapitel 4 gehe ich darauf ein, welche zentralen Antworten die FDP geben muss, wenn sie die vier langen Schattenjahre überstehen will. Sie wird Mut brauchen, aber auch einen klaren inneren Kompass und den unbedingten Willen, im Zweifel Gegenwind auszuhalten. Sie muss Haltung beweisen, nicht behaupten, und auf eine Rückkehr zu demokratischen Grundregeln – generell, zur demokratischen Ordnung – pochen. Hier wird sich in der nächsten Zeit ein weites Feld für den politischen Liberalismus öffnen. Dieses müssen wir beackern.
Schließlich benenne ich in Kapitel 5 die Freiheit, die ich meine. Unbedingte Freiheit war die Antwort nach der Katastrophe. Unbedingte Freiheit bleibt die Antwort, um künftige Katastrophen zu verhindern.
2Die demokratische Positionsbestimmung
Ein Jahrzehnt der Umwälzungen
Kommen wir gleich zur Sache. Eines der größten Themen der vergangenen Jahre ist zweifellos die Migrationspolitik. Nach der anfänglichen Euphorie, die damals selbst die Bild-Zeitung erfasste, mit jubelnden Teddybär-Empfangskomitees an Bahnhöfen und Selfies von Angela Merkel, trat alsbald die Ernüchterung ein. Jetzt, ein Jahrzehnt nach dem September 2015, stehen wir vor einem riesigen politischen Scherbenhaufen. Das »Wir schaffen das« der damaligen Kanzlerin hat sich als viel zu lange hochgehaltene Lebenslüge der bundesdeutschen Politik entpuppt. Der offen präsentierte politische Optimismus traf zu oft auf eine gesellschaftliche Stimmungslage, die ins komplette Gegenteil lief. Tatsächlich müssen wir nach zehn Jahren sachlich festhalten: Wir haben »das« leider nicht geschafft – die jeweils regierenden politischen Kräfte aber auch keinen wirklichen Versuch unternommen.
Wagen wir zunächst die Rückblende. Im September 2015 war ich stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Landtag von Schleswig-Holstein. Die Freien Demokraten befanden sich nach dem bitteren Rauswurf aus dem Deutschen Bundestag nun schon zwei Jahre in der APO und hatten bundespolitisch bedauerlicherweise nicht allzu viel zu melden.
Vielleicht war es der von der Berliner Blase unbeeindruckte Blick aus der Provinz, der es leichter machte, sich die kommende Entwicklung vorzustellen. Denn was sich da an Umwälzungen anbahnte, konnte man eigentlich ohne hellseherische Fähigkeiten absehen. Ich werde nie vergessen, wie ich mich auf meiner morgendlichen Fahrt zum Kieler Landtag mit Hunderten weit gereisten Menschen konfrontiert sah, die entlang der Kiellinie zu Fuß unterwegs waren. Sie wollten offensichtlich eine der Fähren erreichen und sich über den Seeweg nach Schweden durchschlagen. Es kamen Assoziationen mangelnder staatlicher Kontrolle auf, die ich so aus Deutschland nicht kannte – auch wenn wir in der Vergangenheit schon einige Flüchtlingsbewegungen aufzufangen hatten.
Ebenso unglaublich war für mich der behördliche Umgang mit diesem sich aufbauenden Problem. So definierte man plötzlich zweierlei Recht. Im Oktober 2015 beispielsweise wurde die Kieler Polizei angewiesen, Flüchtlinge ohne Ausweispapiere oder behördliche Registrierung bei einfachen Delikten wie Ladendiebstahl oder Sachbeschädigung nicht strafrechtlich zu verfolgen.1
Man setzte Regeln außer Kraft, die vorher unverrückbar gewesen waren. Als ich im Landtag fragte, warum die Vorgaben in der Landesbauordnung nun auf einmal für Flüchtlingsunterkünfte herabgesenkt werden konnten, während man vorher stets auf die höchste Regelungsdichte gepocht hatte, lautete die Antwort: »Aber es geht doch um Menschen.« Ich entgegnete: »Okay, aber worum ging es denn vorher?«
Auch an anderen Stellen erlebten wir vorher Unvorstellbares: Die Redaktion der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY« plante etwa, einen Beitrag für die September-Ausgabe über die Vergewaltigung einer jungen Frau zunächst nicht auszustrahlen, weil der mutmaßliche Täter dunkelhäutig war und dies die Flüchtlingsdiskussion angeblich nur unnötig anfachen würde.2
Die Eigeninitiative, die viele Menschen im Land an den Tag legten, um den Flüchtlingen vor Ort zu helfen, rührte und begeisterte mich. Bei dem Gedanken »Wir fragen nicht nach dem Staat, sondern gehen im Zweifel selbst voran, um Hilfe zu leisten«, geht einem Liberalen naturgemäß das Herz auf. Ohne das gewaltige ehrenamtliche Engagement der ersten Monate wären die Behörden und Organisationen deutlich schneller an ihre Kapazitätsgrenzen geraten. Trotzdem kam es natürlich zu mannigfachen Überforderungssituationen, die mit einer Relativierung unserer Rechtsordnung einhergingen. Menschlich ist es nachvollziehbar, dass man im Notfall einmal fünfe gerade sein lässt. Für einen Rechtsstaat darf eine Ausnahmesituation aber nur von begrenzter Dauer sein, sonst zerbröselt allmählich sein Fundament.
Unter dem Eindruck der wilden Herbsttage des Jahres 2015 schrieb ich für das Handelsblatt einen Gastbeitrag zur Flüchtlingskrise.3 Darin sagte ich: »Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass in unserem Land Unterdrückung von und Gewalt gegen Frauen, Antisemitismus sowie Homophobie keinen Platz haben. In einigen Ländern, aus denen aktuell viele Flüchtlinge kommen, ist dies keine Selbstverständlichkeit.« Mit Blick auf die Geltungskraft unserer Werte und Normen warnte ich außerdem: »Wenn wir aus einer falsch verstandenen Gutmütigkeit diese Regeln relativieren, werden wir rasch die Diffusion des Rechtsstaates und unserer freien Gesellschaft miterleben. Es vergiftet die offene und vorurteilsfreie Debatte, wenn das Ansprechen von Problemen unterbleiben soll, damit den Rechtsradikalen nicht Vorschub geleistet wird. Vielmehr ist die Verhinderung einer offenen Diskussion über Schwierigkeiten mit der Integration von derzeit etwa einer Million Menschen pro Jahr der Humus, auf dem die tumben Parolen des braunen Mobs erst gedeihen können.«
Blicken wir wieder zurück in die Gegenwart, so müssen wir leider feststellen, dass dies genau so eingetreten ist. Die AfD, die im August 2015 in bundesweiten Umfragen noch bei 3 Prozent herumdümpelte, schoss mit der Krise in die Höhe und bekam bei der Bundestagswahl 2025 schließlich die zweitmeisten Stimmen. Dies geschah nicht, weil Union und FDP in der Migrationspolitik angeblich »rechte Narrative« verbreitet hätten, sondern weil in den vergangenen zehn Jahren viel zu viel laufengelassen, ignoriert, zum Teil aktiv verschleppt wurde. Und weil die öffentliche Debatte zur Flüchtlingsfrage sowohl im linken politischen Spektrum als auch im Journalismus4 oft dazu verwendet wurde, kritische Stimmen als rückständig, herzlos oder »irgendwie Nazi« zu diskreditieren. Die Weigerung, sich zunächst einer vorurteilsfreien Betrachtung der Lage und anschließend einer vernunftorientierten Lösung des Problems zu nähern, hatte die Abwendung vieler Wählerinnen und Wähler von Union, SPD, Grünen und FDP zur Folge. Nicht die AfD ist schuld, wenn sie bei demokratischen Wahlen gewählt wird, sondern das offensichtlich zu wenig attraktive Angebot der anderen Parteien. Es wäre besser, wenn alle Beteiligten wieder akzeptieren könnten, dass manchmal auch eine bittere Erkenntnis der Wahrheit entspricht.
Meine Prognose, dass die hohen Zustromzahlen Auswirkungen auf die Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen, Juden und Homosexuellen haben werden, hat sich in der Rückschau leider ebenfalls bestätigt. Ein paar Zahlen veranschaulichen dies: Nach einer Auswertung der Neuen Zürcher Zeitung waren Asylmigranten im Bereich »Vergewaltigung und sexuelle Nötigung« deutlich überrepräsentiert. Im Jahr 2021 beispielsweise lag ihr Anteil in diesem Deliktsfeld bei 13,1 Prozent – bei einem Bevölkerungsanteil von gerade einmal 2,5 Prozent.5 Eine Datenanalyse des WDR aus dem Jahr 2024 ergab, dass die ausländischen Verdächtigen bei Sexualdelikten nicht aus Japan oder Australien, sondern hauptsächlich aus Syrien, der Türkei, Afghanistan und dem Irak kamen – und stellte ebenfalls fest: »In vielen Fällen sind zudem Tatverdächtige aus muslimisch geprägten Ländern stark überrepräsentiert. Dazu zählen Tatverdächtige aus dem Iran, dem Kosovo, Marokko oder Pakistan.«6 Sogar der Bundespräsident erkannte im März 2025 einen Trend zu Frauenfeindlichkeit und »maskuliner Energie« – allerdings ersparte er der verunsicherten Öffentlichkeit die Nennung der Ursachen.7
Seit dem 7. Oktober 2023, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, haben die islamistischen Angriffe auf Juden in Deutschland massiv zugenommen.8 Der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peyman Engel, stellte fest: »Das Land ist für Juden nicht mehr sicher. Wenn es um Terror geht, ist der Rechtsextremismus ganz klar die größere Gefahr. Die alltäglichen verbalen und körperlichen Angriffe kommen allerdings nach Wahrnehmung vieler Juden größtenteils aus dem muslimisch geprägten Milieu.«9
Auch für Schwule ist die Welt mittlerweile eine andere. Bereits im Sommer 2023 berichtete der Tagesspiegel von einer Zunahme homophober Attacken in Berlin; zwischen 2018 und 2021 hätten sich diese gar verdoppelt, so das Blatt.10 Ein von der Zeitung befragtes Pärchen erklärte, es plane, wegen der Intensivierung der Bedrohungen sein Heimatviertel Neukölln zu verlassen. In der Regel, so stellten es die Opfer dar, hätten die Angreifer einen arabischen Migrationshintergrund.11 Wen wundert es da noch, dass die AfD im Februar 2025 in einer Umfrage auf einer Schwulen-Plattform die mit Abstand meisten Stimmen bekam?12
Kaum jemand aus der SPD sprang Kevin Kühnert öffentlich zur Seite, als er in einem Spiegel-Interview von homophoben Anfeindungen aus »muslimisch gelesenen Männergruppen« berichtete.13 Das Gegenteil war die Regel: Sein Parteigenosse, der Queer-Beauftragte Berlins, beispielsweise griff ihn stattdessen an und sprach von »antimuslimischem Rassismus«.14
Diese kleine Episode aus der internen Diskussion einer Regierungspartei – die seit 1998 mit Ausnahme von nur vier Jahren dieses Land regiert – zeigt allzu deutlich, woran die Migrationspolitik der vergangenen Jahre krankt: Wenn man einerseits Weltoffenheit und Toleranz wie eine Monstranz vor sich herträgt, andererseits aber Abweichungen von der eigenen Meinung als »rechts« oder »Nazi« abqualifiziert, dann ist das weder rational noch lösungsorientiert. Das Gleiche gilt, wenn man Freiheits-, Frauen- und Schwulenrechte lautstark gegen eine vermeintlich feindliche Kultur der »alten weißen Männer« verteidigt, aber wegschaut oder peinlich berührt schweigt, wenn Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen in genau diesen Bereichen für erhebliche Schwierigkeiten sorgen. Das Ignorieren und Schönreden von offenkundigen Problemen ausgerechnet in denjenigen politischen Feldern, die man als die eigene Domäne reklamiert, schadet auf Dauer dem Gemeinwesen. Die Sozialdemokratie trägt eine große Verantwortung am Niedergang der Freiheit in diesem Land.
Doch das sind nicht die einzigen Probleme, die sich in einem Jahrzehnt aufgetürmt haben: Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist die Gewaltkriminalität in den vergangenen zehn Jahren um 20 Prozent gestiegen. Die Kriminalstatistik des Jahres 2024 wies aus: 41,8 Prozent der Tatverdächtigen hatten keinen deutschen Pass, die meisten von ihnen stammten aus Syrien, der Türkei, Rumänien und dem Irak. In NRW liegt der Migrantenanteil an der Bevölkerung übrigens bei 16,1 Prozent.15
Oftmals findet die Gewalt mittlerweile mit dem Tatwerkzeug Messer statt. Allein in den ersten zwei Monaten des Jahres 2025 wurden in Deutschland 311 Taten mit Verwundeten polizeilich gemeldet16 – rechnerisch mehr als fünf Messerverletzte pro Tag. Auch hier sind Ausländer statistisch deutlich überrepräsentiert: Die Tathäufigkeit liegt dort bis zu 6,5-mal höher als bei deutschen Staatsangehörigen.17 Stefan Luft, Migrationsforscher am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Bremen, stellte fest, dass der Anstieg von Gewalttaten »völlig klar« auf die gestiegene Zuwanderung zurückgehe. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Gewaltbelastung zurückgegangen, durch die verstärkte Zuwanderung sei sie wieder merklich angestiegen. Und wörtlich: »Es ist belegt, dass die Bereitschaft in muslimischen Familien deutlich höher ist, Konflikte mit Gewalt zu lösen.«18
Wir können ein bestimmtes Täterprofil für gewisse Deliktsfelder also sehr klar zeichnen: jung, männlich und Zuwanderungsgeschichte mit muslimischem Hintergrund. Dies geht auch aus dem Bundeslagebild 2023 des Bundeskriminalamtes »Kriminalität im Kontext von Zuwanderung« hervor. Auffällig ist dabei die Auflistung der »Staatsangehörigkeiten mit vergleichsweise hohem Tatverdächtigenanteil«: Bei einem Anteil von jeweils lediglich 0,2 Prozent der in Deutschland aufhältigen Geflüchteten machen zum Beispiel Tunesier 2,4 Prozent, Marokkaner 2,9 Prozent und Algerier 3,6 Prozent der Gesamtsumme der zugewanderten Tatverdächtigen aus.19 Bei allen handelt es sich um Nationalitäten mit einer sehr geringen Asyl-Anerkennungsquote aus Ländern, in denen viele Deutsche jedes Jahr Urlaub machen. Es lässt sich eindeutig mit Zahlen belegen, dass das jahrelange Hintertreiben der Grünen in Sachen »sichere Herkunftsländer« allein bei den Maghreb-Staaten zu vielen Opfern in Deutschland geführt hat. Auch die grüne Partei trägt eine große Verantwortung für das Schrumpfen der Sicherheit und Freiheit im Land.
Aber wie lauten nun die Lösungsvorschläge der politischen Entscheidungsträger abseits der Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten? Auffällig ist zunächst, dass die bundespolitische Ebene hauptsächlich nur nach jedem medial verbreiteten Mordanschlag – sei es Solingen, sei es Magdeburg, sei es München – ins Handeln kommt, um dann kopflosen Aktionismus an den Tag zu legen. Ausweitung der Messerverbotszonen oder Einrichtung einer »Task Force Islamismusprävention« durch die Bundesinnenministerin:20 Solche Maßnahmen simulieren Handlungsfähigkeit, gehen aber völlig am Kern vorbei und führen am Ende zu Enttäuschung bei den Bürgerinnen und Bürgern, denen jedes Mal hoch und heilig versprochen wird, diese Entscheidungen würden die Sicherheit dramatisch erhöhen. Wenn die politische Ebene sich in der zentralen Freiheitsfrage nur noch zu symbolpolitischen Akten durchringen kann, dann müssen wir uns über den Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen nicht wundern.
Wer wirklich glaubt, dass Messerverbotszonen geeignet sind, diesem Problem abzuhelfen, der sollte sich lieber nicht so viel auf sein Entscheidungsvermögen einbilden. Ich hoffe nicht, dass sich jemand im Bundesinnenministerium ernsthaft vorgestellt hat, dass sich potenzielle Täter bei der Aussicht darauf, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, von einer Straftat abhalten lassen.21 Was wir statt der versprochenen Sicherheit bekommen haben, war jedoch dies: die Möglichkeit, auf dem Weihnachtsmarkt auch die Handtasche von Oma Erna behördlich zu durchsuchen – mit allen negativen Konsequenzen für das Freiheitsgefühl der rechtschaffenen Menschen. Wir haben also nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Freiheit bekommen. Das ist ein schlechter Deal.
Dass sich Innenministerin Faeser hauptsächlich auf den islamistischen Terrorismus konzentrierte, erscheint nur vordergründig plausibel. Denn eigentlich lenken ihre ministeriellen Gesprächskreise von der Gewalt ab, die täglich auf deutschen Straßen, in Zügen und Hinterhöfen zu sehen ist. Zwischen 2015 und 2024 gab es lediglich acht islamistische Anschläge mit Toten in Deutschland22 – dankenswerterweise wurden auch einige durch die Sicherheitsbehörden verhindert. Aber die grausamen Taten von Bad Oeynhausen, Brokstedt, Magdeburg oder Aschaffenburg wurden eben nicht dem islamistischen Terrorismus zugeschrieben. Hier bleibt die »Task Force Islamismusprävention« blind.
Gemein haben diese Fälle, dass sie zum Teil auf haarsträubendes Behörden- oder Staatsversagen zurückgehen. Doch weder in Bad Oeynhausen, wo der Täter schon eine lange kriminelle Karriere hinter sich hatte, weder in Brokstedt, wo wichtige Informationen über den Täter in der Bürokratie untergegangen waren, weder in Magdeburg, wo der Täter bereits in stattlichem Umfang die Bekanntschaft der Polizei gemacht hatte, noch in Aschaffenburg, wo aufgrund von Behördenversagen keine Abschiebung des Täters möglich war, wurde politische Verantwortung übernommen.
Bei keinem dieser Fälle folgte ein Rücktritt, nicht einmal eine Entschuldigung der politisch Verantwortlichen für die skandalösen Fehler des Staates. Wie verantwortungsvergessen, wie herzlos kann ein Gemeinwesen sein, wenn niemand für offenkundige Fehler geradesteht? Was ist ein demokratisches Gefüge wert, das bei solchen Pannen keine politische Verantwortung kennt? Denn ein Rücktritt bedeutet schließlich auch: Wir erkennen, dass es besser werden muss, dass keine Fehler mehr passieren dürfen.