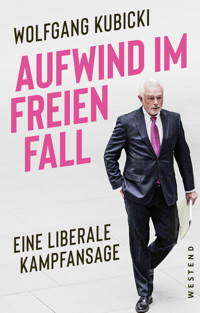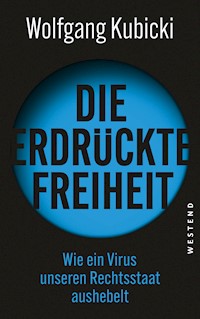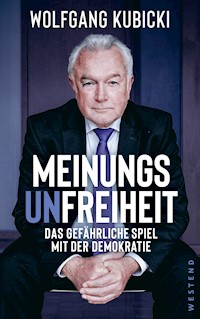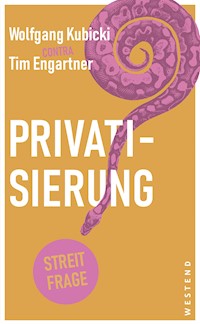
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Streitfragen
- Sprache: Deutsch
Privatisierung – Optimierung oder Entmenschlichung? Zwei diametrale Positionen zu einer der wichtigsten Fragen der Gegenwart: Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, ist davon überzeugt, dass Privatisierung ökonomische Höchstleistung hervorbringt und der Markt am besten weiß, wie er sich - und damit unser aller Wohlstand - erhält und außerdem durch ein Zurückdrangen des Staates für mehr Bürgernähe sorgt. Der Sozialwissenschaftler Tim Engartner warnt hingegen vor den Gefahren der Privatisierung, das die ausschließliche Konzentration auf Profit unweigerlich dazu führt, dass soziale Fragen ausgeklammert und der staatlichen Kontrolle entzogen werden, weshalb sich der Neoliberalismus bis in die letzten Winkel unseres Lebens ausbreiten kann. Wer sich eine kritische und fundierte Meinung zu den drängenden Fragen unserer Zeit bilden will, kommt an der Reihe »Streitfragen« nicht vorbei!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ebook Edition
Wolfgang Kubicki
Tim Engartner
Privatisierung?
Herausgegeben von Lea Mara Eßer
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-86489-896-9
Streitfragen
Originalausgabe
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2022
Motiv: Westend Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Umschlag: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Titel
Vorbemerkungen
Wolfgang Kubicki: Privatisierung heißt Innovation
Bittere Erfahrungen
Kapitalistische Leuchttürme
Ein genauer Blick auf die Ursachen ist nötig
Wie alles begann …
Privatisierungen sollten keine Lückenfüller sein
Privatisierungen müssen gut durchdacht sein
Vom Bittsteller zum König
Stetige Verbesserungen
Fliegen für alle
Revolutionäre Innovationsschübe
Tim Engartner: Renaissance des Staates für die Menschen
Der Staat und das Silicon Valley
Sozialisierung der Kosten, Privatisierung der Gewinne
Verwandeltes Staatsverständnis durch die Coronapandemie?
Welchen und wie viel Staat brauchen wir?
Märkte sind soziale Konstruktionen
Privatisierung und ihre Folgen
»Man kann seinen Urlaub stornieren, aber nicht seine Krankheit zurückgeben«
Düstere Privatisierungsbilanz
Der Staat als Geisel
Wohnungen als Ware
Zusammenhänge offenlegen
Symptombehandlung statt Ursachenbeseitigung
Zeitgeist und Lobbyismus als Treiber von Privatisierungen
Stille Einflussnahme durch »Deep Lobbying«
Lehren aus multiplen Krisen?
Zeitenwenden brauchen Mehrheiten
Anmerkungen
Orientierungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Wir fangen etwas an; wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. […] Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass dieses Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, in einem – schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen – Vertrauen auf das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man es nicht.
Hannah Arendt
Vorbemerkungen
Dies ist der Versuch, Sie in die Frage zu verführen. Das Bild der Schlange, das Sie auf dem Titel sehen, ist keineswegs Zufall: In der Genesis ist sie es, die die Frage in die Welt bringt, die dazu verführt, das Selbstverständliche zu prüfen, dazu, sich ein ganz eigenes Urteil zu bilden. Auf diesem Weg bringt sie zugleich die Gefahr dieses Fragens in die Welt, denn zu fragen heißt immer, dem allzu Selbstverständlichen seine vermeintliche Alternativlosigkeit – und somit die darin liegende trügerische Sicherheit – zu nehmen.
Die Reihe Streitfragen stellt umstrittene Themen und Debatten zur Diskussion. Sie möchte Lust am Selberdenken und dem Entwerfen einer eigenen Position wecken wie auch das offene Gespräch verteidigen. Es ist ein großes Gut und Zeichen von Freiheit, dass es andere Standpunkte gibt, die den eigenen in Frage stellen. Nur so können Gedanken sich formen und umformen, nur so kann Neues entstehen, kann Gesellschaft wachsen und sich entwickeln.
Woran es unserer Zeit nicht mangelt, sind Formate des Streits, die in Lager einteilen und Kontrahenten in die Arena treten lassen. Diese Art der Debatte befördert eine Vertiefung und Verfestigung nicht mehr übertretbarer Frontlinien, sie zieht diese sogar oftmals erst. Auf diese Weise wird zur Linie verkürzt, was Gesellschaft und Öffentlichkeit einzig ermöglicht, nämlich der gemeinsame Raum des Gesprächs. Eine vielstimmige Gesellschaft ist aber weder selbstverständlich noch natürlich, sie bildet sich einzig im Dialog und endet, sobald ein solcher nicht mehr möglich ist, sobald es nur noch darum geht, den anderen mit allen Mitteln zu übertrumpfen, sobald Debatte zum Wettkampfspektakel verkommt.
Diese Reihe möchte dem entgegenwirken. Bei dem hier ausgetragenen Streit soll es nicht um Angriff und Verteidigung gehen, sondern darum, beiden Standpunkten ausreichend Platz zur Entfaltung zu lassen. Aus diesem Grund werden beide Beiträge ohne Kenntnis des jeweils anderen verfasst, und damit ohne dem (unterschwelligen) Zwang zu unterliegen, sich für seine eigene Position rechtfertigen zu müssen.
Nach der Lektüre sollen sich beide Standpunkte erheben wie die Teile eines Vorhangs und so den Platz eröffnen, der Ihren Gedanken, Ihrer Meinung zukommt. Der so entstehende Zwischenraum für eine eigeneSichtweise ist es, der eine lebendige Gesellschaft hervorbringt: die Leerstelle, die offene Frage, die auffordert zu Austausch, Diskussion und Überprüfung der eigenen Überzeugungen.
Lea Mara Eßer, Frankfurt am Main 2023
Wolfgang Kubicki: Privatisierung heißt Innovation
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Geschäfte macht. Kein Hund würde einen Knochen gegen ein Stück Wurst eintauschen.
Adam Smith
»Das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren.«1 Mit dieser schnöden Feststellung beginnt die Paragrafenabfolge des umfangreichsten Privatisierungsvorhabens der deutschen Geschichte. Das noch von der Volkskammer beschlossene Treuhandgesetz vom 1. Juli 1990, genauer: das »Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens« war laut Eingangsformel »[g]etragen von der Absicht, die unternehmerische Tätigkeit des Staates durch Privatisierung so rasch und so weit wie möglich zurückzuführen« sowie »die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen herzustellen und somit Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen«.2
Dies sollte nun gelingen, indem jahrzehntelange Staatswirtschaft unversehens in die Marktwirtschaft überführt wurde – und zwar innerhalb einer möglichst kurzen Zeit. Dieses Projekt stellte sich als vorher ungekannte Herausforderung heraus, die eigentlich in dieser Form nicht zu bewältigen war: Zu stark wirkte der Wettbewerbsschock, mit dem sich viele volkseigene Betriebe konfrontiert sahen. Es wurde offenbar, wie wenig man nach den Zeiten der fünfjahresgeplanten Misswirtschaft für die Auseinandersetzung mit der internationalen Konkurrenz gewappnet war.
Ob wir über die Genussmittel-, die Elektroindustrie – ja, eigentlich über die allermeisten anderen Zweige der DDR-Wirtschaft sprechen: Der Wunsch, unzeitgemäße, teure Technik und Güter zu erwerben, war im deutschen Westen oder im Ausland verständlicherweise recht gering ausgeprägt. Auch in Deutschlands Osten selbst setzte man sich jetzt eher in rostige Gebrauchtwagen aus den Häusern Opel, Audi und Volkswagen als in die technisch wenig satisfaktionsfähigen Trabanten oder Wartburgs. Bedenken wir, dass das DDR-Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt nur gut ein Viertel dessen betrug, was westdeutsche Arbeitnehmer zur gleichen Zeit erwirtschafteten, dann konnte die Herkulesaufgabe der neu gegründeten Treuhandanstalt nicht gerade als vergnügungssteuerpflichtig gelten.
Bittere Erfahrungen
Die sichtbaren Folgen dieser größten Privatisierungsaktion waren Massenarbeitslosigkeit, das ökonomische Abrutschen großer Teile der ostdeutschen Bevölkerung, Perspektivlosigkeit sowie gesellschaftliche Frustrationen und Friktionen, die sich alsbald auch in Fremdenfeindlichkeit widerspiegelten. Viele Menschen verloren den Halt, wurden Entwurzelte im eigenen Land. Ganze Lebenswelten brachen weg. In Traditionsbetrieben machte man das Licht aus. Das Management des übernommenen DDR-Erbes war für Millionen von Menschen die erste bittere Erfahrung mit dem Kapitalismus und mit Privatisierungen. Der Glanz der D-Mark, das zentrale Hoffnungssymbol für die westliche Freiheit, verblasste bald. Rasch schnellte die Arbeitslosenquote in den neuen Ländern auf rund 15, bis Anfang des neuen Jahrtausends im Schnitt gar auf über 20 Prozent.3 Wer konnte, floh. Wer blieb, durfte sich auf schwere Jahre in einer – verständlicherweise – weit verbreiteten Trübsal einrichten. Für viele Menschen schien das übergestülpte westliche System lange Schatten auf den Osten des Landes zu werfen. Noch heute geben die Wahlergebnisse beredte Auskunft darüber, wie anders sich diese Landstriche und die Mentalitäten in vier Jahrzehnten entwickelt haben.
Schon sehr früh wurde offensichtlich, dass weder das treuhänderische Ziel der Privatisierungen, »Arbeitsplätze zu sichern«, geschweige denn »neue zu schaffen«, wie erhofft erreichbar war. Im Angesicht der Tatsache, dass es 1989/90 neben all den genannten Problemen in der DDR-Industrie dort auch noch einen geschätzten Personalüberhang von 15 Prozent gab, waren soziale Spannungen vorprogrammiert. Die »Treuhand« wurde für viele zum Inbegriff des Bösen. Es war wenig verwunderlich, dass es nach dem RAF-Mord an Detlev Karsten Rohwedder viele Anläufe brauchte, um eine Nachfolgerin für den unbeliebten Chefposten zu gewinnen.
Kapitalistische Leuchttürme
Im sesselbequemen historischen Rückblick ist für das Privatisierungsmammutprojekt allerdings ebenfalls die milde Feststellung treffend: »Es war nicht alles schlecht.« Denn bestimmte Filetstücke fanden durchaus interessierte Abnehmer: Jenoptik, einige Ostsee-Werften oder auch eisenhüttenstädtischer Stahl zählen heute zu den seltenen Überlebenden. Was marktgängig war, hatte jede Möglichkeit zu prosperieren, für Arbeit und regionalen Wohlstand zu sorgen. Prächtige kapitalistische Leuchttürme entstanden auf diesem antikapitalistischen Humus.