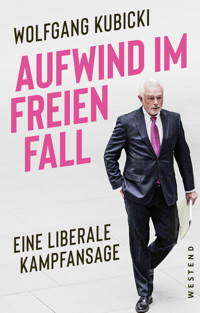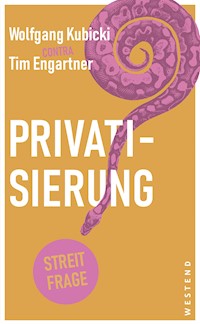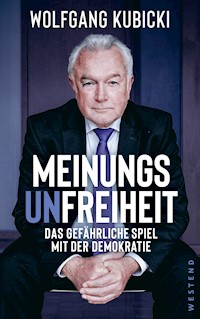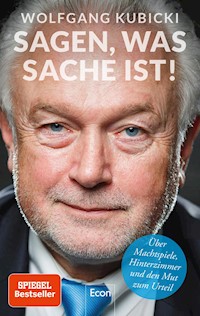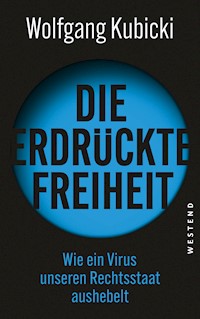
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit der Corona-Pandemie wurden die schwersten Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Bundesrepublik vorgenommen. Freiheitsrechte gerieten nicht nur durch politische Entscheidungen, sondern auch durch eine große gesellschaftliche Verunsicherung unter Druck. WOLFGANG KUBICKI will sich der Frage widmen, wieso die Idee der Freiheit so schnell in Verruf geraten konnte, und welche Rolle die Politik, Medien und Gesellschaft in diesem Prozess gespielt haben. Er ruft dazu auf, die Grundlagen unseres Gemeinwesens nicht leichtfertig über Bord zu werfen, sondern gerade in der Krise auf die Stärke unserer verfassungsmäßigen Ordnung zu setzen. Er wehrt sich gegen Moralismus, Angstmache und Ausgrenzung und plädiert für eine mutige und offene Auseinandersetzung über den besseren Weg. Denn nur eine Gesellschaft, die die Idee der Freiheit im Herzen trage, könne so große Herausforderungen wie eine Pandemie wirklich bewältigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ebook Edition
Wolfgang Kubicki
Die erdrückte Freiheit
Wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-826-6
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2021,
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
1Einleitung
2Wert der Verfassung und der Grundrechte
Wozu braucht es eigentlich eine Verfassung?
Es gehört gewissermaßen zum Standardrepertoire der Veranstalter von Juristentagungen, die Doppeldeutigkeit des Wortes »Verfassung« in den Titeln aufzugreifen: »Unser Grundgesetz – Noch in guter Verfassung?« heißt es dann, und die Organisatoren freuen sich über den eigenen Geistesblitz. Die Frage nach einer guten Verfassung unserer Verfassung war in den vergangenen Jahrzehnten eher philosophischer Natur. Das Grundgesetz hatte sich seit dem 23. Mai 1949 als stabiler Anker unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung erwiesen. Nichts und niemand schienen ihm etwas anhaben zu können. Im Zweifel schritt das Bundesverfassungsgericht ein und verschaffte den Grundrechten die verdiente Geltung. Das Grundgesetz hielt die Bundesrepublik Deutschland gesellschaftlich, politisch und emotional relativ stabil im Lot. Karlsruhe hielt Wache.
Einerseits handelt es sich beim Grundgesetz um das Konzentrat der vorigen verfassungsrechtlichen Entwicklungen. Es flossen die Werte der Aufklärung ein, die Ideen der Freiheitsbewegungen, die Erfahrungen der Paulskirchenverfassung und der Weimarer Reichsverfassung – aber auch die Lehren, die man aus den schrecklichen Grundrechtsmissachtungen des Dritten Reiches zog. Man konnte nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges aus einem vollen Erfahrungsschatz schöpfen.
Andererseits war das Grundgesetz aus der Not geboren. Entstanden auf Ruinen, in einem tief verunsicherten Land. Verfasst von Überlebenden der Diktatur, von Verfolgten, Geflüchteten, von ehemaligen KZ-Insassen, von Frauen und Männern, die sich der historischen Bedeutung ihrer Aufgabe bewusst waren. In wenigen Monaten formulierten sie etwas, um das die Bundesrepublik Deutschland später weltweit beneidet werden würde. Und sie schrieben es auch im Geiste derer nieder, die nicht mehr sprechen, nicht mehr mitwirken konnten, weil sie wenige Jahre zuvor der Naziherrschaft zum Opfer gefallen waren. »Die Würde des Menschen ist unantastbar« war als zentraler Leitsatz die unmittelbarste Reminiszenz an die vielen Millionen Opfer der Tyrannei. Er war Gedenken und Auftrag zugleich.
Doch mit Beginn der Corona-Pandemie änderte sich unser Blick auf das Grundgesetz. Jetzt wurde die Frage der Verfassung der Verfassung nicht mehr nur in den wissenschaftlichen Elfenbeintürmen diskutiert. Stattdessen debattierte das ganze Land, weil die Grundrechtseingriffe jede und jeden betrafen. Die einen kümmerte es weniger: Sie arbeiteten weiter wie gehabt, bekamen ihr Geld regelmäßig aufs Konto und konnten in einer großen Wohnung leicht mit den Einschränkungen leben. Andere wurden zwischen Homeoffice und Homeschooling zerrieben, nicht wenige verloren ihre Existenzgrundlage, ihren Traum, ihr Lebenswerk. Hinzu kam: Zahlreiche menschliche Kontakte brachen auseinander. Liebende wurden plötzlich wieder durch Staatsgrenzen getrennt, Kinder durften ihre Freunde nicht mehr sehen und Alte nicht mehr ihre Nächsten. Gleichzeitig starben allein in Deutschland Zehntausende an diesem tückischen Virus, wegen der hohen Ansteckungsgefahr viele einsam und völlig auf sich gestellt. In den Kliniken arbeitete man sich zugrunde, war monatelang auf Anschlag. Das Leid hatte viele Gesichter.
Das Infektionsschutzgesetz, das über lange Zeit ein Eremitendasein fristete, wurde plötzlich zum Taktgeber einer Entwicklung, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes sicher nicht im Hinterkopf hatten, als sie seine wichtigsten Rechtssätze schufen. Auf dieser einfachen gesetzlichen Grundlage nahm man die schwersten Grundrechtseingriffe seit Bestehen des Landes vor. Möglich machte dies der Paragraph 28. Dort werden lapidar und im feinsten Juristendeutsch die betroffenen Grundrechte aufgezählt:
Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt.
Das klingt einfach. Die Exekutive bekam mit der Epidemie eine enorme Verantwortung übertragen, die selbstverständlich einherging mit einer nicht minder großen Entscheidungsgewalt. In Folge kam es zu inakzeptablen Überschreitungen, zu unerlaubten Kompetenzaneignungen und zu Amtsanmaßungen. Doch dazu später mehr.
Besorgt hat mich, dass der Wert der Verfassung in jenen Tagen nicht mehr erkannt, ja sogar verkannt wurde. Wer auf die wichtigste Rechtsgrundlage als Fundament unserer Gesellschaftsordnung hinweisen wollte, die gerade in Zeiten der Krise ihre stärkste Stunde haben sollte, wurde in der aufgeheizten Situation als Rechtsverdreher, Aluhutträger oder Menschenfeind beschimpft. Es gehe schließlich um Menschenleben, da seien angeblich rechtsdogmatische Einlassungen nicht nur wenig hilfreich, sondern gar schädlich.
Ein trauriges Beispiel dafür, dass diese Denkweise tief in akademischen Kreisen Widerhall gefunden hatte, konnte man am 23. April 2021 im Deutschlandfunk in der Sendung Lebenszeit hören.1 Zum Thema »Beschnittene Freiheitsrechte« kam Johannes Leder, ein Persönlichkeitspsychologie von der Universität Bamberg, zu Wort. Wörtlich sagte dieser: »Wenn dann der Jurist kommt und auf die Verfassung verweist, dann muss man fragen: Ist das denn noch angemessen im 21. Jahrhundert, in unserer digitalisierten Welt, in einem Zeitalter der künstlichen Intelligenz?«
Nachdenklich machte mich der Brustton der Überzeugung, mit dem Leder diese Sätze vertrat. Hätte er dieselben Worte gewählt, wenn es um die Aufhebung der verfassungsrechtlich geschützten Wissenschaftsfreiheit gegangen wäre? Hätte er das Gleiche in Bezug auf die Meinungs- und Pressefreiheit oder das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gesagt? Würde er genauso sprechen, wenn die Menschenwürde selbst zur Disposition stünde? Die wichtigste Frage lautet aber: Wenn die Verfassung nicht mehr gelten soll, was gilt stattdessen?
Glücklicherweise kann nicht einmal der Verfassungsgesetzgeber die Menschenwürdegarantie aus Artikel 1 aufheben. Diese unterfällt der sogenannten Ewigkeitsklausel aus Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes. Doch offenbarte sich in dieser beispielhaften Äußerung ein großes Problem, das sich durch die gesamte Zeit der Pandemie getragen hat: die Höherstellung einer – sicher gutgemeinten – Moral über das Recht. In der Pandemie müsse es eben auch mal anders gehen, so die Argumentation. Das ist jedoch ebenso falsch wie gefährlich. Eine Verfassung darf man nicht ein- und ausschalten, wie es gerade passt. Sie ist in ihrer vollen Pracht die Garantin für die Wahrung der Menschenwürde und der Freiheit. In jeder Situation. Wird die Verfassung beiseitegeräumt, verfällt diese Garantie.
Es drängt sich die Frage auf, wie es dazu kommen konnte, dass unser Grundgesetz, das das bewusste Gegenbild zur Menschenverachtung des Dritten Reiches zeichnen will und deshalb den Geist der Humanität atmet, plötzlich für inhuman und überholt befunden wurde. Zu erklären ist dies sicherlich mit der weitverbreiteten Angst, die eine große gesellschaftliche – aber auch politische – Rolle in dieser Pandemie gespielt hat. Denn wenn es um Leben und Tod geht, gelte wohl der Satz: »Not kennt kein Gebot.«
Diese angstdominierte Stimmungslage machte es den Verfechtern der Verfassungsordnung lange schwer, mit ihren Argumenten durchzudringen. Hiervon wird später die Rede sein.
Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber dem Staat
Nach diesen etwas theoretischen Einstiegsgedanken wenden wir uns nun der Frage zu, was die Grundrechte im praktischen Leben bedeuten. Das Grundgesetz sieht die Menschen nicht als Untertanen, sondern als freie, mündige und selbstbestimmte Bürgerinnen und Bürger. Die Grundrechte sind daher vor allem Abwehrrechte gegenüber dem Staat, der einem mündigen Bürger nicht vorschreiben darf, welche Meinung von der Regierung er haben, in welchem Beruf er arbeiten, an welchem Ort er wohnen oder welche Brotsorte er kaufen soll. Wir haben das Recht auf Renitenz, solange sie sich im zulässigen Rahmen bewegt – doch der ist weit gefasst. Unsere Verfassung gibt uns die Möglichkeit, für eine Sache auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren; und die Behörden müssen diese Demonstration im Zweifel auch dann schützen, wenn man gegen den Freiheitsgedanken des Grundgesetzes protestiert oder dort »All cops are bastards« skandiert.
Der Staat schützt unsere Privatsphäre, wahrt die Unverletzlichkeit der Wohnung, achtet auf die Gleichstellung von Männern und Frauen und schützt die Institutionen von Ehe und Familie – verpflichtet die Menschen aber im Gegenzug dankenswerterweise nicht dazu, eine Ehe einzugehen und Kinder zu zeugen. Das Grundgesetz vertraut auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürger, und es will – so die ursprüngliche Idee – den Staat nicht als Gouvernante in Erscheinung treten lassen. Behördliche Erziehungsleistungen werden also nicht abgedeckt. Das sogenannte »Nudging«, das staatliche »Anstubsen« zum angeblich »richtigen« Verhalten, für das vor einigen Jahren sogar mehrere Referenten im Kanzleramt eingestellt wurden,2 sieht unsere Verfassung nicht vor.
Das bedeutet auch, dass der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern keine Befreiung von den allgemeinen Lebensrisiken geben kann. Jeder Mensch hat das Recht auf Unvernunft. Und jeder ist für die Ergebnisse seiner Freiheitsausübung selbst verantwortlich, seien sie schädlich für ihn oder nicht. Wenn sich also jemand dazu entscheidet, morgens, mittags und abends jeweils Hackfleisch und lauwarme Cola mit Brausetabletten als Hauptmahlzeit einzunehmen, darf er das – ohne befürchten zu müssen, dass die Polizei alsbald einrückt, er ein Mahnschreiben vom örtlichen Gesundheitsamt erhält oder ihm ein staatlich geprüfter Ernährungscoach zur Seite gestellt wird.
Ich lege es jeder und jedem ans Herz, sich den Grundrechtskatalog des Grundgesetzes regelmäßig zur Hand zu nehmen. Es sind die schönsten und bedeutendsten Zeilen des Freiheitsgedankens und der Humanität, die unser Rechtssystem zu bieten hat. Es macht mich immer wieder dankbar, in diesem Land leben zu dürfen.
Sicher, es gibt politische Kräfte, die diesem Freiheitsgedanken und dem Prinzip der Eigenverantwortung kritisch gegenüberstehen, die meinen, der Staat habe die Aufgabe, die Menschen im Zweifel vor sich selbst zu schützen. Deshalb sei es notwendig, Ponyreiten,3 Online-Shopping am Sonntag,4 Konzerte von missliebigen Bands5 oder Süßigkeitenwerbung6 zu verbieten. Dankenswerterweise zerschellen solche sinnbefreiten Forderungen regelmäßig an der verfassungsmäßigen Wirklichkeit.
Der Staatsrechtler Friedhelm Hufen legte in seinem rechtswissenschaftlichen Handbuch über die Grundrechte unmissverständlich dar, dass auch politische Ideen des Kollektivismus, die den Einzelnen nur als Teil eines großen Ganzen sehen, mit unserer Verfassung unvereinbar sind:
Grundrechte sind – auch wenn sie eine politische Funktion haben – immer und zuallererst eigennützig. Die Grundrechtsträger müssen sich keine Inpflichtnahme für das Gemeinwohl oder die demokratische Grundordnung gefallen lassen.7
Wer also die Forderung erhebt, im Sinne der Verhinderung des Klimawandels, der Corona-Bekämpfung oder zur Rettung des gemeinen Mäusebussards müsse man die eine Meinung haben, sonst sei man kein respektierter Teil der Gesellschaft mehr, bewegt sich eher in die Richtung autoritärer Staaten als auf dem Boden unserer Werteordnung.
Aufgrund des überragenden Stellenwerts des Individuums müssen Eingriffe in die Grundrechte nicht nur gut begründet werden, sondern sie bedürfen immer einer gesetzlichen Grundlage. Der Bürger darf demnach alles tun, was gesetzlich nicht ausdrücklich verboten ist, der Staat hingegen darf nur tun, was ihm vom Gesetzgeber ausdrücklich erlaubt wurde. Die Maßnahmen haben überdies folgendem Dreiklang zu entsprechen: Sie müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein. Dieser Grundsatz wird später noch von Bedeutung sein.
Die Grundrechte stehen prinzipiell gleichrangig nebeneinander – aber parallel begrenzen sie sich gegenseitig. Einzig Artikel 1 hat hier eine Sonderstellung. In diesem Zusammenhang war die erregte Debatte, die sich im April 2020 um ein Interview von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble drehte, ziemlich absurd. Schäuble erklärte gegenüber dem Tagesspiegel zur damaligen Corona-Diskussion Folgendes:
Aber wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen.8
Während Deutschland noch in der ersten Corona-Welle steckte, kochten die Emotionen hoch. Der Amtsvorgänger Wolfgang Thierse schaltete sich ein und erklärte empört, Schäubles Herleitung führe am Ende »zu ›Selektion‹ zwischen mehr oder weniger lebenswertem, also schützenswertem Leben«.9 Die italienische Zeitung Il Giornale urteilte, die Menschenwürde, die er im Auge habe, »stellt sich über eine simple Kosten-Nutzen-Rechnung her«. Schäuble sei ein »verdienter Vorkämpfer eines Europa, das mehr ans Geld denkt als daran, was die Würde des Lebens ausmacht«.10
Schäubles Aussage war jedoch alles andere als kontrovers. Denn er erklärte lediglich das, was angehende Juristen schon in Grundlagenseminaren mit auf den Weg bekommen. Selbstverständlich gibt es die staatliche Verpflichtung, Leben zu schützen. Im Gegensatz zur Menschenwürdegarantie aus Artikel 1 findet jedoch bei allen anderen Grundrechten immer eine Abwägung statt. Die Bestrafung der Holocaustleugnung zum Beispiel ist ein gesetzlicher Eingriff in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Und selbst in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit darf eingegriffen werden, logischerweise »nur auf Grund eines Gesetzes«, wie es in Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt. Anders wäre der sogenannte »finale Rettungsschuss«, der in einigen Bundesländern in die Polizeigesetze aufgenommen wurde, nicht möglich. Auch wenn es irritierend klingt: Die polizeiliche Not-Tötung ist per Definition für den Erschossenen zumindest nicht menschenunwürdig.
Die Beschränkung von Grundrechten
Eingriffe in Grundrechte waren also durchaus schon von den Verfassungsmüttern und -vätern vorgesehen. Mit einer starren Auslegung, die jedes Grundrecht für unantastbar erklärt, wäre ein Gemeinwesen auch gar nicht vernünftig zu organisieren. Kollidierten dann zwei Grundrechte, ließe sich dieser Konflikt nicht vernünftig lösen.
Bei der Beschneidung aus religiösen Gründen etwa kollidieren die Glaubensfreiheit aus Artikel 4 und das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2. Der Gesetzgeber löste diese Spannung erst im Dezember 2012 auf, indem er entschied, dass eine Beschneidung bei minderjährigen Jungen grundsätzlich zulässig ist.
Es gibt jedoch auch Grundrechte, bei denen die Interessen ihrer Träger in Konflikt geraten. Ein Beispiel: In deutschen Krankenhäusern kommen jedes Jahr 20 00011 bis 40 00012 Menschen durch Krankenhauskeime zu Tode. Trotzdem würden wir nie auf die Idee kommen, die Krankenhäuser zu schließen. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit derjenigen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, und derjenigen, die sich dort potenziell tödlich infizieren können, wird in diesem Falle zugunsten Ersterer abgewogen.
Es findet immer eine Abwägung zwischen den einzelnen Grundrechten statt. Unsere Gesellschaft nahm auch schon vor der Corona-Epidemie in Kauf, dass Menschen im Rahmen eines Abwägungsprozesses zwischen staatlicher Schutzpflicht und der gesellschaftlichen Freiheitsausübung gestorben sind, zum Beispiel bei Unfällen oder an bestimmten Krankheiten. Der Staat sollte stets mit Augenmaß handeln – aber selbstverständlich nicht, ohne den grundsätzlichen Freiheitsgedanken aus dem Blick zu verlieren.
Im Rahmen eines solchen Abwägungsprozesses wurde 1976 zum Beispiel die Gurtpflicht eingeführt. Der Freiheitseingriff ist klein, die Schutzwirkung umso größer. Und bei der Bekämpfung von Krankheiten versucht der Bund unter anderem mithilfe der steuermittelfinanzierten Förderung der Gesundheitsforschung seiner Schutzpflicht gerecht zu werden.
Vielleicht klingt es für manche hart, aber es ist ein Preis, den jede Gesellschaft für die Freiheit bezahlt: Der freiheitliche Staat kann nicht verhindern, dass Menschen sterben. »Risiken sind«, wie der Rechtswissenschaftler Uwe Volkmann richtig schrieb, »der Preis der Freiheit; eine Welt ohne Risiko ist eine Welt ohne Freiheit.«13 Der Staat darf sich deshalb auch nicht zum Schutzpatron aufschwingen, der den Anspruch hat, sämtliche Lebensgefahren beiseitezuräumen. Ebenso kann er nicht verhindern, dass sich Menschen mit einem Virus infizieren. Er kann aber alles dafür tun, dass die Erkrankten in einem funktionierenden Gesundheitssystem bestmöglich versorgt werden.
Ab dem Frühjahr 2020 erschien dieses Bild des Staates, der seine Schutzpflichten, aber auch seine Grenzen kennt, jedoch plötzlich überholt. Auf einmal glaubten viele, die Bundeskanzlerin könne im Rahmen des Bevölkerungsschutzes freihändig über die Zuteilung von gesellschaftlichen und individuellen Freiheiten verfügen. Der Staat müsse in der Pandemie völlige Handlungsfreiheit haben, um das Virus zu bekämpfen, so der Gedanke. Widerspruch sei hierbei lebensbedrohlich.
Diese gefährliche Idee begann mit den schrecklichen Bildern aus Bergamo enorm an Macht zu gewinnen.
3Der Ausnahmezustand (der Ausnahme bleiben sollte)
In den Anfangstagen der Pandemie gab es im politischen Berlin keine zwei Meinungen. Die Berichte und Bilder von überlaufenden Krankenhäusern und mit Leichen beladenen Armee-Fahrzeugen in Italien ließen für Deutschland Schlimmes erahnen. Gaben sich die Experten um den Charité-Virologen Christian Drosten und RKI-Chef Lothar Wieler in den ersten Wochen des Jahres 2020 noch relativ entspannt – man habe es eher mit einer schweren Grippewelle zu tun, hieß es1 –, schlug die Risikoeinschätzung Ende Februar und Anfang März in das völlige Gegenteil um.2 Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages stimmten daher am 25. März der Änderung des Infektionsschutzgesetzes im absoluten Schnellverfahren zu. Drei Lesungen an einem Tag. Wer gemeint hatte, der Gesetzgeber könne keine schnellen Entscheidungen treffen, sah sich eines Besseren belehrt.
Ich kann mich gut an die erregten Diskussionen auch im Kreise meiner Fraktion erinnern. Am Abend des 11. März erreichte uns die Nachricht, dass wir einen ersten Corona-Fall in den Reihen der FDP-Abgeordneten hatten. Innerhalb der nächsten drei Tage folgten die Fälle zwei und drei in der Fraktion. Die Einschläge kamen gefühlt immer schneller und näher. Am 22. März erklärte der Regierungssprecher, dass sich die Kanzlerin in Quarantäne begeben musste, weil ihr behandelnder Arzt mit dem Coronavirus infiziert war. Gerüchte machten dieser Tage die Runde, es werde bald eine komplette Schließung des öffentlichen Lebens verhängt. Das Bundesgesundheitsministerium dementierte zuerst vehement, aber kurz danach kam der Lockdown: Schulen, Kitas, Theater, Museen, Freizeitstätten, Spielplätze und Gotteshäuser wurden geschlossen. Die Dramatik war allerorten greifbar.