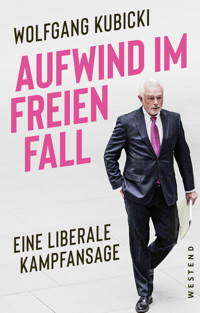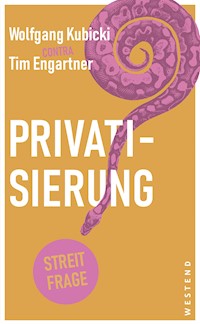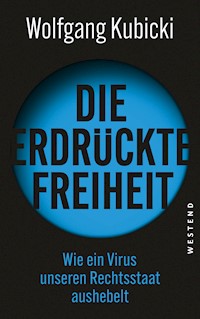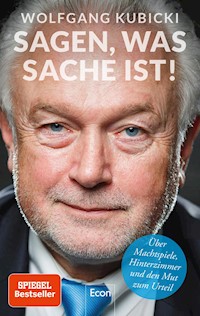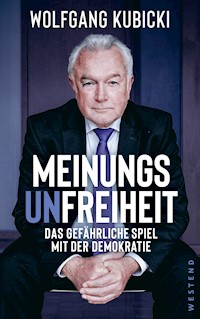
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben." Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention Die Meinungsfreiheit ist für eine freiheitliche Demokratie konstituierend. In Deutschland ist sie deshalb verfassungsrechtlich besonders geschützt. Trotzdem haben viele Deutsche das Gefühl, sie könnten ihre Meinung nicht frei äußern. Wie kommt das? Wolfgang Kubicki widmet sich der Frage, welche Fehler in Politik, Medien und Gesellschaft gemacht wurden, die zu diesem Vertrauensverlust führten und zeigt, wie wir zu einer neuen Diskurskultur finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ebook Edition
Wolfgang Kubicki
Meinungs(un)freiheit
Das gefährliche Spiel mit der Demokratie
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-791-7
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2020
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Fotograf: Tobias Koch
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Einleitung
Im Mai 2019 überraschte das Institut für Demoskopie Allensbach die deutsche Öffentlichkeit mit einer Umfrage. Bei bestimmten politischen Problemfragen, so fanden die Meinungsforscher heraus, hatten bis zu 71 Prozent der Deutschen Vorbehalte, ihre Meinung frei und offen zu vertreten.1 Die Furcht war bei einer überwältigenden Mehrheit offenbar groß, dass die Äußerung der eigenen Ansicht Nachteile im persönlichen Umfeld bringen könnte.
Für eine Demokratie, die vom Widerstreit der Meinungen lebt, ist diese hohe Zahl an Schweigenden alarmierend. Können wir die Vielfalt der Stimmen nicht mehr einfangen, weil sich eine nennenswerte Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern selbst entmündigt und in die zurückgezogene Innerlichkeit begibt, verliert unsere Demokratie nicht nur ihre gesellschaftliche Integrationskraft, sondern – ganz allgemein – ihre Grundlage. Sollte diese Entwicklung fortschreiten, müssen wir befürchten, dass sich immer stärker parallele Teilöffentlichkeiten ausbilden, weil sich viele Menschen ausschließlich mit Gleichgesinnten in digitalen Blasen zusammenfinden. Dann droht uns, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet und die Spaltung im Gegenzug stärker wird.
Diese Gefahr für die Demokratie ist nicht nur in Deutschland virulent. Rund 150 internationale Künstler, Intellektuelle und Wissenschaftler wandten sich im Juli 2020 mit ihrer Sorge an die Öffentlichkeit. Die Unterzeichner um J. K. Rowling, Daniel Kehlmann, Salman Rushdie und Francis Fukuyama schrieben in einem offenen Brief über die Gegenwart und Zukunft der westlichen Demokratien und beklagten eine weitverbreitete »Atmosphäre von Zensur«. Mittlerweile würden »die Grenzen dessen, was ohne Androhung von Repressalien gesagt werden darf, immer enger gezogen«.2 Der Kabarettist Dieter Nuhr wurde im August 2020 Opfer der sogenannten »Cancel Culture«, als man seine Stellungnahme über den Wert und das Wesen der Forschung zwischenzeitlich von der Internetseite der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) entfernte. Nicht was er gesagt hatte löste den Shitstorm aus, sondern die bloße Tatsache, dass er es gesagt hatte. Wenige Tage später wurde ein Auftritt seiner Kollegin Lisa Eckhart in Hamburg abgesagt, weil sich linke Gewalttäter von ihrem kontroversen Programm provoziert fühlen könnten. Der Rechtsstaat zeigte sich außerstande, die Freiheit der Kunst vor Antidemokraten zu schützen.
Insgesamt ist eine ausgeprägte Tendenz zur Moralisierung der Debatte erkennbar, die viele Menschen abschreckt. Haltungsfragen werden diskutiert, also die Auseinandersetzung darüber, ob sich jemand weltanschaulich noch auf der »richtigen« Seite befindet oder ob er stattdessen eine soziale Ächtung verdient hat. Häufig legt sich auch im Bereich des Politischen eine Last der Intoleranz auf die Debatte, dass wir uns beunruhigt fragen müssen, ob es so auf Dauer bei uns noch friedlich bleiben wird.
Ich finde: Es muss. Und deshalb ist es unsere höchste Aufgabe und Pflicht, dass wir uns der Stärken unserer freiheitlichen Demokratie wieder besinnen. Dass wir mit Herz und Leidenschaft für unsere Anliegen einstehen. Immer mit dem Anspruch, dass wir dem Mitdiskutanten ausreichend Raum bieten, ihm am Ende immer in die Augen sehen und die Hand reichen können. Dass wir die Liebe zum Streit wieder neu entdecken, ohne Niedertracht und Bosheit gegenüber dem Kontrahenten, sondern auf Augenhöhe und mit Respekt.
Wir brauchen den gemeinsamen Streit über den besseren Weg. Setzen wir die Regeln des streitbaren Miteinanders außer Kraft, weil uns die Auseinandersetzung als zu anstrengend oder fruchtlos erscheint, dann geben wir auch die Ambition auf, am Ende die beste Lösung zu erhalten. Die beste Lösung für alle ist nämlich in den seltensten Fällen diejenige, die man allein zu Hause ersonnen, sondern eher die, die sich im Diskussionsprozess mit anderen entwickelt hat.
Ich will mich in diesem Buch der Frage widmen, woher dieses Gefühl der Meinungsunfreiheit eigentlich kommt, das derzeit viele Menschen teilen. Welche Fehler in Politik, Gesellschaft und Medien der letzten Jahre sind dafür verantwortlich? Was können wir tun, damit Meinungsfreiheit wieder als Triebfeder für produktiven und konstruktiven Streit verstanden wird? Wie können wir bewirken, dass man die Worte seines Gegenübers zwar ernst nimmt, aber nicht zwingend einzeln auf die Goldwaage legt?
Meinungsfreiheit kann nur bestehen, wenn die allseitige Bereitschaft vorhanden ist, anderen zuzuhören. Dies ist nur im Geist der Toleranz, Pluralität und Humanität möglich. Und ohne den bis zum Bersten aufgeblasenen moralischen Zeigefinger. Fehlt diese menschliche Offenheit gegenüber anderen Meinungen, dann fehlt auch die Voraussetzung dafür, dass es bei uns friedlich bleibt und wir unsere Freiheit bewahren können. Insofern haben wir keine bessere Wahl.
Die rechtliche Dimension
Warum Meinungsfreiheit?
In seinem lesenswerten Buch Meinungsfreiheit! Demokratie für Fortgeschrittene schreibt der Spiegel-Bestseller-Autor Volker Kitz: »Demokratie ist mehr als Rechthaben.«1 Dieser Satz ist richtig. Im Bereich der Meinungsfreiheit gilt ferner: Zwischen Rechthaberei und Recht haben gibt es entscheidende Unterschiede. Klugscheißer liegen schließlich auch manchmal falsch. Und ob man am Ende auch noch Recht bekommt, ist wiederum eine ganz andere Frage.
Dass es mitunter schwierig sein kann, das juristische »Recht haben« und »Recht bekommen« einem unbefangenen, aber interessierten Dritten zu erklären, liegt auf der Hand. Der Graubereich zwischen zulässigen und unzulässigen Meinungsäußerungen ist reichlich unübersichtlich. Eine Vielzahl von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, die vorhergehende Gerichtsurteile aufhoben, legt die Vermutung nahe, dass auch unter Fachleuten eine große Unklarheit herrscht.
Darf man Soldaten als »Mörder« bezeichnen? Kann man einen umstrittenen bayerischen Ministerpräsidenten einen »Zwangsdemokraten« nennen? Ist es erlaubt, eine bekannte Politikerin der Grünen auf einer Social-Media-Plattform eine »Drecksf****«, »Schl****« und »Stück Sch****« zu schelten?* Zu allen diesen Äußerungen gab es unterschiedliche juristische Auffassungen; die ersten beiden wurden höchstrichterlich als verfassungsrechtlich zulässig erklärt.
Bevor weitere Unklarheiten entstehen: Viele Fälle sind juristisch unbestritten. Klar ist, die Karlsruher Richter haben in der Vergangenheit sehr häufig der Freiheit der Meinungsäußerung den Vorrang vor anderen schutzwürdigen Interessen gegeben. Und völlig außer Frage steht auch, dass es für die rechtliche Bewertung entscheidend ist, wer, wann, wie und warum jemand etwas sagt. Doch dazu später mehr.
Wenden wir uns zunächst der Frage zu, warum wir eigentlich Meinungsfreiheit brauchen. Die Schöpferinnen und Schöpfer des Grundgesetzes sahen Artikel 5 zunächst als ein Abwehrrecht des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat. Dass sich die deutsche Regierung in der Vergangenheit unter anderem durch Zensur und Beschränkungen der Meinungsfreiheit Geltung verschafft hatte, war den Beteiligten bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates 1948/49 noch sehr gut in Erinnerung. Damit sich der freiheitlich-demokratische Gedanke entfalten konnte, musste der westdeutsche Staat in Sachen Meinungsfreiheit begrenzt werden. Dies sollte vor allem Absatz 1 gewährleisten:
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Der dahinterstehende Gedanke war: Nur wenn Meinungen im Zweifel auch hart aufeinanderprallen können, entsteht erst die Grundlage dafür, dass alle Seiten Gehör finden und niemand ausgegrenzt wird. Dann entscheidet nicht nur die Mehrheit, sondern auch jede Minderheit vermag ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Nur durch Rede und Gegenrede werde dem gesellschaftlichen und dem politischen Fortschritt wirklich gedient, weil jede scharfe Antwort auch wieder eine Schärfung der eigenen Argumente mit sich bringt. Und nur durch den geordneten und regelbasierten Streit könne dem Extremismus wirkungsvoll der Nährboden entzogen werden.
Im NPD-Urteil aus dem Jahre 2017 hat das Bundesverfassungsgericht diesen Gedanken sehr treffend zusammengefasst:
Das Grundgesetz geht davon aus, dass nur die ständige geistige Auseinandersetzung zwischen den einander begegnenden sozialen Kräften und Interessen, den politischen Ideen und damit auch den sie vertretenden Parteien der richtige Weg zur Bildung des Staatswillens ist. Es vertraut auf die Kraft dieser Auseinandersetzung als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien.2
Der »Staatswillen« bildet sich demnach in einem gemeinsamen Prozess. Alle Bürgerinnen und Bürger sind im Sinne unserer Demokratie aufgerufen, sich an diesem Prozess mit ihrer Stimme zu beteiligen. Das kann ganz klassisch bei Wahlen geschehen, aber auch durch Leserbriefe, Handzettel, auf sozialen Netzwerken, in der Kneipe, bei Demonstrationen oder durch die freie Rede in der Öffentlichkeit. Und wer bei diesem Prozess nicht mitmacht, darf nicht davon ausgehen, dass seine Interessen am Ende auch wirklich berücksichtigt werden.
Wenn sich nun über zwei Drittel der Bundesbürger nicht mehr trauen, ihre Meinung zu jedem Thema öffentlich zu sagen, stehen wir vor einem Demokratieproblem. Denn die Demokratie lebt von der Beteiligung ihrer Bürger.
Bevor wir uns jetzt aber in Schreckensszenarien verlieren, formulieren wir es lieber positiv: Weil das Grundgesetz dazu einlädt, uns an diesem Prozess zu beteiligen, werden wir alle auch zu potenziellen Verteidigern der Demokratie. Die Meinungsfreiheit ist das Mittel, das uns allen die Teilhabe am demokratischen Prozess ermöglicht. Deshalb ist sie für die freiheitlich-demokratische Staatsform »schlechthin konstituierend«, das »Lebenselement« der Demokratie und »in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt« – wie die Karlsruher Richter im berühmten Lüht-Urteil von 1958 feststellten.3
Nun könnte man sagen: Mehr Bedeutung geht wohl nicht. Das stimmt auch. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, untrennbar mit der Ausgestaltung der Meinungsfreiheit in unserem Lande verknüpft.
Sicher, ständiger Streit und Ringen um bessere Argumente sind anstrengend. Wenn wir aber unsere Freiheit behalten wollen, dann müssen wir möglichst alle aktiv werden. Halten wir die Diskussion über eine bessere Zukunft nicht am Leben, stirbt die Demokratie – und damit die Grundlage unserer Freiheit.
Nicht nur Recht, auch Pflicht
In jeder Gesellschaft gibt es Streit. Selbst in den besten Familien sollen manchmal Unstimmigkeiten über das Abendessen, die angeblich viel zu kurzen Röcke der Tochter oder die Bildschirmzeit des Sohnes herrschen. Deshalb müssen Konfliktthemen ausgesprochen, diskutiert und idealerweise einer Lösung zugeführt werden – in der Familie genauso wie in der Gesellschaft. Konflikte unausgesprochen liegen zu lassen, führt am Ende dazu, dass sich eine Seite nicht wahr- oder ernstgenommen fühlt und entweder mit lautem Knall rebelliert oder sich still und leise abkapselt.
Um die Ausgrenzung bestimmter Gruppen zu vermeiden, regelt und »kanalisiert« man den Streit in einer Demokratie. Das heißt, dass es geordnete Bahnen gibt, in denen die Interessensgegensätze friedlich und verträglich gelöst werden sollen. In der Demokratie ist deshalb der Weg zum Ziel mindestens genauso wichtig wie das Ziel selbst. Denn schon die bloße Möglichkeit, seine Forderungen in einen Diskussionsprozess einbringen zu können, wirkt integrierend und friedensstiftend.
Der Deutsche Bundestag, wie auch die Länder- und Kommunalparlamente sollen nach diesem Prinzip funktionieren. Das erfordert von den Abgeordneten, dass sie sich mit den Interessen, Ideen und Forderungen der anderen auseinandersetzen. Dazu dient zum Beispiel die Plenardebatte. Weil der Weg schon ein Ziel ist, darf der Weg niemals abgekürzt werden, indem man politische Anschauungen und Parteien pauschal diskreditiert und ignoriert.
Demokratie kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten nicht nur senden, sondern hin und wieder auch einmal empfangen. Wir werden schließlich auch nicht weiser, wenn wir uns ausschließlich mit unseren eigenen Gedanken beschäftigen. Ein neuer Impuls von außen kann die eigenen Ideen entscheidend voranbringen.
Wir müssen die Positionen von Parteien am jeweiligen Ende des politischen Spektrums, wie der AfD oder der Linkspartei, nicht teilen oder gutheißen. Wir dürfen ihre Forderungen aber nicht deshalb unbesehen abqualifizieren, weil sie von der AfD oder der Linkspartei kommen. Denn es ist deren demokratische Pflicht, sich am öffentlichen Diskurs zu beteiligen. Dafür wurden sie gewählt – die AfD zum Beispiel von vielen, die mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung unzufrieden waren. Aber – und das darf man nicht kleinreden – auch von vielen Spinnern, Reichsbürgern, Monarchiefreunden und Ausländerfeinden.
Trotzdem gilt: Grenzen wir politische Gruppierungen in den Parlamenten pauschal aus, verwehren wir auch deren Wählerinnen und Wählern pauschal ihre Teilhabe am demokratischen Prozess. Der inklusive Gedanke des Grundgesetzes wird damit zur Makulatur. In diesem Sinne sollten wir stets selbstkritisch bleiben: Die Spalter sind nicht immer die anderen.
Unsere Pflicht als Demokraten ist es also, immer genau hinzuhören, was das Gegenüber sagt und fordert. Manchmal darf man diese Forderungen völlig zu Recht als unsinnig zurückweisen. Um eine Forderung aber zurückweisen zu können, muss man sie zunächst auch kennen.
Keine institutionelle Zensur
Die Tatsache, dass viele Stimmen in die »Bildung des Staatswillens« eingebunden sind, hat auch noch einen anderen Hintergrund. Keine politische Gruppierung kann für sich in Anspruch nehmen, allein für das Volk zu sprechen. Das Grundgesetz möchte uns dankenswerterweise vor Anmaßung bewahren.
Dass sich dies noch nicht überall herumgesprochen hat, ist bedauerlich. Gerade bei der AfD im Deutschen Bundestag ist der Anspruch, dass ihre Meinungsäußerungen Allgemeingültigkeit besitzen, verbreitet.
Im Februar 2018 debattierte der Bundestag über einen Antrag der AfD-Fraktion. Das Parlament sollte feststellen, ob die Bundesregierung den kurz zuvor aus türkischer Gefangenschaft freigelassenen Welt-Journalisten Deniz Yücel sonderbehandelt habe. Diesen Angriff auf die Regierung wollte die AfD aber eigentlich dafür nutzen, um Yücel persönlich zu attackieren. Dieser hatte in einem satirischen Zeitungsbeitrag über Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab unter anderem geschrieben: »Der baldige Abgang der Deutschen […] ist Völkersterben von seiner schönsten Seite.«4 Der Antrag der AfD war formal zulässig, gleichzeitig aber intellektuell ziemlich erbärmlich und widersprüchlich. Er konnte argumentativ leicht aus den Angeln gehoben werden – was in der Debatte auch geschah.5
Während meiner Rede erhob sich der AfD-Abgeordnete Thomas Ehrhorn zu einer Zwischenbemerkung. Er beklagte den Umstand, »dass es in diesem Hohen Hause scheinbar [er meinte wohl ›anscheinend‹, Anm. d. Verf.] nicht mehr möglich ist, Äußerungen, die direkt oder indirekt den Volkstod unseres Volkes verlangen, zu rügen«. Und er fragte mich, ob ich nicht auch gemeinsam mit ihm der Meinung sei, »dass das für dieses Hohe Haus ein wirklich erbärmliches Schauspiel ist«. Das Protokoll vermerkt anschließend Beifall bei Abgeordneten der AfD.
Ich antwortete, dass niemand ihn oder die AfD-Fraktion daran gehindert habe, im Bundestag Reden zu halten und zu rügen, was sie für rügenswert halten – »Aber Sie haben keinen Anspruch darauf, dass irgendein anderer Abgeordneter Ihrer Auffassung folgt. Das sieht die Verfassung nicht vor, und das werden wir auch nicht tun.«
Tatsächlich wurde noch nie ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag absichtsvoll daran gehindert, etwas Rechtskonformes zu sagen. Es wurde übrigens auch noch nie ein Abgeordneter im Plenum davon abgehalten, etwas dummes Rechtskonformes zu sagen. Aber es ist die Pflicht des amtierenden Präsidenten, bei rechtswidrigen Äußerungen einzuschreiten und dies gegebenenfalls zu sanktionieren. Das geschieht auch regelmäßig. Wer sich zu Unrecht mit einer Ordnungsmaßnahme belegt sieht, kann hiergegen gerichtlich vorgehen.
Diese kleine Episode aus dem Parlamentsalltag zeigt, dass die AfD ein besonderes, anmaßendes Verhältnis zur Meinungsfreiheit hat. Die hinter den Ausführungen des Kollegen Ehrhorn stehende Idee, es würden Meinungen im Deutschen Bundestag systematisch unterdrückt, ist ziemlich hanebüchen und entbehrt jeder Grundlage. Vielmehr wird hierdurch das politische Anspruchsdenken der AfD erkennbar: Die AfD erhebt Anspruch auf die widerspruchslose Verkündung der Wahrheit im Bundestag. Die Meinungsfreiheit müsse folglich der AfD-Linie unterworfen werden, sonst sei es keine Meinungsfreiheit.
Wie gesagt – intellektuell erbärmlich.
Was man darf und was man lieber nicht tun sollte
Wer glaubt, dass sich Meinungsäußerungen immer an Tatsachen halten müssen, irrt. Ob man nun wirklich meint, was man sagt, ist nicht einmal vom Bundesverfassungsgericht überprüfbar. Schließlich gilt: »Die Gedanken sind frei, […] kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen.« Man könnte morgen um 15.00 Uhr öffentlich erklären, die Bundesregierung sei die schlechteste seit Menschengedenken – und um 15.05 Uhr das genaue Gegenteil. Verfassungsrechtlich gibt es in dieser Frage überhaupt kein Problem. Eher wird sich das persönliche Umfeld nach einiger Zeit fragen, ob man noch alle Latten am Zaun hat.
Die Spreizung zwischen Wahrheit und Meinung sollte jedoch nicht zu weit gehen. Denn eine unwahre Tatsachenbehauptung kann wiederum strafrechtlich relevant werden. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit tritt dann hinter das Persönlichkeitsrecht zurück. Würde ich jetzt zum Beispiel öffentlich behaupten, ein bestimmter Herr verbringe seine freien Abende nicht regelmäßig züchtig im Kreise seiner ihn liebenden Familie, sondern unregelmäßig unzüchtig in städtischen Bordellen, dann sollte dies idealerweise auch stimmen. Hierbei handelt es sich nicht um eine geschützte Meinungsäußerung. Produzenten von Fake News sollten also gewarnt sein.
Es ist im Sinne der Meinungsfreiheit, dass Sachverhalte zugespitzt, polemisch und auch mit Übertreibungen kritisiert werden dürfen. Schließlich geht es darum, eine Wirkung im Meinungskampf erzielen zu können. Es muss also möglich sein, mit Originalität, Humor, Boshaftigkeit und zum Teil sogar Beleidigungen seinen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. Letztere sind daher zu einem gewissen Grad erlaubt, sofern sie als Vehikel zur Kritik an einem Sachverhalt genutzt werden. Steht eine Persönlichkeitsverletzung jedoch im Vordergrund der Kritik, genießt die Äußerung keinen verfassungsrechtlichen Schutz.
Dass dies manchmal schwierig auseinanderzuhalten ist, zeigt folgendes Beispiel: Im November 2011 demonstrierten in Köln Mitglieder einer rechten Gruppierung. Wie so häufig bot dies Anlass für mehrere Gegendemonstrationen. Auf einer davon hielt sich auch der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck auf, der – so stellte es das Kölner Landgericht später fest – die Durchführung des rechten Aufzuges aktiv verhindern wollte. Er informierte sich bei den Polizisten vor Ort und riet den Gegendemonstranten, die Blockade aufrechtzuerhalten. Außerdem bezeichnete er die Demonstranten als »braune Truppe« und »rechtsextreme Idioten«. So weit, so normal.
Nachdem der Versammlungsleiter des rechten Aufzuges Beck jedoch erkannt hatte, wurde aus der Sache ein Fall für die Gerichte. Der Versammlungsleiter äußerte sich in seiner Verärgerung nun wie folgt (Grammatikfehler inklusive):
Ich sehe hier einen aufgeregten grünen Bundestagsabgeordneten, der Kommandos gibt, der sich hier als Obergauleiter der SA-Horden, die er hier auffordert. Das sind die Kinder von Adolf Hitler. Das ist dieselbe Ideologie, die haben genauso angefangen.
Ausgerechnet von einem Rechten als Nazi bezeichnet zu werden, war für Beck des Guten zu viel. Er stellte Strafantrag wegen Beleidigung. Das Amtsgericht, das Landgericht und das Oberlandesgericht in Köln gaben ihm Recht. Sie befanden die NS-Analogien für Schmähkritik, weshalb das Recht auf Meinungsfreiheit hinter dem Ehrenschutz zurückzutreten habe. Das Bundesverfassungsgericht war jedoch anderer Ansicht und hob diese Entscheidungen schließlich auf. Demnach ging es dem Versammlungsleiter »nicht ausschließlich« um die persönliche Herabsetzung Becks. Der Begriff der Schmähkritik sei eng auszulegen, weil er grundsätzlich auf die Meinungsfreiheit einen verdrängenden Effekt ausübe. Schmähkritik liege vor, wenn die persönliche Kränkung das sachliche Anliegen »völlig in den Hintergrund« drängt.6 Wir lernen also: Sogar einen Grünen könnte man einen »Obergauleiter der SA-Horden« nennen, sofern ein gewisser Sachbezug erkennbar ist. Ich würde trotzdem davon abraten.
Ein weiteres Beispiel: Wenn man jemanden öffentlich als »durchgeknallt« beschimpft, ist im Regelfall mit einer strafrechtlichen Ahndung zu rechnen. Begründet man es aber gut genug, darf man gegebenenfalls sogar einen Staatsanwalt so bezeichnen. Dies hatte der Zeit-Herausgeber Michael Naumann in einer TV-Talkrunde getan. Er kritisierte im Zusammenhang mit den Drogenermittlungen gegen Michel Friedman, dass die Staatsanwaltschaft im Vorhinein mehrere Presseorgane informiert habe, »über einen Verdacht, den zu beweisen sie sich gerade erst bemüht«. Das Bundesverfassungsgericht sah zwar auch, dass Naumanns Äußerungen von »gewisser Schärfe« seien und »ehrverletzenden Charakter« hätten, die Grenze des Sagbaren sei aber nicht überschritten worden. Daher hoben die Karlsruher Richter die vorinstanzlichen Entscheidungen auf.7 Der Staatsanwalt hatte zwar recht, dass seine Ehre verletzt worden war, Recht bekommen hat er am Ende trotzdem nicht.
Grundsätzlich gilt, je bekannter eine Persönlichkeit ist und je mehr sie im öffentlichen Rampenlicht steht, umso mehr muss sie ertragen können. Bei der Meinungsfreiheit handelt es sich schließlich um ein hohes Gut. Im öffentlichen Meinungskampf ist also fast alles erlaubt. Fast.
Dass es auch Gerichte gibt, die der Meinungsfreiheit zu viel Raum geben, musste die Grünen-Politikerin Renate Künast schmerzhaft erleben. Auf einer Social-Media-Plattform wurde sie im Zusammenhang mit einer Debatte über Pädophilie unter anderem als »Drecksf****«, »Schl****« und »Stück Sch****« bezeichnet. Diese Äußerungen erachtete das zuständige Berliner Landgericht zunächst sämtlich als zulässig, zum Teil aber als »haarscharf an der Grenze des noch Hinnehmbaren«.8
Nun kann man sich verständlicherweise die Frage stellen: Wenn das nicht verboten ist, was darf man dann eigentlich nicht mehr sagen? Hat Meinungsfreiheit überhaupt eine Grenze? Wie schlimm muss ein Wort sein, dass man es als Schmähkritik und Beleidigung anerkennt? Ich will jetzt keine weiteren Phantasien anregen – denn dankenswerterweise wurde diese Entscheidung durch das Landgericht selbst noch einmal revidiert. In 6 von 22 angezeigten Fällen hat es nachträglich doch unzulässige Meinungsäußerungen erkannt,9 und das nächsthöhere Kammergericht gab Künast anschließend noch einmal bei 6 weiteren Äußerungen Recht.10 Das Gute an diesen Entscheidungen ist das Signal, dass Meinungsfreiheit kein Freibrief für Beleidigungen ist.
Szenenwechsel: Im Herbst 2019 durfte ich auf Einladung des Tagesspiegels an einer Gesprächsrunde zum Thema »50 Jahre Bundeskanzler Willy Brandt« teilnehmen. In der anschließenden Fragerunde erhob sich ein Gast. Es war ein älterer Herr, SPD-Mitglied, sichtlich aufgebracht, der die Podiumsrunde fragte, ob man es zulassen dürfe, dass Willy Brandt im brandenburgischen Landtagswahlkampf von der AfD missbraucht werde. Die AfD hatte wenige Wochen zuvor auf Plakaten mit Brandts Konterfei und seinem berühmten Zitat »Mehr Demokratie wagen!« geworben. Der Gast wollte nun wissen, ob ein solches Vorgehen rechtlich zulässig sei. Denn schließlich werde der gute Name des ehemaligen Bundeskanzlers und NS-Verfolgten Brandt durch die Vereinnahmung von Rechtsextremen in den Schmutz gezogen. Ich teilte dem netten Herrn mit, dass ich zwar nicht wüsste, wie die Gerichte in diesem Falle urteilen werden, er dies aber wahrscheinlich – so sehr ich seine Empörung verstünde – würde hinnehmen müssen.
Ein noch deutlicherer Fall von parteipolitischer Vereinnahmung wurde bereits höchstrichterlich geklärt. Im Bremer Bürgerschaftswahlkampf des Jahres 1991 gab die rechtsextreme Deutsche Volksunion (DVU) eine Wahlbroschüre heraus, in der die Porträts einiger historischer Persönlichkeiten unter der Überschrift standen: »Auch sie würden DVU