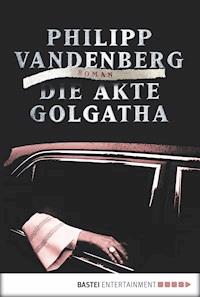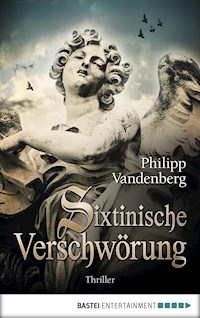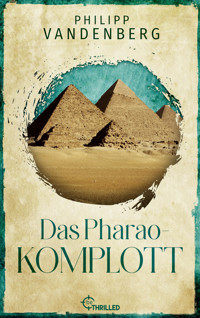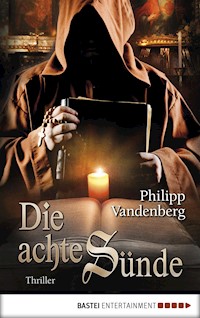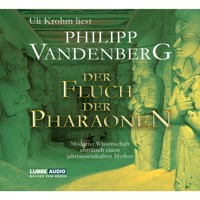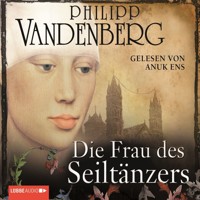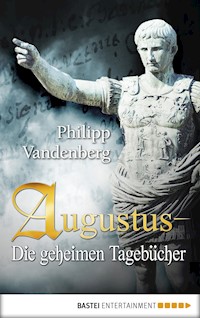
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die spannende Biographie des ersten römischen Kaisers - Augustus zieht Revue in seinen letzten 100 Tagen ...
Ein Orakel weissagt dem Göttlichen Kaiser Augustus dessen Tod in einhundert Tagen. Mit dieser Frist vor Augen beschließt der Beherrscher der Welt, eine Chronik seiner letzten Tage zu schreiben. Er greift zurück auf Erinnerungen an seine Kindheit, spricht über alles, was ihn je bewegt hat, zieht Bilanz. Das Orakel ist historisch verbürgt, das Tagebuch ist fiktiv - Philipp Vandenberg verwendet es als Grundlage für diese mitreißende Biografie des ersten römischen Kaisers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Augustus zieht Revue in seinen letzten 100 Tagen … Ein Orakel weissagt dem Göttlichen Kaiser Augustus dessen Tod in einhundert Tagen. Mit dieser Frist vor Augen beschließt der Beherrscher der Welt, eine Chronik seiner letzten Tage zu schreiben. Er greift zurück auf Erinnerungen an seine Kindheit, spricht über alles, was ihn je bewegt hat, zieht Bilanz. Das Orakel ist historisch verbürgt, das Tagebuch ist fiktiv – Philipp Vandenberg verwendet es als Grundlage für diese mitreißende Biografie des ersten römischen Kaisers.
Über den Autor
Philipp Vandenberg wurde am 20. September 1941 in Breslau geboren. Er wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg bei einer Pflegemutter und im Waisenhaus auf und kam 1952 ins oberbayrische Burghausen.Er besuchte dort dasselbe Gymnasium wie Ludwig Thoma und flog, eigenem Bekunden zufolge, wie dieser von der Schule. Er kehrte »reumütig« zurück und konnte in der Folge die mangelhaften Leistungen in Griechisch sowie Mathematik durch hervorragende Leistungen in Deutsch und Kunst ausgleichen. 1963 machte er am humanistischen Gymnasium Burghausen/Salzach Abitur und studierte anschließend an der Universität München Kunstgeschichte und Germanistik (ohne Abschluss). Ein Volontariat machte Vandenberg 1965/1967 bei der Passauer Neue Presse, die ihn 1967 zum Redaktionsleiter des Burghauser Anzeigers machte.Anschließend wurde er Nachrichtenredakteur bei der Münchener Abendzeitung. 1968–1974 arbeitete er für die Illustrierte Quick. Dann war Vandenberg bis 1976 als Literaturredakteur für das Magazin Playboy beschäftigt. Seither ist er als freier Autor tätig.Vandenbergs Karriere als Sachbuchautor begann 1973, als er seinen Jahresurlaub nahm und begann, über den »Fluch des Pharao« zu recherchieren. Über den rätselhaften Tod von dreißig Archäologen veröffentlichte er das Buch »Der Fluch der Pharaonen« (1973), das ein Weltbestseller wurde. Quick hatte das Manuskript als Serie abgelehnt. Auf den Bestsellerlisten platzierten sich auch Vandenbergs weitere Publikationen wie die archäologische Biographie »Nofretete« (1975). 1977 wechselte Vandenberg seinen Verlag, blieb aber der kulturgeschichtlichen Thematik treu und war in der 80er Jahren als Autor historischer Sachbücher wie »Cäsar und Kleopatra« (1986) erfolgreich. Mitunter versuchte die Fachkritik, seine populären Sachbücher als »Archäo-Krimis« abzutun. Vandenbergs 30 Bücher, mit einer weltweiten Gesamtauflage von über 24 Millionen, erschienen bisher in 34 Sprachen übersetzt, darunter, neben allen Weltsprachen, ins Türkische, Bulgarische, Mazedonische und Rumänische.Vandenberg hat aus erster geschiedener Ehe einen Sohn Sascha (geb. 1965). Seit 1994 ist er mit Evelyn, geb. Aschenwald, verheiratet, beide leben in Baiernrain, in einem tausend Jahre alten Dorf zwischen Starnberger- und Tegernsee. Sein Hobby ist das Sammeln von Oldtimern und Phonographen.
Philipp Vandenberg
Augustus – Die geheimen Tagebücher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2002/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Das Buch erschien unter dem Titel Klatscht Beifall, wenn das Stück gut war. Die geheimen Tagebücher des Augustus erstmals 1988 bei C. Bertelsmann Verlag GmbH, München.
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
Titelbild: © shutterstock/Dimedrol68, © shutterstock/Sebastian Wahsner
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1208-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Ich, Polybius, Freigelassener des Göttlichen Augustus und des Schreibens kundig, habe zu berichten: Heute Morgen rief mich der Caesar in seine Privatgemächer. Ich ahnte, dass etwas Ungewöhnliches vorgefallen sei. »Jupiter auf allen Wegen!«, grüßte ich, aber der Göttliche überging meinen Gruß und sprach geistesabwesend:
»Wie lange dienst du mir, Polybius?«
Die Frage traf mich unerwartet. »Nun ja«, sagte ich, »solange ich denken kann.«
»Und wie lange ist dies?«, beharrte der Caesar, »dreißig Jahre, vierzig Jahre?«
»Eher vierzig als dreißig«, erwiderte ich, »aber genau vermag das niemand zu sagen. Die Geburt eines Sklaven wird nirgends verzeichnet.«
»Und wie lange ist es her, seit ich dir die Freiheit schenkte?«
»Siebzehn Jahre weniger dreißig Tage!«, antwortete ich. »Wie sollte ich diese Zahl nicht kennen.« Ich fiel Augustus zu Füßen und küsste den Saum seines Gewandes. Herren wollen sich bisweilen in Dankbarkeit sonnen, der Caesar macht da keine Ausnahme.
»Du hast mir stets treu gedient, Polybius«, begann der Caesar von Neuem, und ich überlegte, worauf er wohl hinauswollte. In der Kürze des Augenblicks fand ich keine Antwort auf diese Frage. Doch versetzte mich das, was nun geschah, in großes Staunen.
Augustus zog einen Beutel hervor, gab mir ein Zeichen und leerte seinen Inhalt in meine aufgehaltenen Hände. Ich stand da, und in meinen Händen türmte sich ein Haufen Gold. Noch nie im Leben hatte ich, Polybius, Freigelassener des Göttlichen Augustus, so viel Geld in meinen Händen gehalten.
»Nimm es«, sagte der Caesar, »es möge dir Glück bringen.«
Ich würde lügen, schriebe ich nieder, was ich dem Göttlichen erwiderte. Ich weiß es nicht mehr, ich war zu erregt, aber ich pries wohl die Güte des Erhabenen, seine Freigebigkeit, und – ja, dessen erinnere ich mich – ich schwor ihm ewige Treue.
»Hör zu«, sprach Augustus, das heißt, er formulierte seine Rede natürlich anders, in jener unnachahmlichen Art, in der er die Dichter imitiert, aber ich gebe seine Rede mit meinen eigenen Worten wieder: »Hör zu«, sagte er, »dieses Gold schenke ich dir, damit du mir einen Dienst erweist.«
Ich antwortete: »Herr, auch ohne das Gold erfülle ich dir jeden Wunsch, du weißt es!« So etwa sprach ich, und ich starrte auf das Gold in meinen Händen. Gewiss reichte es für ein Häuschen mit Garten in den Albaner Bergen, einen Stall mit ein paar Ziegen, vielleicht einer Kuh. Ich würde Weinstöcke pflanzen und Obstbäume und allerlei Gemüse, das auf dem fruchtbaren Boden gedeiht.
Wie aus der Ferne vernahm ich die Stimme des Göttlichen, während ich das Gold in den Beutel zurückfallen ließ: »Ich will dir von heute an jeden Tag ein Pergament anvertrauen, dessen Inhalt geheim ist wie die Sibyllinischen Bücher. Ich werde in den mir verbleibenden Tagen meine geheimsten Gedanken niederschreiben. Doch ich will nicht, dass vor meinem Tode irgendein Mensch davon erfährt. Deshalb sollst du dieses Tagebuch an einem sicheren Ort aufbewahren.«
Ein ungewöhnlicher Auftrag, gewiss, und ich fragte mich, ob ein Caesar nicht eher zu bedauern ist, als zu beneiden, wenn er nicht einmal einen Ort findet, wo er Wichtiges vor den Blicken Neugieriger verbergen kann. Ich kenne hundert Verstecke, und eines ist sicherer als das andere, und ich werde mich hüten, auch nur eines preiszugeben. Rom ist eine Stadt der Verstecke, weil Rom eine Stadt der Gauner und Diebe ist. Jeder versteckt alles vor jedem, weil sie um ihr Lehen fürchten müssen, und manche halten sich Doppelgänger und schicken sie auf die Straße, damit sie seihst gefahrlos ihren Geschäften nachgehen können.
»Wenn das alles ist, göttlicher Caesar«, sagte ich. Augustus holte eine Rolle Pergament aus den Falten seiner Toga hervor und reichte sie mir. Ich ließ das Schriftstück ebenso schnell in meinem Gewand verschwinden und zog mich zurück. So begann es.
Am Tag darauf übergab mir der Caesar eine zweite Schrift und am folgenden Tag eine dritte. Natürlich wunderte ich mich, warum er mir nicht in die Feder diktierte, zumal er meiner Verschwiegenheit vertraute. Aber dann verwarf ich den Gedanken: Der Göttliche griff nicht selten selbst zur Feder und schrieb, wie es sonst nur einem Schreiber zukommt. Caesaren sind merkwürdige Leute. Ich werde mich jedenfalls hüten, zu seinen Lebzeiten einen Blick auf die Rollen zu werfen.
Als er mir die vierte Schrift überreichte, fragte Augustus jedoch nach dem Verbleib der übrigen. Und als ich ihn beruhigt hatte, trug er mir auf, die täglichen Pergamente zu nummerieren, aber nicht in der üblichen Weise von vorn an, sondern, beginnend von hundert, nachfolgend neunundneunzig, achtundneunzig, und so weiter, denn – sagte er – dies entspreche der Anzahl der Tage, die ihm verblieben.
»Ad libitum«, sagte ich, »wie’s beliebt«, aber kaum hatte ich das ausgesprochen, wurde mir die ganze Tragweite seiner Worte bewusst: Der Alte glaubte, nur noch hundert Tage zu leben. Wahrscheinlich hatte ihn einer der Vorzeichendeuter, an die er seit jeher glaubte, wieder einmal in Panik versetzt. Ich halte es eher mit dem alten Cicero, der sagt, Schicksal sei nicht das, was uns die Vorzeichendeuter versprächen, sondern das, was uns das Leben zuteile. Aber vom Wahrsagen lässt es sich trefflich leben, vom Wahrheitsagen weniger. Dabei ist Augustus ein hochgebildeter Mann, der seinen Platon, Aristoteles und Epikur in griechischer Sprache zitieren kann, von seinen eigenen Dichtern ganz zu schweigen, die er kennt wie kein Zweiter – ich meine Horaz, Vergil und den unglücklichen Ovid.
Der Auftrag des Caesar, die Schriften zu nummerieren, stürzte mich in nicht geringe Verlegenheit. Denn als ich die Schriftrollen aus dem Versteck geholt hatte, da überkamen mich Zweifel, welche die erste gewesen war und das C für centum tragen sollte. Ich schwöre bei meiner rechten Hand: Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine einzige Schriftrolle geöffnet, obwohl jede nur mit einem einfachen Band verschnürt war. Ich schwöre. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als alle vier Pergamente zu öffnen, nur so konnte ich hoffen, die richtige Reihenfolge zu erkennen. Ja, ich gestehe, ich habe jedes einzelne Blatt gelesen – verschlungen habe ich jedes mit feuchten Händen. Ich hätte es nicht tun dürfen, ich weiß, aber ich gelobe bei meine, rechten Hand: Nie soll auch nur ein Wort über meine Lippen kommen von dem, was ich dabei erfuhr.
Glaubte ich bisher, der Erhabene sei ein Gott und halte in seiner Erhabenheit Zwiesprache mit den unsterblichen Göttern, so wurde mir beim Lesen seines Tagebuches klar, dass Augustus alles andere als ein Gott ist, wie Jupiter oder Apollon, ja dass er nicht einmal ein besonders beneidenswerter Mensch ist. Ich jedenfalls möchte nicht mit ihm tauschen! Nicht in meinen Träumen begegneten mir so ungewöhnliche Dinge wie Caesar in seinem Leben, und ich begreife nun, warum der Göttliche so versessen ist, alles mit eigener Hand niederzuschreiben. Wer gibt schon vorbehaltlos zu Lebzeiten seine innersten Regungen und seine geheimen Gefühle preis?
Wüsste ich nicht zuverlässig, dass Augustus selbst Nacht für Nacht seine Gedanken niederschreibt, man könnte meinen, Livius habe ihm in die Feder diktiert, wenn er die heroische Vergangenheit Roms der zügellosen Gegenwart gegenüberstellt. Ja, bisweilen glaube ich sogar, die pathetischen Worte Vergils zu erkennen und Horaz’ bildhafter Symbolik zu begegnen. Wen wundert’s, ist Augustus doch ein glühender Bewunderer des einen wie des anderen. Dass ihm hingegen der Name Ovids, den er nach Tomis verbannt hat, nicht aus der Feder kommt, muss eine tiefere Ursache haben als jene, die der öffentlich bekannt gemachten Verbannung zugrunde liegt.
Ich, Polybius, Freigelassener des Göttlichen Augustus, und des Schreibens kundig, verweise deshalb darauf, weil die Nachwelt zweifeln könnte an der Echtheit seiner Worte. Spätere Generationen sollen durch diese Schriften aber Augustus so erkennen, wie er wirklich war.
C
Beim Blitz des Jupiter, beim Pfeil der jungfräulichen Jägerin, beim Dreizack Neptuns, der über das Ägäische Meer gebietet, bin ich tollhausreif, dass ich heute, am Tage der Nonen des Maius, deren schlechter Klang mich zeitlebens abgehalten hat, irgendetwas Wichtiges zu beginnen, die Feder zwischen Daumen und Panzer meines Gesundheitsfingers klemme, der totsteif und fleckig von meiner Rechten wegsteht, um niederzuschreiben, was nie jemand erfahren sollte, weil es mein Innerstes betrifft, mein Denken und Wollen, mich: »Imperator Caesar Augustus Divi Filius«. Reicht mir Schierling gegen den Wahnsinn, der das reizbare Geschlecht der Dichter befällt, wenn das Weiße in ihren Augen funkelt, wenn Verborgenes aus ihrer Seele quillt, wenn dunkle Absicht sich klärt zur Erkenntnis. Hört, ich will kein Dichter sein, kein poeta aus Minervas Reich, auch Jamben will ich nicht schmieden, die das Wasser zum Ufer der Seligen – mögen sie den Namen Publius Vergilius Maro tragen, Quintus Horatius Flaccus oder jenen, den auszusprechen ich mich hüte seit sieben Jahren – die das Wasser nur vertiefen zwischen mir und jenen, welche, Bellerophon gleich, den Pegasus zu bändigen wissen mit göttlichem Zaumzeug. Selbst Titus Livius, alter Freund, selbst du, selbst Glanz und Würde deiner Sprache würden nicht genügen zur Erklärung meiner Taten, die den Erdkreis unserer Herrschaft unterwarfen und die, an ehernen Pfeilern auf dem Marsfeld und überall im Reich die Ernte von sechsundsiebzig Lebensjahren beschreiben: Res gestae. Was aber sind schon Zahlen, wenn es um ein Leben geht, wie oft sollst du ein Konsulat bekleidet haben oder die tribunizische Gewalt, wie viele Feinde musst du getötet, wie viel Land erobert haben, um dich glücklich zu nennen?
Ich, Imperator Caesar Augustus Divi Filius, der mehr Feinde gefangen, mehr Land erobert, mehr Ämter bekleidet und dem Volk mehr Geld gegeben hat als jeder vor meiner Geburt, ich nenne mich nicht glücklich, nicht an diesem Tag, an diesem Ort, habe ich doch mein einziges Kind verloren, von den Enkeln Gaius und Lucius in jugendlichem Alter ganz zu schweigen, und für alle Freunde schürte ich das Leichenfeuer. Beim Schreiben drücke ich die Hand gegen mein linkes Auge, weil seine Sehkraft der des rechten nachsteht und ohne diese Maßnahme Schwindel in meinem Kopf erzeugt; mein Gebiss ist schadhaft und – soweit vorhanden – schmerzverbreitend, rote Flecken auf Brust und Unterleib, von Ordnung, Form und Zahl wie das Siebengestirn, jucken bisweilen so heftig, dass ich ihnen mit dem Badestriegel begegnen muss. Regelmäßig wie die Gezeiten formen meine Nieren schmerzhafte Steine, deren Pein nur übermäßiges Trinken lindert, wodurch sie mit einem Schwall weißen Urins abgehen. Fürwahr kein erstrebenswertes Alter! Trost in diesem unerbittlichen Unabwendbaren ist nur die Erfahrung, dass die Götter den, den sie lieben, mit Leiden strafen. Wie anders wäre der Meuchelmord an meinem Oheim und Vater, dem Göttlichen Gaius Julius Caesar zu erklären, der an den Iden des März unter den Dolchen widerwärtiger Verschwörer fiel; wie das einsame Sterben des Sokrates, der, obgleich er keine einzige Schrift hinterlassen hat, als einer der Weisesten gilt?
Euripides, der Tragöde der Götter, wurde von thrakischen Hunden zerfleischt, Lukrez, der vortrefflicher von der Natur der Dinge schrieb als jeder andere Römer und der den Menschen die Angst vor dem Tode nahm, ebendieser musste in geistiger Umnachtung enden und sich selbst entleiben. Oder nehmt Aischylos, der bei Marathon gegen die Perser kämpfte; wie lächerlich leidvoll ist sein Tod! Ihm, der uns neunzig Tragödien schenkte, fiel schreibend eine Schildkröte auf den Kopf, dass er starb. Und selbst Diogenes, der glücklich gepriesene Philosoph, dessen Grab in Korinth das Marmorbild eines Hundes schmückt – seine Bedürfnislosigkeit bewundere ich, seine Sittenlosigkeit ist mir ein Gräuel –, selbst er fand, hochbetagt, keinen erstrebenswerten Tod, starb er doch, als er übermütig einen rohen Polypen verschlang. Der Dichter im fernen Tomis, der das Volk mit seiner »Liebeskunst« auf meine Kosten zu amüsieren glaubte, schreibt tränenbenetzte Klagelieder aus der Verbannung, und Quintus Horatius Flaccus, der, wie er selbst zu sagen pflegte, nur durch seine Armut zur Kühnheit verleitet wurde, sich als Dichter zu versuchen, er fand zwar sein Sabinum, doch warum trank er sich zu Tode, wenn er wirklich glücklich war?
Ich, Imperator Caesar Augustus Divi Filius, schreibe das in der Ahnung, dass auch mir kein besseres Ende beschieden sein könnte, obwohl doch gerade ich den Göttern mehr Tempel errichtet habe als jeder Mensch zuvor. Auf dem Palatin der Apollontempel mit seinen Säulenhallen ist mein Werk, auch der Tempel des vergöttlichten Julius und das Lupercal, die heilige Grotte des Faunus, wo Romulus und Remus von der Wölfin gesäugt wurden. Ich habe dem Circus Maximus ein Pulvinar angefügt, wo bei den Spielen die Götterbilder aufgestellt werden, auf dem Kapitol weihte ich Jupiter Feretrius und Jupiter Tonans einen Tempel; mir gebührt der Ruhm, den Tempel des Quirinus, jenen der Minerva, der Juno Regina und des Jupiter Libertas auf dem Aventin errichtet zu haben. Nicht zu vergessen das Laren-Heiligtum am höchsten Punkt der Via sacra, das Heiligtum der Penaten im Bezirk der Velia, den Tempel der Juventas, den Tempel der Magna Mater auf dem Palatin und jenen des Mars Ultor auf meinem eigenen Forum. Besinne ich mich recht, so habe ich allein zurzeit meines sechsten Konsulates zweiundachtzig Göttertempel renovieren lassen und hundert Millionen Sesterzen für Weihegeschenke an die unsterblichen Götter ausgegeben; denn wo die Götter wohnen, wohnt die Macht.
Gestern nun traf mich – ich hielt auf dem Marsfeld vor zahlreich versammeltem Volk das fünfjährige Reinigungsopfer – ein seltsames Vorzeichen, nicht eines von der blutigen Kunst, das aus den Eingeweiden eines Tieres wachsendes Vermögen weissagt (worüber sich schon Marcus Tullius Cicero lustig machte, indem er vorschlug, man solle sich ganz einfach ein für seine Zwecke passendes Opfertier aussuchen), nein, mein Prodigium sandten die Götter unerwartet vom Himmel, kaum blieb mir Zeit, mich unter dem Seekalbfell zu verbergen, das ich ständig mit mir führe, zum Schutz vor den Blitzen des Himmels. Lacht nur über die Flausen eines hinkenden Greises, dem auch hitzige Sandbäder und Schilfumschläge keine Linderung bringen, auch ich schätze die Naturwissenschaft, welche die Griechen, in Lauben wandelnd, Physiologie nennen. Noch mehr aber schätze ich die Vorzeichen der unsterblichen Götter, die, würden sie den Menschen nicht, das Zukünftige verkünden, infrage gestellt wären in ihrer Existenz; denn wüssten sie nicht um das Morgen, das doch von ihnen angeordnet und bestimmt wird, so gäbe es keine Götter, und unsere Tempel wären Tollhäuser, unsere Opfer aber barbarisches Brauchtum. Da sie uns aber Zeichen geben, und da diese Zeichen unser Schicksal bestimmen, kann keiner an den Unsterblichen zweifeln.
Traf das erste Vorzeichen noch lange vor meiner Geburt ein, als in Velitrae, meiner Väter Stadt, ein Blitz die Stadtmauer streifte, was nach den Worten der Auguren einem Bürger dieses Landstrichs größte Macht versprach, so wucherten in dem Jahr, als ich das Licht der Welt erblickte, wundersame edle Pflanzen auf dem Forum, und die Priester deuteten dies Gedeihen als Geburt eines Königs. Vom Senat war schon beschlossen, kein Neugeborenes in jenem Jahr aufzuziehen, Müttern ihre Kleinkinder zu entreißen und sie auszusetzen, doch hatten die Senatoren das Gesetz ohne die Mütter und alle schwangeren Römerinnen gemacht. Jede Einzelne hoffte nach dem Wunderzeichen, einen König zu gebären, und ihre Drohung, sich fortan allen Senatoren zu verweigern, blieb nicht ohne Auswirkung, jedenfalls wurde das Gesetz, obwohl beschlossen, nie in Erz gegraben, auch fand es nie den Weg zum Aerarium, sodass es nicht in Kraft treten konnte.
Atia, meine Mutter, berichtete mir, kaum den Kinderschuhen entwachsen, sie habe sich um Mitternacht in ihrer Sänfte zum Tempel Apollons begeben; betend in frommen Gedanken habe Somnus, der Musenfreund, ihre Lider geschlossen, und Atia sei in tiefen Schlaf gefallen. Wie im Amphiareion von Argos, wo die Menschen schlafend die Zukunft erträumen, habe der Gott ihr einen Traum gesandt: Ein Mann näherte sich zärtlich ihrem Leib, öffnete ihre bebenden Schenkel und drang machtvoll in sie ein. Lautes Geschrei habe Atia aus dem Traum gerissen; fromme Beter wollten eine Schlange gesehen haben, die behänd aus der Sänfte schlüpfte und im klaffenden Gestein des Tempels verschwand. Und obwohl meine Mutter sich wusch wie nach vollzogenem Beischlaf, blieb auf ihrem Leib ein Mal zurück ähnlich dem schlangenleibigen Erddämon Python, der von Phoebus Apollon siegreich bekämpft war. Im zehnten Monat darauf wurde ich geboren, ich, Imperator Caesar Augustus Divi Filius.
Mein Erzeuger Octavius hat glaubhaft versichert, er habe nach seinem Sieg über die barbarischen Besser im fernen Thrakerland das Orakel befragt, was mir, seinem spätgeborenen Sohn, zum Schicksal bestimmt sei. Die Priester im Hain des Liber pater hätten ihn Wein zu opfern geheißen über dem Altar, und als er ihn ausgoss, sei eine Flamme emporgeschossen bis über das Dach des Tempels hinaus, als habe er statt des Weines kochendes Pech ausgegossen. Nur der Große Alexander, hätten die Priester berichtet, habe seinerzeit Ähnliches erfahren, als er am selben Altarstein mazedonischen Wein darbrachte.
Noch bevor ich die toga virilis anlegte – das ist nun zweiundsechzig Jahre her – und keiner meinen Namen kannte, erschien ich bedeutenden Männern im Traum. So dem Marcus Tullius Cicero, der behauptete, alle Träume hätten einen Grund. Ihm träufelte Somnus aus dem mit Mohnsaft gefüllten Schlummerhorn folgendes Bild ins Gedächtnis: Ich glitt, ein lieblicher Knabe, an einer goldenen Kette vom Himmel und trat vor das Capitol. Jupiter empfing mich dort einladend und reichte mir eine Geißel zum Zeichen der Macht. Die Götter mögen mich strafen, wenn nur ein Wort erlogen ist: Cicero erzählte jenen Traum dem göttlichen Julius auf dem Wege zum Capitol, und als die beiden dort ankamen, deutete Cicero auf mich und rief erregt: »Das ist der Knabe, der mir im Traum erschienen ist!« Ich sah damals Cicero zum ersten Mal, ich schwöre es bei meiner rechten Hand, die diese Zeilen lenkt! – Quintus Catulus, dem Oberpriester, erschien ich in zwei aufeinanderfolgenden Nächten als Knabe. Der erste Traum zeigte mich spielend am Altar des Jupiter Optimus Maximus, und der Herr des Himmels winkte nach mir und legte ein Standbild der Göttin Roma in meine Arme. In der folgenden Nacht durchkreuzte ich erneut die Traumgesichte des Priesters: Ich saß auf dem Schoß des Jupiter Capitolinus, und Quintus Catulus wies die Tempeldiener an, mich herunterzuholen; Jupiter wehrte ab mit beschwichtigender Geste: Dieser Knabe solle zum Heil des Staates erzogen werden.
Ich selbst kenne all das nur vom Hörensagen, aber jene, die es vermelden, versichern es glaubhaft, wie jene Geschichte aus frühester Kindheit, als ich noch in der Wiege lag. Bestürzt reckte eines Morgens meine Amme die Hände zum Himmel: Ich war verschwunden. Suchtrupps schwärmten nach allen Seiten aus und fanden mich schließlich auf einem Turm, der aufgehenden Sonne zugewandt, wo ich den quakenden Fröschen gebot, ihr Morgenkonzert zu beenden. Was rede ich – mein kindliches Stammeln zeigte Wirkung wie der Donner Jupiters: Noch heute wagt kein Frosch an dieser Stelle das breite Maul zu öffnen zum lärmenden Quaken.
Dies alles schicke ich voran der folgenden Absicht, mein Leben auszubreiten wie ein Fischhändler die Früchte des Meeres; denn, obgleich an Vorzeichen gewöhnt, traf mich gestern, am Tag vor den Nonen, das furchtbarste Vorzeichen von allen – jedenfalls deuteten es die Priester so, und es steht mir nicht an, ihre Deutung zu leugnen. In der Glut des nahenden Abends zuckte ein Blitz aus schwarzfarbiger Wolke, suchte zielstrebig den glänzenden Marmor des Forums und streifte glühend mein ehernes Standbild mit erhobener Hand. Dort aber, wo am Fuße des Götterbildes goldene Lettern verkünden Imperator Caesar Augustus Divi Filius, trat der leuchtende Strahl aus der Schrift hervor wie der Kopf einer Natter das Frettchen verschlingend, schoss krachend und stinkend in den Boden und versetzte jene, die es aus der Ferne beobachteten, in Schrecken. Mochten die Seher ein solches Prodigium aus der Ferne noch Glück verheißend deuten, weil das Licht Jupiters das Licht der Erde gesucht habe, so wandelte sich im Näherkommen das Glück in tiefes Leid: Der glühende Strahl hatte aus meinem Namen das C geschmolzen, sodass der Stolz meines Namens zu einem hässlichen »aesar« verkümmert war. Das geschmolzene C, deuteten die Priester, hieße Centum, also hätte ich noch hundert Tage zu leben, aesar aber stünde in der Sprache der Etrusker, welche die Gabe der Weissagung zu uns brachten, für »Gott«, ich würde also nach hundert Tagen unter die Götter aufgenommen.
Soll ich zweifeln an diesem Zeichen, das einzigartig ist unter den Menschen, soll ich glauben, mein Leben währe ewig? Ewig wird nur mein Name sein. Imperium sine fine dedi. Mein Haus ist bestellt. Die Vestalischen Jungfrauen bewahren seit einem Jahr das Testament, welches ich teils meinen Freigelassenen Polybius und Hilorion in die Feder diktiert, teils mit eigener Hand gefertigt habe, damit niemand an seiner Echtheit zweifle. Und weil ich nicht wusste, wie viel Zeit mir die Götter gewähren würden, habe ich schon in meinem sechsten Konsulat zwischen Tiber und Flaminischer Straße ein Mausoleum errichtet zur Aufbewahrung meiner Asche. Es ist ein Weltwunder und steht jenem des Königs Mausolos in Halikarnass weder in Größe noch in Pracht der Ausstattung nach. Dass ich alle Nachkommen meines Blutes im Marmor dieses Bauwerks bestatten musste – Marcellus, den Sohn meiner Schwester Octavia, der mit meiner liederlichen Tochter vermählt war und den ich liebte wie meinen Sohn, und Gaius und Lucius, meine treuen Enkelsöhne –, mag nur bestätigen, was ich schon sagte, dass die Götter mit Leid nicht sparen gegenüber jenen, denen sie Göttliches zugedacht haben.
Nein, hundert Tage, die mir von den Unsterblichen noch zugedacht sind, sind eine lange Zeit, wenn man sie nützt. Carpe diem. Horatius Flaccus, des Lebens größter Künstler von allen, lehrte mich vieles, hatte er doch für jeden Schicksalstag Passendes parat; beneidenswert, welch ein Träumer! Er hat mich gelehrt, den Tod nicht zu fürchten, und so fürchte ich nicht das Ende dieser hundert Tage. Der Dichter sagt, den Tod brauche man nicht zu fürchten, er gehe weder die Lebenden an noch die Toten. Für die Toten existiere er ohnehin nicht – ein Toter könne nicht sterben –, und für die Lebenden sei er noch nicht vorhanden. Denke ich darüber nach, so wächst die Klarheit, dass auch ich nicht den Tod fürchte, sondern eher die Vorstellung des Todes. Warum aber soll ich mir Gedanken machen über Dinge, von denen ich nichts weiß? Das wäre töricht.
So lebe ich denn hundert Tage, des Lebens gedenkend, nicht des Sterbens, will lachen, nicht weinen (etiamsi est quaedam fiere voluptas – ihr kennt ihn, der das sagte), will Bacchus den Becher reichen und singen, will hüpfen im Reigen mit gerade erblühten Mädchen – soweit Livia es zulässt; und meinen schrumpeligen priapus eifrig gebrauchen – soweit Livia es möglich macht. Vor allem aber will ich Buch führen und meine Gedanken niederschreiben, jeden Tag. Ich will Selbstbetrachtungen anstellen und erklären, warum ich dieses getan, jenes gelassen habe, bemüht sein, das Untere nach oben zu kehren, Unbedeutsames Bedeutsamem vorzuziehen wie das Innere dem Äußeren. Nicht verschweigen will ich die Wahrheit, die ganze Wahrheit (weil die halbe gefährlicher ist als jede Lüge), damit ich, Imperator Caesar Augustus Divi Filius, nicht auf den Stufen zum Olymp vom Flügelschlag der eigenen Vergangenheit getroffen werde. Nicht will ich zählen nur die heiteren Stunden – waren die tristen nicht gar in der Überzahl? – und behaupten, fern jeden Irrtums zu sein: Quandoque bonus dormitat Homerus. Einmal, gewiss, schläft auch der untadelige Homer; aber gelten nicht gerade für den Größten besondere Gesetze? Hier stocke ich schon beim Wort »der Größte«, das wohl stets relativ ist. Denn ist einem Hellenen Homer »der Größte«, so ist es einem vir vere Romanus Vergil.
Welcher Herrscher aber erscheint einem Römer als »der Größte«? Die Griechen, deren Gedanken schlau sind wie Schlangen, deren Tun aber träge geworden ist wie ein Krokodil, sie meinten, den Größten gebe es nie, allenfalls den Größeren, und so will ich ihnen beipflichten, will mich den Größeren nennen, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich genau weiß, dass meine Feinde frohlocken, meine Freunde aber enttäuscht sein werden.
Freunde? – Hier stocke ich zum zweiten Mal. Viele Freunde gehen in ein kleines Haus, ein großes kennt nur wenige. So zähle ich die Freunde an den Fingern einer Hand, zumindest die von jener Art, die von Aristoteles als eine Seele in zwei Körpern beschrieben wurde. Schmeichler hatte ich genug, zeit meines Lebens. Du kannst sie kaufen auf dem Markt wie Äpfel aus Campanien, und sie beherrschen die Kunst, dir das zu sagen, was du von dir glaubst, vortrefflich. Wer solche Freunde schätzt, ist ihrer würdig. Ich habe es immer so gehalten: Der Schmeichler war mein Feind, der Kritiker mein Lehrer, ja ich bin mir bis heute nicht im Klaren, wer das größere Unheil anrichtet, die Freunde mit den besten Absichten oder die Feinde mit den schlechtesten. Post mortem aber, da bin ich sicher, werde ich mehr Freunde haben, als ich Hände schüttelte in sechsundsiebzig Jahren.
Der Arm wird schwer, das Auge träumt, das Öl verbrennt; so will ich denn den hundertsten Tag vor meinem Ende beschließen. Neunundneunzig Tage sind eine lange Zeit, sich zu erinnern.
XCIX
Wäre ich Jupiter, jede Nacht würde ich meine Hand gebietend erheben und der Mutter des Schlafes, des Todes und der Träume Einhalt gebieten. Wie Jupiter luststöhnend in den Armen Alkmenes, des thebanischen Königs geiler Gemahlin, den Herakles zeugend im Handstreich die Nacht verdoppelte, so würde ich sie verkürzen auf einen Augenblick, denn zählst du die Tage erst, wird das Licht immer knapper, die Finsternis aber scheint dir unendlich. Trübe Gedanken gebiert die Nacht. Als Jüngling lobst du abends schöne Tage und morgens schöne Frauen, als Greis aber findest du zum Ersten keinen Anlass, zum Zweiten kaum Gelegenheit. Man schleppt dich in einem Tragsessel von einem Ort zum anderen, weil deine Anwesenheit als unabdingbar gilt, doch mit den Jahren erkennst du wohl, dass nicht du es bist, mit dem man Umgang pflegt, sondern nur dein Name. Wäre ich heute noch jener, als der ich, wie behauptet wird, gegen meinen Willen, geboren wurde, kein Mensch scherte sich um den Sohn dieses C. Octavius und der Atia, obwohl sie eine Nichte des Göttlichen C. Julius Caesar war. So aber als Augustus, als Imperator Caesar Divi Filius sucht mich jeder, um einen Strahl vom Glanz meines Namens zu erhaschen, nicht in Verehrung des Erhabenen, im Gegenteil, das geschieht, um sich selbst zu erhöhen.
Als Pontifex, als Praefectus urbi feriarum Latinarum causa – ich erinnere mich wohl – suchte keiner meine Nähe, schalt man mich doch einen Emporkömmling aus nicht gerade vornehmer Familie, aus der Provinz gar, obwohl doch gerade Saturnia Tellus, die ländliche Erde Italiens, die Größten hervorgebracht hat in der Gegenwart. Atmete nicht der göttergleiche Vergil zuerst die klare Luft im nördlichen Mantua? Nahm nicht Horaz im apulischen Venusia seinen Anfang? Und der Alte Livius – ab imo pectore, er ist vier Jahre jünger als ich – kam er, der die Geschichte Roms in 142 Büchern beschrieben hat nach dem Ablauf der Jahre, kam er nicht aus Patavium, einer Stadt, über die man in Rom die Nase rümpft? So gereicht es mir beinahe zur Ehre, dass meine Mutter Atia mich, obwohl in Rom unter dem Konsulat des Marcus Tullius Cicero und des Marcus Antonius zur Welt gekommen, in den Albaner Bergen aufzog, in Velitrae, das den Römern länger die Stirn bot als alle anderen Provinzstädte.
Dem, der mich gezeugt hat – auch Götter bedürfen der Zeugung – verdanke ich nichts, und deshalb nenne ich ihn auch nicht »Vater«; denn nicht der, welcher den Samen legte, ist dein wirklicher Vater, sondern jener, der sich zu dir bekennt. Also trage ich nicht den Namen Gaius Octavius und den Beinamen Thurinus wie jener erste Gemahl meiner Mutter, weil er bei Thurii erfolgreich die flüchtenden Sklaven geschlagen. Oder hat es je einer gewagt, mich mit diesem Namen anzureden? Quos ego!
Ich zählte noch keine fünf Jahre, da starb Octavius in Nola. Wer Trauer ernten will, muss Liebe säen: Ich trauerte nicht. Ich trauerte erst, als Atia, kaum war das Trauerjahr verstrichen, sich L. Marcius Philippus zuwandte, dem heimkehrenden Statthalter von Syrien; denn nie fand ich meine Mutter schöner und begehrenswerter als in diesem kurzen Jahr der Trauer, in dem sie die Haare offen trug wie eine Hafenhure. Nie wieder überkam mich ein so wohliges Gefühl wie damals, wenn sie zärtlich mich zu Bett brachte und ihre goldenen Haare auf mich herabfielen wie das lichte Geäst einer campanischen Birke. Dann berührte ich ihre schweren Brüste, und sie verwehrte nicht, sie zu streicheln, weil sie meinte, dass ich ein Kind sei. Kindsein aber ist keine Frage des Alters, und so wie mir später vom Senat erlaubt wurde, alle Ämter zehn Jahre vor der gesetzlichen Zeit zu bekleiden, war ich schon in den Tagen der Kindheit ein Mann. Ich folgte Atia heimlich, wenn sie zum Umkleiden in ihr cubiculum ging und die Fibeln auf ihren Schultern löste, und ihre Nacktheit erregte meinen priapus mehr als Honig meine Zunge.
Dieser kindlichen Wollust hat L. Marcius Philippus mich beraubt, als er meine Mutter heiratete, und noch heute hasse ich ihn dafür. Wenngleich Marcius treu auf der Seite meines wahren Vaters Caesar stand, strafte ich ihn mit tiefer Missachtung. Hatte er mir schon die Mutter genommen, so versuchte er mich auch um meinen wahren Vater zu bringen, indem er mich drängte, das Erbe Caesars auszuschlagen. Ich war damals ein junger Mann und trug die toga virilis noch keine fünf Jahre, ein Alter, in dem dein Sinn biegsam ist wie eine Weidenrute. Ich schwankte, ihm zu folgen, aber der Wunsch meines Göttlichen Vaters, seinen Namen zu tragen, und die überlieferten Rechte seiner Familie ließen mich alle Bedenken vergessen.
Viele haben mir damals vorgeworfen, es sei mir um nichts anderes als um das Vermögen des Göttlichen gegangen, das er mir zu drei Vierteln zugesprochen hatte, jedenfalls verbreiteten dies die Gefolgsleute des Gnaeus Pompeius. Heute weiß ich natürlich, warum sie Gift und Galle spuckten: Gaius Julius Caesar, mein göttlicher Vater, änderte sein Testament viele Male, um es anschließend der ältesten Vestalischen Jungfrau zur Aufbewahrung im Tempel zu übergeben; und Soldaten, mit denen er oft seinen letzten Willen besprach, versicherten glaubhaft, noch ein halbes Jahr vor seinem Tod habe Julius den Pompeius als Haupterben bedacht. Mir aber bedeutete die Aufnahme in das Julische Geschlecht mehr als ein paar Millionen Sesterzen; denn, mochte er auch gestorben sein, in Gaius Julius Caesar war mir ein Vater erstanden, größer als alle Väter, ein Vater, dessen Ahne Julius ein Sohn des Aeneas und dessen Stammmutter Venus Genetrix war. All das wollte mir der zweite Mann meiner Mutter vorenthalten. Und dafür soll ich ihn nicht hassen?
Es ist um die neunte Stunde, und brütende Hitze liegt über der Stadt. Ich habe den Türsklaven beauftragt, niemanden vorzulassen, auch Livia nicht, damit mein leichter Schlaf zur Mittagszeit nicht gestört werde. Ich will nicht; dass irgendjemand mein heimliches Tun wahrnimmt, ich will nicht, dass meine Aufzeichnungen bekannt werden, solange ich atme. Solange ich lebe, will ich der bleiben, zu dem mich Senat und Volk von Rom gemacht haben, Pater patriae, Pontifex maximus, der Erhabene, genannt Imperator Caesar Augustus Divi Filius.
Solange ich lebe, sollen die Tugenden meiner Regierung erhalten bleiben: Ehrlichkeit, Friedfertigkeit, Ehrenhaftigkeit, Schamhaftigkeit und Tugendhaftigkeit, und niemand muss erfahren, dass auch der Erhabene falsch, zänkisch, unaufrichtig, geil und unmoralisch handelte, weil auch er nur ein Römer war, ein vir vere Romanus.
Außerdem: Quod licet Jovi, non licet bovi, und schließlich darf ich mir zugutehalten, dass das Reich nicht von Gedanken regiert wird, sondern von Taten. Gedanken sind die Knospen, Taten die Früchte eines Baumes. Ich war stets ein Mann der Tat. Hätte ich damals, als alle mir rieten, das Erbe Caesars auszuschlagen, weil Marcus Antonius, der Hund, sich das Geld des Göttlichen angeeignet hatte, während ich nichts ahnend in Apollonia weilte, lange nachgedacht, so wäre meines Vaters Letzter Wille nie in Erfüllung gegangen. Man hätte mich später in eine Reihe gestellt mit den Caesar-Mördern, und ich zweifle, ob die ruchlose Tat je gesühnt worden wäre. So aber zog ich mit meinen Freunden M. Agrippa und Q. Salvidienus Rufus von Apollonia, wohin mich mein Vater zur Vorbereitung eines Partherfeldzuges entsandt hatte, nach Brundisium. Wir setzten über mit einem Schiff, in dem alle für den Feldzug vorgesehenen Gelder verstaut waren, doch reichte die Summe bei Weitem nicht, um der Verfügung des Göttlichen nachzukommen, an alle Bedürftigen Roms (es mögen 150000 gewesen sein) je 300 Sesterzen zu verteilen. Also versteigerte ich einen beträchtlichen Teil meines Privatvermögens und erfüllte so den Letzten Willen meines Vaters Gaius Julius Caesar. Marcus Antonius hatte in der Annahme, ich würde die Erbschaft nicht antreten, das Vermögen meines Vaters bereits durchgebracht, indem er seine eigenen immensen Schulden bezahlte und großzügige Bestechungsgelder ausgab.
Antonius gehörte zu jener Art von Freunden, die man besser nicht hat. In Art und Charakter unterschied er sich kaum von seinem Vater, einem habgierigen, vergnügungssüchtigen Mann, der postum den Spottnamen Cretius erhielt, weil er auf Kreta von Seeräubern erschlagen worden war. Wie der Vater, so der Sohn: Antonius raffte zwar das Vermögen meines göttlichen Vaters an sich, die Verpflichtungen aber überließ er mir. Ich war damals einfach zu jung, um diesem hinterhältigen Menschen die Stirn zu bieten.
Ich war es, der dem Göttlichen den Scheiterhaufen nahe dem Grabmal der Julia errichtete. Ich habe die Rednerbühne auf dem Forum mit einem Prunkbett geschmückt, von dem das besudelte Gewand herabhing, in dem er ermordet worden war. Ich habe heiße Tränen geweint, als das Leichenfeuer loderte, und jeder konnte es sehen. Ich war es auch, der die von meinem Göttlichen Vater gelobten Spiele zu Ehren der Venus durchführte, obwohl der Senat sich dagegen ausgesprochen und mir angedroht hatte, mich zur Rechenschaft zu ziehen für diesen »Frevel«. Als aber am ersten Tag der Spiele um die elfte Stunde ein Komet am Himmel erschien und diese Erscheinung sich an allen zehn Tagen der Spiele wiederholte, ja als Botschaften aus allen Teilen des Reiches eintrafen, man habe den Göttlichen zum Himmel fahren sehen, einen breiten Silberstreif hinterlassend, da lobten auch jene, die mich vorher getadelt hatten, meine Sohnestreue, und die Himmelserscheinung wurde sidus Julium genannt.
Neunzehn Jahre war ich damals alt, oh käme sie wieder diese Jugend, neunzehn ungestüme Jahre, und ich drängte den Senat, mich in seinen Reihen aufzunehmen. Nie hatte ein Römer, jünger als ich, die Stufen geteilt mit den Patres conscripti. Ja, ich erinnere mich wohl, dass ich froh war, den Trauerbart zu tragen entgegen meiner Gewohnheit, weil ich glaubte, mein Milchgesicht würde leuchten wie eine Frühlingsblume im trockenen Herbstlaub. Aber so ist das im Leben eines Mannes: Die eine Hälfte bist du streng bedacht, dass man dein wahres Alter erkenne, die andere wünschtest du, man möge dich ruhig etwas jünger schätzen. Dein wahres Alter lebst du nie.
XCVIII
Am zweiten Tag vor den Iden des Maius schreibe ich dieses: Kaum war die Asche meines Vater erkaltet, traf mich ein neuer Schicksalsschlag, furchtbarer als alles, was mein Leben bisher erschüttert hatte. Die Feder spreizt sich, der Schreibfluss stockt, wenn ich mich erinnere, und Tränen quellen aus meinen Augen. Ich weine, ich schäme mich nicht. Ja, ihr sollt wissen, wie sehr ich meine Mutter liebte, sie vergötterte. Atia, Geliebte, warum gingst du von mir, schön in der Blüte deines Lebens? Was hätte ich gegeben, deine Wärme länger zu spüren, nur ein wenig länger, als dir von Morta vergönnt war, die den Lebensfaden abschneidet. Nennt mich ruhig »Schwellfluss« wie den unglücklichen König von Theben, der seine Mutter Iokaste liebte wie sich selbst, das kränkt mich nicht. Warum auch? Ich habe nie eine Frau mehr geliebt als Atia. Oh wäre mir die Macht Apollons gegönnt, welcher der schönen Jungfrau Deiphobe so viele Lebensjahre versprach, wie ihre Hand Sandkörner zu fassen vermochte! Wie Apoll die Jungfrau hätte ich meine Mutter umgarnt mit dem Begehren kindlicher Lüsternheit, hätte Voluptia tagtäglich Täubchen geopfert und Vesta den zehnten Teil meines Goldes, hätte Favonius beneidet, den zeugungsfähigen Westwind, der in den Falten ihrer Tunika spielte, und an den Floralien, die fünf Tage lang jeder Frau das Neinsagen verwehren, hätte ich sie besprungen wie der bocksfüßige Faunus.
Hättet ihr je ihre hohen Schenkel berührt, das Weiß ihrer Schultern und ihre breiten Brüste, wäret ihr nur ein einziges Mal liebkost worden von ihren langen schmalen Fingern und hättet ihr den Duft ihres Haares geatmet, ihr würdet meine Glut nicht verlachen. Noch heute, beim Wein und Meditieren alt geworden, presse ich nachts, wenn Skythen und Cantaber meinem Kriegsglück Rache schwören, sodass an Schlafen nicht zu denken ist, meine Schenkel gegen den parischen Marmor ihres Standbildes von griechischer Hand. Das bedeutet mir mehr als alle Buhlkunst libyscher Dirnen, deren spitze Brüste mich ohnehin mehr zum Lachen reizen als zur Wollust.
Glücklich der Jamben schmiedende Dichter, dem auf den Hügeln des Esquilin meinem Wunsch gemäß ein gebührendes Grabmal errichtet ist, glücklich, weil er von Geschäften fern, das Forum meidend, Äpfel erntete und selbst gepfropfte Birnen und Trauben wie Purpur, glücklich aber vor allem, weil er die Ranken des Weinstocks den Windungen eines Weibes vorzog, welche dieses unter dem Speer eines Mannes vollführt. Du kennst nicht die Qual eines schuldvoll verliebten Jünglings, der Küsse zu spenden bereit ist dem rasend verehrten Körper, aber nur Mitleid erntet und herablassende Beschwichtigungen aus dem Munde der Mutter. Hat dich, Horatius Flaccus, die im Schimmer der Sterne geborene Melpomene um den Verstand gebracht, als sie dir lächelnd die tragische Maske reichte, so wurde ich gefangen von Atias Locken, dem Haar meiner Mutter. So hat jeder seine Melpomene.
Pythagoras auf der Suche nach dem Geheimnis der Zahlen mag sein Hirn nicht mehr gemartert haben als ich, forschend, ob meine Mutter Atia wusste, wie es um mich bestellt war. Mit zunehmendem Alter schwinden zwar die Taten, die Gedanken aber wachsen. Und doch sinne ich ohne Antwort, welche die bessere Mutter genannt werden kann, jene Atia, die den Wallungen ihres Sohnes nachgegeben hätte, oder jene, die sie stolz nicht zur Kenntnis nahm. Hätte das eine die Erfüllung meiner Träume bedeutet, so ist dem anderen die Qual meines Lebens erwachsen. Dem vagabundierenden Helden Aeneas gleich, dem Jupiter im ackerreichen Karthago verbot, von Dido, der unvergleichlichen Königstochter, zu kosten, so irrte auch ich durch das andere Geschlecht. Was nicht sein durfte zwischen Aeneas und Dido und was die römisch-punische Feindschaft nach sich zog, war für mich Grund genug, Frauen stets mehr Feind zu sein als Gefährte.
Allein gelassen von der geliebten Mutter verdrängte ich das geheime Verbrechen mit sündigen Tändeleien, suchte dem reifen Alter Atias die Jugendblüte der Kindheit entgegenzusetzen und zeigte mich nicht abgeneigt, als Publius Servilius Isauricus, Prokonsul der Provinz Asia und dem Göttlichen wie mir in gleichem Maße zugeneigt, mir seine Tochter andiente, ein Reh mit dunklen Augen wie Glasfluss. Was aber nützt dem Stier der Liebreiz des Kalbes, wenn er die Kuh sucht mit wogendem Euter? So saßen wir uns schweigsam gegenüber, und weder die rührende Nacktheit ihres mädchenhaften Körpers noch der scharfe Duft von Räucherstäbchen vermochten uns näherzubringen. Ich ließ sie ziehen wie ein siegreicher Gladiator, der, dem Wink des Imperators gehorchend, auf den Todesstoß verzichtet. Stattdessen gab ich ihr Gold, ihrem Vater aber das folgende Konsulat.
Sie war fünfzehn und für mich viel zu alt, schien mir. Deshalb ließ ich mir Claudia ins Bett legen, des Publius Claudius Töchterlein, zehn Jahre alt, nicht älter, und einem Zwanzigjährigen wie mir gerade recht. Beim Glück verheißenden Becken der Venus, auch sie wurde mir aufgedrängt; Antonius hat mir das schüchterne Mädchen aufgehalst. Er war, mit Fulvia verheiratet, ihr Stiefvater und glaubte auf diese Weise unser Bündnis, das Triumvirat mit Lepidus, zu festigen. Mir fehlt die Erinnerung, und das Ereignis bleibt mir rätselhaft wie der Spruch der Sybille; denn aus dem Traum der Versöhnung erwachend erkannte ich: Ich war verheiratet – mit einem Kind. Bereitete mir schon die Fünfzehnjährige ernsthafte Schwierigkeiten, so scheute ich die Begegnung mit dem zehnjährigen Mädchen so sehr, dass ich nicht einmal den Flaum ihrer Venusgrotte berührte, obwohl sie mir diese jede Nacht darbot auf Geheiß ihrer Mutter Fulvia.
Viel lieber hätte ich mit dieser verrichtet, was mir aufgrund des Gelöbnisses mit ihrem Kind auferlegt war, denn Fulvia war eine erfahrene Frau, der drei Ehen und fünf Kinder das Aussehen Vestas verliehen hatten, die über das Herdfeuer wacht, und ihr Haar glich dem meiner Mutter Atia. Fulvia, deren Vater den Beinamen Bambalio trug, »der Stammler«, worunter sie so sehr litt, dass sie nur Männern höchsten Ranges ihre Gunst schenkte, wollte auch die Tochter versorgt sehen und sandte jeden Tag zu Auroras Stunde einen Boten, das befleckte Laken zu holen. Ich überlegte damals ernsthaft, eine Taube zu köpfen, um die ersehnte Sudelei zu beweisen, als aber Fulvia nach Ablauf eines Mondes unverschämt an mein Bett trat, mich dreist einen Schlappschwanz nannte, mich, Imperator Caesar Augustus Divi Filius, da warf ich sie hinaus samt ihrer Tochter und schickte den Scheidebrief hinterher, der Juno ein Kalb opfernd mit vergoldeten Hörnern.
Du, Maecenas, warst mir Trost, flüstertest hinter vorgehaltener Hand auf dem Forum (sodass man gewiss sein konnte, ganz Rom würde am folgenden Tag davon wissen), Claudia sei überhaupt noch nicht mannbar und deshalb von mir nie berührt worden. Naturalia non sunt turpia. Zum Beweis gleichsam zerrtest du mich durch die Lupanare beim Zirkus, schafftest Frauen herbei aus Meroe, deren Brust sich nicht unterscheidet vom Säugling, während keiner ihre lüsternen Lieder versteht. Zum Gastmahl ludest du mich mit Efeu bekränzten Knaben, ein jeder so schön wie Apoll von der Insel. Welch schrillen Gesang entlockte dein Gold ihren Kehlen, wenn sie Bacchus Euius imitierten, den Ekstatischen, welch helles Gelächter beim Mimen des Bacchus Lyaeus, der uns von Sorgen befreit!
Du glaubtest wohl mich umzudrehen an jenem Abend, alter Kuppler, hießest die enthaarten jonischen Knaben unter obszönen Possenversen – den Göttern sei Dank, dass Vergilius fehlte – die Füße der Gäste salben und ihnen grüne Ranken um die Waden binden. Alter Päderast! Wolltest mir weismachen damals, die Größten hätten sich allesamt einen Knaben gehalten für einsame Stunden: der untadelige Aristides, der tollkühne Alexander, der kluge Aristoteles, der weise Platon, selbst Sophokles und Aischylos, die Tragiker. Zeus habe den schönen Ganymed geliebt, Apollon den Hyakinthos, Poseidon den Pelops, Hephaistos den Peleus. Ich wurde verlegen, und angewidert wandte ich mich ab, als deine Lustknaben es sich auf einem Schaffell gegenseitig besorgten, angefeuert von unflätigem Gebrüll.
Und während ich in einer Ecke an den Becher mit rotem Falerner geklammert meiner Mutter Atia nachtrauerte, fühlte ich, wie sich der Leib einer Frau gegen meinen Rücken presste. Ich ließ es geschehen, ja ich erwiderte sogar das sanfte Drängen, ohne nach der Urheberin zu forschen – so wohl wurde mir in diesem Augenblick. Ich kannte auch die Stimme nicht, die spöttisch fragte, ob ich an schönen Knaben keinen Gefallen fände. Nicht, solange es solche Frauen wie dich gibt, antwortete ich und wandte mich um. Dabei endete die wohlige Annäherung so abrupt, dass ich der Unbekannten am liebsten sofort wieder den Rücken gekehrt hätte.
Sie aber erschrak. Bist du nicht Gaius Caesar?, sagte sie und wollte sich entfernen. Das ließ ich nicht zu, fragte nach ihrem Namen und erfuhr, dass sie Scribonia sei, die Schwester des Lucius Scribonius Libo, verheiratet mit einem Cornelius Scipio, nicht der Rede wert. Was soll ich sagen? Einen Monat später waren wir verheiratet.
Obwohl edler Abkunft war Scribonia eine Hure. Alle Frauen sind Huren. Haben sie erst einmal die Grenzen des Schicklichen überschritten – und in Rom begegnest du kaum einer Frau, die nicht dazu gezählt werden kann –, so tun sie es im Bewusstsein, gegen das Gesetz zu handeln und wider die Moral. Gerade das aber ist es, was ihnen höchste Lust bereitet; der Reiz des Verbotenen, das Verwerfliche, eben das, was man nicht tun darf. Nur deshalb spreizen Matronen ihre Schenkel für die Sklaven, nur deshalb suchen sie die besten Freunde ihrer Männer auf, nur deshalb verkleiden sich ehrbare Römerinnen, um in den Lupanaren beim Circus ihre Gunst zu verkaufen, und manch einer soll die eigene Frau besprungen haben unter seidig glänzender Maske.
Frauen und Wein haben vieles gemeinsam, jung und spritzig sind sie stets willkommen, ohne bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Beide bedürfen eines gewissen Alters, man spricht von Reife, um dir höchste Erfüllung zu bieten. Doch Vorsicht! Wie der Wein ein Alter erreicht, das seinen Geschmack nicht mehr steigert, von dem an er im Gegenteil schlechter wird von Jahr zu Jahr, so überschreiten auch Frauen den Zenit sehr schnell. Denke ich an Scribonia, so geschah dies von einem Tag auf den anderen seit dem Tag unserer Eheschließung. Die Ehe ist der Tod jeder Leidenschaft. Alles, was Scribonia tat, das tat sie mit dem Kopf, nichts mit dem Herzen. Heiratete sie mich, so geschah dies mit dem Vorsatz, Ansehen und Reichtum zu mehren, schlief sie mit mir, so ermahnte sie mich, einen Knaben zu zeugen, und trank, bevor sie es geschehen ließ, ein Gebräu aus Arsenogonon, dessen hodenähnlicher Samen dem des Ölbaums gleicht und als Knabenerzeuger gilt. Hätte dies Allerweltsmittel seine Wirkung gezeigt wie verheißen, mir wäre vieles erspart geblieben. So aber …
Ich muss hier unterbrechen, ich höre Livia. Sie soll nicht Zeugin meiner Gedanken sein.
XCVII
Um die dritte Stunde heute Morgen wachte ich auf, im Schweiße schwimmend wie eine Zwiebel im Saft, und hatte Angst. Es ist so schwer, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass einem der Tod nichts anhaben kann. Doch dann kam mir – der Morgen graute – auf einmal in den Sinn, dass nur der Törichte das längere Mahl dem kurzen, besser zubereiteten vorzieht. Waren nicht meine Tische stets reich gedeckt? Sie waren es, beim Jupiter, und es ist töricht, das längere Leben dem erfreulichen vorzuziehen. Leben?
Was ist das schon: Leben! Geboren werden aus der Mutter Schoß, gesäugt werden an ihren Brüsten, fortgestoßen in eine fremde Welt suchst du Halt an allem und jedem, Glück dir, wenn es gute Menschen sind, wegweisend für dein Werden! Schulmeister und Philosophen lehren dich, und du begreifst, Anpassung und Selbstverleugnung heißt das Ziel der Lehren, die Götter lächeln über derlei Qualen. Und ehe du dich versiehst, reißen die Wogen dich fort im Lebensfluss, den Ufern gehorchend, dir unabdingbar die Richtung weisend, und dein ganzes Bestreben bleibt, nicht unterzugehen. Der Fluss wird zum Strom, der Strom füllt den ewigen Ozean. Hast du ihn erst erreicht, übersät mit Blessuren, und findest du Zeit, dies zu bemerken, so suchst du nach Antwort auf die Frage, wozu du so machtvoll geschwommen bist um dein Leben, die Klippen meidend mit letzter Kraft und die reißenden Strudel, wo doch auch das Meer alle Kraft verlangt, dich über Wasser zu halten, und deine Kraft begrenzt ist gegen den Sog des dunklen Kokytus. Es war wohl der Sog der stygischen Wasser, den ich spürte heute Nacht, ich will es nicht leugnen.
Zurück zu Scribonia, der übergewichtigen Hure: Kaum hatte sie ihr Ziel erreicht, das Bett zu teilen mit dem Göttlichen, kaum hatte ich den göttlichen Samen in sie gelegt – Jupiter konnte kaum besser sein, als er Minos zeugte mithilfe Europas –, da zeigte das eben noch lüsterne Weib Unmut, nannte mich – ich geniere mich nicht – Muttersöhnchen, Schlappschwanz sogar und suchte streunend das Weite wie eine trächtige Katze, die des Katers überdrüssig ist. Ich ließ sie gewähren. O Venus Genetrix, die Anchises den göttergleichen Aeneas gebar! O sinnloser Arsenogonon-Samen! Eine Tochter wurde mir vor die Füße gelegt, und schon damals kamen mir Zweifel, ob ich überhaupt der Vater sei. Das Kind überließ ich der Brust einer illyrischen Amme, Scribonia aber den Müßiggängern beim Circus.
Von meiner Tochter Julia wird noch viel die Rede sein, und mit Gewissheit nichts Gutes. Entspricht es doch der Eigenart der Natur, dass der Mensch mit dem Kopf voran geboren wird, und römischer Sitte, ihn mit den Füßen voran zu Grabe zu tragen. Julia kam mit den Füßen voran zur Welt, als »Schwergeborene« wider die Natur, was als böses Vorzeichen gilt und noch keinem Glück gebracht hat, auch ihr nicht. Und gewiss wird man sie mit dem Kopf voran zu Grabe tragen, nur wird es nicht mein Grabmal sein – dafür habe ich gesorgt.
Ich zählte damals noch keine vierundzwanzig Jahre, aber ich soff mich, beim Bacchus, durch tausend Gelage. Tausend Schluck Wein opferte ich für den Gürtel der Venus, sie möge mir das Geschmeide überlassen wie einst Jupiter zur Stärkung der Liebeskraft, denn die Weiber verfolgten mich kreischend, Roma Dea, ich nahm sie, wie sie kamen: Pompeia, Antonia, Fulvia, die herbe Favonia und die nabellose Hersilia, Rhode mit dem breiten Becken, die Namen der meisten sind mir entfallen. Ruhm, müsst ihr wissen, macht sinnlich, und mein Ruhm stand damals in der ersten Blüte: Ich war Triumvir, hatte die Caesarmörder bei Philippi besiegt und Lucius Antonius im Perusinischen Krieg geschlagen, im Vertrag von Brundisium war mir der Westen des Reiches zuerkannt worden, mir Divi Filius. Dennoch glaube ich, der Ruhm eines Mannes beruht nur zum kleineren Teil auf dem eigenen Verdienst, zum größeren Teil verdankt er ihn der Hysterie der Weiber, die bestrebt sind, sich im Glanz des Erhabenen zu sonnen.
Bei einem der zahllosen Feste, die Maecenas auf dem Esquilin zelebrierte, ja, ich schreibe bewusst zelebrierte, weil jedes andere Wort eine grobe Vereinfachung darstellte, kam es zu jener erregenden Begegnung, die mein ganzes Leben veränderte. Noch heute, nach einem halben Centennium, ist der Duft in meiner Nase, den die knospenden Blüten in den Gärten des Freundes verbreiteten; denn Maecenas hegte alle Baumarten, die den erhabenen Göttern geweiht sind: für Jupiter die Wintereiche, für Apollon den Lorbeer, für Minerva den Ölbaum, für Herkules die Pappel, für Venus die Myrte.
Unter einem Myrtenstrauch – wer kennte nicht ihre weißen, blattachselständigen Blüten – traf ich Livia zum ersten Mal. Venus selbst hatte diese Begegnung gefügt: Lächelnd trat sie mir entgegen, ein Kind auf dem Wege zur Frau, neunzehn Jahre, verheiratet mit Tiberius Claudius Nero, und Mutter eines dreijährigen Sohnes. Was mir den Atem raubte, war ihr sinnlicher, schwangerer Leib. Stolz wie Venus Genetrix trug sie ihn nur mühsam verhüllt zur Schau, und noch heute finde ich keine Antwort auf die Frage, ob Zucht oder Unzucht ihre Haltung prägte.
Ich liebte diese Frau vom ersten Augenblick an, das Mütterliche ihres jungen Körpers, aber nicht nur dieses, wenngleich es mich in Raserei versetzte, dass ich sie noch am selben Tag mit aller Kraft meiner Lenden besprang. Zwar blieb mir versagt, was Amphitryon, dem Enkel des Perseus, gelang, der, nachdem Jupiter seine Frau Alkmene heimgesucht hatte, sie in der folgenden Nacht ein zweites Mal begattete (bekanntlich gebar sie Zwillinge, vom Gott den Herakles, vom Menschen den Iphikles), ich leugnete nie die Vaterschaft des Tiberius Nero. Vielmehr forderte ich von ihm das göttliche Weib, ja, ich forderte es und hätte mir auch mit Gewalt genommen, was mir im Einvernehmen verwehrt worden wäre. Doch der zeigte Einsicht, indem er mein Feuer erkannte, und ich heiratete Livia kurz nach den Iden des Januarius. Der Junge aber, der bald darauf zur Welt kam, erhielt den Namen Nero Drusus.
Jupiter! Seither sind zweiundfünfzig Jahre vergangen, und ich liebe Livia noch immer – soweit man eine Frau nach so langer Zeit noch lieben kann. Sie ist mir Mutter und Geliebte, sie begleitet mich auf all meinen Reisen. Dafür machte ich ihr zwei Städte zum Geschenk: Liviopolis im fernen Pontus, und Livias in Judäa. Was immer ich tat, Livia zeigte Verständnis. Litt ich, so litt sie mit mir. Ich glaube, mein Schmerz wegen des Kindes, mit dem sie von mir schwanger ging und welches unzeitig und tot geboren wurde, traf sie mehr als ihr eigener, und sie schickte mich zu anderen Frauen.
Obwohl ich nichts sehnlicher wünschte als einen Nachkommen, habe ich Livia nie Vorwürfe gemacht. Antonius Musa, mein Leibarzt, sagt, es gebe, trotz gegenseitiger Liebe, eine gewisse Abneigung der Körper, die wechselseitige Unfruchtbarkeit hervorrufe, bei Verbindung mit einem anderen Partner jedoch normale Nachkommenschaft ermögliche. Der Gedanke lässt mich nicht los. Cui dolet, meminit.
XCVI
Ich habe nachgedacht, und Antonius Musa meint, ich sollte mich nicht zieren; vielen Römerinnen vornehmen Geschlechts würde es zur Ehre gereichen, mir, Imperator Caesar Augustus Divi Filius, zu Willen zu sein. Ich bin ein Sohn des Göttlichen, und ein von mir gezeugter Sohn wäre ebenfalls göttlich! Bei Castor und Pollux, noch reicht meine Manneskraft! Mögen die Jahre Spuren hinterlassen haben in meinem Gesicht, meine Hoden sind prall. Massinissa, sagt man, der Numiderfürst, habe achtundachtzigjährig einen Sohn gezeugt mit der schönen Sophoniba, zehn hinterließ er insgesamt, als er starb mit zweiundneunzig Jahren. Und Cato, der Censor, bekam mit achtzig Jahren einen Sohn von der Tochter seines Klienten Salonius. Lachhaft, gerade jetzt an einen männlichen Erben zu denken, mit sechsundsiebzig Jahren, wo ich sicher bin, mein Erzeugnis nicht mehr in Augenschein zu nehmen. Sapere aude! Zeugte ich eine weitere Ausgeburt wie Julia, das Krebsgeschwür, noch im fernen Olymp würde ich klagen, oh wäre ich kinderlos geblieben und einsam gestorben.
Warum ich Julia so hasse? Julia ist das getreue Abbild ihrer Mutter; trotzdem habe ich sie geliebt, als sie ein Kind war. Man kann nur hassen, was man einmal geliebt hat.
Und es ist nicht der Hass, der die Menschen ins Verderben stürzt, sondern die Verachtung; denn Hass ist ein Gefühl – wenngleich in der verkehrten Richtung –, Verachtung aber ist ein Zustand. Gewiss, meine Enttäuschung war groß, erfleht doch der Landmann von Genetrix einen Sohn, der ihm den Pflug aus der Hand nimmt eines Tages, und der einfache Soldat strebt, auf erkämpftem Landstrich das Schwert dem Ältesten zu übergeben. Ich wollte nur das Beste für mein Kind, verlobte sie, noch nicht der Brust entwöhnt, mit Antyllus, dem Sohne Marc Antons. Doch fügte sich, dass Julia, kaum mannbar, sich mit Marcellus verband, meiner Schwester Octavias Sohn. Ich lag damals schwer krank danieder – es war in meinem neunten Konsulat – und ließ deshalb Agrippa das Fest ausrichten, meinen treuen Freund seit gemeinsamen Tagen in der Rhetorenschule.