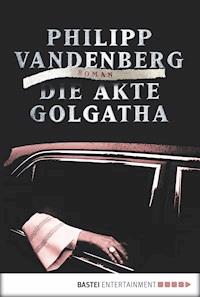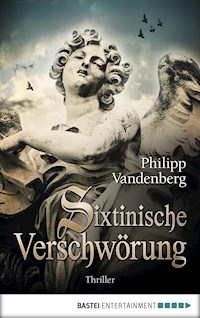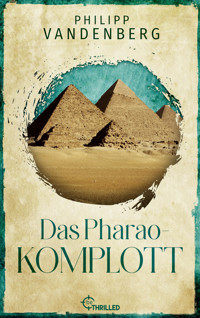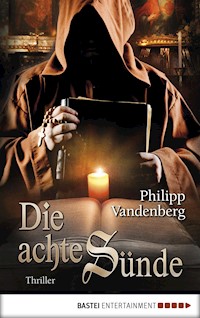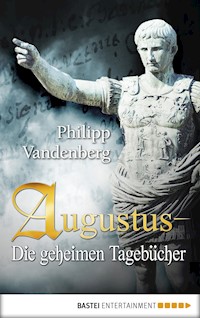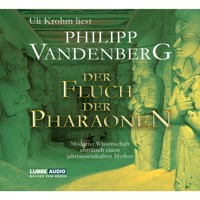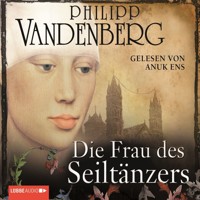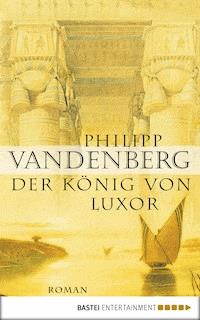
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1939 treffen sich in London drei Damen, die sich erst kurz zuvor auf der Beerdigung von Howard Carter, dem Entdecker des Grabes von Tut-ench-Amun, kennen gelernt haben. Jede von ihnen hat sein Leben beeinflusst: Sarah Jones, Carters Lehrerin und erste Liebe. Lady Evelyn Beauchamp, die behauptet, sie sei der Grund für Carters Reise nach Ägypten. Und Carters Nichte Phyllis Walker, die zu ihm stand, als sein Ruhm in Vergessenheit geriet. Jede kennt ein Versatzstück aus Carters Leben, das zur Lösung eines bis heute ungelösten archäologischen Rätsels führt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1041
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über den Autor
Philipp Vandenberg, geboren 1941, studierte in München Germanistik und Kunstgeschichte. Er arbeitete als Journalist bei großen deutschen Tageszeitungen und Illustrierten. Zum Bestsellerautor wurde er durch seinen Welterfolg Der Fluch der Pharaonen (Bastei Lübbe Taschenbuch Bd. 64067) und hat sich ebenso als Verfasser historischer Thriller wie Sixtinische Verschwörung (Bastei Lübbe Taschenbuch Bd. 11686) und aufsehenerregender Sachbücher wie Der Schatz des Priamos (Bastei Lübbe Taschenbuch Bd. 61423) einen Namen gemacht. Mit Ausgaben in über 30 Sprachen ist er einer der meistübersetzten Autoren der Gegenwart. Weltweit wurden über 16 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft.
PHILIPPVANDENBERG
DER KÖNIG VON LUXOR
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2001/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Daniela Bentele-Hendricks
Einbandgestaltung: Guido Klütsch, Köln
Bildmotiv: AKG, Berlin
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-5777-3
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
15. MÄRZ 1939
Natürlich regnete es auf der Fahrt nach Soho.
»Wie immer um diese Zeit!«, meinte der Taxifahrer entschuldigend und warf einen flüchtigen Blick durch die Scheibe nach hinten. Die alte Dame war eine gepflegte Erscheinung, wohlhabend, aber nicht reich, gerade so, dass man ein anständiges Trinkgeld erwarten konnte. Reiche Leute geizten mit Trinkgeldern, das war eine alte Erfahrung. Und nach zwanzig Jahren am Steuer konnte man ihm da kaum etwas vormachen.
»Das hat doch nichts mit der Jahreszeit zu tun!«, korrigierte die alte Dame den Fahrer. »In Notting Hill ist das Wetter viel besser. Es muss an Soho liegen.«
»Sie mögen Soho nicht, Madam?«, fragte der amüsierte Fahrer nach hinten.
»Warum soll ich Soho nicht mögen!«, entrüstete sich die alte Dame, »ich finde nur, dass es in Soho öfter regnet als anderswo.«
Der Taxifahrer ließ es dabei erst einmal bewenden, und sein Fahrgast widmete sich der Betrachtung der riesigen bunten Kino- und Theaterplakate an den Fassaden. Im »Leicester Square Kino« lief zum letzten Mal »Frankensteins Sohn« mit Boris Karloff in der Titelrolle. Im »Haymarket Theater« standen Rex Harrison und Diana Wynyard in »Design for Living« auf der Bühne, und im Piccadilly gegenüber dem Regent Palace Hotel brillierten Mackenzie Ward und Eileen Peel in dem Stück »French without Tears«.
Wie immer um die Nachmittagszeit waren alle Straßen um Piccadilly Circus verstopft; aber der Fahrer benützte einige Seitenstraßen und brachte plötzlich und für die alte Dame völlig unerwartet sein Taxi vor einem Hoteleingang zum Stehen.
»Einmal ›Ritz‹«, rief er vergnügt, »fünf Shilling, Madam!«
Er hatte sich nicht getäuscht, denn die Lady reichte ihm sechs und stieg aus, nachdem ein Portier in roter Livree die Wagentüre geöffnet hatte.
Sie wirkte unsicher in der Halle des »Ritz«, und sie gab sich auch keine Mühe, ihre Unsicherheit zu verbergen. Mit leichtem Kopfnicken nach allen Seiten erwiderte sie die Ehrbezeugungen des Personals. Schließlich steuerte sie mit kurzen Schritten energisch auf einen vornehm wirkenden Herrn im Frack zu, der ihr mit hinter dem Rücken verschränkten Händen entgegenlächelte.
Sein schütteres, silbergraues Resthaar war mit Brillantine der ovalen Kopfform angepasst und ließ ihn jenseits der fünfzig erscheinen. Trotzdem redete die alte Dame ihn mit den Worten an: »Junger Mann, führen Sie mich in den Tea-Room.« – Was den »jungen Mann« betraf, so pflegte sie jeden Mann so zu bezeichnen, der nicht älter war als sie.
»Zum Tea-Room, sehr wohl, Madam!«, dienerte der Angesprochene, und dabei machte er eine ausholende Armbewegung, als wolle er einen Halbkreis vor seinem Bauch beschreiben.
»Aber langsam!«, mahnte die resolute Dame und stieß mit ihrem Stock heftig auf den Teppich. Ihre Erscheinung hatte etwas von der herben Schönheit, die ein langes Leben in ein Gesicht zeichnet und die alten Damen einen eigentümlichen Reiz verleiht. Sie trug einen altmodischen Hut, der ihr etwas Unnahbares verlieh, und ein tailliertes, grünes Kostüm mit beinahe knöchellangem Rock. In der Halle des mondänen Hotels wirkte sie zweifellos etwas unmodern.
Aus der Glastüre, die zum Tea-Room führte, worauf ein Schild aus poliertem Messing hinwies, trat ihr ein Ober im Cut entgegen mit einer aufgesteckten Süßwasserperle im Plastron. Darüber hinaus war allein sein Gesichtsausdruck erwähnenswert, dessen Ernst und Strenge nur von jenem übertroffen wurde, welchen die Konservativen im Parlament seit geraumer Zeit an den Tag legten.
»Junger Mann«, sagte sie, noch bevor der gestrenge Ober etwas fragen konnte, »ich bin hier mit Lady Evelyn Beauchamp verabredet. Ich bin wohl zu früh?«
Entgegen jeder Erwartung erhellte sich das Gesicht des Obers, und in einem Anfall von Entzücken, den man ihm nie zugetraut und schon gar nicht erwartet hätte, erwiderte er: »Oh nein, Madam, die Damen sind bereits zugegen. Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«
Im Tea-Room glänzte dunkles Mobiliar, und der Raum wurde von gelben Lampenschirmen aus Schafsleder in diffuses Licht getaucht. Aus dem Halbdunkel löste sich eine Gestalt. Es war Lady Evelyn, die ihr entgegentrat. Ihr graues, zweireihiges Kostüm mit feinen hellen Streifen kleidete sie vorteilhaft, und ein Topfhut, den sie tief ins hell geschminkte Gesicht gedrückt hatte, verlieh ihr ein jugendlich-keckes Aussehen.
»Mrs. Jones!«, rief die Lady und streckte ihr beide Hände entgegen. »Wie schön, dass Sie gekommen sind.«
»Miss Jones, Mylady!«, korrigierte die alte Dame unnachsichtig. »Miss Jones. Ich war nie verheiratet, und ich lege auf meine alten Tage auch keinen Wert darauf, den Anschein zu erwecken. Bleiben wir also bei Miss Jones.«
Als sich die beiden gegenüberstanden, wurde deutlich, dass die Lady gut einen Kopf kleiner war als Miss Jones, was seinen Grund jedoch nicht in Miss Jones’ Größe hatte, nein, Lady Evelyn war wirklich klein gewachsen.
Lady Evelyn geleitete Miss Jones zu einem Ecktisch. Dort wartete bereits Phyllis Walker, gerade halb so alt wie Miss Jones. Obwohl von einnehmendem Äußeren, hatte sie sich in weite, graue Hosen und ein enges Jackett gekleidet wie ein Dandy. Auf dem Kopf trug sie eine Baskenmütze. Darunter ragten dunkle Locken hervor, die mit glänzendem Gel an die Stirn geklebt waren – keine außergewöhnliche Erscheinung in Soho, aber im »Ritz« ohne Zweifel etwas gewagt.
Vor zehn Tagen hatten die drei Frauen auf dem Friedhof von Putney einer höchst merkwürdigen Beerdigung beigewohnt. Übersehen konnten sie sich nicht, denn die Beerdigungsgesellschaft bestand nur aus acht Trauernden, den Vikar eingeschlossen, und das war trotz eines ehrenden Nachrufs in der London Times doch ein trauriges Ende für den berühmtesten Archäologen der Welt: Howard Carter.
Die Idee, sich im »Ritz« zum Tee zu treffen, stammte von Lady Evelyn Beauchamp und hatte ihre Ursache in einem kleinen Ereignis am Rande. Beim Verlassen des Friedhofs in Putney hatte sich Lady Evelyn noch einmal umgedreht und dabei einen Landstreicher beobachtet, von denen um diese Zeit Hunderte die wärmenden U-Bahnhöfe bevölkerten. Der Mann hielt kurz inne, dann warf er ein kleines Päckchen in das offene Grab und humpelte davon.
Auf Fragen, wer der Mann gewesen sei und welche Bedeutung sein seltsames Verhalten wohl habe, wusste niemand eine Antwort. Nur Phyllis Walker glaubte den Landstreicher zu kennen. Jedenfalls erinnerte er sie an einen Mann, der in Howard Carters Leben eine zwielichtige Rolle gespielt hatte.
Durch diese Bemerkung war die Neugierde der beiden anderen Frauen geweckt worden, zumal jede von ihnen glaubte, alles über Carter zu wissen, und so hatten sie den Entschluss gefasst, sich an diesem 15. März 1939 im »Ritz« zum Tee zu treffen und sich gegenseitig auszutauschen.
Das Gespräch begann schleppend, was zum einen im Alters- und Standesunterschied der Damen liegen mochte, andererseits kannten sie sich kaum, aber da war dieser Howard Carter, dem jede dieser drei Frauen auf ihre Weise verbunden gewesen war. Das kundzutun, bedurfte einer gewissen Überwindung.
»Was meinen Sie, meine Damen«, begann Lady Evelyn, um das peinliche Schweigen zu überbrücken, »wird es Krieg geben?«
Phyllis hob die Schultern. Sie wusste keine Antwort.
Miss Jones hingegen ereiferte sich: »Die Zeitungen sind voll von Berichten über Flottenmanöver im Atlantik und Truppenbewegungen in ganz Europa. Der König und die Königin besuchen jeden Tag eine andere Flugzeugfabrik, heute in Birmingham, morgen in Rochester. Neulich war zu lesen, man solle sich Lebensmittelvorräte für zwei Monate anlegen. Mylady, es riecht förmlich nach Krieg!«
»Ich bin ganz Ihrer Meinung, Madam«, erwiderte Lady Evelyn, »ich war zwar noch jung, als der letzte Krieg ausbrach, und mein Vater, Lord Carnarvon, vertrat die Ansicht, ich sollte mich mehr mit Musik und Kunst beschäftigen als mit Politik, aber mir ist noch gut im Gedächtnis, dass die Umstände damals den heutigen aufs Haar glichen.«
»Howard war ein unpolitischer Mensch«, bemerkte Phyllis und kam damit endlich zum Thema.
»Aber nur, was den Zank der Parteien betraf!«, protestierte die Lady, »Howard war ein Einzelgänger, auch in seinen politischen Ansichten. Er redete heute der Labour Party das Wort, und morgen verteidigte er die Tories. Meinen Vater trieb Howards Wankelmut bis zum Wahnsinn. Ich hatte manchmal den Eindruck, als bereitete es ihm teuflisches Vergnügen, seine Meinung von heute auf morgen zu ändern.«
»Wann lernten Sie Howard kennen?«, erkundigte sich Miss Jones. Dem Klang ihrer Stimme konnte man entnehmen, dass sie mit Lady Evelyns Behauptung nicht einverstanden war.
»Oh, da war ich noch ein kleines Mädchen. Das war noch vor dem Krieg. Ich begleitete meinen Vater zum ersten Mal nach Ägypten. Aber damals nahm er mich gar nicht wahr – ich meine als Frau. Ich hingegen verliebte mich schon als kleines Mädchen in Carter. Er war groß, hatte kräftige dunkle Haare, und sein Oberlippenbart verlieh ihm etwas Draufgängerisches. Carter war für mich der Abenteurer und Schatzgräber aus dem Märchen, der eines Tages seiner Prinzessin begegnet. Und die Prinzessin war ich.«
»Merkwürdig«, meinte Phyllis Walker nachdenklich, »ich hatte Howard gegenüber die gleichen Empfindungen. Für mich war er auch eine außerordentliche Erscheinung, ein weit gereister Abenteurer und erfolgreicher Schatzgräber, zu dem ich aufschaute. Howard nannte mich immer seine Prinzessin. Und so fühlte ich mich auch in seiner Gegenwart – zumindest am Anfang.«
»Und Sie, Miss Jones?« Lady Evelyn versuchte die alte Dame mit einem freundlichen Lächeln zum Sprechen zu bewegen. Aber die schien weit weg mit ihren Gedanken, bisweilen schmunzelte sie vor sich hin, als begegnete ihr ein Ereignis längst vergangener Tage.
»Und Sie?«, wiederholte die Lady ihre Frage, »welche Empfindungen hegten Sie gegenüber Carter?«
»Ich?« Miss Jones schreckte hoch. »Nein, als Prinzessin fühlte ich mich Howard gegenüber nie. Das verhinderte schon der Altersunterschied. Sie müssen bedenken, ich war achtundzwanzig, Howard war fünfzehn, als wir uns zum ersten Mal begegneten. Ich war seine Lehrerin. Trotzdem – Howard war die große Liebe meines Lebens.«
Phyllis und Lady Evelyn warfen sich einen vielsagenden Blick zu, ja Phyllis zeigte sich sogar entrüstet, jedenfalls konnte sie ihr Erstaunen kaum verbergen, als sie fragte: »Sie wollen damit sagen, dass Sie mit Howard …« Weiter kam sie nicht.
Miss Jones blickte an sich herab. »Sie vergessen, dass auch ich einmal jung war, Miss Walker. Und mit den Jahren werden wir alle von der Schwerkraft besiegt und etwas schäbig.«
»Verzeihen Sie, Madam, so war das nicht gemeint. Ich dachte nur, Howard habe mir alles erzählt. Wenn er von seiner Jugendzeit redete, erwähnte er immer nur einen Namen, und er behauptete, diese Frau sei seine große Liebe gewesen.«
»Das kann ich bestätigen«, ergänzte Lady Evelyn. »Als wir zum ersten Mal über Liebe sprachen, meinte er, er kämpfe noch immer gegen die Erinnerung. Und dabei nannte er einen Namen.«
»Welchen Namen?«, erkundigte sich Miss Jones, nun weit weniger selbstbewusst als noch vor wenigen Augenblicken.
»Sarah!«, antwortete Lady Evelyn.
Und Phyllis ergänzte: »Ja, Sarah!«
»Ich bin Sarah. Sarah Jones.« Über ihr Gesicht huschte ein stolzes Lächeln, dann wandte sie ihren Blick beinahe schamhaft zur Seite und sagte: »Ja, ich gebe zu, unser Verhältnis war ungewöhnlich; doch ich kann sagen, es war kein Irrtum. Für ein paar Monate war ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Manche Menschen brauchen eben ein halbes Leben, um zu wissen, was Glück ist …«
Für Augenblicke schien an dem Tisch im Tea-Room die Zeit stillzustehen. Phyllis und Lady Evelyn, die gerade noch überzeugt gewesen waren, sie hätten die wichtigste Rolle in Carters Leben gespielt, mussten auf einmal einsehen, dass ihnen eine mächtige Konkurrentin diese Rolle streitig machte. Nun war ihre Neugierde groß, in Carters Vorleben Einblick zu gewinnen, schließlich hatten ihn beide erst im stolzen Mannesalter kennengelernt.
Sarah Jones wiederum brannte darauf, die näheren Umstände zu erfahren, die zu Carters Erfolg geführt hatten. Sie hatte all die Jahre jeden Zeitungsausschnitt gesammelt, der über ihn erschienen war. Liebevoll hatte sie alle Ausschnitte in ein Album geklebt und mit Tränen in den Augen so oft gelesen, bis sie die Texte auswendig konnte. Und mehr als einmal hatte sie laut vernehmbar zu sich gesagt: Sarah, du bist eine Närrin.
Den Mut, zu seiner Beerdigung zu kommen, hatte Sarah Jones gefasst, nachdem sie den Nachruf in der London Times gelesen hatte. Er endete mit dem Satz: He was unmarried – er war unverheiratet. Das hatte natürlich nichts zu sagen. Oder vielleicht doch? Jetzt hoffte auch sie, mehr zu erfahren.
Je länger sich Sarah Jones, Lady Evelyn und Phyllis Walker unterhielten, desto mehr wich das Misstrauen zwischen ihnen. Je mehr sie voneinander erfuhren, desto mehr gelangten sie zu der Erkenntnis, dass das Schicksal einer jeden mit dem der anderen verknüpft war.
Die drei Frauen vergaßen die Zeit. Und indem jede aus ihrer Vergangenheit erzählte, wurde noch einmal das Leben des Mannes lebendig, den man den König von Luxor nannte.
ERSTES BUCH
KAPITEL 1
Um von Ipswich in East Suffolk nach Swaffham zu gelangen, brauchte man damals, vor der Jahrhundertwende, einen halben Tag und gute Nerven.
»Norwich umsteigen, Richtung King’s Lynn!«, hatte ihr der Fahrkartenverkäufer eingeschärft. »Aber rasch, es bleiben nur zehn Minuten Zeit!«
Wider Erwarten hatte Sarah Jones die gestellte Aufgabe bewältigt und den Zug nach Swaffham erreicht, was – wie wir noch hören werden – mit gewissen Komplikationen verbunden war. Nun saß sie allein in ihrem Abteil und ließ den Blick aus dem Fenster schweifen, wo die Landschaft an ihr vorüberzog, flach und nur von Steinwällen unterbrochen, die dunkle Striche über die Weiden zogen und die Grundstücksgrenzen markierten.
Es war Frühling geworden. Ansehnliches Grün überzog die Landschaft, gewiss nicht so grün wie in Sussex, wo das grünste Grün zu Hause war, aber zweifellos von intensiverer Farbigkeit als die Ödnis um Ipswich.
Sarah Jones stammte aus Ipswich, wo ihr Vater Hafenarbeiter war und in der Hauptsache Getreidesäcke schleppte. Ihre Mutter starb bei ihrer Geburt, und hätte sich nicht eine Frau aus der Nachbarschaft ihrer angenommen, Sarah wäre im Waisenhaus St. Albans gelandet oder sonstwo.
Sarah war alles andere als dumm, aber für den Besuch der teuren Lateinschule, wo die Kinder der Kohlen- und Zuckerhändler, der Lagerhausbesitzer und Reeder erzogen wurden, fehlte dem Vater das Geld. Lange genug musste Sarah ihren Vater piesacken, bis er ihr den Besuch einer Dame-School nahe dem Christchurch-Herrenhaus erlaubte, wo Mädchen wie Sarah lesen und schreiben, rechnen und das Nähen von Papierkleidern lernten.
Nach Abschluss der Schule absolvierte sie ein weiteres Lehrjahr und wurde selbst Lehrerin an der Dame-School. Da starb ihr Vater bei einem furchtbaren Unfall. Ein Hafenkran stürzte um und begrub ihn. Seit jenem Tag ließ Sarah der Gedanke nicht los, sie würde in Ipswich vom Unglück verfolgt. Und so beschloss sie, die Stadt zu verlassen. Dem Reverend, der ihren Vater eingesegnet hatte, klagte Sarah Jones ihr Leid, und dieser zeigte Verständnis für ihren Wunsch, aus Ipswich fortzugehen. Er versprach sogar, ihr eine Anstellung als Lehrerin zu verschaffen. In Swaffham, in der Grafschaft Norfolk, werde eine Hilfskraft für die dortige Dame-School gesucht. Sie könne sich auf ihn berufen.
Alles, was sie damals besaß, passte in jenen braunen, mit Segeltuch bespannten Reisekoffer, den einst ihre Mutter in die Ehe gebracht hatte und der ihr nun auf der Holzbank gegenüberstand. Er zeichnete sich durch eine Besonderheit aus, die ihn von anderen Gepäckstücken unterschied. Aufgrund seiner Breite verfügte er über keinen Tragegriff in der Mitte, der es einem kräftigen Menschen ermöglicht hätte, den Koffer allein fortzutragen. Nein, der Koffer besaß nur zwei Griffe an beiden Seiten, und weil seine Breite jede natürliche Armspanne übertraf, war es unmöglich, das Gepäckstück allein fortzubewegen.
Zum Glück war der Bahnhof in Norwich von vielen Menschen bevölkert, und Sarahs Aussehen äußerst adrett, sodass sie nicht lange nach bereitwilligen Helfern Ausschau halten musste, die ihr Gepäckstück in den Zug nach Swaffham beförderten.
Nun ruckelte Sarah erwartungsvoll ihrer Zukunft entgegen, unterbrochen von zahllosen Haltestellen auf Bahnhöfen, die irgendwie alle gleich aussahen, rotbraune Backsteinbauten von unterschiedlicher Größe, manche so klein, dass es nur einen einzigen Raum gab. Nach eineinhalb Stunden hatte Sarah ihr Ziel erreicht, und der Bahnhofsvorsteher, der dies durch lautes Rufen kundtat, war ihr sogar beim Ausladen ihres sperrigen Gepäcks behilflich.
Jeder kennt das Empfinden, wenn man sich einer fremden Stadt zum ersten Mal nähert. Es ist entweder ein Gefühl freudiger Erwartung oder aber eine mit Abneigung verbundene Vorahnung. Was Sarahs Empfindungen betraf – sie war der einzige Fahrgast, der ausstieg –, so übertraf ihre Abneigung die Begeisterung bei Weitem. Ratlos stand sie vor dem Bahnhofsgebäude, neben sich den großen Koffer, den zu heben sie nicht imstande war, und weit und breit keine Menschenseele. Von Hühnergackern abgesehen, wirkte der Ort wie ausgestorben.
Dort, wo sie herkam, in Ipswich, balgten sich um diese Zeit vor dem Bahnhof die Droschkenbesitzer um den besten Standplatz, Zeitungsverkäufer brüllten Neuigkeiten, und Kofferträger gab es genug. Nichts von all dem in Swaffham. Wäre damals, als sie hilflos vor dem Bahnhof stand, ein Zug aus der Gegenrichtung gekommen, sie wäre eingestiegen und zurück nach Ipswich gefahren. Aber es kam kein Zug.
Die matte Frühlingssonne stand tief, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein hochgewachsenes Bürschchen auftauchte. Der Junge mit dunklen Haaren und blassem Gesicht trug ein Schmetterlingsnetz in der Linken, über der rechten Schulter hing eine Botanisiertrommel. Mit weit ausholenden Schritten, die seinem Gang etwas Komisches verliehen, versuchte er sich, starr geradeaus blickend, an Sarah Jones und ihrem Schicksal vorbeizustehlen. »He da!«, rief Sarah ebenso hilflos wie verzweifelt, »he da, kannst du mir nicht zur Hand gehen? Soll auch dein Schaden nicht sein!«
Der Junge machte halt, musterte die fremde Frau einen Augenblick, kam dann über die Straße und packte wortlos den Koffer am rechten Griff. Sarah fasste den linken. Ohne überhaupt zu fragen, wohin sie denn wolle mit ihrem Kleiderkasten, gingen sie ein kurzes Stück nebeneinanderher, bis Sarah das peinliche Schweigen des jungen Mannes, der immer geradeaus blickte, unterbrach: »Willst du denn überhaupt nicht wissen, wohin ich will?«
Der Junge grinste, ohne die Fremde anzusehen. Dann meinte er mit dünner Stimme, wobei er die Vokale wie in Norfolk üblich ungewöhnlich in die Länge zog: »Wo werden Sie schon hinwollen, Miss, zu Mr. Hazelford am Marktplatz halt. Ihm gehört das ›George Commercial Hotel‹, ein anderes gibt es nicht in der Gegend.«
Sarah hatte Mühe, den langen Schritten des Jungen zu folgen, und dabei bot sich kaum die Möglichkeit, ihn unbemerkt von der Seite zu betrachten. Nur so viel blieb ihr im Gedächtnis: Sein markanter Kopf hatte eine lang gezogene, dreieckige Form, die Nase länglich, das Kinn spitz. Trotz seiner Größe wirkte er nicht sehr kräftig, und deshalb war das Alter des jungen Mannes schwer abzuschätzen.
»Reden die Leute in Swaffham alle so viel?« fragte, Sarah, nachdem sie wieder eine Weile schweigend nebeneinanderher gegangen waren.
Der Junge grinste, und dabei sah er Sarah Jones zum ersten Mal ins Gesicht. »Ach, wissen Sie, Miss, damit müssen Sie sich abfinden. In Swaffham wird jeder, der mehr als fünf Sätze redet, als Schwätzer bezeichnet. Woher kommen Sie, Miss?«
»Ipswich«, erwiderte sie – nun ihrerseits kurz angebunden.
Der junge Mann pfiff leise durch die Zähne, was Sarah als Bewunderung deutete, doch musste sie sich wohl geirrt haben, denn schon im nächsten Augenblick meinte ihr Begleiter: »London. Ich komme aus London. Brompton, falls Sie es kennen.«
»Nein«, erwiderte Sarah irritiert, »ich war nie in London. Nur einmal in Sussex. Meinst du, ich habe etwas versäumt?«
»Hm.« Der Junge legte den Kopf zur Seite und ging stumm weiter. In der Ferne tauchte ein klotziger Kirchturm auf mit hohen Fenstern nach allen Seiten, in deren Mitte jeweils eine Uhr die Zeit verkündete.
»St. Peter und Paul!«, meinte der Junge, der Sarahs interessierte Blicke wahrnahm. »Und was verschlägt Sie nach Swaffham, Miss?«
Sarah sah keinen Grund, den Zweck ihres Besuchs zu verheimlichen. Dabei konnte sie nicht ahnen, welche Wirkung ihre Antwort zur Folge haben würde. Also antwortete sie ohne nachzudenken: »An der hiesigen Dame-School ist eine Stelle vakant. Ich bin Lehrerin.«
Kaum hatte sie geendet, da ließ der Junge den Koffer fallen, als habe ihn der Blitz getroffen, und ohne eine Erklärung rannte er in die Richtung fort, aus der sie gekommen waren. Sarah wusste nicht, wie ihr geschah.
Aus einer Seitenstraße näherte sich ein Mann in gebeugter Haltung. Ihn anzusprechen, wagte sie nicht, er erschien ihr einfach zu schwächlich, um ihr beim Transport ihres Gepäcks behilflich zu sein. Doch der Alte trat auf sie zu, sah sie von unten an und rang sich ein Grinsen ab, wobei zwei oder drei schwarze Zahnlücken sichtbar wurden.
»Wo wollen Sie denn hin mit Ihrem Schrank, Miss?«, fragte er mit betonter Höflichkeit.
»Ist es noch weit bis zum ›George Commercial Hotel‹?«, fragte sie zurück.
»Ach wo«, antwortete der zahnlückige Alte und zeigte in Richtung des klotzigen Kirchturms. »Keine fünf Minuten.«
»Wären Sie bereit, solange auf meinen Koffer aufzupassen?«, fragte Sarah. »Ich mache mich auf den Weg zu dem Hotel und schicke einen Kofferknecht mit einem Karren vorbei.«
Der Alte nickte und wiederholte seine Armbewegung in Richtung des Kirchturms.
Länger als erwartet dauerte die Suche nach dem Hotel, denn es lag keineswegs bei dem Kirchturm von St. Peter und Paul, wie der Alte bedeutet hatte, sondern gegenüber, unmittelbar am Marktplatz, was Sarah von einer ortskundigen Wäscherin erfuhr. Mr. Hazelford, der Wirt des Gasthofes, war äußerst zuvorkommend und schickte sogleich seinen Sohn Owen mit einem Karren los, nachdem sie den Ort beschrieben hatte, an dem der braune Koffer zurückgeblieben war.
Ihr Zimmer hatte ein Fenster zum Marktplatz hin, und man konnte den »Butter Cross« sehen, eine Art Pavillon, bestehend aus einer Kuppel auf sieben Säulen, und gegenüber die Kirche St. Peter und Paul. Das Zimmer war freundlich und billig, und bald traf auch Sarahs Koffer ein. Allerdings gab ihr Owen Hazelford die Penny-Münze zurück, die sie ihm zur Entlohnung des Alten mitgegeben hatte. Er habe niemanden bei dem Koffer angetroffen, meinte er.
Zuerst nahm Sarah die Mitteilung nicht weiter ernst, aber schon im nächsten Augenblick beschlich sie ein furchtbarer Verdacht, und ein Blick auf das Kofferschloss bestätigte ihre finstere Ahnung. Das Schloss war aufgebrochen.
Es darf nicht sein!, schoss es ihr durch den Kopf, und sie war geneigt, ein Stoßgebet zum Himmel zu schicken, was sonst nicht ihre Art war. Hastig öffnete sie den Koffer, schleuderte Wäsche- und Kleidungsstücke heraus, und dabei merkte sie, dass das Gepäck durchwühlt war. Endlich bekam sie ihren Mantel zu fassen. Wie von Sinnen zerrte Sarah ihn aus dem Koffer und tastete nach der Innentasche. Die Tasche war leer.
Nach dieser Entdeckung war Sarah wie betäubt. Sie kniete sich vor das leere Gepäckstück, vergrub ihr Gesicht in den Armen und weinte wie ein Kind. Man hatte Sarah ihre gesamten Ersparnisse geraubt: sechsundsiebzig Pfund und fünf Shillinge.
Der Wirt, dem sie sich anvertraute, verständigte die Polizei, aber die machte ihr Vorwürfe wegen ihres Leichtsinns und nur geringe Hoffnung, ihr Erspartes jemals zurückzuerhalten.
In dieser Nacht im »George Commercial Hotel« schlief Sarah keine Minute, und zum ersten Mal beschlich sie der Gedanke, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Sie hatte auf vieles verzichtet und hart gespart für ihr kleines Vermögen, nun stand sie mittellos da in dieser fremden Stadt. Wie sollte es weitergehen?
Am nächsten Morgen – ein leuchtender Frühlingstag kündigte sich an – suchte sie die Dame-School auf, einen düsteren Backsteinbau mit vergitterten Fenstern und einem wuchtigen Holztor als Eingang. Das zweistöckige Gebäude hatte zwei Flügel links und rechts und viele Zimmer, von denen nur der geringere Teil genutzt wurde, denn es gab nur zwei Klassen mit je einem Dutzend Schülerinnen. Außerhalb des Unterrichts, wenn das Gebäude leer stand, hatte das alte Haus etwas Unheimliches an sich, und Sarah Jones stellte sich die Frage, ob sie hier jemals heimisch werden könnte. Gertrude von Schell, die Leiterin, war, obwohl deutscher Herkunft, Queen Victoria wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie diese trug sie nur schwarze Kleider und einen Mittelscheitel, das Haar streng nach hinten gekämmt, und sie stand der Queen weder im Alter noch in ihrer zur Schau getragenen Bigotterie nach. Auch vergaß sie nur selten, in einem Satz ihren verstorbenen Gemahl, einen Baron von Schell, zu erwähnen, der alles – wie sie betonte – besser, klüger und mit mehr Würde bewerkstelligt hatte und der weit herumgekommen war im Leben. Nach jedem vollendeten Satz kniff sie mit großer Heftigkeit beide Augen zusammen, und um ihrer Rede Nachdruck zu verleihen, beendete sie diese stets mit der Frage: »Haben Sie mich verstanden?«
Diese Art zu sprechen verlieh ihr etwas Preußisches, Herrisches, und Sarah zweifelte schon am ersten Tag, ob sie es mit dieser Frau lange aushalten würde – zumal sie bereits beim ersten Kennenlernen – gleichsam als Warnung – Namen und Aufenthaltsdauer ihrer sechs Vorgängerinnen herunterbetete.
Unter dem Dach zeigte ihr die Baronin – sie hatte es gern, wenn man sie mit dem deutschen Adelstitel anredete – eine Kammer, deren Mietpreis sie von Sarahs durchaus respektablem Gehalt einzubehalten gedachte. Was blieb ihr anderes übrig, Sarah sagte zu.
Die Baronin und Sarah Jones waren die einzigen Lehrkräfte in der Dame-School von Swaffham. Beamte, Handwerker und Geschäftsleute schickten ihre acht- bis achtzehnjährigen Töchter auf diese Schule, um ihnen eine bescheidene Bildung mitzugeben.
Tags darauf führte Gertrude von Schell die neue Lehrerin in die Oberklasse ein, und Sarah begann die Namen der einzelnen Schülerinnen in ein Klassenbuch einzutragen, als sie plötzlich innehielt. In der letzten Reihe, rechts außen, erkannte sie den Jungen, dem sie bei ihrer Ankunft am Bahnhof begegnet war.
»Name?«, fragte sie scheinbar unbeeindruckt, so wie sie es bei den Mädchen getan hatte.
Der Junge erhob sich und nahm Haltung an: »Howard Carter.«
Sarah Jones fühlte die Augen aller Mädchen auf sich gerichtet. Die Mädchen erwarteten irgendeine Reaktion. Ein halbwüchsiger Junge in einer Dame-School? In dieser unerwarteten Situation ließ sich Sarah zu einer Bemerkung hinreißen, welche ihr, kaum hatte sie diese ausgesprochen, zutiefst leid tat. »Oh, ein Hahn im Korb …«
Die Mädchen kicherten, ein paar hielten die Hand vor den Mund, zwei ließen gar ihre Köpfe unter der Schulbank verschwinden, damit man ihre hämischen Gesichter nicht sehen konnte. Sie selbst starrte den Jungen hilflos an, der vor Scham dunkelrot anlief und tapfer den Blick auf sie gerichtet hielt, als wollte er sagen: Nur zu, demütige mich nur, ich bin das gewöhnt.
Was sollte sie tun nach dieser Entgleisung? Sarah fiel es nicht leicht, ihre eigene Scham zu verbergen; denn ihr wurde schnell klar, dass kein Junge in diesem Alter freiwillig eine Dame-School besuchte. Unschwer konnte sich Sarah vorstellen, wie sehr er sie in diesem Augenblick hasste.
»War nicht so gemeint, Carter!«, sagte sie zur Entschuldigung.
Howard zeigte keine Regung.
Nach dem Ende des Unterrichts stellte Miss Jones die Baronin zur Rede, warum sie sie nicht auf den Jüngling in der Mädchenklasse vorbereitet hatte. Die unerwartete Konfrontation habe sie in eine peinliche Situation gebracht.
Gertrude von Schell holte tief Luft, und dabei schwoll ihr Hals an wie eine Schweinsblase. Schließlich entgegnete sie mit leiser, aber bebender Stimme: »Miss Jones, es steht Ihnen nicht zu, mich in irgendeiner Weise zu kritisieren. Und sollten Sie sich Ihrer Aufgabe nicht gewachsen fühlen, so bitte ich Sie, mir das umgehend mitzuteilen, damit ich mich nach einer anderen Lehrkraft umsehe. Haben Sie mich verstanden, Miss Jones?«
»Ich war nur so überrascht«, stammelte Sarah hilflos, »ich hatte nicht erwartet, einen Jungen in der Mädchenklasse anzutreffen, und in meiner Verblüffung ließ ich mich zu einer Bemerkung hinreißen, die mir im Nachhinein leidtat. Das müssen Sie doch verstehen!«
»Gar nichts muss ich verstehen«, erwiderte die Baronin schroff. »Ich sehe nur, dass Sie Ihre erste Bewährungsprobe nicht bestanden haben, Miss Jones. Noch so etwas, und Sie können sich Ihre Papiere abholen. Haben Sie mich verstanden?«
In diesem Augenblick spielte Sarah mit dem Gedanken, der herrischen Alten das Klassenbuch vor die Füße zu werfen und zu antworten: Nicht nötig, ich gehe von selbst. Aber dann kam ihr ihre Lage in den Sinn. Sie war mittellos, die Baronin zahlte nicht schlecht, und sie brauchte jeden Penny. Also schluckte Sarah ihre Wut hinunter, obwohl sie sich gedemütigt fühlte wie selten zuvor.
Nach wenigen Tagen Umgang mit der Klasse wurde Sarah Jones klar, welch schweren Stand der junge Carter in einer Mädchenklasse hatte. Nicht, dass er gehänselt oder verspottet wurde, dazu war Howard eine viel zu überlegene Erscheinung, nein, die Mädchen ließen ihn einfach links liegen, kümmerten sich nicht um ihn, auch wenn er bisweilen rührende Versuche unternahm, mit ihnen in Kontakt zu treten.
Andererseits merkte sie deutlich, dass Howard ihr aus dem Weg ging. Es schien, als spürte er, dass sie das dringende Bedürfnis hatte, mit ihm ein paar Worte zu wechseln, die über den Umgang einer Lehrerin mit ihrem Schüler hinausgingen.
Die Gelegenheit kam unerwartet. Sarah Jones nutzte die ersten warmen Apriltage, um die Gegend zu erkunden, in die sie das Schicksal verschlagen hatte.
Drei Meilen nördlich von Swaffham liegt, nahe dem Fahrweg nach Fakenham, eine uralte Klosterruine, Castle Acre. Das verlassene Kloster stammt aus normannischer Zeit, und die Leute in der Gegend erzählten, es sei auf den Mauern einer Römerburg erbaut worden.
Auf Sarah machten die Ruinen über dem River Nar den Eindruck, als seien sie aus einem alten Gemälde von William Turner herausgeschnitten. Sie hielt staunend inne, schließlich machte sie sich auf den Weg, das Innere des verwunschenen Bauwerks zu erkunden. Nichts regte sich, nur schrilles Vogelgezwitscher schallte aus dem Mauerwerk. Vertieft in den Anblick einer schmalen, hohen Fensteröffnung, erschrak sie, weil hastige Schritte sich aus dem Hintergrund näherten. Sarah wollte gerade einen schützenden Mauervorsprung aufsuchen, als hinter der Mauer eine Gestalt hervortrat und sich mit einem Satz auf den Boden warf, als gelte es, ein flinkes Tier einzufangen.
Sarah Jones erkannte den jungen Carter sofort, der, mit beiden Händen einen Hohlraum formend, bäuchlings auf dem grasbewachsenen Boden lag. Vorsichtig nahm er ein lebendiges Etwas vom Boden auf, da erblickte er die Frau in einiger Entfernung.
»Oh, Miss Jones!«, rief er freundlich und trat mit hohlen Händen auf sie zu. Mit dem Kinn deutete er auf seine Hände, dann sagte er stolz: »Ich habe eine Eidechse gefangen. Wollen Sie mal sehen?«
Miss Jones schüttelte heftig den Kopf: »Lieber nicht. Es heißt, dass Eidechsen ihren Schwanz verlieren, sobald sie mit Menschen in Berührung kommen.«
»Das stimmt nicht, Miss Jones!«, ereiferte sich Howard. »Salamander werfen ihren Schwanz ab, sobald sie sich vom Menschen bedroht fühlen. Auf Eidechsen trifft das nicht zu. Hier, sehen Sie!«
Der junge Carter öffnete behutsam den Käfig seiner Hände, in dem sich die Eidechse befand. Aber noch ehe beide die Unversehrtheit des grün schimmernden Reptils begutachten konnten, schnellte dieses aus der Öffnung, klatschte zu Boden und verschwand in einer der zahllosen Mauerritzen. Deutlich sehen konnte man, dass es seinen Schwanz wohlbehalten nach sich zog.
»Tut mir leid, Howard«, sagte Sarah entschuldigend.
Aber Howard winkte ab: »Ich fang mir eine neue. War ohnehin ein ziemlich kleines Exemplar für meine Zwecke.«
Einen Augenblick überlegte Sarah Jones, was er mit dem Tierchen wohl anfangen wollte und dass er für Lausbübereien doch schon etwas zu alt war. Aber Carter schien ihre Gedanken zu erraten, denn er sagte, noch ehe sie eine Frage stellen konnte: »Jetzt wollen Sie natürlich wissen, warum ich Eidechsen fange, Miss Jones. Warten Sie.«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, verschwand er hinter der Mauer. Als er zurückkehrte, hielt er ihr einen Skizzenblock entgegen. »Pflanzen und Tiere, müssen Sie wissen, sind meine Leidenschaft!«
Der Block enthielt gewiss zwei Dutzend kunstvolle Skizzen von Büschen und Blumen, Vögeln und Schmetterlingen.
»Wie finden Sie die Bilder?« Howard sah sie erwartungsvoll an.
Miss Jones mochte nicht so recht glauben, dass der Junge die Arbeiten selbst gemacht hatte. Vor allem wollte sie nicht glauben, dass dieser Junge jener Howard Carter war, der in der Dame-School meist geistesabwesend in der letzten Reihe saß. Neugierig betrachtete sie seine schalkhaften Lippen, seine Glück verheißenden, lächelnden Augen und seine hoch aufgeschossene Gestalt. Anders als in der Schule redete Howard frei und natürlich und ohne jede Hemmung. Sarah starrte den Jungen nachdenklich an.
»Nun sagen Sie schon, wie finden Sie meine Bilder?«, wiederholte Howard mit Nachdruck.
»Gut. Ziemlich gut sogar«, stammelte sie verwirrt. »Woher hast du nur dieses Talent?«
Howard hob die Schultern. »Von meinem Vater. Es liegt wohl in der Familie.«
»Er lebt nicht mehr?«
Der Junge nahm ihr den Skizzenblock aus der Hand. »Wer sagt das?«, fragte er und zog die Stirn in Falten.
»Mrs. von Schell machte eine Andeutung. Sie sagte, zwei Tanten hätten dich an Kindes statt angenommen.«
»Ja, wenn Mrs. von Schell das behauptet!«
»Stimmt es etwa nicht?«
Carter drehte sich um und machte ein paar Schritte in Richtung des Gemäuers. Dabei rief er mit lauter Stimme, dass es in der Ruine widerhallte: »Nein, das stimmt nicht, Miss Jones!« Er blieb stehen, drehte sich um und kam wieder zurück. Und in leiserem Tonfall fuhr er fort: »Mein Vater lebt in London. Ebenso meine Mutter. Sie deklamiert täglich von früh bis spät Shakespeare. Obwohl sie bereits elf Kinder zur Welt gebracht hat, ist sie immer noch von dem Gedanken besessen, eine berühmte Schauspielerin zu werden. Da bleibt für den Elften natürlich keine Zeit.«
»Das habe ich nicht gewusst«, sagte Sarah entschuldigend.
»Woher auch«, bemerkte Carter bitter, »woher auch, Miss Jones.« Und nachdem er eine Weile geschwiegen hatte: »Aber ich will nicht klagen. Fanny und Kate, die Schwestern meines Vaters, sind für mich wirklich wie Ersatzeltern. Habe ich damit alle Fragen beantwortet?« Howard schluckte.
Sarah Jones blieb nicht verborgen, wie sehr er unter dieser Situation litt, aber sie hatte Hemmungen, irgendetwas zu sagen, was ihn hätte aufheitern können. Und als sie sich endlich zu einer Erwiderung durchrang, da wurde ihr schon im nächsten Augenblick klar, dass ihre Rede falsch, ja töricht war. Sarah sagte, eingedenk ihrer eigenen Vergangenheit: »Es ist nicht leicht, ohne Vater und Mutter aufzuwachsen …« Der Junge sah sie lange prüfend an, als wollte er ergründen, ob ihre Bemerkung nur so dahingesagt oder ernst gemeint war; dann brach es aus ihm heraus: »Ich könnte nicht behaupten, dass sich mein Vater oder meine Mutter je ernsthaft um mich gekümmert hätten. Lange habe ich nach dem Grund dafür gesucht. Als ich zwölf war, las ich heimlich im ›Peddler’s Magazine‹ eine Geschichte, in der ich mich irgendwie wiedererkannte.«
»Dieses Schundmagazin ist bei Gott kein Lesestoff für einen Zwölfjährigen!«, meinte Sarah Jones und tat entrüsteter, als sie war. »Was meinst du damit, du habest dich wiedererkannt?«
Über Howards Gesicht huschte ein verschämtes Lächeln. »Die Geschichte hieß ›Der Zaunkönig‹ und handelte von einem kleinen Jungen aus Middlesex, der sich ungeliebt und unverstanden fühlte. Seine Eltern kümmerten sich kaum um ihn, und er lebte am liebsten auf der Straße. John, so hieß der Junge, litt wie ein Hund, und er fragte sich, warum seine Eltern ihn von einer Kinderfrau zur anderen, von einem Heim ins andere schoben. Er empfand sich als klein, wie ein Zaunkönig, obendrein dumm und hässlich. Von der Frau des Krämers erfuhr er eines Tages, dass seine Mutter überhaupt kein Kind mehr gewollt und alles versucht hatte, es vor der Geburt loszuwerden. Dabei sei sie sogar von einem fahrenden Wagen gesprungen …«
»Du solltest nicht solchen Schund lesen, Howard!«, fiel Miss Jones ihm ins Wort. »Schon gar nicht in so jungen Jahren.«
Aber Carter ließ sich in seinem Redefluss nicht bremsen. »Warten Sie«, ereiferte er sich, »warten Sie, wie die Geschichte ausgeht.«
Also hörte sie weiter zu.
»John war nicht sehr gescheit, aber er hatte eine Fähigkeit, die bei den anderen Straßenjungen Bewunderung hervorrief. Er benutzte die Eisenrohre einer Wasserleitung, die damals in Middlesex gebaut wurde, zum Balancieren und errang dabei solche Kunstfertigkeit, dass er von allen bewundert wurde. Als eine Seiltänzertruppe in seiner Stadt gastierte, fragte er, ob er seine Kunstfertigkeit vorführen dürfe. Ohne Hemmungen erklomm er das Seil und ging mithilfe einer Stange unbeirrt auf den Kirchturm. Von diesem Tag an war John Seiltänzer und reiste mit der Truppe durch ganz England, ja sogar nach Amerika …«
»Und du fühlst dich auch als so ein Zaunkönig?«
Howard bemerkte wohl, wie Miss Jones ihn von Kopf bis Fuß musterte. »Ich war klein und schwächlich, müssen Sie wissen. Alle öffentlichen Schulen verweigerten meine Aufnahme. Das war auch der Grund, warum ich letztlich in einer Dame-School landete, mitten unter ziemlich albernen Mädchen, die dort gerade mal das große Einmaleins lernen und wie man Kleider aus Papier schneidert. Ich bin erst in den letzten Jahren gewachsen.«
»Du leidest unter dieser Schule?«
Carter blickte verlegen zur Seite. »Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich gehe gerne dorthin. Was bleibt mir übrig.«
»Hast du denn deinen Traum aufgegeben, ein berühmter Seiltänzer zu werden? Ich meine, du hast doch ebenfalls ein großes Talent!«
»Sie meinen das hier?« Er ließ die Blätter seines Zeichenblocks zwischen Daumen und Zeigefinger durchlaufen. »Ob das reicht, um berühmt zu werden?«
»Du musst daran glauben!«, betonte Sarah.
Da sah er sie lange an, und Sarah vermochte seinen nachdenklichen Blick nicht zu deuten.
Wind kam auf, und Sarah sagte, sie wolle sich auf den Heimweg machen, bevor es kühl werde, ob er sie begleiten wolle.
Howard schüttelte den Kopf und murmelte nur, er würde doch lieber noch eine Eidechse fangen. Dazu müsse er allein sein. Und schon im nächsten Augenblick verschwand er grußlos in die entgegengesetzte Richtung.
Auf dem Rückweg gingen Sarah Jones seltsame Gedanken durch den Kopf. Irgendwie fühlte sie sich dem Jungen und seinem Schicksal verbunden. Zwar war sie ein Einzelkind; doch diese Tatsache allein schien keineswegs dazu angetan, ihr ein besseres Leben zu bescheren als dem Elften in einer vielköpfigen Kinderschar. Seit sie denken konnte, empfand sie ihre Existenz immer als Störung anderer Menschen, als Störung des Witwerdaseins ihres Vaters, als Störung der Nachbarin, die sich ihrer annahm und der sie für jeden Handgriff danken musste, als Störung in der Dame-School in Ipswich, wo sie sich eine feste Anstellung erbetteln musste.
Was Sarah Jones wunderte, war die Abgeklärtheit, mit der der junge Carter über sein Schicksal redete. Selbstmitleid und hilflose Wut, die einem Jungen seines Alters und in seiner Situation durchaus angemessen gewesen wären, schienen ihm fremd. Ja, es schien, als habe er gerade durch sein schweres Los jene Stärke erlangt. Howard war fünfzehn und eigentlich noch ein Kind, doch in seinem Wesen hatte Sarah eine gewisse natürliche Autorität entdeckt, die sie sich selbst manchmal gewünscht hätte.
KAPITEL 2
Für Sarah Jones bedeutete der Verlust ihrer Ersparnisse eine Katastrophe, denn nun war sie den Launen der Baronin von Schell ausgeliefert. Der Unterricht in der Dame-School fiel ihr nicht leicht. Obwohl sie von Ipswich einiges gewöhnt war, benahmen sich die Mädchen widerborstig und zickig und zeigten wenig Interesse am Unterricht.
Sie hatte die ersten vier Wochen gerade hinter sich gebracht, da ließ die Baronin Sarah Jones auf ihr Zimmer kommen, das im Obergeschoss am Ende eines langen Korridors lag. »Direktion« stand auf einem weißen Emailschild über der zweiflügeligen, schwarz gestrichenen Türe.
Seit ihrer Ankunft hatte Sarah dieses Zimmer nur einmal betreten, und wie beim ersten Mal schauderte sie beim Anblick des dunklen Mobiliars und der schweren, verstaubten Vorhänge, die den Eindruck vermittelten, als sei der Raum seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnt worden.
Wie eine Figur aus dem Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds saß Gertrude von Schell unbeweglich hinter ihrem Schreibtisch, einem heruntergekommenen Ungetüm mit schwarzen Löwenpranken, das gewiss schon unter King George seinen Dienst verrichtet hatte – dem Dritten wohlgemerkt! Über ihrem Kopf hing ein angegrautes Bild Queen Victorias in einem balkendicken schwarzen Rahmen.
Im Näherkommen bemerkte Sarah, dass die Baronin äußerst erregt war. Ihr Kopf glühte purpurrot, und ihre von feinen Äderchen durchzogenen Wangen hatten eine bläuliche Färbung angenommen.
»Setzen Sie sich, Miss Jones!«, sagte sie im Kommandoton, wobei sie ihre Aufregung mühsam unterdrückte.
Sarah ließ sich auf dem einzigen Stuhl nieder, der vor dem Schreibtisch stand, und wartete wie eine Delinquentin auf ihr Urteil.
Gertrude von Schell wühlte in irgendwelchen Papieren. Schließlich breitete sie eines auf dem Schreibtisch aus. »Wissen Sie, was das ist? – Das ist der Brief eines Vaters, der Beschwerde führt über die mangelnde Erziehung seiner Töchter. Könnte es sein, dass Sie Ihre Aufgabe überfordert, Miss Jones?«
Überfordert, von wegen!, wollte Sarah antworten. Werfen Sie doch einen Blick auf meine Zeugnisse. Die sind hervorragend. Was ist schon Ihre lächerliche Dame-School im Vergleich zu jener in Ipswich!, wollte sie sagen. Aber sie schwieg betreten.
Die Baronin ballte die dürre rechte Faust und schlug mit den Knöcheln auf die schwere Eichenplatte. »Mister McAllen beklagt die mangelnde Autorität der neuen Lehrkraft. Seine beiden Töchter, schreibt er, benötigten eine starke Hand, kein Händchen. Mister McAllen ist einer der wichtigsten Geldgeber unserer Schule, Miss Jones. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn er seine Töchter von unserer Schule nimmt und seine Zahlungen einstellt? Dann sind Sie und ich ohne Arbeit. Haben Sie mich verstanden?«
Sarah nickte einsichtig, obwohl sie sich nichts vorzuwerfen hatte, was ihre Arbeit betraf. In Ipswich hatte sie nur Lob geerntet wegen ihrer offenen, freundlichen Art den Mädchen gegenüber. Es lag ihr fern, mit dem Rohrstock Bildung zu vermitteln.
Wie nicht anders zu erwarten, wertete die Baronin Sarahs Schweigen als Schuldeingeständnis, ja sie drohte, sie auf die Straße zu setzen. Dann könne sie sehen, wo sie bleibe.
»Und jetzt gehen Sie!«, beendete sie abrupt das Gespräch. Dabei machte sie eine flatternde Handbewegung.
Mit Tränen in den Augen stieg Sarah Jones die steile Treppe zu ihrer Kammer hinauf. Schluchzend warf sie sich auf ihr Bett. Ihre Hände zitterten vor Wut, ihre Augen starrten ins Leere.
Als sie wieder denken konnte, fasste Sarah Jones den Entschluss: Sie wollte weg aus Swaffham, egal wohin. An einen Ort, wo es noch Luft zum Atmen gab, wo die Atmosphäre nicht von Misstrauen, Bosheit und Gehässigkeit verpestet war.
Aber wie sollte sie das in ihrer Lage bewerkstelligen?
Was Howard Carter betraf, so hatte die Begegnung mit Miss Jones bei ihm weniger Eindruck hinterlassen als umgekehrt. Er hatte vor ihr schon zwei andere Lehrerinnen erlebt, und keine hatte auch nur im Entfernten Eindruck auf ihn gemacht. Eine Dame-School war ohnehin nicht dazu da, Herzens- oder Charakterbildung zu vermitteln.
Howards Herz war fraglos weich geraten; dafür zeichnete sich sein Verstand durch Nüchternheit und Härte aus. Längst hatte er sich mit der Einsicht abgefunden, dass seine Zukunft nicht rosig sein würde. Wie seine älteren Brüder Samuel, Vernet und William wollte Howard Maler werden. Etwas anderes kam für ihn nicht infrage. Maler sind Einzelgänger. Insofern passte sich seine Leidenschaft seinem Charakter an.
Andere hätten wohl unter dem Einzelgängerdasein gelitten und allein bei dem Gedanken Langeweile empfunden, ganze Nachmittage am dicht bewachsenen Ufer des River Nar zu verbringen, wo man flirrende Libellen beobachten konnte und Frösche, so groß wie eine Faust. Während er zeichnete und malte, blieb Howard viel Zeit zum Nachdenken. Er fühlte, seine Kindheit neigte sich dem Ende zu, das Erwachsensein begann.
Eines Tages kündigte Howards Vater Samuel brieflich sein Kommen an, um nach dem Rechten zu sehen und mit dem Jüngsten über dessen Zukunft zu sprechen.
Das Haus der Carters an der Straße nach Sporle, etwas außerhalb von Swaffham gelegen, sah nicht anders aus als tausend andere Häuser in der Gegend. Misstrauisch, fast ängstlich versteckte es sich hinter üppigen Hecken, sodass es unmöglich war, einen Blick durch die vorhanglosen Sprossenfenster, wie sie hier an der Tagesordnung waren, zu erhaschen. Howards Mutter Martha, geborene Sands, Tochter eines Baumeisters am Ort, hatte den Besitz mit in die Ehe gebracht und hier alle elf Kinder geboren, was der Elfte jedoch allzu gerne verschwieg. Er bezeichnete sich stets als Londoner, weil er die ersten Jahre seiner Kindheit bei den Eltern im Stadtteil Brompton verbracht hatte, einer Gegend, wo feine Leute lebten, wo es aber auch Mews gab, kleine Häuserreihen mit Werkstätten und Kramerläden zu ebener Erde.
Fanny und Kate, Vaters Schwestern und einander wie aus dem Gesicht geschnitten, hatten Feiertagskleidung angelegt, lange dunkle Röcke und weiße Rüschenblusen. Sie nahmen zu beiden Seiten des Kamins Platz und sahen aus wie Porzellanhunde aus Chelsea oder Staffordshire, welche die Eingangshallen vornehmer Häuser bewachten. Dazu machten sie ein strenges Gesicht. Howard bereitete es Mühe, ernst zu bleiben, doch als er seinen Vater ansah, traf ihn eine düstere Vorahnung.
Der Vater, ein bärtiger Mann mit wogendem grauem Haupthaar, war von der äußeren Erscheinung eher ein Philosophie-Professor aus Oxford als ein freischaffender Tiermaler und keineswegs so alt, wie er aussah. Er baute sich vor Howard mit auf dem Rücken verschränkten Händen auf, als wollte er ein Donnerwetter auf seinen Jüngsten loslassen, begann dann aber zurückhaltend seine Rede: »Mein lieber Sohn Howard. Dein fünfzehnter Geburtstag liegt gerade eine Woche zurück, und ich habe das zum Anlass genommen, über deine Zukunft nachzudenken.«
Fanny und Kate, die ihrem Bruder mit großem Respekt begegneten, nickten beifällig wie zwei Nonnen beim Sonntagsspaziergang. Es schien, als kannten sie Samuel Carters Rede im Voraus.
»In deinem Alter«, fuhr Samuel Carter fort, »weiß man noch nicht, welchen Weg man einmal einschlagen will. Aber Tatsache ist, dass ich nicht ewig Kostgeld bezahlen kann. Wir gehen unsicheren Zeiten entgegen. Unsere Regierung will sogar Helgoland an die Deutschen verschachern. Das ist der Ausverkauf des britischen Empire.«
Als habe Samuel Carter etwas ganz Furchtbares verkündet, schüttelten Fanny und Kate entrüstet die Köpfe.
Schließlich nahm dieser seine Rede wieder auf: »Wohl dem, der in diesen Zeiten über ein festes Einkommen verfügt. Ich habe mich umgehört nach einer geeigneten Stelle für dich, aber alles war vergeblich. Ja, Grubenarbeiter in Mittelengland sind gesucht oder Eingeweideschneider in den Londoner Schlachthöfen für zwei Shilling die Woche oder Sackträger auf den Docks für ein Shilling Sixpence; aber das ist nichts für dich, Howard! Schließlich hörte ich mich in der Verwandtschaft um. Harold, ein Neffe deiner Mutter in Harwich, leitet das Zollkontor im Hafen. Er ist bereit, dich für zwei Shilling die Woche als Botengänger aufzunehmen bei freier Kost und Logis. Gewiss, das ist nicht viel und verspricht auf den ersten Blick auch nicht gerade eine erstrebenswerte Karriere. Aber Harold meint, du könntest dich im Laufe der Jahre durchaus bis zum Kontorvorsteher hocharbeiten. Ich habe zugesagt, dass du nach dem Ende des Schuljahres bei ihm antrittst.«
»Als Botengänger«, stammelte Howard tonlos. Er fühlte sich wie gelähmt, unfähig, aufzuspringen und seinen Protest herauszuschreien, ja, Howard war nicht einmal in der Lage loszuheulen, obwohl ihm verdammt danach zumute war. Seine Wut gegen die Macht seines Vaters wuchs ins Unermessliche. Botengänger für zwei Shilling die Woche! In Howards Kopf pochte es heftig: Nein, nein, nein!
»Ich hoffe, du bist mit meiner Entscheidung einverstanden«, legte Samuel Carter nach. Es klang beinahe wie eine Entschuldigung, denn die Reaktion seines Sohnes blieb ihm nicht verborgen. »Nun sag schon etwas!«
Howard starrte aus dem Fenster. Er schwieg. Es schien, als färbte sich im Osten der Abendhimmel rot. Im Osten? Howard erhob sich und öffnete das Fenster. »Es brennt«, rief er aufgeregt, »drüben in Sporle!« Dann stürmte er aus dem Haus.
Das Dorf lag keine Meile entfernt, aber schon von Weitem sah Howard den Rauch, der aus der Mitte der Häuserreihe aufstieg. Howard begann zu rennen. Er wusste selbst nicht, warum ihn das Feuer so anzog.
Je näher er dem Brandherd kam, desto mehr Menschen begegnete er. »Feuer!«, riefen sie wie berauscht und »Es brennt, es brennt«.
In Sporle stand die Seilerei in Flammen, ein kleines weiß getünchtes Haus mit einem Dach, welches das niedrige Gebäude beinahe zu erdrücken schien. Aus dem Dach züngelten gelbe und bläuliche Flammen.
Fasziniert betrachtete Howard das schaurige Schauspiel, beobachtete die Menschen, die scheinbar ziellos herumrannten und aufgeregt nach der Feuerspritze riefen. In das Geschrei mischten sich aus der Ferne die gellenden Glocken von St. Peter und Paul. Die Flammen wuchsen höher und höher. Und während er die Szene mit ängstlichem Blick verfolgte, nahm der Junge wahr, wie das Glas einer Dachluke zersprang.
Zuerst dachte Howard, die Hitze des Feuers hätte das kleine Dachfenster zum Bersten gebracht, aber dann entdeckte er in der Fensteröffnung Hände mit einem Gegenstand und ein Gesicht, ja, er erkannte im Qualm die Züge eines Mädchens, das mit weit aufgerissenem Mund nach Luft schnappte. Das Mädchen rief nicht um Hilfe, es rang nur verzweifelt nach Luft. Howard blickte sich um, aber keiner schien das Mädchen in seiner Bedrängnis zu bemerken.
Mut zählte gewiss nicht zu den hervorstechenden Eigenschaften des jungen Carter, aber in dieser unerwarteten Situation zeigte er plötzlich eine Verwegenheit, die ihn später, als alles vorbei war, selbst verwunderte.
Während behelmte Feuerwehrmänner eine Feuerspritze, die inzwischen eingetroffen war, in Stellung brachten, entriss Howard einem Mann mit Augenklappe den Wassereimer, schüttete sich den Inhalt über den Kopf und stürmte, ohne zu überlegen und ohne dass ihn jemand zurückhalten konnte, in das brennende Gebäude.
Es dauerte endlose Sekunden, bis Howard die Orientierung fand. Instinktiv verbarg er Mund und Nase in der nassen Armbeuge. Vorsichtig tastete er sich durch beißenden Qualm auf der schmalen Treppe empor, die gleich neben dem Eingang nach oben führte. Obwohl er nur Schemen erkennen konnte, hatte er die Richtung genau im Kopf, und so wandte er sich, auf dem Treppenabsatz angelangt, um und arbeitete sich, sorgsam einen Fuß vor den anderen setzend, in entgegengesetzter Richtung vor. Unerwartet prallte er mit dem Kopf gegen eine Wand und musste seine schützende Armhaltung aufgeben, denn er brauchte beide Hände, um sich seitwärts fortzubewegen. Irgendwo hier musste sich das Mädchen doch aufhalten. Howard bekam kaum noch Luft.
In dem Zischen und Krachen vernahm Howard plötzlich ein keuchendes Husten. Hier musste das Mädchen sein. »Hallo!«, rief er, in gebückter Haltung weiterkriechend, »hallo, wo steckst du?« Keine Antwort.
Carter merkte, je tiefer er den Kopf hielt, desto besser wurde die Luft zum Atmen. Schließlich kroch er auf allen vieren in die Richtung, aus der er das Lebenszeichen gehört hatte. So gut es ging, prägte er sich den Weg ein, den er wieder zurückfinden musste. Plötzlich berührte seine rechte Hand ein Hindernis. Howard fasste nach, und von einer Sekunde zur anderen wurde seine Unsicherheit zur Gewissheit: Vor ihm lag das Mädchen auf dem Boden. Es schien bewusstlos zu sein.
Irgendwie bekam er es an beiden Armen zu fassen. Mühsam richtete er sich auf und schleifte, sich rückwärts bewegend, den leblosen Körper in Richtung des Treppenabsatzes, so wie er sich den Weg eingeprägt hatte. Das erforderte höchste Anstrengung, und Carter begann zu keuchen. Er hatte das Gefühl, seine Lungen würden jeden Augenblick platzen.
Inzwischen hatte auch das Treppengeländer Feuer gefangen. Es schwelte vor sich hin und verbreitete beißenden Gestank. Howards Augen tränten und raubten ihm die letzte Orientierung, und es hätte nicht viel gefehlt und er wäre rückwärts über die Treppe gestürzt. Nur das Gewicht des am Boden liegenden Mädchens bewahrte ihn davor.
Rücklings den leblosen Körper hinter sich herschleifend, arbeitete Carter sich vier, fünf Treppenstufen nach unten. Dann versuchte er, das Mädchen auf die Schulter zu nehmen; aber mit einem Mal kehrte Leben in das Mädchen zurück. In seiner Todesangst klammerte es sich an Howards durchnässte Kleidung und ließ den Jungen nicht mehr los, bis beide hustend, schnaubend und spuckend den Eingang des Hauses erreicht hatten.
Mit letzter Kraft zerrte Howard das Mädchen über seine Schultern. In gebückter Haltung schleifte er es ins Freie, wo inzwischen ein halbes Hundert Helfer den Kampf mit den Flammen aufgenommen hatten. Aus dem Schlauch der Feuerspritze prasselte ein mächtiger Wasserstrahl auf das Hausdach, welches bereits vollends in Flammen stand. Die Menschen rannten und riefen wild durcheinander, sodass kaum einer wahrnahm, wie der junge Carter plötzlich mit dem Mädchen auf dem Rücken im qualmenden Eingang des Hauses stand.
Nur ein kräftiger Bursche aus Swaffham, den Howard vom Sehen her kannte, sprang, mit wilden Armbewegungen und lauter schreiend als alle anderen, auf Carter zu, nahm ihm das hustende Mädchen ab und trug es auf den Armen aus der Reichweite der Brandstelle, wobei er immer wieder ausrief: »Seht her, sie lebt!«
Howard rang nach Luft und schleppte sich über die Straße bis zu einer Hauswand, wo ihn die Kräfte verließen und er ohnmächtig in sich zusammensank.
Als er im Morgengrauen verrußt, zerlumpt und ausgelaugt nach Hause zurückkehrte, war sein Vater bereits abgereist. Fanny und Kate machten ihm Vorwürfe, es zieme sich nicht, seine Schaulust am Unglück anderer Menschen zu befriedigen. Die verdorbene Kleidung würden sie ihm vom Kostgeld abziehen.
Das Haus des Seilers Hackleton konnte nicht mehr gerettet werden. Es brannte bis auf die Grundmauern nieder und bot noch lange Gesprächsstoff – nicht nur weil Hackleton und seine Frau sich bei Ausbruch des Feuers zwei Meilen entfernt, in Little Dunham aufgehalten hatten. Man erzählte sich, die rothaarige Frau des Seilers sei vom Teufel besessen. Aber noch mehr erregte die Menschen die Rettung von Jane Hackleton, der Seilerstochter, aus dem brennenden Haus.
Die Zeitung brachte einen großen Artikel unter der Überschrift: »Robert Spink, der Held von Sporle.« Darin schilderte der junge Spink, Sohn eines Fabrikbesitzers aus Swaffham, wie er das Mädchen aus den Flammen gerettet habe.
Als Howard davon erfuhr, erfasste ihn eine unbändige Wut. Er hatte keine Dankbarkeit erwartet für seine Tat, erst recht keine öffentliche Anerkennung; aber dass ein anderer damit prahlte und sich als Retter des Mädchens ausgab, damit wollte er sich einfach nicht abfinden.
Hätte er geahnt, dass die Erlebnisse jener Nacht Konsequenzen für sein ganzes Leben haben würden, Howard Carter hätte gewiss die Sache auf sich beruhen lassen. Aber das Leben geht seltsame Wege, und keiner ahnt, wohin sie letztendlich führen.
Wem sollte er sich anvertrauen?
Miss Jones, der Howard die ganze Geschichte schließlich erzählte, zeigte Verständnis für seine Situation, und sie gab Carter den Rat, er solle Robert Spink zur Rede stellen, andernfalls nage das erlittene Unrecht ein Leben lang an seiner Seele.
Der Sohn des Fabrikbesitzers war in Swaffham bekannt für seine Überheblichkeit und Arroganz, mit der er den einfachen Leuten in der kleinen Stadt begegnete, und viele wunderten sich, dass ausgerechnet er zu einer so selbstlosen Heldentat fähig sein sollte. Für gewöhnlich prahlte er mit dem Geld seines Vaters und mit lateinischen Sätzen, die man ihm auf dem College in Cambridge beigebracht hatte. Howard wartete ein paar Tage, um dann bei dem jungen Spink vorstellig zu werden.
Die Spinks lebten in einem Landhaus am westlichen Stadtrand auf einem parkähnlichen Grundstück mit riesigen Eichen und Koniferen, deren Äste sich beinahe bis auf den Rasen neigten. Vom Eingangstor aus weiß gestrichenem Lattenwerk zum säulenumrahmten Hauseingang führte eine breite, gepflegte Auffahrt, die mit roten Bruchsteinen belegt und geeignet war, dem fremden Besucher Respekt einzuflößen vor so viel Wohlstand.
Am Eingang wurde Howard von einem Butler empfangen und mit aufgesetzter Höflichkeit nach seinem Begehren gefragt und wen er melden dürfe. Nach einer Weile kehrte er zurück und ließ Carter wissen, er bedauere, der junge Herr, so drückte er sich aus, sei nicht zu Hause, er könne gerne eine Nachricht hinterlassen.
Howard schüttelte den Kopf und wandte sich um. Er glaubte dem Butler kein Wort. Vor dem Eingangstor stieß Carter auf den Gärtner und fragte diesen, ob er wisse, wohin Robert Spinks gegangen sei.
Er habe ihn gerade noch gesehen, erwiderte der Gärtner, weit könne er nicht sein.
Carter tat so, als zöge er sich zurück, doch ihm stand nicht der Sinn danach aufzugeben. Und so stieg er, außer Sichtweite des Hauses, über die Mauer, die den gesamten Besitz umgab, und näherte sich dem Anwesen schließlich von der Terrassenseite, wo ihm Robert Spink direkt in die Arme lief.
Für beide kam die Begegnung so unverhofft, dass sie sich eine Weile wortlos gegenüberstanden, beide etwa gleich hochgewachsen, Robert Spink jedoch kraftstrotzend und von kerniger Gesundheit, Howard Carter hingegen schmal und von schwächlichem Äußeren. Was nun geschah, hatte wohl keiner von beiden erwartet: Carter holte aus und verabreichte Spink eine klatschende Ohrfeige.
Der Mut des Schwächeren musste Spink wohl so überrascht haben, dass er sich überhaupt nicht wehrte und betroffen auf den Boden starrte, wie ein Kind, das soeben bei einer Lüge ertappt wurde.
»Warum hast du das getan?«, fragte Howard tonlos, und aus seinen Augen blitzte offene Wut.
Es schien, als habe Robert sich von dem Schock erholt, denn mit einem Mal setzte er ein zynisches Grinsen auf und meinte verächtlich: »Zweifelst du etwa, dass ich nicht in der Lage gewesen wäre, das Mädchen aus dem brennenden Haus zu holen?«
»Warum hast du es dann nicht getan?« Howards Stimme wurde lauter.
»Ich hab es doch getan! Du kannst es in allen Zeitungen nachlesen.«
»Du weißt genau, dass das gelogen ist! Du bist ein erbärmlicher Lügner!«
»Das behauptest nur du, Carter!«
»Ja. Das behaupte ich.«
»Niemand wird dir glauben, hörst du, niemand!«
Howard wischte sich mit der flachen Hand über das Gesicht. Der Kerl hatte recht. Ihm würde wirklich niemand glauben. Nicht jetzt, da das Ereignis bereits eine Woche zurücklag.
Aus Spinks Gesicht verschwand das unverschämte Grinsen. »Ich mache dir einen Vorschlag, Carter. Du bekommst von mir zwei Sovereign, und wir vergessen die Sache. Einverstanden?«
Und noch ehe Howard antworten konnte, noch ehe ihm bewusst wurde, wie demütigend das Angebot war, zählte Spink ihm zwei Sovereign in die Hand. Dann wandte er sich um und machte Anstalten zu gehen. Schließlich drehte er sich noch einmal um, und mit ausgestrecktem Arm und erhobenem Zeigefinger rief er Carter zu: »Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, versuche nie mehr deine Hand gegen mich zu erheben. Nie mehr, hörst du!«
Betreten blickte Carter auf die zwei Sovereign in seiner Hand, während er dem Eingangstor zustrebte. Zwei Pfund, das war viel Geld für einen Jungen wie ihn. Aber schon im nächsten Augenblick kam ihm der Gedanke: Hast du denn überhaupt keinen Stolz, Howard? Die Wahrheit ist nicht käuflich.
Auf halbem Weg kam ihm der Gärtner entgegen. Er nickte ihm freundlich zu.
Carter hielt ihn an, drückte ihm die zwei Sovereign in die Hand und sagte: »Richte dem jungen Herrn aus, ein Carter lässt sich nicht kaufen. Nicht von einem Spink!«
Mit ihrem ersten Gehalt, das ihr Gertrude von Schell korrekt und pünktlich ausbezahlte, suchte Miss Jones den Besitzer des »George Commercial Hotel« auf, um ihre Mietschuld zu begleichen.
Mr. Hazelford, ein listig blickender, kleiner Mann von großer Freundlichkeit, erkundigte sich, ob sie sich denn in Swaffham schon eingewöhnt habe und ob es immer noch keine Spur gebe von dem Gelddieb.
»Was das Eingewöhnen betrifft«, antwortete Miss Jones betont freundlich, »so wird es wohl noch eine Weile dauern. Und von der Polizei habe ich seit zwei Wochen nichts mehr gehört. Ich hoffe nur, sie haben die Suche nicht aufgegeben.«
Hazelford nickte beflissen, dann räusperte er sich, als wollte er etwas sagen, schließlich rief er nach hinten in den Gang, der zum Hof führte: »Owen, Miss Jones ist hier!«, und an Sarah gewandt, meinte er: »Ich weiß nicht, ob es Sie interessiert, Miss, aber Owen hat eine interessante Beobachtung gemacht. Aber das soll er Ihnen selbst sagen.«
Der Gastwirtssohn war von der Statur das Gegenteil seines Vaters, lang und schlaksig, und dabei machte er nicht gerade den hellsten Eindruck.
»Erzähle mal der Miss, was du gesehen hast, damals«, befahl Hazelford, als Owen endlich eintraf.
»Nun ja«, begann dieser und blickte verlegen auf den Boden der Gaststube, »also das war so damals. Es dämmerte schon, als ich an der Stelle eintraf, die Sie mir beschrieben hatten. Und als ich niemanden bei dem Koffer fand, da sah ich mich natürlich um; denn Sie hatten ja gemeint, ein alter Mann würde auf das Gepäckstück aufpassen.«
Vater Hazelford puffte seinem Sohn ungeduldig in die Seite: »Ja und? Nun sag schon. Was hast du damals gesehen?«
Owen hob die Schultern. »Ich sag es nicht gerne, weil ich natürlich nichts beweisen kann, Miss. Ich sage es überhaupt nur deshalb, weil auch auf mich ein gewisser Verdacht fällt. Aber ich war es nicht, Miss, glauben Sie mir!«
Sarah Jones nickte. Allmählich wurde auch sie ungeduldig.
»Also das war so«, holte der Sohn des Gastwirts aus, »als ich mich umsah, wo der alte Mann geblieben sein könnte, da entdeckte ich vor dem Haus des Apothekers, keine fünfzig Yards entfernt, einen hochgewachsenen schmächtigen Jungen. Ich glaube, es war der junge Carter.«
»Howard Carter?« Sarah Jones’ Stimme klang aufgeregt.
»Ja, der! Aber damit will ich natürlich nicht gesagt haben, dass er … Sie verstehen.«
»Und hast du das beim Verhör auch der Polizei gesagt?«
»Also nicht direkt, Miss Jones, ich habe mich nämlich erst jetzt erinnert. Und damals erschien es mir ohne Bedeutung.«
»Aber es könnte von großer Bedeutung sein!«
»Ich weiß.« Owen hob verlegen die Schultern. Sein Vater nickte zustimmend.