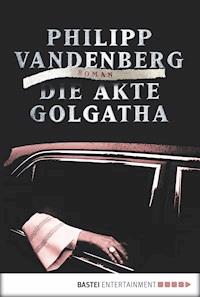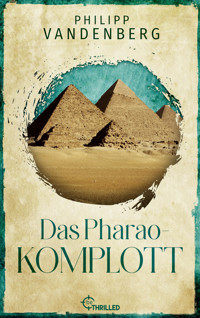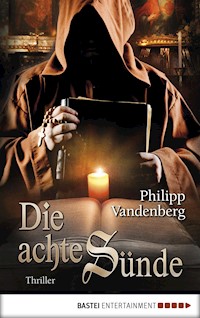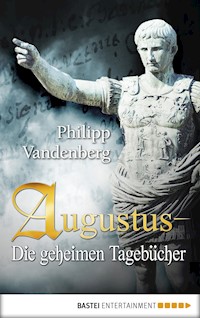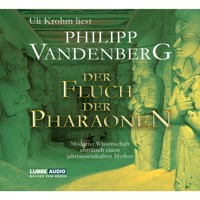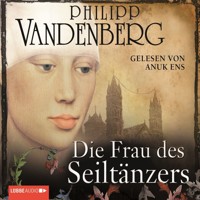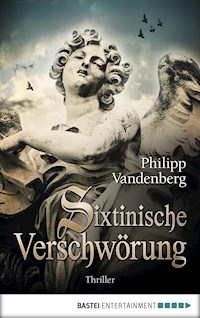
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine merkwürdige Entdeckung bei der Restaurierung der Sixtinischen Kapelle beunruhigt die Gemüter: Einzelne Bildfelder sind mit Buchstaben versehen, deren Abfolge keinen Sinn ergibt. Auf der Suche nach einer Erklärung stößt Kardinal Jellinek, Präfekt der Glaubenskongregation, in den Geheimarchiven des Vatikans auf ein Dokument, das die Lehre der Kirche in ihren Grundfesten zu erschüttern droht. Ist dies die späte Rache des Michelangelo an Gottes Stellvertreter?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
DIEWICHTIGSTEN PERSONENDER HANDLUNG
VONDER WOLLUSTDES ERZÄHLENS
DAS BUCH JEREMIAS
An Epiphanias
Am Tag nach Epiphanias
Am Fest des Papstes Marcellus
Zwei Tage später
Zwischen zweitem und drittem Sonntag nach Epiphanias
An Pauli Bekehrung
Am vierten Sonntag nach Epiphanias
Ebenfalls am vierten Sonntag nach Epiphanias
Mariä Lichtmess
Montag nach Lichtmess
An Quinquagesima, vermutlich
Aschermittwoch
Donnerstag darauf
Vor dem ersten Fastensonntag Invocavit
Montag nach Invocavit
Die folgende Nacht und der folgende Tag
Am Fest des Apostels Matthias
An Reminiscere
Montag nach Reminiscere
Dienstag nach Reminiscere
Am Mittwoch der zweiten Fastenwoche
Ebenfalls am Mittwoch der zweiten Fastenwoche
Am Freitag der zweiten Fastenwoche
Am Tage nach Oculi
Irgendwann zwischen Oculi und Laetare
Am Tag nach Laetare und am nächsten Morgen
Am Fest des heiligen Josef
Am Montag nach Judica
Maria Verkündigung
Am Montag der Karwoche
Am Dienstag der Karwoche
Am Mittwoch der Karwoche
Am Gründonnerstag
Von Karsamstag zu Ostersonntag
VONDER SÜNDEDES SCHWEIGENS
ANHANG
Über den Autor
Philipp Vandenberg wurde am 20. September 1941 in Breslau geboren. Er wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg bei einer Pflegemutter und im Waisenhaus auf und kam 1952 ins oberbayrische Burghausen. Er besuchte dort dasselbe Gymnasium wie Ludwig Thoma und flog, eigenem Bekunden zufolge, wie dieser von der Schule. Er kehrte reumütig zurück und konnte in der Folge die mangelhaften Leistungen in Griechisch sowie Mathematik durch hervorragende Leistungen in Deutsch und Kunst ausgleichen. 1963 machte er am humanistischen Gymnasium Burghausen/Salzach Abitur und studierte anschließend an der Universität München Kunstgeschichte und Germanistik (ohne Abschluss). Ein Volontariat machte Vandenberg 1965/1967 bei der Passauer Neuen Presse, die ihn 1967 zum Redaktionsleiter des Burghauser Anzeigers machte.
PHILIPPVANDENBERG
SixtinischeVerschwörung
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 1988/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustrationen: © shutterstock/Phant, © shutterstock/Csehak Szabolcs
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5775-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
DIEWICHTIGSTEN PERSONENDER HANDLUNG
Die Eminentissimi und ReverendissimiHerren Kardinäle
GIULIANO CASCONE – Kardinalstaatssekretär und Präfekt des Rates für die Öffentlichen Angelegenheiten der Kirche
JOSEPH JELLINEK – Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre
GIUSEPPE BELLINI – Präfekt der Kongregation für die Sakramente und den Gottesdienst
FRANTISEK KOLLETZKI – Prosekretär der Kongregation für das katholische Bildungswesen und Rektor des Collegium Teutonicum
Die Eminentissimi und Reverendissimi HerrenErzbischöfe und Bischöfe
MARIO LOPEZ – Prosekretär der Kongregation für die Glaubenslehre und Titularerzbischof von Caesarea
PHIL CANISIUS – Leiter des Istituto per le Opere Religiose IOR
DESIDERIO SCAGLIA – Titularerzbischof von San Carlo
Die hochgeachtetenHerren Monsignori
WILLIAM STICKLER – Kammerdiener des Papstes
RANERI – 1. Sekretär des Kardinalstaatssekretärs
Des Weiteren
AUGUSTINUS FELDMANN – Leiter des Vatikanischen Archivs
PIO SEGONI – Benediktiner aus Montecassino
PROF. ANTONIO PAVANETTO – Generaldirektor der Vatikanischen Bauten und Museen
PROF. RICCARDO PARENTI – Michelangelo-Spezialist aus Florenz
PROF. GABRIEL MANNING – Professor für Semiotik am Athenäum des Lateran
BRUDER BENNO alias DR. HANS HAUSMANN – Klosterbruder
GIOVANNA – Hausbeschließerin
VONDER WOLLUSTDES ERZÄHLENS
WÄHRENDICHSCHREIBE, WERDEICHVONHEFTIGEN Zweifeln geplagt, ob ich das überhaupt alles erzählen darf. Ob ich es nicht besser für mich behielte, so wie jene es für sich behalten haben, die bisher Kenntnis davon hatten. Aber ist nicht Schweigen die grausamste Lüge? Und trägt nicht sogar Irrtum zum Verständnis der Wahrheit bei? Unfähig jener Erkenntnis, die selbst dem wahren Christenmenschen ein Leben lang verborgen bleibt und die sich stets in das Zeugnis des Glaubens flüchtet, habe ich lange das Für und Wider erwogen, bis die Wollust überhandnahm, diese Geschichte zu erzählen – so wie ich sie unter denkwürdigen Umständen erfuhr.
Ich liebe Klöster, ein unerklärlicher Drang treibt mich an diese von der Außenwelt abgesonderten Orte, welche, das sei einmal angemerkt, die schönsten Flecken der Erde besiedeln. Ich liebe Klöster, weil dort die Zeit stillzustehen scheint, ich genieße den morbiden Geruch, der ihre weit verzweigten Gebäude durchströmt, jene Mischung aus ewig vor sich hin muffelnden Folianten, feucht gewischten Gängen und verflüchtigtem Weihrauch. Vor allem aber liebe ich Klostergärten; sie werden meist vor der Öffentlichkeit verborgen, warum weiß ich nicht, zeigen doch gerade sie einen Blick ins Paradies.
Dieses vorausschickend, will ich erklären, warum ich an jenem leuchtenden Herbsttag, den nur der südliche Himmel hervorzuzaubern vermag, in das Paradies des Benediktinerklosters eindrang. Es war mir gelungen, mich nach einer Führung durch Kirche, Krypta und Bibliothek von einer Gruppe abzusetzen, und dabei fand ich den Weg durch ein kleines Seitenportal, hinter dem nach dem Plan des hl. Benedikt man den Klostergarten vermuten konnte.
Das Gärtlein war ungewöhnlich klein, viel kleiner, als es ein Kloster dieser Größe erwarten ließ, und der Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass die tief stehende Sonne das paradiesische Quadrat diagonal in eine grell beleuchtete und eine tief schattige Hälfte teilte. Nach der beklemmenden Kühle, die dem Inneren des Klosters anhaftete, wirkte die Wärme der Sonne wohltuend. Spätsommerblumen, Phlox und Dahlien mit schweren Blütenköpfen, zeigten ihre hohe Zeit, Iris, Gladiolen und Lupinen setzten senkrechte Akzente, und allerlei Gewürzkräuter drängten sich wild wachsend in schmalen Beeten, durch einfache Holzbretter voneinander getrennt. Nein, dieser Klostergarten hatte nichts gemein mit den parkähnlichen Anlagen anderer Benediktinerklöster, welche allseitig eingerahmt von der Phalanx trutziger Gebäudetrakte und gestützt auf einen umlaufenden Kreuzgang mit Profanem konkurrieren wie Versailles oder Schönbrunn. Dieser Klostergarten war gewachsen, nachträglich aufgehäuft zu einer Terrasse am südlichen Abhang des Klosters und getragen von einer hohen Mauer aus Tuffstein, wie ihn die Gegend hervorbrachte. Nach Süden war der Blick frei, an klaren Tagen konnte man am Horizont die Gebirgskette der Alpen ausmachen. An der einen Seite, dort, wo die Küchenkräuter wuchsen, plätscherte Wasser aus einem Eisenrohr in einen Steintrog, und daneben stand ein morsches Gartenhäuschen, eher ein Bretterverschlag, an dem sich schon mehrere Baumeister ziemlich ungeschickt versucht hatten. Vor Regen schützte eine verschlissene Bedeckung aus Dachpappe, ein quer gestellter, ausgedienter Fensterflügel war die einzige Lichtöffnung. Das Ganze verbreitete auf ungewöhnliche Weise Heiterkeit, wohl deshalb, weil die Konstruktion irgendwie an jene Bretterhäuschen erinnerte, die wir als Kinder in den Ferien zusammenzimmerten.
Aus dem Schatten tönte plötzlich eine Stimme: »Wie hast du mich gefunden, mein Sohn?«
Ich hielt schützend die Hand über die Augen, um mich im Schattenlicht besser zu orientieren, und der Anblick, der sich mir bot, lähmte mich für einen Augenblick: Da saß aufrecht in einem Rollstuhl ein Mönch mit prophetischer schlohweißer Barttracht. Er trug einen gräulichen Habitus, der sich auffallend von dem vornehmen Schwarz der Benediktinermönche unterschied, und während er mich mit durchdringenden Augen ansah, drehte er sein Haupt hin und her, ohne den Blick von mir zu lassen, wie eine hölzerne Marionette.
Obwohl ich seine Frage sehr wohl verstanden hatte, fragte ich, um Zeit zu gewinnen, zurück: »Was meinen Sie?«
»Wie hast du mich gefunden, mein Sohn?«, wiederholte der seltsame Mönch seine Frage mit der gleichen Bewegung des Kopfes, und ich glaubte einen Ausdruck von Leere in seinem Blick zu erkennen.
Meine Antwort blieb unverbindlich, sollte es auch sein, denn ich wusste nichts anzufangen mit dieser seltsamen Begegnung und seiner ebenso seltsamen Frage. »Ich habe Sie nicht gesucht«, sagte ich, »ich habe das Kloster besichtigt und wollte nur einen Blick in den Garten werfen, entschuldigen Sie.« Ja, ich schickte mich an, mich mit einem Kopfnicken zu verabschieden, als der Alte plötzlich die Arme anwinkelte, die bis dahin reglos auf den Lehnen des Rollstuhls lagen, und den Rädern einen Stoß versetzte, dass er auf mich zuschoss wie von einem Katapult beschleunigt. Der Alte schien Bärenkräfte zu haben. Ebenso schnell, wie er sich mir genähert hatte, blieb er stehen, und als er ganz nahe war, erkannte ich, nun dem Sonnenlicht ausgesetzt, unter der strähnigen Haar- und Barttracht ein schmales, fahles Gesicht, viel jünger, als es den ersten Anschein hatte. Die Begegnung begann mich zu beunruhigen. »Du kennst den Propheten Jeremias?«, fragte der Mönch unvermittelt, und ich zögerte einen Augenblick, ich überlegte, einfach wegzulaufen; aber sein stechender Blick und diese seltsame Würde, die von dem Mann ausging, hielt mich zu bleiben.
»Ja«, sagte ich, »ich kenne den Propheten Jeremias und Isaias, Baruch, Ezechiel, Daniel, Arnos, Zacharias und Malachias« – so wie sie mir seit meiner Internatszeit in einem Kloster im Gedächtnis geblieben waren.
Die Antwort verblüffte den Mönch, ja, sie schien ihn zu erfreuen, denn mit einem Mal wich die Starrheit aus seinem Gesicht, und er verlor das Marionettenhafte in seinen Bewegungen.
»In jener Zeit«, sagt Jeremias, »wird man die Gebeine der Könige von Juda und die Gebeine seiner Fürsten und die Gebeine seiner Priester und die Gebeine der Propheten und die Gebeine der Bewohner Jerusalems aus ihren Gräbern zerren. Man wird sie der Sonne, dem Mond und dem gesamten Himmelsheer hinwerfen, denn man liebte und verehrte diese ja, lief ihnen nach, suchte sie auf und warf sich anbetend vor ihnen hin. Sie werden nicht wieder gesammelt und kommen in kein Grab. Als Dung auf dem Acker sollen sie dienen. Und der gesamte Rest, der von diesem bösen Geschlecht allerorts noch übrig bleibt, wohin immer ich sie verstoße, wird dann lieber sterben als leben.«
Ich sah den Mönch fragend an, und der Mönch erkannte meinen ratlosen Blick und sagte: »Jeremias acht, eins bis drei.«
Ich nickte.
Der Mönch hob den Kopf, dass sein weißer Bart beinahe waagrecht stand, und mit dem Handrücken strich er sanft über die Unterseite seiner Haarpracht. »Ich bin Jeremias«, sagte er dabei, und im Tonfall seiner Stimme klang eine gewisse Eitelkeit, eine ganz und gar unmönchische Tugend. »Alle nennen mich Bruder Jeremias. Aber das ist eine lange Geschichte.«
»Sie sind Benediktiner?«
Er machte eine verneinende Handbewegung. »Man hat mich in dieses Kloster gesteckt, weil sie glauben, dass ich hier am wenigsten Schaden anrichten kann. So lebe ich nach der Ordo Sancti Benedicti unberührt und ungestört von weltlichen Daseinsbedürfnissen, würdelos als Converse. Könnte ich, ich würde fliehen.«
»Sie sind noch nicht lange im Kloster?«
»Wochen. Monate. Vielleicht sind es schon Jahre. Was spielt das für eine Rolle!«
Das Klagen des Bruders Jeremias begann mein Interesse zu wecken, und mit der gebotenen Vorsicht erkundigte ich mich nach seinem früheren Leben.
Da schwieg der rätselhafte Mönch, er ließ das Kinn auf die Brust sinken und blickte an sich hinab auf seine gelähmten Beine, und ich fühlte, dass ich zu weit gegangen war mit meiner Frage. Aber noch bevor ich ein Wort der Entschuldigung hervorbringen konnte, begann Jeremias zu reden.
»Was weißt du, mein Sohn, von Michelangelo …?«
Er redete stockend, ohne mich dabei anzusehen, und man spürte, dass er sich jedes Wort überlegte, bevor er es aussprach, und dennoch erschienen mir seine Worte wirr und zusammenhanglos. Ich erinnere mich nicht mehr an jede Einzelheit, vor allem deshalb, weil er sich ständig verhaspelte, verbesserte und Sätze neu begann; aber mir blieb im Gedächtnis, dass hinter den Mauern des Vatikans Dinge im Gang seien, von denen der gläubige Christenmensch keine Ahnung habe und dass – und das erschreckte mich – die Kirche eine casta meretrix, eine keusche Hure sei. Dabei gebrauchte er Fachausdrücke und schwelgte in Worten wie Kontroverstheologie, Moraltheologie und Dogmatik, dass meine Zweifel, Bruder Jeremias könnte nicht bei klarem Verstand sein, schneller schwanden, als sie gekommen waren. Er nannte Konzile mit Namen und Jahreszahl, unterschied Partikular-, Plenar- und Provinzialkonzile und nannte Vor- und Nachteile des Episkopalismus, bis er auf einmal jäh endete und fragte: »Du hältst mich wohl auch für verrückt?«
Ja, er sagte auch, und das überraschte mich. Offensichtlich wurde Bruder Jeremias in diesem Kloster als geistig Verwirrter abgesondert wie ein lästiger Häretiker, und ich weiß auch nicht mehr, was ich dem Mönch antwortete; ich erinnere mich nur noch, dass mein Interesse an diesem Mann wuchs. Also kam ich auf meine Frage zurück und bat ihn, er solle mir doch berichten, auf welche Weise er in dieses Kloster gelangt sei. Aber Jeremias wandte sein Gesicht der Sonne zu und schwieg mit geschlossenen Augen, und während ich ihn so betrachtete, merkte ich, wie sein Bart zu zittern begann; die kleinen Bewegungen wurden heftiger, und mit einem Mal zuckte der ganze Oberkörper des Mönchs, und seine Lippen bebten wie vom Fieber gequält. Welch furchtbares Ereignis mochte vor den geschlossenen Augen dieses Mannes ablaufen?
Vom Turm der Klosterkirche schlug die Glocke und rief zum Chorgebet, und Bruder Jeremias richtete sich auf, als erwachte er aus einem Traum. »Sprich mit niemandem über unser Zusammentreffen«, sagte er hastig, »am besten, du verbirgst dich in dem Gartenhaus. Während der Vesper kannst du das Kloster unbemerkt verlassen. Komme morgen zur gleichen Zeit! Ich werde da sein!«
Ich befolgte die Anweisung des Mönchs und verbarg mich in dem kleinen Holzhaus, und gleich darauf näherten sich Schritte. Ich spähte durch das halb erblindete Fenster und sah, wie ein Benediktiner Jeremias in seinem Rollstuhl zur Kirche schob. Die beiden sprachen kein Wort. Es schien, als nehme keiner von dem anderen Notiz, als käme der eine einem unabänderlichen Mechanismus nach, und der andere ließ ihn teilnahmslos über sich ergehen.
Wenig später vernahm ich aus der Kirche gregorianische Gesänge, ich ging nach draußen, hielt mich jedoch im Schatten des Gartenhauses, um nicht doch noch von einem Fenster der umliegenden Klostergebäude aus entdeckt zu werden, denn ich wollte Bruder Jeremias unbedingt wiedersehen. An der hohen Stützmauer führte eine steile Steintreppe nach unten. Ein eisernes Tor, das den Zugang versperrte, war leicht zu überwinden.
Auf diese Weise verließ ich das Kloster und den paradiesischen Garten, und auf demselben Weg verschaffte ich mir am nächsten Tag Zutritt. Ich musste nicht lange warten, bis ein Confrater, wortlos wie am Tag zuvor, Jeremias im Rollstuhl in den Garten schob.
»Seit ich hier bin, hat sich niemand für mein früheres Leben interessiert«, begann der Mönch ohne Umschweife, »im Gegenteil, sie haben sich Mühe gegeben, es vergessen zu machen, mich abzuschirmen von der Außenwelt, sie wollen mir einreden, ich hätte den Verstand verloren, als sei ich ein verkommener Spirituale, ein islamischer Assassine. Mag sein, dass die vollkommene Wahrheit über mich nicht in dieses Kloster vorgedrungen ist; auch wenn ich sie tausendmal beschwüre, niemand würde mir glauben. Galilei muss nicht anders gefühlt haben.«
Ich beteuerte, dass ich seinen Worten Glauben schenkte; ich spürte, dass es ihm ein Bedürfnis war, sich jemandem anzuvertrauen.
»Aber meine Erzählung wird dich nicht glücklicher machen«, wandte Bruder Jeremias ein, und ich beteuerte, ich würde sie zu ertragen wissen. Da begann der einsame Frater zu erzählen, er redete ruhig, bisweilen sogar distanziert, und am ersten Tag wunderte ich mich, warum er selbst nicht in seiner Geschichte vorkam. Am zweiten Tag wurde mir allmählich klar, er schien über sich in der dritten Person zu berichten wie ein neutraler Beobachter – ja, einer der Menschen, von denen er weit ausholend erzählte, musste er selbst sein: Bruder Jeremias.
Wir begegneten uns fünf Tage hintereinander im Paradiesgarten des Klosters, wir verbargen uns hinter einem wild wuchernden Rosenspalier, bisweilen auch in der morschen Hütte. Jeremias redete, nannte Namen und Fakten, und obwohl seine Geschichte bisweilen fantastisch erschien, zweifelte ich keinen Augenblick an ihrer Wahrheit. Während er sprach, sah Bruder Jeremias mich nur selten an, er hielt den Blick meist auf einen imaginären Punkt in der Ferne gerichtet, als lese er von einer Tafel ab. Ich wagte nicht, ihn auch nur einmal zu unterbrechen, ich wagte ihm keine Frage zu stellen, weil ich fürchtete, er würde den Faden verlieren, und weil ich gebannt war von seiner Erzählung. Auch mied ich es, mir Notizen zu machen, die den Redefluss des Mönchs vielleicht gestört hätten, sodass ich das Folgende aus dem Gedächtnis niederschreibe; aber ich glaube, es kommt den Worten des Bruders Jeremias nahe.
DAS BUCH JEREMIAS
An Epiphanias
DER TAGSEIVERFLUCHT, ANDEMDIE KURIEBESCHLOSS, DIE Sixtinische Kapelle einer Restaurierung zu unterziehen nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Verflucht sei der Florentiner, verflucht alle Kunst, verflucht die Vermessenheit, ketzerische Gedanken nicht auszusprechen mit dem Mut des Ketzers, sondern sie gemahlenem Kalk, dem widerwärtigsten aller Gesteine, anzuvertrauen, buon fresco mit lüsternen Farben vermischt.
Joseph Kardinal Jellinek blickte zum hohen Gewölbe, wo, mit Planen verhängt, ein Gerüst hing; es gab den Blick gerade noch frei auf Adam am Finger des Schöpfers. Als fürchte er die mächtige Rechte Gottes, huschte über das Gesicht des Kardinals ein merkliches Zucken, mehrmals in unregelmäßigen Abständen; denn dort, umwallt von roten Gewändern, schwebte kein gnädiger Gott, ein Schöpfer stand auf, kraftvoll und schön, muskelbepackt wie ein Kämpfer, Leben verbreitend. Das Wort, hier war es Fleisch geworden.
Seit den unseligen Zeiten des kunstsinnigen Pontifex Julius hat kein Papst Freude gefunden an den orgiastischen Malereien Buonarrotis, der, was schon zu seinen Lebzeiten ein offenes Geheimnis war, dem christlichen Glauben zweifelnd gegenüberstand und die Bilder seiner Gedanken aus einer seltsamen Mischung alttestamentarischer Überlieferung und griechischer Antike ableitete, vielleicht auch noch idealisiertem Römertum, was schlichtweg als sündhaft galt, damals. Papst Julius soll betend zu Boden gefallen sein, als ihm der Künstler zum ersten Mal das Fresko mit dem unbarmherzigen Richter enthüllte, welcher Gute wie Böse vor der Gewalt seines Urteils erzittern lässt, doch kaum erholt von seiner Demut, geriet er mit Michelangelo in heftigen Streit über die Fremdheit, Rätselhaftigkeit und Nacktheit der Darstellung. Verwirrt von der undurchdringlichen Symbolik, den zahllosen Anspielungen und neuplatonischen Hinweisen, wusste die Kurie keinen anderen Rat, als die Anhäufung prallen, nackten Menschseins zu tadeln, mehr noch, ihre Beseitigung zu fordern, allen voran Biagio da Cesena, der Zeremonienmeister des Papstes, der sich in Minos, dem Höllenrichter, zu erkennen glaubte, und nur wütender Einspruch der bedeutendsten Künstler Roms hatte das Jüngste Gericht vor dem Abschlagen bewahrt.
Sickerwasser, mehrfache Übermalungen und Kerzenruß drohten Michelangelos orgiastischen Geistesflug zu zerstören. O hätte doch Schimmel die Propheten gefressen und Rauch die Sibyllen verzehrt; denn kaum hatte Chefrestaurator Bruno Fedrizzi auf hohem Gerüst die Arbeit begonnen, kaum hatte er mit seinen Helfern die ersten Propheten von einer dunklen Schicht, bestehend aus Kohlenstoff, Kaninchenleim und in Öl gelösten Pigmenten, befreit, da nahm das Vermächtnis des Florentiners seinen Lauf, ja es schien, als erhebe sich Michelangelo von den Toten, drohend wie der Engel der Rache.
Joel, der Prophet, hielt einst eine düstere Rolle Pergament in Händen, welche, obwohl zwischen linker und rechter von vorne nach hinten verdreht, weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite ein geschriebenes Zeichen enthielt, so war nun, nach erfolgter Reinigung, auf der Schriftrolle deutlich ein A zu erkennen. A und O, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets, sind christliche Symbole der Urkirche, aber die Restauratoren wischten vergeblich, bis das al fresco gemalte Pergament grelle Weiße erlangte. Der Kalkputz verbarg kein O. Dafür tauchten in dem Buch, das die erythräische Sibylle, dem Propheten Joel benachbart, auf einem Lesepult aufgestellt hat, ein anderes rätselhaftes Kürzel auf: I – F – A. Diese unerwartete Erscheinung brachte, unbemerkt von der Öffentlichkeit, eine heftige Diskussion in Gang. Archivare und Kunsthistoriker der vatikanischen Bauten und Museen unter Professore Antonio Pavanetto begutachteten die Entdeckung, aus Florenz reiste der Michelangelo-Spezialist Riccardo Parenti an, und der Kardinalstaatssekretär Cascone erklärte die Entdeckung zur Geheimsache, nachdem man intern über die Bedeutung der Buchstaben A – I – F diskutiert hatte. Parenti war es auch, der zum ersten Mal die Möglichkeit ins Gespräch brachte, im Zuge der Restaurierungsarbeiten könnten weitere Schriftzeichen entdeckt werden und ihre Entschlüsselung könne unter Umständen wenig wünschenswert sein für Kurie und Kirche. Schließlich habe Michelangelo unter seinen Auftraggebern, den Päpsten, gelitten und mehr als einmal angedeutet, er würde sich auf seine Weise rächen.
Ob von dem florentinischen Maler häretisches Gedankengut zu erwarten sei, erkundigte sich der Kardinalstaatssekretär.
Der Kunstprofessor bejahte diese Frage unter Vorbehalt.
Darauf ließ Kardinalstaatssekretär Giuliano Cascone den Präfekten der heiligen Kongregation für Glaubensfragen, Joseph Kardinal Jellinek, hinzuziehen, der jedoch an der Angelegenheit wenig Interesse zeigte und die Empfehlung aussprach, die Generaldirektion der vatikanischen Bauten und Museen unter Professore Pavanetto möge sich des Falles annehmen – wenn man überhaupt von einem Fall sprechen könne. Das heilige Offizium wolle nicht eingreifen.
Als im folgenden Jahr die Restauration bei der Figur des Propheten Ezechiel angelangt war, richtete sich das Interesse der Kurie vor allem auf die Schriftrolle, die der Künder der Zerstörung Jerusalems in seiner Linken hält. Es habe den Anschein, meldete Fedrizzi, als sei das Fresco an dieser Stelle besonders verrußt, als sei mit einer Kerzenflamme künstlich nachgeholfen worden, die Stelle abzudunkeln. Schließlich kamen unter dem Schwamm des Restaurators zwei weitere Buchstaben zum Vorschein: L und U, und Professore Pavanetto äußerte die Vermutung, dass auch die persische Sibylle, die Ezechiel in der Reihe nachfolgt, ein Buchstabengeheimnis berge. Die bucklige Alte hält, offensichtlich kurzsichtig, ein rot gebundenes Buch direkt vor die Augen, und vom Gerüst aus der Nähe betrachtet war schon vor der Reinigung durch Bruno Fedrizzi ein Buchstabe andeutungsweise zu erkennen. Kardinalstaatssekretär Cascone, den die Entdeckung mehr als alle anderen zu beunruhigen schien, ließ das Buch der Sibylle probereinigen. So wurde die Vermutung zur Gewissheit, und ein weiterer Buchstabe, B, fügte sich der Kombination an.
Man musste also davon ausgehen, die letzte Gestalt in der Reihe, der Prophet Jeremias, würde ebenfalls ein Kürzel preisgeben, und in der Tat, die Schriftrolle an seiner Seite zeigte ein A. Jeremias, der wie kein anderer Prophet von inneren Kämpfen gequält wurde und offen aussprach, das Volk werde niemals bekehrt werden, er, dem Michelangelo sein eigenes verzweifeltes Gesicht aufgesetzt hatte, blieb stumm, resigniert, ratlos – so als kenne er die geheimnisvolle Bedeutung der Buchstabenreihe: A-I-F-A-L-U-B-A.
Kardinalstaatssekretär Giuliano Cascone erklärte, vor Veröffentlichung der Entdeckung müsse die Bedeutung der Inschrift geklärt sein, und er stellte zur Diskussion, die unerklärlichen Kürzel, sollte ihr Geheimnis nicht umgehend gelöst werden können, abzuwaschen, was nach Auskunft von Chefrestaurator Bruno Fedrizzi technisch möglich sei, weil Michelangelo die Buchstabenkürzel a secco zusammen mit geringfügigen Korrekturen auf die fertigen Fresken aufgebracht habe. Doch Professore Riccardo Parenti protestierte heftig, er drohte, in diesem Fall seine Beratertätigkeit aufzugeben und sich an die Öffentlichkeit zu wenden mit dem Hinweis, dass in der Sixtinischen Kapelle das wohl bedeutsamste Kunstwerk der Welt verfälscht und zerstört werde. Cascone zog daraufhin seine Pläne zurück und beauftragte nun ex officio Joseph Kardinal Jellinek als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, eine Kommission zur Erforschung der sixtinischen Inschrift einzusetzen und die Ergebnisse in einer ordentlichen Versammlung zu beraten. Gleichzeitig wurde die Angelegenheit von der Kategorie speciali modo zur Kategorie specialissimo modo erhoben, derzufolge jede Übertretung des Geheimhaltungsauftrages mit Ehrverlust geahndet werde, und als Termin für das Consilium wurde Montag nach dem zweiten Sonntag nach Epiphanias festgesetzt.
Jellinek verließ die Kapelle und stieg die engen Steinstufen empor, mit gekonntem Griff seine Soutane raffend, die, wie alle Kleidung des Kardinals, von Annibale Gammarelli stammte, Santa Chiara Nr. 34, wo Kurie und Papst schneidern ließen, wandte sich auf dem Treppenabsatz nach links und lief in dieser Richtung weiter. Seine aufgeregten Schritte hallten in dem langen, leeren Korridor, der zweihundert Schritte erforderte, vorbei an Landkartenfresken der Kosmographen Danti, ausgewählt nach achtzig Schauplätzen der Kirchengeschichte, welche Papst Gregor XIII. zwischen den goldgefassten Stuck des endlosen Gewölbes hatte malen lassen, bis zu jener Tür, die – ohne Schloss und Klinke – den Zugang zum Turm der Winde versperrte wie ein unüberwindliches Falltor. Der Kardinal gab ein Klopfzeichen und verharrte regungslos, wissend, dass der Öffnende einen weiteren Weg zurücklegen musste.
Woher dieser Turm seinen Namen trägt, ist bekannt: Die gregorianische Kalenderreform nahm hier im Dachgeschoss ihren Anfang, als der Pontifex ein Observatorium installieren ließ zur Beobachtung von Sonne, Mond und Sternen. Selbst das wechselvolle Spiel der Winde konnte ihm nicht entgehen, weil der mächtige Arm eines Zeigers an der Decke stets in die Richtung des Luftstroms wies, von einer Wetterfahne gesteuert. Schon lange ist jenes Instrumentarium verschwunden, mit dessen Hilfe im denkwürdigen Jahre des Herrn 1582, dem zehnten seines Pontifikats, das Abendland um zehn Tage gebracht wurde, dass dem 4. der 15. Oktober folgte und die sinnenverwirrende Regel, hinkünftig seien von den Säkularjahren nur diejenigen als Schaltjahre zu zählen, deren erste Ziffern durch vier teilbar sind: Fiat, Gregorius papa tridecimus. Was blieb, sind Bodenmosaiken des Tierkreises, von der Sonne bestrahlt, die ein Spalt in der Wand einlässt, und Fresken an den Wänden, Göttergestalten in wehenden Gewändern, den Winden gebietend.
Tabu und Geheimnis umgeben den Turm der verlorenen Tage seit frühester Zeit; aber nicht die heidnischen Götter, nicht Jungfrau, Stier und Wassermann tragen Schuld, auch nicht die Tatsache, dass es in dem wuchtigen Gemäuer keine Beleuchtung gibt, nein, die Aura des Mysteriums rührt von Bergen von Akten, Wänden von Dokumenten, die hier – in Fondi gegliedert – aufbewahrt werden, thematisch, historisch sortiert – wie viele Fondi im Staub der Jahrhunderte ruhen, weiß niemand: l’Archivio Segreto Vaticano – das Vatikanische Geheimarchiv.
Vereinnahmt im Laufe der Zeit von den endlosen Korridoren des päpstlichen Geheimarchivs, breiteten sich Papiere und Pergamente in dem Turm aus wie vulkanische Lava. Jahrhundertelang überdeckte Gegenwärtiges Vergangenes, bis Gegenwärtiges selbst Vergangenes war und von neuer Gegenwart verschüttet wurde. Im Turm fanden Archivare Gelegenheit, jene Dokumente zu stapeln, die nach dem Willen der Päpste niemand anderem als ihren Nachfolgern zur Kenntnis gelangen sollten: Riserva, geschlossene Abteilung.
Als der Kardinal Schritte hörte hinter dem Portal, wiederholte er sein Klopfzeichen, und gleich darauf klapperte ein Schlüssel, und das schwere Tor öffnete sich lautlos. Man schien das Klopfzeichen des Kardinals zu kennen oder auch den Zeitpunkt oder die Hintertür, durch die er zu dieser Zeit Einlass forderte; denn der öffnende Präfekt fragte nicht nach dem späten Besucher, ja, er blickte nicht einmal durch den Türspalt, so sicher war er, das Klopfzeichen des Kardinals zu erkennen. Der Präfekt, ein Oratorianer mit Namen Augustinus, war der ältere, oberste und erfahrenste Archivhüter, ihm standen ein Vizepräfekt, drei Archivare und vier Scrittori zur Seite, die allesamt der gleichen Tätigkeit nachgingen, wenngleich mit unterschiedlichem Rang; aber von Augustinus hieß es, er könne ohne Pergamente und Buste – so nennt man die Ordner-Mappen, in denen Briefe und Papiere aufbewahrt werden – nicht leben, er schlafe inmitten seiner Urkunden und wahrscheinlich decke er sich mit ihnen auch zu.
Für gewöhnlich betrat man das Archiv von vorne, wo der Präfekt oder einer der Scritorri an einem breiten, schwarzen Tisch saß, ein jeder in derselben Haltung, die Hände in den Ärmeln seines schwarzen Gewandes verborgen, vor sich das aufgeschlagene Register, in das jeder Besucher gegen Vorlage des Zulassungsausweises eingetragen wurde, der ihm den Zugang zu gewissen Regalen erlaubte, die Mehrzahl aber verschloss, und der Kustos vergaß nie, die Zeit in Stunden und Minuten dahinterzusetzen, welche der Forscher – zwei, drei, mehr kamen nicht pro Woche – in den dunklen Regalen verbrachte.
Im Gehen murmelte der Kardinal etwas, das sich anhörte wie »laudetur Jesus Christus«, und huschte an dem Präfekten vorbei; er lehnte es ab, seinen Namen in das Register einzutragen. Zur Rechten ein Raum mit dem verheißungsvollen Namen Sala degli Indici barg Gebundenes, Indices und Summarien und Bestandsverzeichnisse und Klassifizierungsvermerke des Archivs, ohne deren Kenntnis das Gestapelte undurchdringbar war wie die Geheime Offenbarung Johannis und gewiss ebenso verwirrend. Archivare und Scrittori hätten die geheimen Räume und Regale ruhig offen stehen lassen dürfen, und niemand, auch nicht der beflissenste Wissenschaftler, würde den kilometerlangen Ablagerungen auch nur ein einziges Geheimnis entlockt haben, weil alle Fondi, mit Buchstaben und Zahlen verschlüsselt, nicht den geringsten Hinweis auf ihren Inhalt verrieten, ja, allein zum Gebrauch der einzelnen Register wurden wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, welche Regalwände füllten, und es gab Abteilungen wie jene, nur vom obersten Geschoss im Turm der Winde zugänglich, wo neuntausend Buste lagerten, zum größten Teil ungeöffnet, weil zwei Scrittori – so wurde kalkuliert – bei Sichtung jeder einzelnen Notiz einhundertachtzig Jahre brauchen würden zu deren Archivierung.
Wer aber glaubt, im Besitz der Signatur eines Dokumentes, dasselbe auf geradem Wege entdecken zu können, sieht sich getäuscht; denn es gab im Lauf der Jahrhunderte, vor allem seit dem Schisma, zahlreiche wiederkehrende und vergebliche Versuche, die gesamten Bestände neu zu signieren, und das hatte zur Folge, dass viele Buste mehrere Signaturen tragen, eine offene Verbalsignatur »de curia, de praebendis vacaturis, de diversis formis, de exbibitis, de plenaria remissione« usw., welche jedoch nur dann leserlich erscheint, wenn die Akten – wie zur Zeit der mittelalterlichen Päpste üblich – liegend aufbewahrt wurden (die Bezeichnung befindet sich daher auf der Unterseite), oder eine Zahlensignatur oder ein kombiniertes Buchstaben-Zahlen-System wie z. B. »Bonif.IX 1392 Anno 3 Lib.28«.
Im Letztgenannten hinterließ ein custos registri bullarum apostolicarum namens Giuseppe Garampi um die Mitte des 18. Jahrhunderts deutliche Spuren. Er schuf jenes Schedario Garampi, eine Archivsammlung, deren schematische Aufteilung in verschiedene Themengebiete für jedes Pontifikat jedoch mehr Verwirrung verursachte als Nutzen, weil kein Pontifex so lange regierte wie ein anderer und weil die unterschiedlichen Register wie »de jubileo« oder »de beneficiis vacantibus« verschiedenen Umfang annahmen, aber gleichen Platz zur Verfügung hatten.
Klingt dies verwirrend genug, so gliche jede Neuordnung dem Turmbau zu Babel; denn so wie der Turm nie die Höhe des Himmels erreichte und Gott die Sprache seiner Erbauer verwirrte, so hätte eine neue Konkordanz nur ähnliche Folgen, da sie als Abbild eines unendlichen Universums von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre; oder auch weil – nach der Lehre der griechischen Kosmogonie – das Chaos der Urzustand war, aus dem der Schöpfer den geordneten Kosmos bildete, und nicht umgekehrt. Der Vergleich hinkt weniger als der erste, weil Chaos nicht nur das Ungeordnete ist, der ungestaltete Zustand, sondern auch das Gähnende, Klaffende, sich Öffnende, und dem Eintretenden öffnete sich eine unbekannte Welt, über die Augustinus wachte wie der dreiköpfige Zerberus am Tor des Hades.
Der Oratorianer reichte dem Kardinal eine batteriebetriebene Lampe; er ahnte, dass sein Weg zur Riserva führen würde, wo es keine Beleuchtung gab, und der Kardinal nickte, ohne ein Wort zu sagen. Auch Augustinus schwieg; aber er ließ sich nicht abschütteln und folgte dem Kardinal über die enge Wendeltreppe in die oberen Stockwerke des Turmes, ein beschwerlicher Weg, der einzige Zugang nach oben, mit einem Wandtelefon auf jedem Treppenabsatz.
Hier, auf dem Weg zu den ältesten und geheimsten Abteilungen des Archivio Segreto, roch es muffig dumpf, und der pestilente Gestank wurde durch eine nicht weniger unangenehme Chemikalie verstärkt, deren schneidende Ausdünstung einen hartnäckigen Pilz abtöten sollte, welcher, vor Jahrhunderten eingeschleppt, Akten und Pergamente mit einem purpurnen Gespinst überzog und selbst klugen Formeln der Neuzeit standhielt. Nur mit Genehmigung des Papstes durfte hier geforscht und Einsicht in die Akten genommen werden, doch weil der Papst nicht zu unterschreiben pflegte, es sei denn, es handelte sich um Urkunden bedeutsamen Inhaltes, nahm diese Aufgabe Joseph Kardinal Jellinek wahr; höchst selten freilich, denn es stand keinem Christenmenschen zu, Rechenschaft über die Ablehnung seines Antrages zu fordern. Akten jünger als hundert Jahre unterlagen ohnehin ausnahmsloser Geheimhaltung, päpstliche und den Papst betreffende Dokumente blieben gar dreihundert Jahre der Nachwelt verborgen. Gestapelt, gerollt, verschnürt und versiegelt lagen hier beinahe zwei Jahrtausende Kirchengeschichte gehortet: Hier fand sich die mit dreihundert Siegeln versehene Urkunde, in welcher die protestantische Schwedenkönigin Christine sich zur Transsubstantiation, dem heiligen Abendmahl, dem Fegefeuer, dem Nachlass der Sünden, der unfehlbaren Autorität des Papstes, den Erkenntnissen des Konzils von Trient und damit zur heiligen katholischen Kirche bekannte. Anweisungen Papst Alexanders VI., Kontobücher, Rechnungen, Briefe und detailgetreue Reports, welche weder die Kleidung der Konvertitin (schwarze Seide, tief dekolletiert) noch die gereichte Patisserie (Statuen und Blumen aus Marzipan, Aspik und Zucker) ausließen und auch ihre bisexuellen Neigungen beschrieben, bestätigten den Ruf dieses Archives als eines der besten der Welt. Der letzte Brief der leidenschaftlich katholisierenden Urenkelin Heinrichs VII., Maria Stuart, an den Papst wurde hier aufbewahrt, desgleichen der Indizierungsbeschluss, mit der die Heilige Kongregation die »Sechs Bücher über die Umläufe der Himmelskörper« des Nikolaus Kopernikus verbot, die der Doktor des Kirchenrechtes Papst Paul III. gewidmet hatte. Im separaten Archiv lagerten die Prozessakten des Falles Galileo Galilei, gebunden verwahrt unter dem Kürzel EN XIX, mit dem unseligen Urteil der sieben Kardinäle, Blatt 402: »Wir sagen, verkünden, urteilen und erklären, dass du, oben genannter Galileo, wegen der prozessual erschlossenen und von dir gestandenen Dinge wie oben, dich diesem Sant’ Ufficio der Häresie schwer verdächtig gemacht hast, nämlich behauptet und geglaubt zu haben, die falsche und den heiligen und göttlichen Schriften widersprechende Lehre, dass die Sonne der Mittelpunkt der Erde sei und sich nicht von Osten nach Westen bewege und dass die Erde sich bewege und nicht das Zentrum der Welt sei … und folglich bist du allen Strafen verfallen, die von den heiligen Kirchengesetzen und anderen Erlassen derartigen Verbrechern auferlegt und rechtskräftig erklärt wurden.« Verba volant, scripta marient.
Papstweissagungen wurden hier aufbewahrt, Prophezeiungen, die man offiziell gar nicht zur Kenntnis nahm, und angebliche Fälschungen, welche jedoch von Bedeutung sein mussten, aber auch die Papstweissagungen des hl. Malachias, die – und das stürzte die Kurie in tiefe Ratlosigkeit – nicht von diesem Heiligen stammen können, weil sie erst vierhundertvierzig Jahre nach dessen Ableben niedergeschrieben wurden, während jedoch ebendiese anonymen Weissagungen mit bestürzender Treffsicherheit Namen, Herkunft der Päpste und bedeutsame Fakten ihres Pontifikats vorhersagten, mehr noch, das Ende des Papsttums dem übernächsten Stellvertreter zuschrieben, einem Römer namens Petrus; die Siebenhügelstadt, heißt es, werde zerstört werden, und der furchtbare Richter werde sein Volk richten. Nichts auf dieser Welt ist so unumstößlich endgültig wie ein Beschluss der Römischen Kurie, und weil sie den Papstweissagungen ablehnend gegenübersteht, wenngleich credo quia absurdum (ich glaube, weil es wider die Einsicht ist) nicht aus dem Mund eines Ketzers, sondern des Kirchenlehrers Anselm von Canterbury stammt, dessen Loyalität gegenüber Gregor VII. und der heiligen Mutter Kirche nicht in Zweifel gezogen werden kann, bleibt der gefälschte Prophet Malachias tabu – nach außen hin jedenfalls. Papst Pius X., dem nach der Weissagung Ignis ardens (brennendes Feuer) prophezeit war – er wurde am 4. August gewählt, dem Tag des heiligen Dominikus, und dessen Attribut ist ein Hund mit brennender Fackel; gestorben ist Pius wenige Wochen nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges – dieser Pontifex bedauerte seinen Nachfolger, den er nicht kannte, weil er von der Weissagung wusste, welche ihm zukam: religio depopulata – entvölkerte Religion.
Forschung und Wissenschaft haben inzwischen Filippo Neri, einen großen Heiligen der katholischen Erneuerung, als Urheber der Papstweissagungen entlarvt. Er soll zu Michelangelos Zeiten bisweilen entrückt, von übernatürlicher Besessenheit gewesen sein, dass sein Körper bebte und mit ihm die Häuser, in denen er sich aufhielt, dass er beim Messopfer über den Altarstufen schwebte und sein Herz abnorm laut zu schlagen begann wie Pauken zum Jüngsten Gericht. Aufsehen erregende Krankenheilungen und Zeugen seiner charismatischen Gaben begründeten später seine Kanonisation.
Wo aber lagen die Aufzeichnungen Neris, des Vaters der Oratorianer? Nicht unbegründet durfte man hoffen, sie hier im geheimen Archiv des Vatikans zu entdecken, wenngleich es heißt, der Heilige habe vor seinem Tod alle persönlichen Papiere verbrannt. War es ein Zufall? In Neris Todesjahr 1595 erschien ein fünfbändiges Werk des Benediktiners Arnold Wion über die literarischen Leistungen seines Ordens, Titel »Lignum vitae – ornamentum et decus Ecclesiae«, welches, Band zwei auf den Seiten 307 bis 311, die Prophezeiungen des Oratorianer-Gründers als Prophetia S. Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus aufführt. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Eine Querverbindung zwischen dem Oratorianer Filippo und dem Benediktiner, Gott möge seiner armen Seele gnädig sein, ist nicht auszuschließen – welch lauteres Motiv auch immer seine Feder gelenkt haben mag.
Sidus olorum – eine Zierde der Schwäne, hieß es dort, werde sich die Tiara aufs Haupt setzen, symbolisch rätselhaft; aber als 1667 Klemens IX. den Thron bestieg, zweifelte niemand mehr an der Richtigkeit der Vorhersage. Klemens (Giulio Rospigliosi) erlangte als Dichter große Berühmtheit, blieb bis heute der einzige Dichter und Papst, und der Schwan ist bekanntlich das Symboltier der Dichter. Jahrhunderte verließ kein Summus Pontifex nach der Wahl im Konklave den Vatikan; und kein anderes Schicksal war Pius VI. vorgezeichnet, als er nach fünfmonatigem Konklave im Quirinalspalast zum Nachfolger des vierzehnten Klemens gewählt wurde. Pereginus apostolicus, so hatte der entrückte Heilige den neuen Papst charakterisiert, was aber im Zeitalter der Aufklärung vergessen blieb, bis der Unglückliche 1798 von französischen Revolutionstruppen nach Frankreich verschleppt wurde, wo er als peregrinus, als Fremdling, den Tod fand. Rätselraten rief ein Komet im Wappen Leos XIII. hervor, das jeder Pontifex bei seinem Amtsantritt anzunehmen verpflichtet ist; erst in Verbindung mit der Weissagung »ein Licht am Himmel, lumen in coelo« wurde dieses verständlich. Schon vor der Wahl Johannes’ XXIII. wurde die Prophezeiung diskutiert, der Nachfolger des zwölften Pius würde pastor et nauta, Hirte und Seemann, sein; doch auf keinen der Papabili machte die Verheißung Sinn, niemand gab dem Patriarchen von Venedig, der Stadt der christlichen Seefahrt, eine Chance. Und doch, Roncalli wurde gewählt, und sein Pontifikat gilt als eines von höchst pastoralem Charakter.
Nur ein paar Schritte weiter lag das vom päpstlichen Komissär Remolines erfolterte Geständnis des Mönchs Girolamo Savonarola, sich der Ketzerei, der Predigt irriger Lehren und der Verachtung des römischen Stuhles schuldig gemacht zu haben. Minutiöse Berichte über die letzten Stunden des gefürchteten Bußpredigers, seine peinliche Untersuchung in der Zelle, ob nicht der Zauber eines Dämons ihn zum Zwitter verwandelt habe, wie die heilige Inquisition argwöhnte, Zeugenaussagen über seinen tiefen Schlaf vor der Hinrichtung, unterbrochen nur von mehrmaligem lautem Gelächter, der sensationslose Tod am Galgen und die Verbrennung seines toten Körpers, dessen Asche in den Arno geschüttet wurde. Geheime Dossiers wissen aber auch von florentinischen Mägden, unter deren Gewändern sich vornehme Frauen verbargen und Asche des Fra sammelten, ja sogar ein Arm und Teile des Schädels sollen, so wurde beobachtet, als Reliquien bewahrt worden sein. Auch die Dogmen der Päpste fanden sich hier, das jüngste von der Unbefleckten Empfängnis Mariens gebunden in hellblauem Samt.
Der Kustos wusste, dass der Kardinal für all das kein Interesse zeigte, dieser strebte der oberen schwarzen Eichentür zu, die ohne seine, des Kustos, Hilfe nicht zu öffnen war, denn den doppelbärtigen Schlüssel trug er selbst mit einer Kette am Gürtel befestigt bei sich, und kein anderer, nur er hatte den Schlüssel zu diesem geheimsten Raum des geheimen Archivs. Das bedeutete jedoch keineswegs, dass er um das ganze Mysterium dieses Raumes wusste, seinen Inhalt kannte und über das Unaussprechliche schweigen musste; ihm war nur so viel bekannt: Hinter dieser schweren schwarzen Eichentür lagerten die größten Geheimnisse der Kirche, nur dem jeweiligen Papst zugänglich – jedenfalls hatten es die Vorgänger Johannes Pauls II. so gehalten. Doch der Polenpapst hatte dies Privileg dem Kardinal übertragen, und so trat der Kustos vor den Kardinal und sperrte das Schloss auf im Schein der Lampe. Ein Zittern der Hände verriet seine Erregung. Der Kardinal verschwand in der Tür, Augustinus blieb im Dunkeln zurück. Er beeilte sich, wieder abzuschließen; so war es Vorschrift.
Jedes Mal beim Aufschließen warf der Kustos einen Blick in den Raum, bei der Heiligen Jungfrau Maria eine lässliche Sünde; so kannte er die Einrichtung hinter dem schwarzen Portal: aneinandergereiht schwere Tresortüren wie im Keller einer Staatsbank, deren einzelne Schlüssel aber nicht er, sondern der Kardinal bei sich trug. Es kam nicht oft vor, dass Augustinus diese Tür aufschließen musste, wenngleich der Kardinal in jüngster Zeit öfter von seinem Recht Gebrauch machte. Das einzige Mal hatte er 1960 erfahren, von welch erregendem Inhalt die hier verschlossenen Dokumente waren. Damals hatte er Johannes XXIII. eingelassen und eingeschlossen, er hatte auf ein Klopfzeichen des Papstes gewartet, so wie er jetzt auf das Klopfen des Kardinals wartete, aber lange, über eine Stunde, blieb alles still. Doch dann auf einmal hatte er dumpfe Schläge mit der Faust gegen die Tür vernommen, und als er das Schloss aufsperrte, war ihm der Papst entgegengelaufen, zitternd am ganzen Körper, als habe ihn ein Fieber befallen – jedenfalls hatte das der Kustos zu jenem Zeitpunkt geglaubt; aber am Ende war dann zumindest ein Teil der Wahrheit ans Licht gekommen. Die Heilige Jungfrau, welche 1917 in Fatima drei portugiesischen Hirten erschienen war und den Ausgang des Weltkrieges vorhergesagt hatte, »Unsere liebe Frau von Fatima« hatte eine dritte Prophezeiung verkündet, deren Inhalt nach Niederschrift erst dem Papst des Jahres 1960 bekannt gemacht werden durfte. Der wahre Inhalt jenes Schriftstückes, das hinter dieser Tür verwahrt wurde, gab im Vatikan zu furchtbaren, ganz unterschiedlichen Spekulationen Anlass – ein apokalyptischer Weltkrieg, der alles Leben auslöschen werde, hieß es, sei angesagt, der Papst werde ermordet werden, lautete ein anderes Gerücht –, und der Nachfolger Paul VI. konnte nicht umhin, sich nach seiner Wahl hinter dieser Tür zu informieren. Dass er seither an schweren Depressionen und an Entscheidungsschwäche litt, ist kein Geheimnis.
Doch dessen Interesse galt an diesem Abend jenem Stahlschrank, in dem alle Dokumente Michelangelo Buonarroti betreffend aufbewahrt wurden. Dass Michelangelos Korrespondenz mit den Päpsten – vor allem mit Julius II. und Clemens VII. –, die Dossiers über seinen Umgang, denen weder seine asketische Leidenschaft zu Fürstin Vittoria Colonna noch die Kontakte zu Neuplatonikern und Kabbalisten verborgen blieben, dass gerade jene Dokumente allergrößter Geheimhaltung unterlagen, hatte beim Kardinal den nicht unbegründeten Verdacht geweckt, hinter Michelangelo und seiner Kunst verberge sich ein furchtbares Geheimnis. Ja, es konnte gar nicht anders sein; es musste doch einen Grund haben, dass Michelangelos Leben seit vierhundertfünfzig Jahren im Vatikan tabu war!
Ignoranz fürchtet das Wissen, und so griff der Kardinal immer hastiger nach Pergamenten, nach mehrfach gefalteten Papieren, nach mit Bändern verschnürten Aktendeckeln. Er erkannte im Schein seiner Lampe die kleine, schön geschwungene Schrift, überflog Briefe, die ohne Kontext verständnislos blieben, die meist mit der italienischen Redewendung »io Michelagniolo scultore …«beginnen, »ich, Michelangelo, der Bildhauer …« was zum einen seinen Stolz auf die Sprache Dantes ausdrückte und dass er das von der Kirche verwandte Latein nicht verstand, zum anderen aber ein Seitenhieb sein sollte auf die Vergewaltigung seiner Kunst im Vatikan.
Papst Julius II. hatte Michelangelo unter falschen Voraussetzungen nach Rom gelockt, für ihn, den Papst, ein gewaltiges Grabmonument zu schlagen aus Carrara-Marmor, für zehntausend Scudi – ein Menschenleben reichte nicht aus zur Bewältigung des Werkes. Doch als der Marmorbruch aus der Toskana in Rom eintraf, fand der Papst weniger Gefallen an dem Projekt, weigerte sich sogar, die Steinbrecher zu entlohnen, und Michelangelo verließ Rom überstürzt in Richtung Florenz. Erst zwei Jahre später kehrte er auf dringende Appelle der päpstlichen Adlaten zurück, wo ihn Julius mit der Erkenntnis überraschte, es müsse Unglück verheißen, sein eigenes Grabdenkmal zu Lebzeiten zu errichten, der Künstler möge vielmehr die Wölbung der Sixtinischen Kapelle ausmalen, jenes schmucklosen Bauwerkes, dem Sixtus IV. della Rovere seinen Namen gegeben hatte. Was halfen da alle Beteuerungen des Künstlers, er sei als »scultore« geboren, nicht als »pittore«, seine Heiligkeit bestand auf Ausführung dieser Pläne.
Ein Pergament in der Hand des Kardinals, unscheinbar, die Schrift nur noch schwer leserlich, kündete vom Sieg des Papstes über Michelangelo: »Heute, am 30. Mai 1508, habe ich, Michelagniolo scultore, von Seiner Heiligkeit Papst Julius II. fünfhundert Dukaten erhalten, welche mir Messer Carlino, der Kämmerer, und Messer Carlo Albizzi auf Rechnung der Malerei ausgezahlt haben, mit der ich heutigen Tages in der Kapelle des Papstes Sixtus beginne, und zwar unter den kontraktlichen Bedingungen, welche Monsignor von Pavia aufsetzt und ich mit eigener Hand unterschrieben habe.«
Der Kardinal schätzte den Duft, der von alten Schriftstücken ausging, den unsichtbaren, feinen Staub, der sich unmerklich auf den Nasenschleimhäuten absetzte und die Sinne derart in Unordnung brachte, dass auf dem Umweg über die Nase das Gelesene früherer Tage Gestalt anzunehmen begann. Und plötzlich tauchte der untersetzte, drahtige Florentiner vor ihm auf, in engen dünnen Beinkleidern und gestepptem, eng gegürtetem halblangem Samtwams, sein dreieckiger Schädel, die lange Nase und seine eng beieinanderliegenden Augen, gewiss keine Schönheit von Mann, noch weniger ein kraftstrotzender scultore.