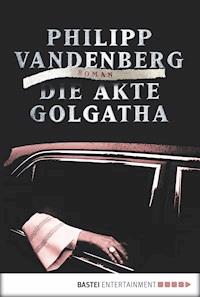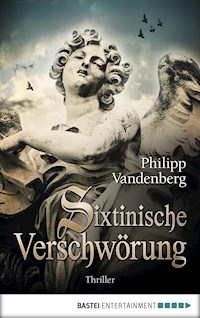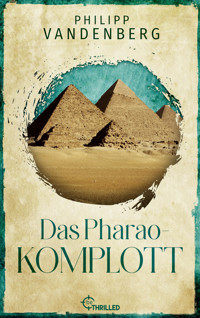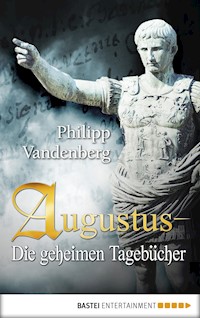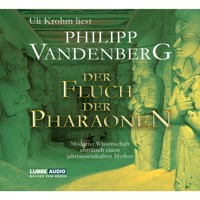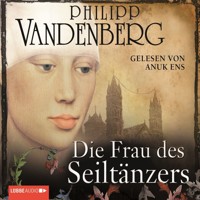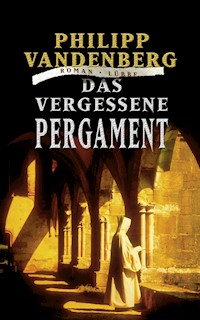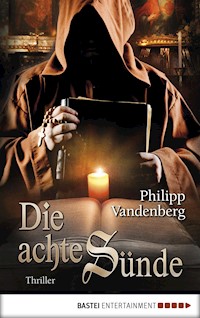
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Burg am Rhein, deren Tore sich nur auf den Code "Apokalypse 20-7" öffnen. Ein geheimnisvolles Stück Stoff, von unschätzbarem Wert für eine geheime Bruderschaft. Ein grausamer Mord in Rom. Der Antiquar Lukas Malberg gerät von einem Tag auf den anderen in ein gefährliches Abenteuer, bei dem nicht nur sein eigenes Leben auf dem Spiel steht. Dabei beginnt alles ganz harmlos: Malberg wollte eigentlich nur die wertvolle Büchersammlung einer verarmten Marchesa erwerben - ein Tipp seiner Schulfreundin Marlene, die mittlerweile in Rom wohnt. Als die schöne Marlene nicht zum vereinbarten Treffen erscheint, geht Malberg zu ihrer Wohnung und erlebt eine grauenvolle Überraschung: Die Wohnungstür ist angelehnt, Marlene liegt in der Badewanne - tot. Auf dem Schreibtisch ein aufgeschlagenes Notizbuch mit rätselhaften lateinischen Eintragungen. Im Gegensatz zur Polizei glaubt Malberg nicht an Selbstmord ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Über dieses Buch
Eine Burg am Rhein, deren Tore sich nur auf den Code »Apokalypse 20-7« öffnen. Ein geheimnisvolles Stück Stoff, von unschätzbarem Wert für eine geheime Bruderschaft. Ein grausamer Mord in Rom – der Antiquar Lukas Malberg gerät von einem Tag auf den anderen in ein gefährliches Abenteuer, bei dem nicht nur sein eigenes Leben auf dem Spiel steht. Dabei beginnt alles ganz harmlos: Malberg wollte eigentlich nur die wertvolle Büchersammlung einer verarmten Marchesa erwerben - ein Tipp seiner Schulfreundin Marlene, die mittlerweile in Rom wohnt. Als die schöne Marlene nicht zum vereinbarten Treffen erscheint, geht Malberg zu ihrer Wohnung und erlebt eine grauenvolle Überraschung: Die Wohnungstür ist angelehnt, Marlene liegt in der Badewanne – tot. Auf dem Schreibtisch ein aufgeschlagenes Notizbuch mit rätselhaften lateinischen Eintragungen. Im Gegensatz zur Polizei glaubt Malberg nicht an Selbstmord …
Über den Autor
Philipp Vandenberg wurde am 20. September 1941 in Breslau geboren. Er wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg bei einer Pflegemutter und im Waisenhaus auf und kam 1952 ins oberbayrische Burghausen. Er besuchte dort dasselbe Gymnasium wie Ludwig Thoma und flog, eigenem Bekunden zufolge, wie dieser von der Schule. Er kehrte »reumütig« zurück und konnte in der Folge die mangelhaften Leistungen in Griechisch sowie Mathematik durch hervorragende Leistungen in Deutsch und Kunst ausgleichen. 1963 machte er am humanistischen Gymnasium Burghausen/Salzach Abitur und studierte anschließend an der Universität München Kunstgeschichte und Germanistik (ohne Abschluss). Ein Volontariat machte Vandenberg 1965/1967 bei der Passauer Neue Presse, die ihn 1967 zum Redaktionsleiter des Burghauser Anzeigers machte.
Anschließend wurde er Nachrichtenredakteur bei der Münchener Abendzeitung. 1968 - 1974 arbeitete er für die Illustrierte Quick. Dann war Vandenberg bis 1976 als Literaturredakteur für das Magazin Playboy beschäftigt. Seither ist er als freier Autor tätig.
Vandenbergs Karriere als Sachbuchautor begann 1973, als er seinen Jahresurlaub nahm und begann, über den »Fluch des Pharao« zu recherchieren. Über den rätselhaften Tod von dreißig Archäologen veröffentlichte er das Buch »Der Fluch der Pharaonen« (1973), das ein Weltbestseller wurde. Quick hatte das Manuskript als Serie abgelehnt. Auf den Bestsellerlisten platzierten sich auch Vandenbergs weitere Publikationen wie die archäologische Biographie »Nofretete« (1975).
1977 wechselte Vandenberg seinen Verlag, blieb aber der kulturgeschichtlichen Thematik treu und war in der 80er Jahren als Autor historischer Sachbücher wie »Cäsar und Kleopatra« (1986) erfolgreich. Mitunter versuchte die Fachkritik, seine populären Sachbücher als »Archäo-Krimis« abzutun. Vandenbergs 30 Bücher, mit einer weltweiten Gesamtauflage von über 24 Millionen, erschienen bisher in 34 Sprachen übersetzt, darunter, neben allen Weltsprachen, ins Türkische, Bulgarische, Mazedonische und Rumänische.
Vandenberg hat aus erster geschiedener Ehe einen Sohn Sascha (geb. 1965). Seit 1994 ist er mit Evelyn, geb. Aschenwald, verheiratet, beide leben in Baiernrain, in einem tausend Jahre alten Dorf zwischen Starnberger- und Tegernsee. Sein Hobby ist das Sammeln von Oldtimern und Phonographen.
PHILIPP VANDENBERG
DIEACHTESÜNDE
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2008/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
Unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Nomad_Soul|Arva Csaba
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0015-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
PROLOG
Auch auf mehrmaliges Klingeln hin blieb die Wohnungstür verschlossen. Da holte er aus und schlug mit der Faust gegen die Türfüllung. Die beiden schwarz gekleideten Männer in seiner Begleitung blickten irritiert.
»So öffnen Sie doch!«, rief er aufgebracht. »Wir wollen nur Ihr Bestes. Öffnen Sie im Namen Gottes, des Allerhöchsten!«
Aus dem Innern der Wohnung kam eine ängstliche weibliche Stimme: »Ich kenne Sie nicht. Was wollen Sie? Verschwinden Sie!«
Die Stimme klang aufgeregt, aber keineswegs hysterisch, wie er erwartet hatte. In einem anderen Fall hätte Don Anselmo auf dem Absatz kehrtgemacht. Mit der Erfahrung von vierzig Jahren auf diesem Gebiet wusste er nur zu genau, dass es manchmal mehrerer Anläufe bedurfte, um ans Ziel zu gelangen. Aber in diesem Fall war alles anders, ganz anders. Und Don Anselmo hatte lange mit sich gerungen, ob er dem Drängen von höchster Stelle nachgeben und zu der schrecklichen Tat schreiten sollte.
Denn obwohl Don Anselmo in seinem klerikalen Leben schon tausendmal oder noch öfter den Teufel oder böse Dämonen mit so seltsamen Namen wie Incubus, Enoch oder Leviathan ausgetrieben und beklagenswerte Menschen von unerträglicher Seelenqual befreit hatte, kostete ihn jeder neue Fall Überwindung.
Nicht nur wegen der körperlichen Anstrengung, die das Procedere erforderte. Vor allem die Erlebnisse, welche mit seiner Aufgabe einhergingen, hatten sich tief in sein Gedächtnis eingegraben. Dazu gehörte, dass manche Dämonen, mochten sie Baal oder Forcas heißen, der eine mit drei Köpfen, der andere ein ansehnlicher Kraftprotz und von verschlagener Schläue, vor ihm selbst nicht haltmachten und in ihn einfuhren.
In einem Fall hatte sich Abu Gosch, der Dämon des Blutes, der jahrelang einer verkrüppelten Jungfrau aus Perugia beigewohnt hatte, bei der Teufelsaustreibung seiner bemächtigt, ohne dass er den Quälgeist bemerkte. Erst als er begann, sich selbst Schnitte und Verwundungen beizufügen, und daran ging, mithilfe einer Schere sein – zugegeben – nutzloses Fortpflanzungsorgan abzuschneiden, wurde ein Mitbruder aufmerksam und hielt ihn zurück.
Durch Auflegen einer eilends herbeigeschafften Reliquie der heiligen Margareta von Cortona wich der Dämon aus Don Anselmo. Margareta hatte in ihrer Jugend in Sünde und Schande gelebt, später aber durch Kasteiung und Selbstgeißelung zum rechten Glauben gefunden. Dabei hatte sie sich Schnitte entlang der Oberschenkel und am Unterleib zugefügt.
Erneut polterte Don Anselmo gegen die Tür und drückte auf den Klingelknopf. »Haben Sie vergessen, dass wir verabredet sind?«
»Verabredet? Ich bin mit niemandem verabredet.«
»Doch, letzte Woche. Erinnern Sie sich nicht?«
»Letzte Woche war ich noch gar nicht hier«, kam die Stimme aus dem Innern der Wohnung.
»Ich weiß«, erwiderte Don Anselmo. Nicht, weil es der Wahrheit entsprach, vielmehr wollte er der Frau keinen weiteren Anlass geben, sich aufzuregen.
»Typisch«, murmelte der ältere seiner Begleiter, ein hochgewachsener Fünfziger mit kahlem, glänzendem Schädel und der Bräune eines Trientiner Bergführers. »Wir Neurologen sprechen von neurasthenischer Schizophrenie. Kein seltenes Phänomen, bei dem der Patient die Erinnerung an nahe liegende Dinge verliert.«
»Unsinn«, bemerkte Don Anselmo ungehalten. »Das ist der Dämon Isaacaron. Er löscht alle klaren Gedanken aus und lenkt alles Tun und Handeln auf Verführung und Lust oder, wie man heute sagt, Sex.«
Der zweite Begleiter, ein dicklicher Jüngling mit geröteten Wangen und kurzem Haarschnitt, schlug die Augen nieder und blickte betreten auf sein blank poliertes Schuhwerk. Sein Verhalten ließ kaum Zweifel aufkommen, dass es sich um den Studenten eines Priesterseminars handelte.
Mit beiden Händen umklammerte der verschüchterte Studiosus den Griff einer kofferartigen schwarzen Ledertasche, in der die zur Teufelsaustreibung notwendigen Utensilien verstaut waren: eine violette Stola, zwei Flaschen mit unterschiedlichem Wasser, eine dicke weiße Kerze, eine Kapsel aus Nickel mit dem pulverisierten Docht einer geweihten Kerze, ein Kruzifix aus Messing, fünfzehn mal fünfundzwanzig Zentimeter, Spanngurte aus dem Autozubehörhandel und ein Buch im Oktavformat mit rotem Ledereinband und der in Gold geprägten Aufschrift:
RITUALE ROMANUMEDITIO PRIMA POST TYPICAM1
Der Lärm hatte eine unerwünschte Zeugin angelockt, die ein Stockwerk tiefer neugierig ihren Kopf durch das Treppengeländer steckte. Als der Studiosus sie bemerkte, gab er dem Padre mit dem Kopf einen Wink und zeigte nach unten ins Treppenhaus.
Don Anselmo beugte sich über das Geländer, und mit belegter Stimme zischte er: »Weg da, das geht Sie nichts an!«
Im Nu war die Frau verschwunden. Ein paar Stockwerke tiefer fiel eine Tür ins Schloss.
Völlig unerwartet wurde plötzlich die Wohnungstür geöffnet. Wie eine Marienerscheinung aus dem neunzehnten Jahrhundert stand sie da in einem dünnen himmelblauen Schlafrock mit bleichem Gesicht und ohne Schminke, das halblange Haar nur flüchtig hochgesteckt und gerade deshalb von einer gewissen Laszivität.
Welch ein Prachtweib, dachte Don Anselmo, der die Frau nicht kannte, nicht von Angesicht, der aber gewarnt war und wusste, was auf ihn zukommen würde. Er war es auch, der als Erster die Fassung wiederfand.
Denn während die beiden anderen noch dastanden und die Frau mit den Augen verschlangen wie eine Götterspeise, setzte der Padre einen Fuß in die Tür. Aus der Wohnung schlug ihnen stickige Wärme entgegen. Für eine Wohnung im obersten Stockwerk nicht ungewöhnlich um diese Jahreszeit. Auch die Nacht brachte keine Abkühlung.
Trotz der Hitze und aus Verlegenheit, ja sogar Scham den drei Männern gegenüber, hielt die schöne Frau den Kragen ihres Schlafrocks mit beiden Händen geschlossen.
»Sind Sie von der Polizei? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?«, fragte sie verwirrt und starrte die Männer mit großen Augen an.
Don Anselmo hielt ihr einen Briefbogen unter die Nase. »Wir sind nicht von der Polizei, Signora. Sie wissen, worum es geht!«
Doch die Signora war viel zu aufgeregt, um das Schreiben zu lesen, das obendrein in lateinischer Sprache abgefasst war. Sie sah nur das päpstliche Wappen im Briefkopf und den Absender Città del Vaticano sowie dick unterstrichen NORMA OBSERVANDA CIRCA EXORCIZANDAM A DAEMONIO.
Ihr kleines Latinum, das sie in der Schule erworben hatte, reichte gerade, um dem holprigen Kirchenlatein einen Sinn zu geben: Richtlinie zur Austreibung eines Dämons.
Die schöne Signora holte tief Luft. Teufelsaustreibung!, schoss es durch ihr Gehirn.
Sie hatte davon gehört, sogar einen Hollywood-Film gesehen mit dem Titel Der Exorzist, ein gruseliges Machwerk, aber sie hatte das alles für Fiktion gehalten. Undenkbar, dass es heute noch so etwas gab.
»Hören Sie, das muss eine Verwechslung sein!« Ihre Stimme wurde laut: »Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich vom Teufel besessen bin?«
Don Anselmo setzte ein hintergründiges Lächeln auf: »Der Satan bemächtigt sich nicht selten der schönsten Geschöpfe, die Gott der Herr geschaffen hat.«
Da begann die schöne Signora laut und künstlich zu lachen. Sie lachte, verschluckte sich und hustete sich die Seele aus dem Leib, und es hätte nicht viel gefehlt, und sie wäre an ihrem Gelächter erstickt.
Der Padre warf dem begleitenden Neurologen einen vielsagenden Blick zu, und der Doktor erwiderte die Geste mit einem leichten Kopfnicken. Schließlich streckte er seinen Arm aus und drängte die Frau zur Seite.
»Wir wollen doch kein weiteres Aufsehen erregen«, sagte er, während er die Wohnung betrat. Seine Begleiter folgten ihm stumm und ohne aufzublicken. Die Signora war zu überrumpelt, um sie aufzuhalten.
»Mein Name ist übrigens Don Anselmo«, sagte dieser, während er sich in dem geschmackvoll eingerichteten Salon umsah. »Und das ist der Neurologe Dottore … der Name tut nichts zur Sache. Angelo, ein angehender Theologe, der zu großen Hoffnungen Anlass gibt, wird mir bei der Liberatio assistieren.« Angelo machte eine ungelenke Verbeugung wie ein Zirkusartist bei der Ankündigung seiner Nummer. Dann reichte er dem Padre seine Tasche.
»Hören Sie, was soll das alles?« Das Telefon fest im Blick, stand die schöne Signora vor dem Sofa mitten im Raum. Während der Padre begann, den Inhalt seiner Reisetasche auf dem niedrigen Couchtisch zu verteilen, suchte die Frau nach einer Möglichkeit, wie sie aus dieser verfluchten Situation herauskommen konnte. Mit ängstlichem Blick betrachtete sie jeden einzelnen Gegenstand, den Don Anselmo aus seiner Tasche hervorzog.
»Ich bitte Sie, was soll der Unsinn?« Ihre Stimme wurde laut. »Verlassen Sie sofort die Wohnung!«
Als sie die vier Spanngurte sah, die der Padre auf dem Tisch vor ihr ausbreitete, stieß sie einen gellenden, nicht enden wollenden Schrei aus. Da spürte sie, wie der dickliche Studiosus von hinten an sie herantrat und sie mit Bärenkräften in die Polster drückte.
Gleichzeitig trat der Dottore auf sie zu. Sie sah die Injektionsspritze in seiner Hand. Wie von Sinnen begann sie um sich zu schlagen. Aber jede Gegenwehr war vergebens. Sie spürte den Einstich an ihrem rechten Oberschenkel. Die Zimmerdecke begann zu schwanken. Dann setzte eine wohlige Benommenheit ein.
Mit einem Gefühl von Gleichgültigkeit nahm sie wahr, wie der Studiosus ihre Beine an den Fesseln zusammenband und Spanngurte um ihre Handgelenke legte. Auch als er sie aufhob und mit kräftigen Armen in das Schlafzimmer nebenan trug, sah sie keinen Anlass mehr, sich zu wehren.
Auf dem Bett, über dem sich ein duftiger Baldachin wölbte, zurrte der Studiosus die Fessel fest, indem er die Spannbänder unter dem Bett hindurchschob und miteinander verknotete.
Mit der rechten Hand an ihrer Halsschlagader zählte der Doktor den Puls. »Sechsundvierzig Puls«, meinte er und zog die Augenbrauen hoch. »Es ist schwierig, einem Patienten ohne Indikation die richtige Dosis zu verabreichen.«
»Das ist Isaacaron, der von ihr Besitz ergriffen hat«, rief Don Anselmo mit leuchtenden Augen. »Aber ich werde ihn austreiben aus dem schönen Leib dieses Weibes.« Ein teuflisches Grinsen huschte über das Gesicht des Exorzisten. Er sah seine Stunde gekommen.
Hektisch warf er sich die violette Stola über. Dann öffnete er die Schraubverschlüsse der beiden Wasserflaschen. Aus der ersten goss er ein wenig Wasser in die hohle Hand und besprengte damit die schöne Signora.
Diese zeigte keine Reaktion. Erst als er die Prozedur mit Wasser aus der zweiten Flasche wiederholte, begann die schöne Signora den Kopf nach links und rechts zu werfen. Ihr Körper bäumte sich auf, und mit matter Stimme sagte sie: »Was macht ihr mit mir, ihr Schweine? Bindet mich los! Drei Kerle gegen eine schwache Frau! Schämt ihr euch nicht?«
Der Studiosus zuckte zurück, als habe ihn der Blitz des Heiligen Geistes getroffen. Er kniff die Augen zusammen, als fühlte er Schmerz wegen der unflätigen Worte. Gespannt sah der Doktor den Padre an, wie er wohl reagieren würde. Doch Don Anselmo zeigte keine Regung.
»Es ist der Dämon, der aus ihr spricht und solche Worte gebraucht«, zischte er. Und an den Neurologen gewandt: »Sie wundern sich vielleicht, warum ich verschiedenes Wasser verspritzt habe. Ich wollte ganz sicher gehen, dass wir es in dem Fall nicht mit Hysterie zu tun haben. Im Zustand der Hysterie reagieren manche nur so, als ob sie besessen wären, zum Beispiel, um sich interessant zu machen. Dann wäre die Signora ein Fall für Sie, Dottore, kein Fall für den Exorzisten. Also habe ich mit dem Exorzismus probativus begonnen. Ich habe die Signora zuerst mit gewöhnlichem Wasser besprengt, wie Sie gesehen haben, zeigte sie keine Reaktion. Das Wasser aus der zweiten Flasche war jedoch Weihwasser. Sie konnten selbst erleben, wie der Dämon darauf reagiert hat.«
»Don Anselmo …«, unterbrach der Studiosus seinen Lehrmeister, »Don Anselmo …«
»Er schweige gefälligst«, herrschte der Padre den Studiosus an und nahm das rote Rituale Romanum zur Hand. Mit sicherem Griff schlug er die gewünschte Seite auf. Dann nahm er das Kruzifix in die Rechte und begann, wobei er das Knie vor der zitternden Signora beugte, den Ritus:
»Allmächtiger Vater, einziger Gott, eile herbei, damit du den Menschen, den du nach deinem Ebenbild geschaffen hast, vom Untergang errettest. Richte, o Herr, deinen Zorn gegen das Tier, das deinen Weinberg abweist. Deine mächtige Rechte möge ihn bedrängen, von deiner Dienerin zu weichen, damit er nicht länger wage, die gefangen zu halten, die du für würdig erachtet hast, nach deinem Ebenbild erschaffen zu werden.«
Die schöne Signora zerrte an den Gurten, die sie an ihr Bett fesselten. Die Riemen schmerzten und verursachten dunkelrote Spuren. Soweit es ihre Haltung zuließ, warf sie sich von einer Seite auf die andere, und dabei entblößte sie ihren makellosen Körper vor den Blicken der Männer. Sie rang nach Luft.
Selbst der Ohnmacht nahe, öffnete der Studiosus seinen weißen durchgeschwitzten Priesterkragen. Seit seiner Entwöhnung von der Mutterbrust im Alter von eineinhalb Jahren hatte er kein sekundäres Geschlechtsmerkmal aus solcher Nähe betrachtet. Nachdem er das erregend schändliche Bild mit Wollust in sich aufgesogen hatte, warf er Don Anselmo einen vorwurfsvollen Blick zu.
Der Neurologe, von Natur aus eher dem eigenen Geschlecht zugetan und an ähnlich verlaufende Symptome von Hysterie gewöhnt, zeigte sich weniger beeindruckt, gab jedoch zu bedenken, die Prozedur könne die psychische wie die physische Natur der Signora überfordern. »Ich rate dringend, den Vorgang abzubrechen«, rief er in das Schreien, Jammern und Winseln, das die Schöne von sich gab.
Don Anselmo schien es zu überhören.
Aus der Flasche mit dem Weihwasser bespritzte er erneut die tobende Signora. Ihre gequälte Stimme hatte inzwischen eine solche Lautstärke angenommen, dass der Exorzist selbst mit erhobener Stimme zu rufen begann: »Ich befehle dir, wer auch immer du bist, unreiner Geist, und allen deinen Gefährten, die diese Dienerin Gottes beherrschen, dass du deinen Namen sagst, den Tag und die Stunde deines Ausgangs, mit irgendeinem Zeichen. Und du sollst mir, Gottes unwürdigem Diener, durchaus in allem gehorchen. Noch sollst du diesem Geschöpf oder den Anwesenden irgendwelchen Schaden zufügen!«
Kaum hatte Don Anselmo seine Beschwörung beendet, begann die schöne Signora mit aller Kraft, zu der ihre Stimme noch fähig war, zu schreien. »Hilfe, Hilfe. Hört mich denn niemand? Hilfe, Hilfe!«
Ihre Rufe waren so laut, dass der Padre dem Studiosus ein Zeichen gab, er möge der Signora ein Kissen über den Kopf stülpen, damit nicht das ganze Haus zusammenlaufe.
»Hören Sie auf, das können Sie nicht tun!«, herrschte der Dottore den Studiosus an und versuchte ihm das Kissen zu entreißen. Doch mit Gottes Hilfe und der geballten Kraft seiner Jugend stieß dieser den Neurologen zur Seite, sodass er strauchelte und zu Boden stürzte.
»Das muss ich mir nicht bieten lassen!« Der Dottore schäumte vor Wut, rappelte sich hoch und humpelte dem Ausgang zu. »Betrachten Sie unsere Zusammenarbeit als beendet«, rief er im Gehen. Dann krachte die Tür ins Schloss.
Das Kissen über ihrem Kopf dämpfte die Schreie der schönen Signora. Ihre konvulsiven Bewegungen, mit denen sie sich aus den Fesseln zu befreien suchte, dauerten an.
Ihr Anblick entfachte bei dem Studiosus immer neue, sündige Gedanken. Wie, dachte er, mochten sich erst die Engel des Himmels präsentieren, wenn schon der Teufel auf Erden solch verführerische Gestalt annahm?
Don Anselmo, von alters wegen solchen Gedanken eher abhold, ließ sich nicht davon abhalten und fuhr fort, sein Werk zu vollenden:
»Ich beschwöre dich, alte Schlange, bei dem Richter über Lebende und Tote, entweiche eilends von dieser deiner Magd, die zum Schoß der Kirche Zuflucht nimmt. Es gebietet dir Gott der Vater. Es gebietet dir Gott der Sohn. Es gebietet dir Gott der Heilige Geist. Es gebietet dir der Glaube des heiligen Apostels Paulus. Es gebietet dir das Blut der Märtyrer. Es gebietet dir die Fürsprache aller Heiligen. Es gebietet dir die Stärke des christlichen Glaubens. Weiche also, du Verführer, du Feind der Tugend.«
»Don Anselmo, Don Anselmo!«, rief der Studiosus. »Sehen Sie nur!« Er zitterte am ganzen Körper.
KAPITEL 1
Alberto, der Fahrer des Kardinals, drückte das Gaspedal des kleinen Fiat so tief durch, dass der Motor aufheulte wie ein gequältes Tier.
Kardinal Gonzaga saß aufrecht und steif wie eine ägyptische Statue auf dem Rücksitz. Mit belegter Stimme krächzte er: »Wir müssen vor Tagesanbruch am Ziel sein!«
»Ich weiß, Excellenza!« Alberto blickte auf die Uhr, die grün auf dem Armaturenbrett leuchtete: zweiundzwanzig Uhr zehn.
Schließlich erwachte der Beifahrer neben Alberto aus seinem Schweigen. Seit sie kurz hinter Florenz auf der Autostrada A 1 in Richtung Bologna eingebogen waren, hatte der Monsignore kein Wort von sich gegeben. Monsignor Soffici, der Privatsekretär des Kardinals, war gewiss kein großer Schweiger. Doch in dieser Situation schnürte ihm die Aufregung die Kehle zu.
Soffici räusperte sich gekünstelt. Dann meinte er, während er den Blick nicht von den Rücklichtern eines vorausfahrenden Wagens ließ: »Es ist keinem damit gedient, wenn wir im Straßengraben landen, Ihnen nicht und der heiligen Mutter Kirche schon gar nicht – wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Excellenza!«
»Ach was!«, zischte Gonzaga unwillig und wischte sich mit dem Ärmel seines schwarzen Jacketts über den schweißnassen Kahlkopf. Die Hitze der schwülen Augustnacht machte ihm zu schaffen.
Alberto beobachtete ihn im Rückspiegel.
»Es war Ihre Idee, Excellenza, die Sache mit meinem Privatwagen durchzuführen. Ihr Dienstwagen hätte eine Klimaanlage, und das wäre in Ihrer Situation gewiss von Vorteil.«
»Das brauchen Sie mir nicht zu sagen«, herrschte Gonzaga den Chauffeur an.
Jetzt mischte sich auch der Monsignore ein: »Ja, eine schwarze Limousine mit Vatikan-Kennzeichen! Am besten noch eine Polizeieskorte mit Blaulicht und die Ankündigung in den Nachrichten: Heute Nacht transportiert auf der Autostrada von Florenz nach Bologna Seine Excellenz Kurienkardinal Philippo Gonzaga …«
»Schweigen Sie!«, unterbrach der Kardinal den Redefluss seines Sekretärs. »Kein Wort mehr. Ich habe mich nicht beklagt. Wir haben uns entschieden, dass es am unverfänglichsten ist, wenn drei Männer bei Nacht in einem unscheinbaren Fiat von Rom in Richtung Brenner fahren. Basta.«
»War nur gut gemeint, Excellenza«, entschuldigte sich Alberto. Dann fielen die drei Männer erneut in angespanntes Schweigen.
Alberto hielt die Geschwindigkeit des Wagens konstant bei hundertsechzig Stundenkilometern. Der Kardinal auf dem Rücksitz starrte angestrengt durch die Windschutzscheibe nach vorne, wo die abgeblendeten Scheinwerfer sich mühsam einen Weg bahnten.
Soffici, ein drahtiger Vierziger mit Bürstenhaarschnitt und einer Brille mit Goldrand, bewegte in kurzen Abständen die Lippen, als ob er betete. Dabei verursachte er ein Geräusch wie ein tropfender Wasserhahn.
»Können Sie Ihre Gebete nicht stumm verrichten?«, sagte der Kardinal genervt. Devot wie ein gemaßregeltes Kind stellte der Monsignore seine Lippenbewegungen ein.
Hinter Modena, wo die A 1 weiter nach Westen, in Richtung Milano, führt, und die A 22 nach Norden abzweigt, wurde das Dröhnen des Motors von Händels Halleluja unterbrochen. Die Melodie kam aus der Innentasche von Sofficis Sakko. Nervös fingerte der Sekretär sein Mobiltelefon hervor und blickte auf das Display. Mit einer Verrenkung reichte er das kleine Gerät nach hinten: »Für Sie, Excellenza!«
Gonzaga, mit seinen Gedanken ganz woanders, streckte die Linke aus, ohne seinen Sekretär anzusehen: »Geben Sie her!« Schließlich presste er das Telefon an sein Ohr.
»Pronto!«
Eine Weile lauschte er wortlos, dann sagte der Kardinal knapp: »Ich habe das Codewort verstanden. Hoffentlich können wir die Zeit einhalten. Im Übrigen fühle ich mich wie eine ägyptische Mumie, wie dieser …« Er stockte.
»Tut-ench-Amun!«, kam Soffici auf dem Vordersitz zu Hilfe.
»Genau. Wie dieser Tut-ench-Amun. Gott zum Gruß.«
Kardinal Gonzaga reichte das Mobiltelefon zurück. »Wenn es schiefgeht, können Sie sich bald eine neue Melodie auf Ihr Handy herunterladen«, meinte er mit einem sarkastischen Unterton.
Der Sekretär wandte sich um: »Was sollte jetzt noch schiefgehen, Excellenza?«
Gonzaga hob theatralisch beide Arme, als wollte er das Tedeum anstimmen; aber seine Worte klangen eher blasphemisch: »Ein bisschen viel, was uns unser Herr Jesus in letzter Zeit zumutet. Würde mich nicht wundern, wenn unser Vorhaben noch in letzter Minute scheitert.«
Eine Weile herrschte nachdenkliches Schweigen. Schließlich sagte Gonzaga im Flüsterton, als könnte jemand ihr Gespräch belauschen: »Das Codewort lautet ›Apokalypse 20,7‹. Alberto, haben Sie mich verstanden?«
»Apokalypse 20,7«, wiederholte der Fahrer und nickte geflissentlich. »Wann werden wir erwartet?«
»Drei Uhr dreißig. Auf jeden Fall noch vor dem Morgengrauen.«
»Madonna mia, wie soll ich das schaffen?«
»Mit Gottes Hilfe und Vollgas!«
Schier endlos und schnurgerade führte die Autobahn durch die Poebene. Bei Nacht und mit erhöhtem Tempo verführt diese Straße zum Sekundenschlaf. Auch Alberto hatte mit der Müdigkeit zu kämpfen.
Aber dann ging ihm der Zweck der Reise durch den Kopf. Ein absurdes Unternehmen, in das nur der Kardinalstaatssekretär, Monsignor Soffici und er eingeweiht waren.
An Soffici gewandt, begann der Kardinal erneut nach einer längeren Strecke des Schweigens: »Wirklich sinnreich dieses Codewort. Sie kennen den Text der Geheimen Offenbarung?«
»Natürlich, Excellenza.«
»Auch Kapitel zwanzig, Vers sieben?«
Soffici kam ins Stottern: »Ausgerechnet dieser Vers ist mir gerade nicht gegenwärtig; aber alle anderen vermag ich durchaus aus dem Gedächtnis zu zitieren.«
»Schon gut, Soffici, jetzt wissen Sie, warum Sie es bisher nur zum Monsignore gebracht haben und nicht weiter.«
»Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Excellenza, ich verneige mich in Demut vor dem Titel, den mir mein Amt einbrachte!«
Gonzaga verstand es vortrefflich, seinen jungenhaften Sekretär immer wieder auf perfide Weise zu beleidigen. Soffici blieb nur die Freiheit seiner Gedanken.
Die Luft im Wagen war penetrant mit »Pour Monsieur« von Coco Chanel geschwängert, einem gewöhnungsbedürftigen Männerparfüm, das der Kardinal in der exquisiten Boutique im Vatikan-Bahnhof günstig erstand. Mit dem Duftwasser pflegte der Kardinal seine marzipanfarbige Glatze einzureiben, seit der Küster von Santa Maria Maggiore ihm nach einem Pontifikalamt unter strengster Geheimhaltung verraten hatte, dass die genannte Prozedur den Haarwuchs fördere.
Auch von hinten und in der Dunkelheit entgingen dem Kardinal nicht die ruckartigen, unwilligen Kopfbewegungen, welche die Gedanken seines Sekretärs begleiteten. »Ich will Ihnen sagen, was in 20, 7 geschrieben steht!«
»Nicht nötig«, unterbrach Soffici den Kardinal. »Ich hatte nur einen kurzen Blackout. Der fragliche Satz lautet: ›Wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus dem Kerker.‹«
»Respekt, Monsignore«, erwiderte Gonzaga. »Allerdings erkenne ich keinen Zusammenhang mit unserer Mission.«
Alberto, der von Anfang an in das geheime Unternehmen eingeweiht war, unterdrückte ein verlegenes Kichern und wandte seine Aufmerksamkeit einem Fahrzeug zu, das seit beinahe dreißig Kilometern an seiner Stoßstange klebte. Jedes Mal wenn er seinen Fiat beschleunigte, blieb ihm auch dieser unangenehme Fahrzeuglenker auf den Fersen. Verlangsamte er die Fahrt, wurde auch das Auto hinter ihm langsamer.
Um den lästigen Hintermann abzuhängen, gab Alberto Gas.
Irgendwo zwischen den Ausfahrten Mantua und Verona passierte es: Mit brüllendem Motor scherte der verfolgende Wagen aus, überholte und setzte sich so dicht vor Albertos Fiat, dass dieser sich genötigt sah, abrupt abzubremsen. Alberto kommentierte das riskante Manöver mit einem Schimpfwort übelster Sorte, worauf der Sekretär sich mahnend räusperte. Plötzlich erschienen auf der rechten Seite des Fahrzeugs ein Arm und eine rot blinkende Kelle: Polizia.
»Auch das noch«, stöhnte Alberto. Widerwillig fügte er sich den heftigen Armbewegungen des Polizisten, seinen Anweisungen zu folgen.
Die Polizeiaktion war sorgfältig geplant. Keine dreihundert Meter entfernt gab es einen unbeleuchteten Parkplatz. Dorthin, wurde dem Fahrer bedeutet, möge er dem Polizeifahrzeug folgen.
Kaum hatte Alberto den Wagen zum Stehen gebracht, als drei Männer mit Maschinenpistolen aus ihrem Fahrzeug sprangen und den Fiat, ihre Waffen im Anschlag, umstellten.
Soffici hielt die Hände verschränkt und begann, deutlich hörbar die Lippen zu bewegen. Auf dem Rücksitz saß der Kardinal steif und bewegungslos, als wäre er tot. Eher gelassen begegnete der Chauffeur des Kardinals der brisanten Situation. Stumm kurbelte er die Seitenscheibe herab und blinzelte in das grelle Licht einer Handlampe.
»Aussteigen!«
Betont langsam und unwillig kam Alberto der rüden Aufforderung nach. Doch kaum war der Fahrer ausgestiegen, packte ihn je ein Carabiniere am linken und rechten Oberarm und presste seine Hände auf das Wagendach.
Alberto, ein in jeder Situation furchtloser Mann, und in dieser Hinsicht nicht gerade ein typischer Italiener, stieß einen gequälten Schrei aus, welcher der Situation in keiner Weise angemessen war. Er beruhigte sich erst, als er die Mündung der Maschinenpistole des dritten Carabiniere im Rücken spürte.
»Hören Sie«, rief er, nachdem ihn einer der Polizisten von oben bis unten nach Waffen abgetastet hatte. »Ich bin der Chauffeur Seiner Exzellenz des Kurienkardinals Gonzaga.«
»Schon gut«, kam die Antwort des Anführers des Trios, »und ich bin der Kaiser von China. Papiere!«
Alberto deutete auf den Kofferraum. Der Anführer ließ von seinem Opfer ab und ging zum Kofferraum. Dabei leuchtete er kurz ins Wageninnere. Er erschrak.
»Ist er tot?« Er drehte sich um, an Alberto gewandt.
»Er da!«
»Das ist Kardinal Gonzaga!«
»Das sagten Sie bereits. Dazu kommen wir später. Ich meine, der Mann gibt kein Lebenszeichen von sich.«
»Das hat durchaus seinen Grund.«
»Ich bin gespannt, ihn zu hören.«
Durch die geöffnete Fahrertür hatte der Kardinal die Auseinandersetzung des Polizisten mit seinem Chauffeur gehört. Deshalb hob er würdevoll seine Rechte.
Der Polizist wich einen Schritt zurück.
»Ich dachte wirklich, der Kerl ist tot«, raunte er den beiden anderen zu.
Die postierten sich zu beiden Seiten, als Alberto den Kofferraum öffnete.
»Madonna«, rief der eine, ein schlaksiger Kerl und einen Kopf größer als die beiden anderen und vermutlich der Anführer des Einsatzkommandos. Gott weiß, was er im Kofferraum des kleinen Fiat erwartet hatte – auf keinen Fall eine purpurrote Schärpe, sorgsam gefaltet auf einem schwarzen, ebenso sorgsam gefalteten Talar mit roten Applikationen samt einem purpurfarbenen Scheitelkäppchen.
Aus einer Mappe aus rotem Saffianleder zog Alberto einen Reisepass mit goldfarbenem Aufdruck »Città del Vaticano« hervor. Den reichte er dem Carabiniere.
Hilfesuchend warf der Polizist seinen Kollegen einen Blick zu, und als diese noch immer ihre Maschinenpistolen im Anschlag hielten, zischte er durch die Zähne, sie sollten gefälligst die Waffen sinken lassen.
Das Foto im Reisepass des Kardinals entsprach gewiss nicht dem neuesten Stand – auch an einem Kardinal hält sich die Zeit schadhaft –, aber an der Echtheit des Dokuments konnte kein Zweifel bestehen. Name: S. E. Philippo Gonzaga, Cardinale di Curia, wohnhaft: Città del Vaticano.
Der Polizist stieß seinen Kollegen beiseite und trat salutierend vor die rückwärtige Seitenscheibe, hinter der Gonzaga noch immer regungslos verharrte.
»Entschuldigen Sie, Excellenza«, rief der Carabiniere durch die geschlossene Scheibe. »Ich konnte nicht wissen, dass Excellenza sich in einem alten Fiat auf Reisen begeben. Aber ich bin nur meiner Pflicht nachgekommen …«
Gonzaga warf dem zerknirschten Polizisten einen abschätzigen Blick zu, dann öffnete er das Seitenfenster einen schmalen Spalt und streckte fordernd die linke Hand aus.
Vorsichtig und mit spitzen Fingern reichte der Carabiniere den Pass zurück. Er salutierte, und mit einer heftigen Kopfbewegung gab er den beiden anderen das Zeichen zu verschwinden.
»Das wäre ja noch einmal gut gegangen«, prustete Alberto und ließ sich auf den Fahrersitz fallen.
KAPITEL 2
Montagmorgen lief der Nachtzug von München nach Rom mit Verspätung in der Stazione Termini ein. Malberg hatte schlecht geschlafen, und das Frühstück, das ihm der Schlafwagenschaffner hereinreichte, war eine mittlere Katastrophe.
Auf dem Bahnsteig zog Malberg missmutig seinen Koffer hinter sich her. In tadellosem Italienisch nannte er dem Taxifahrer sein Ziel: »Via Giulia 62. Hotel Cardinal, per favore.«
Dies erwies sich insofern als Fehler, als der Taxifahrer aus unerfindlichen Gründen begann, dem sprachkundigen Fremden sein Leben zu erzählen, woran Malberg nicht das geringste Interesse hatte und von dem ihm nur fünf Töchter im Gedächtnis blieben.
Das Hotel lag nicht weit von der Piazza Navona in einem Viertel mit zahlreichen Antiquitätenhändlern und Antiquaren. Malberg war schon einige Male hier abgestiegen, und so begrüßte ihn der Concierge in der ganz in Rot gehaltenen Rezeption überschwänglich.
Auf dem Zimmer im ersten Stock packte er lustlos seinen Koffer aus – er hasste das Aus- und Einpacken wie die Pest –, dann griff er zum Telefon und wählte die elfstellige Nummer eines Mobiltelefons.
Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis am anderen Ende der Leitung abgehoben wurde. Eine verschlafene weibliche Stimme meldete sich: »Hallooo?«
»Marlene?«, fragte Malberg unsicher.
»Lukas, du? Wo steckst du? Wie spät ist es?«
»Also der Reihe nach«, begann Malberg amüsiert. »Ja, ich bin es. Ich habe eben im Hotel Cardinal eingecheckt. Und es ist zehn Uhr fünfundvierzig. Sonst noch Fragen?«
Die Frau am anderen Ende der Leitung lachte: »Lukas, du bist noch derselbe Spaßvogel wie früher!«
»Wir waren verabredet, erinnerst du dich?«
»Ich weiß. Aber der Vormittag ist nun mal nicht meine Zeit. Hör zu: Ich hole dich in einer Stunde am Hotel ab. Dann fahren wir gemeinsam zur Marchesa. Bis gleich.«
Malberg betrachtete verdutzt den Telefonhörer, als erwartete er noch ein Auf Wiedersehen, aber Marlene hatte längst aufgelegt.
Eigentlich kannte er Marlenes Sprunghaftigkeit, ihre Angewohnheit, von einem Augenblick auf den anderen einen Entschluss zu fassen oder in einen Rausch der Begeisterung zu verfallen. Schließlich hatten sie zwei volle Jahre eine Schulbank geteilt. Aber wie das so ist, nach der Schulzeit hatten sie sich aus den Augen verloren. Und als sie sich zum zwanzigsten Abitur-Jubiläum wiedertrafen, da löste Lenchen – wie er Marlene früher etwas despektierlich nannte – Erstaunen, ja Entzücken aus. Denn das einst so biedere Lenchen hatte sich zu einem stattlichen, ja aufregenden Frauenzimmer entwickelt.
Ihr Biologiestudium für das höhere Lehramt hatte Lenchen schon bald nach dem Abitur aufgegeben. Warum sie nach Rom gegangen war, konnte oder wollte Marlene nicht sagen. Auch nicht, wovon sie eigentlich lebte. Jedenfalls war sie im Gegensatz zu allen anderen aus der Klasse nicht verheiratet. Das verwunderte.
Bei Lukas Malberg, der als gutverdienender Antiquar in München lebte, hatte Marlene jedenfalls großen Eindruck hinterlassen. Als er sie letzte Woche anrief, meinte sie gesprächsweise, sie kenne da eine verarmte Marchesa, die sich von der Büchersammlung ihres verstorbenen Mannes trennen wolle – es seien wertvolle Folianten aus dem fünfzehnten Jahrhundert darunter. Malberg hatte sofort Interesse bekundet. Zugegeben, es waren nicht nur die Bücher, die ihn zu der Romreise veranlassten.
Er war ein gut aussehender Junggeselle und Marlene eine attraktive Frau. Und Rom bot die perfekte Kulisse für eine aufregende Affäre.
Natürlich war Marlene unpünktlich. Das hatte Lukas nicht anders erwartet. Der römische Verkehr führt ohnehin jeden Termin ad absurdum. Aber als Marlene gegen halb eins immer noch nicht eingetroffen war, griff Malberg zum Telefon und wählte die Nummer ihres Mobiltelefons. Doch es antwortete nur die Mailbox. Als er die Nummer ihres Festnetz-Anschlusses wählte, kam die automatische Ansage: »Dieser Anschluss ist zurzeit nicht erreichbar.«
In der Annahme, er habe sich verwählt, versuchte es Lukas erneut.
Nach dem dritten Versuch gab Malberg auf. Er blickte ratlos aus dem Fenster auf die Straße. Nach einer weiteren halben Stunde versuchte er es wieder.
»Dieser Anschluss ist zurzeit nicht erreichbar.«
Malberg wurde unruhig. Wenn etwas passiert war – warum ließ Marlene nichts von sich hören?
Auf einem Zettel hatte er außer ihrer Telefonnummer auch ihre Adresse notiert: Via Gora 23. Vor dem Hotel bestieg Malberg ein Taxi.
Das Haus in Trastevere, ein fünfstöckiger Klotz wie die meisten Häuser in der Straße, machte einen etwas heruntergekommenen Eindruck. Es war gewiss hundert Jahre alt, und der pompöse Eingang mit zwei hohen Säulen zu beiden Seiten konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine dringende Renovierung anstand.
Von ihren Erzählungen wusste Malberg, dass Marlene eine geräumige Dachwohnung mit Terrasse und Blick auf Tiber und Palatin bewohnte.
Vorbei an einer üppigen Concierge, die im Erdgeschoss uninteressiert durch einen Türspalt lugte, strebte Malberg dem Lift zu. Mit einem Schmunzeln nahm er den Namen auf dem Türschild der Hausbeschließerin wahr: Fellini. Das aus dunklem Mahagoni und geschliffenem Glas gefertigte Ungeheuer gab, noch ehe der Besucher einen Fuß hineingesetzt hatte, klagende und fauchende Geräusche von sich. Sie hallten durch das ganze Treppenhaus, als der Aufzug von oben herabschwebte. Malberg, der jeder Art von Fortbewegung, die von der Erde abhob, mit Misstrauen begegnete, entschloss sich, die Treppe zu nehmen.
Die Luft im Treppenhaus war stickig. Es roch nach Bohnerwachs und Wischwasser. Auf dem Weg nach oben wurde er beinahe von zwei Männern umgerannt, die in großer Eile nach unten hasteten.
»Können Sie nicht aufpassen!«, rief er den beiden hinterher.
Im obersten Stockwerk angelangt, wischte sich Malberg den Schweiß von der Stirn.
Eine zweiflügelige, weiß gestrichene Tür trug kein Namensschild. An der Wand eingelassen ein Klingelknopf aus Messing. Malberg klingelte.
Aus dem Innern der Wohnung drang kein Laut.
Nach einer Weile schellte Malberg ein zweites Mal, und als Marlene keine Reaktion zeigte, ein drittes und ein viertes Mal. Schließlich schlug er mit der flachen Hand gegen die Tür und rief: »Ich bin es, Lukas! Warum öffnest du nicht?«
In diesem Augenblick gab die Tür nach – sie war nur angelehnt. Malberg zögerte. Vorsichtig trat er ein.
»Marlene? Ist alles in Ordnung? Marlene?«
Malberg lauschte mit geöffnetem Mund.
»Marlene?«
Keine Antwort.
Malberg befiel auf einmal ein beklemmendes Gefühl. Er empfand plötzlich Angst, Furcht vor dem Ungewissen.
»Marlene?«
Sorgsam darauf bedacht, jedes Geräusch zu vermeiden, setzte Malberg einen Fuß vor den anderen. Ein herber, nicht unangenehmer Duft wie von Lilien lag in der Luft. Eher unbewusst nahm er im Flur die goldfarbenen Brokattapeten, die kostbaren Appliken und das antike Mobiliar wahr.
Der Salon, ein geschmackvoll möbliertes Interieur mit schweren Polstermöbeln und voluminösem amerikanischem Teppichboden, war in Unordnung. Was die Wohnung betraf, hatte Marlene nicht übertrieben, der Blick über Rom war atemberaubend. Hier ließ es sich leben.
Noch bevor Malberg in Träumereien verfallen konnte, holte ihn die Wirklichkeit ein: Das Telefon lag am Boden, die Steckdose war aus der Wand gerissen. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Malberg wollte gerade das Telefon vom Boden aufheben, da fiel sein Blick auf die offene Tür zum Badezimmer.
Auf dem schwarzen Fliesenboden glitzerte eine große Wasserlache. Malberg trat näher. Jetzt wusste er, woher der Lilienduft kam. Eine teure Badeessenz. Als er in die Tür trat, pochte sein Herzschlag in den Ohren.
Wie gebannt starrte er auf die luxuriöse weiße Eckbadewanne: Da lag Marlene in der übergelaufenen Wanne, den Kopf unter Wasser, mit offenen, verdrehten Augen, den Mund zu einer Fratze verzerrt, als habe sie im Todeskampf einen Schmerzensschrei ausgestoßen. Ihre langen dunklen Haare trieben wie Schlingpflanzen im Badewasser. Obwohl ihr sonnengebräunter Körper schön und nackt war, ging von ihm etwas Furchterregendes aus. Ihre verrenkten Glieder erinnerten an einen toten, von der Brandung angeschwemmten Vogel.
»Marlene«, stammelte Malberg weinerlich. Er wusste, dass jede Hilfe zu spät kam. »Marlene …«
Wie lange er wie paralysiert tatenlos in der Tür gestanden hatte, Malberg wusste es nicht. Plötzlich hörte er Stimmen im Treppenhaus. Er musste so schnell wie möglich aus der Wohnung verschwinden. Wenn man ihn hier fände, würde er sofort in Verdacht geraten. Denn dass Marlene sich das Leben genommen hatte, erschien ihm absurd.
Malberg machte kehrt und warf noch einen kurzen Blick in den luxuriösen Salon, als er auf einem Beistelltischchen ein aufgeschlagenes Notizbuch entdeckte. Der Gedanke, Marlene könnte auch seinen Namen, Adresse und Telefonnummer darin notiert haben, veranlasste ihn, das Notizbuch an sich zu nehmen und in der Jackentasche verschwinden zu lassen. Dann verließ er Marlenes Wohnung und zog die Tür leise hinter sich zu.
Wie konnte er unbemerkt aus dem Mietshaus verschwinden? Das Haus war nicht so groß, dass ein fremder Besucher unbemerkt geblieben wäre.
Auf Zehenspitzen schlich er zwei Stockwerke nach unten, als sich der altmodische Aufzug, der die Mitte des Treppenhauses einnahm, aufwärts in Bewegung setzte. Durch das Gitternetz, das den Aufzugsschacht wie ein Käfig umgab, erkannte Malberg eine Frau mittleren Alters. Sie schien ihn nicht zu bemerken. Im Parterre angelangt, hielt Malberg inne.
Wie zuvor stand die Tür der Conciergewohnung einen Spaltbreit offen. Aus dem Innern hörte man laute Radiomusik. Malberg zögerte. Im Vorbeigehen musste ihn die Hausbeschließerin bemerken. Da kam ihm der Zufall zu Hilfe.
Eine fette, struppige Katze mit irgendetwas im Maul huschte plötzlich aus der Tür. Die Concierge, eine stattliche Frau mit modischer Kurzhaarfrisur und blitzenden Kreolen im Ohr, verfolgte das Tier laut schreiend bis auf die Straße. Diese Gelegenheit nutzte Malberg, um das Haus unbemerkt zu verlassen.
Betont lässig schlenderte er die Via Gora entlang in Richtung Tiber. In seinem Innersten war Malberg aufgewühlt. Er fühlte kalten Schweiß im Nacken und hatte das Bedürfnis, fortzurennen so schnell er konnte; aber eine innere Stimme mahnte ihn, damit würde er sich nur verdächtig machen.
Es war merkwürdig, in seiner Verwirrtheit fühlte Malberg sich irgendwie fast schuldig an Marlenes Tod. Sie hatte am Telefon so fröhlich geklungen. Warum hatte er so lange gewartet? Er war zu spät gekommen. Und dann heulte er los. Malberg weinte so hemmungslos, dass ihm salzige Tränen über das Gesicht rannen.
Was in aller Welt war im fünften Stockwerk der Via Gora 23 vorgefallen? Vor drei Stunden hatte Malberg noch mit Marlene telefoniert. Jetzt war sie tot. Ermordet. Marlene!
Während er in die vielbefahrene Viale di Trastevere einbog, die geradewegs zum Tiberufer führt, tauchte vor seinen Augen das Bild von Marlenes unter Wasser treibendem Körper auf. Gequält blinzelte er in die Sonne, um diesen Albtraum loszuwerden. Fast blind tappte er vor sich hin. Nur fort von diesem furchtbaren Ort! Mit ausgestrecktem Arm versuchte er ein Taxi heranzuwinken; aber die Taxis brausten alle an ihm vorbei.
Schließlich trat Malberg auf die Straße, um sich bemerkbar zu machen. Da spürte er einen furchtbaren Schlag, der ihm die Luft nahm. Einen Augenblick glaubte er zu fliegen. Ein zweiter Schlag traf seinen Kopf, dann wurde es um ihn Nacht.
KAPITEL 3
Als Lukas Malberg wieder zu sich kam, blickte er in das herbe Gesicht einer Krankenschwester. In allernächster Nähe vernahm er einen regelmäßigen, nervenden Piepston.
»Wo bin ich?«, erkundigte er sich bei der Schwester.
»Im Klinikum Santa Cecilia. Sie hatten einen Unfall.«
Erst jetzt bemerkte Malberg, dass sein Kopf schmerzte. Ihm war übel, und er hatte Mühe zu atmen.
»Einen Unfall? Ich kann mich nicht erinnern.« Malberg versuchte sich zu konzentrieren, aber der Versuch misslang.
»Kein Wunder, Sie haben eine Gehirnerschütterung. Trotzdem können Sie noch von Glück reden. Außer der Platzwunde am Kopf sind Sie noch glimpflich davongekommen.«
Malberg betastete seine Stirn und fühlte einen leichten Verband. »Einen Unfall, sagten Sie?«
»Auf der Via di Trastevere. Der Fahrer ist flüchtig.«
So sehr Malberg sich sein Gehirn zermarterte, im Dunkel seiner Erinnerung tauchte kein Unfall auf. Aber plötzlich, als habe ein Funke sein Gedächtnis entzündet, flammte in seinem Kopf ein Bild auf: Marlenes Leiche im Wasser der Badewanne. Malberg stöhnte auf.
»Sie sollten sich keine Sorgen machen«, antwortete die Schwester. »In einer Woche werden Sie wieder entlassen. Was Sie jetzt brauchen, ist vor allem Ruhe.«
Malberg kniff die Augenbrauen zusammen und sah die Schwester fragend an. »Und sonst?«
»Was meinen Sie?«
»Ich meine, sonst ist nichts passiert?«
Die Schwester schüttelte den Kopf. Dann sagte sie: »Ich kann Sie doch einen Augenblick allein lassen?«
»Schon gut«, erwiderte Malberg.
Allein in dem kahlen weißen Raum, bekam er es mit der Angst zu tun. Das EKG-Gerät, an welches er angeschlossen war, piepste nervtötend. Unter höchster Konzentration versuchte Malberg seine Erinnerungen zu ordnen: die Rom-Reise im Nachtzug, seine Ankunft im Hotel Cardinal, wie er mit Marlene telefoniert hatte, und dann der Albtraum, Marlene tot in der Badewanne.
Bei diesem Gedanken beschleunigte das Überwachungsgerät seine Taktfrequenz. Im selben Augenblick kam die Schwester in Begleitung eines Arztes zurück.
»Dottor Lizzani.« Der Doktor reichte Malberg die Hand. »Und wie ist Ihr Name?«, fragte Lizzani geschäftsmäßig.
»Lukas Malberg.«
»Sie sind Deutscher?«
»Ja. Doktor, aber ich kann mich an keinen Unfall erinnern.«
Lizzani warf der Schwester einen bedeutungsvollen Blick zu. Dann fragte er unvermittelt: »Wie viel ist drei mal neun?«
»Dottore«, empörte sich Malberg, »ich bin völlig in Ordnung. Es ist nur – ich kann mich an keinen Unfall erinnern!«
»Drei mal neun?«, wiederholte der Arzt unnachgiebig.
»Siebenundzwanzig«, knurrte der Patient unwillig. Und gekränkt fügte er hinzu: »… wenn ich mich nicht verrechnet habe.«
Dottor Lizzani ließ sich nicht beirren: »Haben Sie Angehörige in Rom, die wir benachrichtigen können?«
»Nein.«
»Sie sind hier auf Urlaub?«
»Nein, eher geschäftlich.«
Eher geschäftlich verlief auch die weitere Unterredung zwischen Arzt und Patient. Sie endete mit der Ankündigung des Dottore: »Wir werden Sie ein paar Tage zur Beobachtung hierbehalten, Signor Malberg. Und was Ihren Blackout wegen des Unfalls betrifft, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist völlig normal. Früher oder später wird sich Ihr Erinnerungsvermögen wieder einstellen.«
»Und die Drähte?«, meinte Malberg mit einem vorwurfsvollen Blick auf die Kabel, die zum Überwachungsgerät führten.
»Die kann Ihnen die Schwester abnehmen. Guten Tag, Signore.«
Nachdem die Schwester ihn vom Gewirr der Leitungen befreit und das Zimmer verlassen hatte, sah sich Malberg um. Aber außer dem EKG-Gerät, von dem die Verkabelung herabhing wie die Fangarme eines Polypen, gab es da nichts zu sehen. Nur weiße, kahle Wände und eine weiße Schrankwand. Ein weißer Stuhl mit seiner Kleidung.
Auf dem Nachttisch aus weiß gestrichenem Stahlrohr lagen seine Brieftasche und daneben das Notizbuch, das Malberg in Marlenes Wohnung an sich genommen hatte. Der Anblick versetzte ihm einen Schlag in die Magengrube. Ihm wurde übel.
Malberg bemerkte, wie seine Hände zitterten, als er in dem Notizbuch zu blättern begann. Die ungelenke Mädchenschrift wollte so gar nicht zum selbstbewussten Erscheinungsbild Marlenes passen. Noch größeres Erstaunen lösten jedoch die Eintragungen aus: keine Namen, keine Adressen, nur seltsam verschlüsselte Wörter. Was hatten diese Eintragungen zu bedeuten?
Laetare: Maleachi
Sexagesima: Jona
Reminiscere: Sacharja
Oculi: Nahum
Malbergs Befürchtungen, sein Name könnte in Marlenes Notizbuch festgehalten sein, erwiesen sich jedenfalls als falsch. Es gab überhaupt keine normalen Namen. Ratlos legte er die Aufzeichnungen beiseite.
Marlene! Malberg sah plötzlich wieder ihren unter Wasser getauchten Kopf und die langen Haare, die wie Schlingpflanzen im Wasser trieben. Er wusste, dass er diesen Anblick nie vergessen würde. Erste Bedenken machten sich breit, ob er sich in seiner Panik richtig verhalten hatte, ob es nicht besser gewesen wäre, die Polizei zu verständigen.
Was hatte er für einen Grund davonzulaufen? Hatte er sich nicht gerade dadurch verdächtig gemacht? Und die Hausbeschließerin? Hatte sie ihn wirklich nicht gesehen? Würde sie ihn bei einer Gegenüberstellung wiedererkennen?
Ein Kaleidoskop von Gedanken und Möglichkeiten raste durch sein ohnehin angeschlagenes Gehirn, Bilder überlagerten sich und machten ihn nur noch ratloser. Und dazwischen immer wieder Marlenes weit aufgerissene Augen unter Wasser. Wie musste sie gelitten haben, bevor der Tod sie erlöste.
Noch nie im Leben war ihm der Tod so nahe gekommen. Den Tod kannte Malberg nur aus der Ferne. Wenn er aus der Zeitung oder den Nachrichten erfuhr, dass jemand gestorben war. Dann hatte er den Tod zwar registriert, aber der hatte ihn nie wirklich berührt. Marlenes Tod hingegen betraf ihn unmittelbar. Jetzt erst merkte er, mit welch hohen Erwartungen er zu der schönen Schulfreundin gefahren war.
Voller Unruhe rappelte er sich in seinem Krankenbett auf. Er musste wissen, was mit Marlene passiert war. Hier wollte er, hier konnte er nicht länger bleiben. Im Augenblick fühlte sich Malberg noch zu schwach. Aber morgen – das nahm er sich fest vor –, morgen würde er die Klinik verlassen.
KAPITEL 4
Der schmale Fahrweg ging steil bergauf. Soffici, der Sekretär des Kardinals, hatte nach der langen Nachtfahrt das Steuer übernommen. Jetzt schlief Alberto auf dem Beifahrersitz, und nicht einmal die tiefen Schlaglöcher auf dem unbefestigten Weg konnten ihn aufwecken.
Im ersten Gang steuerte Soffici den Fiat durch die engen Kurven. Tiefhängende Äste des Unterholzes zu beiden Seiten schlugen gegen die Windschutzscheibe.
»Man kann nur hoffen, dass uns kein Fahrzeug entgegenkommt«, bemerkte Kardinalstaatssekretär Gonzaga nach längerem Schweigen. Er saß noch immer stocksteif auf seinem Rücksitz. Auf der ganzen Strecke hatte er kein Auge zugetan.
Nachdem sie hinter Wiesbaden die Autobahn verlassen hatten, hatte Gonzaga die Aufgabe des Wegweisers übernommen. Die Strecke, welche rechtsrheinisch nach Burg Layenfels führte, stand auf einem Zettel notiert. In Lorch, einem tausendjährigen Städtchen, zweigte eine Landstraße ab ins Wispertal, die gesäumt war von üppipen Weinbergen und bis zu einer Gabelung führte.
Gonzaga, der zu stolz war, eine Lesebrille zu tragen, hielt die Wegbeschreibung am ausgestreckten Arm.
»Jetzt immer links halten«, krächzte er mit belegter Stimme.
Inzwischen begann es zu regnen.
»Und Sie sind sicher, Excellenza, dass das der richtige Weg ist«, erkundigte sich Soffici unsicher.
Gonzaga gab keine Antwort. Er studierte zum wiederholten Mal den Zettel, der den Weg beschrieb. Schließlich zischte er: »Was heißt sicher, ich fahre den Weg auch zum ersten Mal. Aber irgendwohin muss diese gottverdammte Straße ja führen!«
Der Sekretär zuckte zusammen, und Alberto erwachte aus seinem Schlaf. Als er die Unsicherheit bemerkte, mit der Soffici den Wagen lenkte, erbat er sich, wieder selbst das Steuer zu übernehmen.
Soffici hielt an und stellte den Motor ab.
Die steile Straße war so schmal und so eingewachsen, dass Soffici und Alberto Mühe hatten auszusteigen, um die Plätze zu tauschen.
Es war totenstill. Man konnte nur den Regen hören, der auf die Sträucher klatschte. Während sich Alberto hinter das Steuer klemmte, kurbelte der Kardinal das Seitenfenster herunter. Frischer, moosiger Geruch drang in das Innere. Gonzaga sog ihn gierig ein. Aus der Ferne hörte man Hundegebell.
»Weiter!«, befahl der Kardinal.
Alberto startete den Motor, aber das Gefährt wollte nicht anspringen.
»Auch das noch!« Unwillig presste Gonzaga die Luft durch die Nase.
»Bei der Heiligen Jungfrau«, beteuerte Alberto, der sich schuldig fühlte an der Misere, »mein Wagen hat mich noch nie im Stich gelassen. Es ist das erste Mal, Excellenza.«
Der machte eine unwillige Handbewegung. Dann klopfte er Soffici von hinten auf die Schulter.
Monsignor Soffici verstand, was der Kardinalstaatssekretär damit sagen wollte. Aus dem Handschuhfach kramte Alberto eine Mütze hervor und reichte sie Soffici.
»Weit kann es nicht mehr sein«, rief Gonzaga durch das geöffnete Seitenfenster seinem Sekretär hinterher. Soffici verschwand nach wenigen Metern bergan hinter der nächsten Biegung.
In Augenblicken wie diesen verfluchte der Monsignore, obwohl von tiefer Frömmigkeit, seinen Dienstherrn. Nicht umsonst nannte man ihn in der Kurie hinter vorgehaltener Hand: Gonzaga la iena, Gonzaga die Hyäne. Man wusste nie, wie man bei ihm dran war. Jedenfalls hatte der zweite Mann hinter dem Papst im Vatikan mehr Feinde als Freunde. Genau genommen kannte Soffici nicht einen, den er als Gonzagas Freund hätte bezeichnen können.
Trotz allem war der Monsignore seinem Herrn scheinbar treu ergeben. Ein Mann wie er betrachtete seine Aufgabe als Dienst am Allerhöchsten. Ohne Bedenken hatte er, als Gonzaga ihn unter dem Siegel der Verschwiegenheit in das Unternehmen einweihte, einen heiligen Eid geschworen, das Geheimnis mit ins Grab zu nehmen.
Bergan wurde der Weg immer beschwerlicher. Soffici japste und rang nach Luft. Er war nicht gerade eine Sportlernatur. Das nasse Gestrüpp zu beiden Seiten des Weges schlug ihm ins Gesicht und trug auch nicht gerade dazu bei, seine Laune zu verbessern.
Da plötzlich, nach einer scharfen Biegung, schimmerte Mauerwerk durchs Geäst. Soffici hielt inne. Inzwischen waren seine Kleider durchnässt, und als er den Blick gen Himmel wandte, erkannte er hoch über den Bäumen Mauern und Türme einer wuchtigen Burg.
»Jesus-Maria«, entfuhr es ihm halblaut. Der Anblick des Bauwerks mit seinen Zinnen, Türmen und Erkern versetzte ihn in Unruhe. Burg Layenfels hatte er sich einladender vorgestellt.
Unsicher tappte Soffici auf das Burgtor zu. Im Näherkommen erkannte er ein Schilderhäuschen neben einem vergitterten Eingang. Hinter dem winzigen Fenster des Wächterhäuschens brannte Licht, obwohl es bereits Tag war. Das alles wirkte bedrohlich und geheimnisvoll, und Soffici konnte sich nur schwer vorstellen, dass diese Burg hoch über dem Rhein tatsächlich dem Zweck dienen sollte, den Gonzaga angedeutet hatte.
Aus dem Innern der Burg drang kein Laut, keine Stimme, keine Schritte, nichts. Auf Zehenspitzen versuchte Soffici einen Blick in das Fenster zu werfen: Der winzige quadratische Raum glich einer Mönchszelle. Kahle Wände, ein klobiger Tisch, davor ein Stuhl, gegenüber dem Fenster eine hölzerne Liege ohne Polster, darüber an der Wand ein altmodisches Telefon. Auf der unbequemen Liege döste ein Wächter mit gefalteten Händen vor sich hin. Eine helle, nackte Glühbirne an der Decke hinderte ihn am Einschlafen. Getrübt wurde die Idylle allerdings durch eine Maschinenpistole, die griffbereit auf dem Stuhl lag.
Gerade wollte sich Soffici durch Klopfen bemerkbar machen, da vernahm er ein Motorengeräusch. Alberto war es doch noch gelungen, seinen Fiat zum Laufen zu bringen. In Schrittgeschwindigkeit quälte er sich bergan.
Der Wächter im Schilderhäuschen schreckte hoch, griff zu seiner Waffe und trat ans Fenster. Soffici blickte in ein bleiches, ausgemergeltes Gesicht.
»Das Codewort!«, herrschte der Wächter ihn an.
»Das Codewort«, stammelte Soffici im Anblick der auf ihn gerichteten Maschinenpistole, »Apokalypse zwanzig-sieben.«
Der bleiche Wächter schlug das Fenster zu, nahm den Hörer des Wandtelefons ab und machte Meldung.
Ächzend schwebte das schwere Eisengitter wie von Geisterhand gehoben in die Höhe und verschwand im Obergeschoss des Torturms.
Alberto bremste den Wagen ab. Kurz darauf trat der Wächter vor das Eingangstor und winkte das Fahrzeug in den Burghof. Sie wurden erwartet. Aus dem Kreuzgang, der den fünfeckigen Burghof einrahmte, strömten von allen Seiten schwarz gekleidete Gestalten herbei. Im Nu bildeten sie einen andächtigen Kreis um das Fahrzeug.
Soffici trat hinzu und half dem Kardinalstaatssekretär aus dem Wagen. Der wirkte steif und beinahe verlegen im Angesicht der vielen Menschen.
Ein hochgewachsener, schmalschultriger Mann im dunklen Gehrock und mit langem nach hinten gekämmtem Haar trat auf Gonzaga zu und fragte grußlos, eher geschäftsmäßig: »Ist alles glatt gegangen?« Sein Name war Anicet.
Als Kardinalstaatssekretär war Gonzaga devotere Töne gewöhnt. Sein Amt verlieh ihm die höchste Würde, und die war er auch in dieser Situation nicht bereit abzulegen.
»Guten Morgen, Herr Kardinal«, erwiderte Gonzaga, ohne auf die Frage seines Gegenübers einzugehen. »Was für eine scheußliche Gegend.« Die beiden kannten sich aus einer gemeinsamen Vergangenheit. Jeder wusste über den anderen bestens Bescheid. Das Fatale an dieser Situation war nur: Anicet hatte den Kardinalstaatssekretär in der Hand. Und deshalb hasste Gonzaga diesen Anicet, der sich großsprecherisch Großmeister nannte, mehr als es einem Christenmenschen zukam – von einem Kardinal ganz zu schweigen. »Was Ihre Frage betrifft«, erwiderte der Kardinal schließlich, »ja, es ist gut gegangen.«
Anicet registrierte sehr wohl den zynischen Unterton in Gonzagas Antwort; aber er tat, als habe er den leisen Spott nicht bemerkt. Ja, in sein herbes Gesicht verirrte sich sogar ein höfliches Lächeln, als er den Kardinal jetzt mit einer einladenden Handbewegung aufforderte, ihm zu folgen.
Burg Layenfels war um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts von einem spleenigen Engländer nach dem Vorbild mittelalterlicher Befestigungsanlagen erbaut worden. Die Bauarbeiten wurden jedoch nie vollendet, weil James-Thomas Bulwer – so der Name des Engländers – an einem frostigen Karfreitag sich über die Brüstung des Burgfrieds lehnte und nach einem dreißig Meter tiefen Sturz sein Leben aushauchte.
Ein preußischer Knopffabrikant, der das unvollendete Bauwerk kaufte, fand ebenfalls wenig Freude daran, weil er, noch vor der endgültigen Vollendung, von seiner Geliebten, einer trinkfesten Berliner Tingeltangel-Tänzerin, aus Eifersucht erschossen wurde.
Seither ging die Mär, auf Burg Layenfels liege ein Fluch. Das Bauwerk verfiel über die Jahrzehnte zur Ruine, weil sich kein Käufer finden wollte, der bereit war, neben dem Kaufpreis eine Millionensumme für die Restaurierung und Vollendung der Burganlage zu investieren.
Groß war deshalb die Verwunderung bei den Stadtvätern von Lorch, in deren Besitz die Liegenschaft inzwischen übergegangen war, als eines Tages ein Italiener namens Tecina auftauchte. Der Mann war eine gepflegte Erscheinung, trug teure Kleidung und fuhr einen dunkelblauen Mercedes 500. Aber das war auch schon das Einzige, was man über ihn mit Sicherheit sagen konnte.
Einige behaupteten, er sei Rechtsanwalt und agiere als Strohmann für einen obskuren Orden, andere wussten von Verbindungen zur russischen Mafia. Beweisen konnte es keiner. Tatsache war, dass Tecina mit einem Barscheck bezahlte, den Kaufpreis und die Restaurierung. Da trat die Frage nach der Herkunft des Geldes in den Hintergrund.
Der Kardinalstaatssekretär glaubte das Geheimnis zu kennen, das sich hinter den Mauern von Burg Layenfels verbarg. Seine Gedanken drehten sich um nichts anderes. Sie erfüllten ihn mit Sorge, und ihm wurde speiübel, wenn er nur daran dachte. Außerdem empfand er es als entwürdigend, den Befehlen Anicets Folge zu leisten und hinter ihm herzutrotten wie ein Hund.
Der Weg führte über eine steinerne Außentreppe in den ersten Stock der Burg. Sie ging steil nach oben, und es gab kein Geländer, an dem er sich festhalten konnte. Gonzaga war müde und ausgelaugt und hatte Schwierigkeiten mit der kostbaren Hülle, die ihn umgab, den oberen Treppenabsatz zu erklimmen.
Wie in einer Prozession folgten die schwarz gekleideten Männer, einer hinter dem anderen, dem Kardinal. Einige murmelten Unverständliches, andere legten den Weg schweigend in sich gekehrt zurück.
Oben angelangt führte eine schmale, eisenbeschlagene Tür in den Rittersaal. Ein wuchtiges Tonnengewölbe überspannte den langen, schmalen Raum. Er war hell erleuchtet und bis auf einen Refektoriumstisch in der Mitte unmöbliert.
Etwas hilflos hielt Kardinal Gonzaga nach seinem Sekretär Ausschau. Der fing in der Menge – es mochten wohl hundert Männer sein – seinen Blick auf, kam seinem Herrn zu Hilfe und half ihm aus dem Mantel. Die Männer umringten den Kardinal wie gierige Hunde das erlegte Wild, als sie sahen, was unter dem Mantel zum Vorschein kam. Wie auf ein lautloses Kommando hin reckten sie plötzlich die Hälse.
Nur Anicet hielt der unsichtbaren Kraft stand, die von Gonzaga ausging. Erwartungsvoll und mit einem Gesichtsausdruck, der zwischen Triumph und Neugierde schwankte, beobachtete er, wie Soffici das ockerfarbene, raue Tuch löste, welches der Kardinal wie ein Korsett um den Leib trug.
Während Gonzaga sich dreimal um die eigene Achse drehte, wickelte der Sekretär das Tuch ab und faltete es mehrmals. Dann legte er den Stapel auf den Tisch in der Mitte des Saales. Die Männer, die das Procedere mit Spannung verfolgt hatten, blieben stumm.
»In nomine domini«, murmelte Anicet süffisant und begann das Tuch zu entfalten.
Hundert Augenpaare verfolgten aufmerksam jeden Handgriff des Großmeisters. Obwohl jeder im Saal genau wusste, was vor seinen Augen ablief, war die Atmosphäre zum Zerreißen gespannt.
Der Länge nach hatte Anicet das Tuch bereits auf über zwei Meter ausgebreitet. Jetzt trat der Kardinal an das andere Ende, und gemeinsam mit dem Großmeister schlug er das doppelt gefaltete Leinen auseinander.
»Das ist der Anfang vom Ende«, triumphierte Anicet. Bis zu diesem Augenblick hatte sich der Großmeister in seiner Gewalt gehabt und kühl und emotionslos gehandelt. Nun aber, im Anblick des ausgebreiteten Tuches, rang er nach Luft, und er wiederholte ein ums andere Mal: »Der Anfang vom Ende.«
Die Männer um ihn herum blickten skeptisch, manche zeigten Anzeichen von Verwirrung. Ein kleiner, glatzköpfiger Mensch mit hochrotem Kopf klammerte sich an seinen Nebenmann und verbarg das Gesicht an dessen Brust, als könnte er den Anblick nicht ertragen. Ein anderer schüttelte den Kopf, als wollte er sagen: Nein, es kann nicht sein! Ein Dritter, dessen Tonsur seine mönchische Vergangenheit verriet, obwohl er statt Kutte einen dunklen Anzug trug, schlug sich wie in Ekstase heftig gegen die Brust.
Vor ihnen lag das Tuch, in welches Jesus von Nazareth nach seinem Kreuzestod eingehüllt worden war. Schattenhafte Spuren hatten auf dem Leinen den Negativ-Abdruck eines geschundenen Mannes hinterlassen. Deutlich waren Vorder- und Rückseite im Abstand von einem halben Meter zu erkennen. Und man brauchte nur lange genug auf die Stelle zu starren, wo das Gesicht gewesen sein musste, dann nahm das Bild dreidimensionale Formen an.
Der Kardinalstaatssekretär atmete schwer. In die Spannung, die der Anblick auch bei ihm hervorrief, mischte sich Wut auf Anicet und auf die Bruderschaft.
Von der Seite trat der Großmeister auf Gonzaga zu. Ohne den Blick von der kostbaren Reliquie zu wenden und als hätte er dessen Gedanken gelesen, raunte er ihm zu: »Ich kann verstehen, wenn Sie mich hassen, Herr Kardinal. Aber glauben Sie mir, es gab keine andere Möglichkeit.«
KAPITEL 5
Nach dreitägigem Aufenthalt verließ Lukas Malberg die Klinik Santa Cecilia. Dies geschah gegen den Willen der Ärzte und mit der ausdrücklichen Ermahnung, jede Anstrengung, vor allem aber jede Aufregung, zu vermeiden.
Das war leichter gesagt als getan. Auf seinem stickigen Hotelzimmer – es war um den Ferragosto – versuchte Malberg zuallererst, den Kopf klar zu bekommen. Die Mitwisserschaft am mysteriösen Tod Marlenes hatte sein Urteils- und Wahrnehmungsvermögen beeinträchtigt. Und nach Stunden des Grübelns stellte sich Malberg ernsthaft die Frage, ob er das alles wirklich erlebt, ob er nicht geträumt hatte. Nachdenklich strich er über den Einband von Marlenes Notizbuch. Das jedenfalls war kein Traum. Er musste wissen, was passiert war.
Von Zweifeln geplagt, zog er den Zettel hervor, auf dem er Marlenes Telefonnummern notiert hatte, und griff zum Telefon. Er wählte die Nummer, und zu seinem Erstaunen vernahm er das Freizeichen.
»Hallo?«
Malberg erschrak zu Tode. Er brachte keinen Ton hervor.
Eine weibliche Stimme wiederholte die Frage, diesmal energischer: »Hallo? Wer ist da?«
»Lukas Malberg«, er kam ins Stottern und fuhr fort: »Marlene, bist du’s?«
»Hier spricht die Marchesa Lorenza Falconieri. Sagten Sie Malberg? Der Antiquar aus München?«
»Ja«, erwiderte er kleinlaut und blickte verdutzt auf seinen Zettel.
»Ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen«, begann die Marchesa zögernd. »Marlene ist tot.«
»Tot«, wiederholte Malberg.
»Ja. Die Polizei weiß noch nicht, ob es ein Unfall oder Selbstmord war …«
»Ein Unfall oder Selbstmord?«, brauste Malberg auf. »Nie im Leben!«
»Man weiß es noch nicht«, wiederholte die Marchesa kühl und beherrscht. »Sie meinen, Marlene war nicht der Typ Frau, die ihrem Leben selbst ein Ende setzt? Mag sein. Vielleicht kannte ich sie nicht gut genug. Im Übrigen, wer kann schon in einen Menschen hineinsehen. Dann war es vermutlich doch ein Unfall.«
»Es war auch kein Unfall!«, polterte Malberg los. Er erschrak über seine eigenen Worte.
Die Marchesa schwieg einen Moment. »Woher wollen Sie das wissen?«, fragte sie misstrauisch.