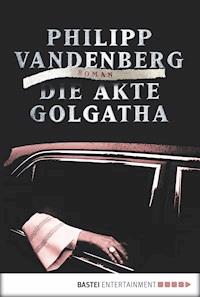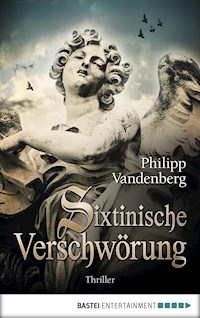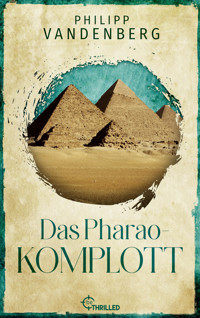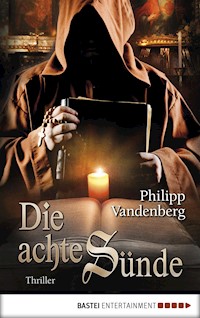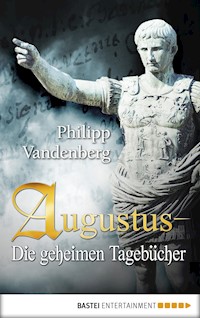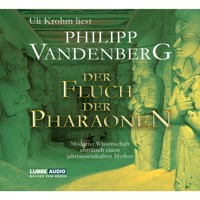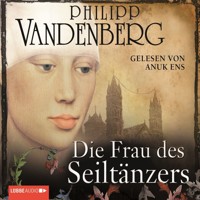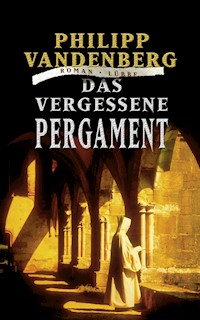9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anno 1525. Wenige Tage vor dem ewigen Gelübde flieht die Novizin Magdalena aus dem Kloster Seligenpforten. In ihrer Not schließt sie sich der Gauklertruppe des Großen Rudolfo an, des berühmtesten Seiltänzers der Welt. Von Anfang an ist sie fasziniert von dem begehrten Frauenhelden. Und sie verliebt sich in ihn. Doch der rätselhafte Rudolfo gehört einem undurchsichtigen Geheimbund an, der über die größten Mysterien der Menschheit wacht. Als Rudolfo beim Besteigen des Mainzer Doms abstürzt, glaubt Magdalena als Einzige an ein Komplott und macht sich auf eine gefährliche Spurensuche ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Epilog
Die Fakten
Anmerkungen
PHILIPP VANDENBERG
Die Fraudes Seiltänzers
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Lübbe Audio lieferbar
Originalausgabe
Copyright © 2011/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © 2011 by Philipp Vandenberg und Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin
Umschlagmotiv: © akg-images, © Portrait of a Lady, c.1460, Weyden, Rogier van der (1399–1464) National Gallery of Art, Washington DC, USA/Bridgeman, © FinePic®, München
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1017-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
PROLOG
Ich heiße Hildebrand von Aldersleben, nach einem kleinen Dorf im Fränkischen, wo ich vor beinahe 50 Jahren zur Welt kam. Manche halten mich für einen Mann von Adel, dabei bin ich nichts weiter als ein fahrender Sänger, ein Gaukler, wenn ihr wollt, und vogelfrei, und jeder Landsknecht könnte mich meucheln, ohne eine Strafe fürchten zu müssen.
Meine mir angeborene Bescheidenheit verbietet mir, mich einen Minnesänger zu nennen wie jener Reimar von Hagenau oder Neidhart von Reuenthal oder gar Oswald von Wolkenstein, der, mit nur einem Auge wie der unselige Riese Polyphem, Gedichte schrieb, die noch heute zu Tränen rühren, und Lieder komponierte, die er in Anwesenheit schöner Frauen vortrug. Jetzt ist er schon hundert Jahre tot. Er zählte zu den Größten seiner Zunft.
Ganz zu schweigen von Walther von der Vogelweide, dem Geadelten, der mit Königen und Kaisern auf Du und Du stand und mit seinem Sprechgesang und seinem Dumdideldei die Frauen verzückte. Seine Texte, da bin ich sicher, werden noch bewundert werden, wenn keinem mehr im Gedächtnis ist, wo Walther geboren und begraben wurde.
Mir, Hildebrand dem Geschichtenerzähler, wird es nicht anders ergehen. Aber das stimmt mich nicht traurig, im Gegenteil. Schließlich lebe ich nicht schlecht vom Geschichtenerzählen – von Geschichten, die ich selbst erlebt oder von anderen erfahren habe.
Das Volk giert nach Geschichten, mehr noch als nach hochtrabendem Minnesang. Nicht umsonst ist die Bibel zum Buch der Bücher geworden. Nur Pfaffen und ihre frömmlerischen Anhänger glauben, das Versprechen ewigen Lebens sei der Grund dafür. Weit gefehlt. Der Erfolg der Bibel beruht auf zahllosen Geschichten, die von Eifersucht und Brudermord, Ehebruch und Triebleben erzählen. Nicht einmal vor Zauberei macht die Bibel halt, obwohl diese vom römischen Papst als Gottlosigkeit und damit als schwerste aller Sünden verurteilt wird. Wäre mir vergönnt, dem Pontifex maximus jemals zu begegnen, würde ich ihm die schlichte Frage stellen, wie er die Fähigkeit des Herrn, über das Wasser zu wandeln, bezeichnen würde, wenn nicht als Zauberei.
Was mich betrifft, muss ich bei meinen Erzählungen auf niemanden Rücksicht nehmen. Mich kümmern weder die Gesetze der Natur noch die der Moral, denn ich erzähle Geschichten aus dem Leben. Und das Leben hat seine eigenen Gesetze. Gesetze, die mal dem einen, mal dem anderen missfallen. Gesetze sind ohnehin so fragwürdig wie das Versprechen ewiger Glückseligkeit, wobei noch niemand den Beweis für deren Existenz erbracht hat. Ist es nicht so, dass die Bestimmung, wie etwas sein oder geschehen soll, schon jenseits eines Flusses oder Gebirges nicht mehr gilt, ja verspottet wird, weil dort ganz andere Gesetze gelten, über welche wiederum wir uns lustig machen?
Ich, Hildebrand, der Geschichtenerzähler, scheue mich nicht, Geschichten von Zauberern und Hexen zu erzählen. Selbst der Teufel, von dem manche sagen, es gebe ihn gar nicht, während andere sichtbar von ihm besessen scheinen, selbst der Teufel spielt in meinen Geschichten keine unbedeutende Rolle. Es gibt Zeitgenossen, die meinen, all das entspringe meiner Phantasie wie die Verse des größten aller Geschichtenerzähler, Homer mit Namen, dem keiner von uns das Wasser reichen kann. Darüber jedoch soll sich jeder seine eigene Meinung bilden.
Zwar will ich eingestehen, dass auch ich schon über Länder berichtet habe, die mir fremd sind wie die neu entdeckte Welt jenseits des großen Ozeans, in die ich nie im Leben meinen Fuß gesetzt habe. Aber kommt es wirklich darauf an? Wenn es mir gelingt, das Land in der Vorstellung des Einzelnen lebendig werden zu lassen, sehe ich mein Ziel erreicht. Da ist es ohne Bedeutung, ob eine Wiese im Tal mit Lichtnelken bewachsen ist oder mit fremdartigen Blumen, deren Farben noch keiner gesehen und deren Namen keiner erfahren hat. Für den Geschichtenerzähler ist von Wichtigkeit, wer sich auf dieser Wiese begegnet: der Ritter seinem Erzfeind, der Räuber dem reichen Prasser, der Jüngling seiner Geliebten, der lüsterne Mönch der schüchternen Jungfrau.
In meinem aufregenden Leben habe ich viele Menschen kennengelernt, die es verdient hätten, sich ihnen länger zu widmen. Immer wieder waren es Frauen, die meinen Weg kreuzten, denen ich sogar zum Objekt der Begierde wurde und umgekehrt. Aber die Zeit – heute hier, morgen da – erlaubte selten, mich näher mit ihnen abzugeben. Leider – stelle ich heute mit Wehmut und Bedauern fest. Aber mir ist nach einem ereignisreichen Leben auch klar geworden: Ein fahrender Geschichtenerzähler, ein Vagant und Gaukler hat es schwer mit einer Frau an seiner Seite. Ein Geschichtenerzähler lebt von der Sehnsucht des Mannes nach einer Frau. Und diese Lüsternheit, Begehrlichkeit oder Naschhaftigkeit – nennt es, wie ihr wollt – zieht sich durch alle Geschichten, die ich im Gedächtnis habe.
Zu den anrührendsten und aufregendsten zählt die folgende Geschichte. Es ist im Übrigen die einzige, welche ich zu Papier gebracht habe – eine langwierige Angelegenheit. Denn so leicht es mir fällt, meine Gedanken mit schneller, flüssiger Zunge zu formen, so schwer fällt es mir, diese stumm mit ungelenker Hand aufzuschreiben. Die Sprache wird dem Menschen in die Wiege gelegt, die Schrift muss er sich erdienen.
Verzeiht mir also, wenn ich bisweilen vulgär werde und schreibe, wie ich rede. Dahinter steckt keine Absicht. Für hochtrabende Worte ist der abtrünnige Mönch aus Wittenberg zuständig. Doch auch der versteigt sich nicht selten ins Ordinäre. Ich schreibe so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und so, wie es dem Milieu angemessen erscheint, in dem sich die Frau, von der hier die Rede ist, bewegte.
Erwartet also von mir keine Erzählungen wie Wunderblüten mit betörendem Duft. Dazu ist das Leben zu nüchtern – vor allem jenes der schönen Magdalena. Ihre Geschichte von Liebe und Leidenschaft, Glück und Leid, Tugend und Laster, Gottesfurcht und Gottlosigkeit hätte genügt, drei Leben anzufüllen; und doch ist es nur das eine, von dem ich berichten will.
1. KAPITEL
Um Mitternacht gellte die Glocke des Dormitoriums und rief die Nonnen zur Matutine, dem ersten Stundengebet des neuen Tages. Vor der Türe des lang gestreckten Schlafsaals schallte die dürre, heisere Stimme der Äbtissin: »Erhebt eure sündhaften Leiber und preiset den Herrn. Raus mit euch!«
Verschlafen murmelten die siebzig Nonnen: »Dank sei Gott!« und wälzten sich aus ihren rohen, aus knorrigem Holz gezimmerten und mit Strohsäcken ausgelegten Bettkästen. Jeweils 35 dieser Kästen standen sich an den beiden Längswänden mit den Fußenden voraus gegenüber, sodass nur ein schmaler Durchgang frei blieb. Zwischen den Betten diente rechter Hand jeweils ein Stuhl zur Aufnahme der Ordenskleidung während der Nacht.
Magdalena, der man beim Eintritt ins Kloster vor vier Jahren den Ordensnamen Laetitia gegeben hatte, schob die raue Decke beiseite und setzte sich benommen auf die Bettkante. Durch das derbe bodenlange Leinenhemd, das sie wie alle anderen bei Tag und Nacht anbehielt, schnitt das ungehobelte Bett in ihre Oberschenkel. Sie hielt einen Augenblick inne und schaute durch das unverglaste, kleine Fenster auf der gegenüberliegenden Seite. Magdalena fröstelte. Ein eiskalter, modriger Luftzug schlug ihr von der Luke entgegen. Nur im strengen Winter bei klirrender Kälte wurden die Fenster mit einem Sack Heu verschlossen.
Unter allen Kasteiungen, welche der Orden der Zisterzienserinnen den Nonnen auferlegte, war diese Magdalena zunächst am rätselhaftesten erschienen: Es wollte ihr nicht in den Kopf, warum eine vor Kälte schlotternde Nonne Gott, dem Herrn, näher sein sollte als eine warm gebettete. Das Rätsel fand jedoch schon nach wenigen Nächten im Dormitorium eine einleuchtende Erklärung, als Magdalena – sie wollte ihren Ohren nicht trauen – zu nachtschlafender Zeit ungehörige Geräusche vernahm. Ungehörig insofern, als diese zweifelsfrei als Ausdruck körperlichen Lustempfindens gedeutet werden mussten, also als klaren Verstoß gegen das Keuschheitsgelübde einer Zisterzienserin.
Schon bald war Magdalena klar geworden, dass es in einem Nonnenkloster Feindschaften, aber auch Liebschaften gab wie im normalen Leben. Was die Liebschaften betraf, waren diese so geheim wie die Geheime Offenbarung des Johannes. Der Vergleich hinkte keineswegs, immerhin bietet das eine wie das andere genügend Möglichkeiten der Interpretation.
Tatsache ist, offiziell lebten die Nonnen in ihrem Kloster Seligenpforten, in halber Höhe über dem Maintal gelegen, in Demut und Keuschheit, streng nach den Regeln des heiligen Benedikt. Insgeheim, vor allem nächtens, schien es, als ließen sie ihren Gefühlen und körperlichen Bedürfnissen freien Lauf.
Die Äbtissin von Seligenpforten, eine hochgewachsene, androgyne Frau von großer Bildung, hatte diese Vorkommnisse zum Anlass genommen, den Wallungen der Nonnen Einhalt zu gebieten. Vom Hörensagen, vielleicht aber auch aus eigener Erfahrung, glaubte sie, ein kaltes Bett sei ein probates Mittel, triebhafte Regungen zu unterdrücken. Mindestens einmal die Woche machte sie, mit einer Laterne ausgerüstet, einen Kontrollgang durch den lang gestreckten Schlafsaal, ohne sich näher zu erklären. Bislang jedoch ohne eine Entdeckung zu machen, die den Ordensregeln des heiligen Benedikt widersprach.
Dies mag seine Ursache zum einen in dem Laternenschein gehabt haben, der ihren Kontrollgang schon von Weitem ankündigte, vielleicht aber auch im Klimpern jenes Rosenkranzes, den sie unter dem schwarzen Skapulier der weißen Nonnentracht um den Leib trug. Im Dormitorium ertönte dann wie bei den Murmeltieren im Gebirge ein leiser Pfiff, und augenblicklich herrschte andächtige Ruhe.
Bisher war Magdalena von Annäherungsversuchen ihrer Mitschwestern verschont geblieben. Nicht dass sie hässlich gewesen wäre oder auf irgendeine Weise von der Natur vernachlässigt, im Gegenteil. Ihr Schöpfer hatte sie mit einem wohlgeformten Leib und mit Brüsten ausgestattet, deren Existenz nicht einmal die strenge Zisterzienserinnentracht verbergen konnte. Nein, es war wohl ihre ungewollte Unnahbarkeit, eine Vornehmheit, ja Würde, die von Magdalena trotz ihrer niederen Herkunft und der Jugendlichkeit von gerade 22 Jahren ausging.
Doch in dieser Nacht – Magdalena hatte noch den monotonen Singsang der Komplet im Kopf, welche den Tag beschloss –, in dieser Nacht hatte sie leise Schritte am Fußende ihres Bettkastens vernommen. Nichts Ungewöhnliches unter den geschilderten Umständen.
Als äußerst ungewöhnlich empfand Magdalena allerdings nur Augenblicke später die Hände, welche zärtlich ihren Leib abtasteten. Sie war wie gelähmt. Zunächst, weil sie glaubte zu träumen; dann aber, als sie in die Wirklichkeit zurückfand, weil sie nicht wusste, wie sie sich in dieser Situation verhalten sollte.
Die Berührungen, deren Verursacherin ihr in dem stockfinsteren Dormitorium verborgen blieb, erschienen ihr keineswegs unangenehm, ja, Magdalena musste sich eingestehen, dass hier etwas ablief, was sie insgeheim manchmal ersehnt hatte. Mehr als einmal hatte sie sich in ihren Wachträumen vorgestellt, wie es sein würde, wenn eines Mannes lüsterne Hände ihren jungfräulichen Leib liebkosten. Auf einmal schien alles so real, dass sie vergaß, wer sie war und wo sie sich aufhielt. Magdalena glaubte verrückt zu werden vor Lust, und sie begann erregt zu stöhnen – so, wie sie es in schlaflosen Nächten im Dormitorium vernommen hatte.
Doch als sich die fremden Hände zwischen ihre Schenkel drängten, als das Blut in ihren Adern brannte wie Feuer, als sie nicht mehr ein noch aus wusste, wie sie der Situation begegnen sollte, da schlug sie, beinahe besinnungslos, mit dem Handrücken ihrer Linken in die Dunkelheit, dass ein Klatschen zu vernehmen war. Ein unterdrückter Schrei. Dann entfernten sich leise Schritte.
So saß Magdalena also benommen auf der harten Bettkante und versuchte ihre Gedanken zu ordnen. Noch herrschte stockfinstere Nacht, und in der Nacht vermengen sich Traum und Wirklichkeit auf beklemmende Weise.
Während sie nun in ihre Kutte schlüpfte und den kahlen Kopf in die gestärkte Nonnenhaube zwängte, warf sie verschämte Blicke in den halbdunklen Schlafsaal. Magdalena fühlte alle Blicke auf sich gerichtet. Aufgelöst und verzweifelt nahm sie in der Zweierreihe Aufstellung, die sich in dem schmalen Mittelgang formierte. Schließlich setzte sich die mitternächtliche Prozession zum Kirchgang in Bewegung. Sie führte über eine schmale Treppe, die sich wie eine Schnecke nach unten wand, durch eine Öffnung zum Kreuzgang und auf der gegenüberliegenden Seite zu einer Türe mit spitzem Bogen, dem Eingang zum Chorgestühl.
Während der Matutine mit ihren ständig wiederkehrenden Gebetsformeln versuchte Magdalena krampfhaft das Geschehen der vergangenen Nacht aus ihrem Gedächtnis zu drängen. Sie war wie berauscht; aber nicht wie sonst vom Weihrauch und dem Duft brennender Kerzen, die sie in Entzücken versetzten, sondern von der Macht der Gefühle, die sie erlebt hatte.
Aber je länger sich die Sprechgesänge des ersten Morgengebetes hinzogen, desto mehr kamen Magdalena Zweifel, ob sie das Erlebte nicht doch nur erträumt, erhofft und sich eingebildet hatte. Ob Keuschheit und Jungfräulichkeit ihr nicht etwas vorgegaukelt hatten, dem sie bei ihrem Eintritt ins Kloster entsagt hatte. Ob es nicht nur eine Versuchung des Bösen war, das in vielerlei Gestalt an jeden herantritt. Selbst der Herr Jesus bildete da keine Ausnahme.
Nach dem Ende des ersten Stundengebetes machten sich die Nonnen in der gleichen Aufstellung, in der sie gekommen waren, auf den Rückweg zum Dormitorium, um ihre Schlafstätten in Ordnung zu bringen. Beinahe angeekelt betrachtete Magdalena die Stätte ihres Sündenfalls.
Nach den Ordensregeln war es verboten, vor Sonnenaufgang auch nur ein lautes Wort zu sprechen. Die Blicke, welche die Nonnen austauschten, sprachen jedoch oft Bände. Verstohlen suchte Magdalena einen dieser Blicke aufzufangen, einen Blick, der ihr einen Hinweis gab auf die Person, die für das Geschehen der vergangenen Nacht verantwortlich war. Vergeblich.
Noch bevor der Tag graute, trafen sich die Nonnen im Refektorium zur Morgensuppe. Der Speiseraum, zwei Stockwerke unter dem Dormitorium gelegen, hatte dieselben Ausmaße wie der Schlafsaal. Allerdings gab es hier größere Fenster, welche obendrein mit Butzenscheiben verglast waren. Die Tische, auf denen das Essen aufgetragen wurde, standen in langer Reihe an den Wänden zu beiden Seiten, verbunden an der oberen Schmalseite durch einen einzigen breiten Tisch, an dem für gewöhnlich die Äbtissin Platz nahm.
Ihr stand auch der einzige Stuhl in dem lang gestreckten Refektorium zu, mit einer hohen Rückenlehne, die ihre Bedeutung unterstrich, im Übrigen aber schmucklos und ohne Schnitzereien war. Die gewöhnlichen Nonnen des Klosters teilten sich jeweils zu viert eine hölzerne Sitzbank.
Obwohl schon beinahe Sommer war, wurde nie ein Fenster geöffnet. Deshalb hing noch immer die klamme Winterkälte in dem alten Gemäuer, und als der hölzerne Trog mit der Morgensuppe – ein flüssiger Brei aus Milch, Wasser und Graupen – von zwei Nonnen hereingetragen und auf einem Schemel in der Mitte des Raumes abgestellt wurde, dampfte dieser wie der träge dahinströmende Fluss im Herbstnebel.
Ungeachtet klösterlicher Unterwürfigkeit und Demut, drängten sich die Nonnen um das dampfende Gefäß, aus dem jeden zweiten Tag eine andere von ihnen die Morgensuppe mit einer hölzernen Schöpfkelle verteilte. Das Essgeschirr, eine Schale aus derbem Ton, hüteten die Nonnen wie ihren Augapfel, denn nur einmal im Jahr, an Lichtmess, wurden die dünnen Schalen erneuert. Wer seinen Teller zerbrach oder beschädigte, musste sich bis dahin mit einer Scherbe begnügen.
Es war strikt untersagt, bei der Essensverteilung viel oder wenig zu fordern. Aber zum Glück hatte der Schöpfer den Augen eine stumme Sprache verliehen, und so senkte Magdalena die Lider und deutete an, dass sie keinen Hunger verspürte. Der Gedanke an das Erlebnis der vergangenen Nacht löste bei ihr auf einmal Ekel aus vor jeder Art von Nahrungsaufnahme.
An diesem Morgen oblag es Hildegunde, die Morgensuppe auszuteilen. Beinahe ein halbes Jahrhundert klösterlicher Entsagung hatte der kleinen, dicklichen Nonne verhärmte Züge ins Gesicht gebrannt und einen boshaften Charakter verliehen. Ungeachtet der Geste Magdalenas, ja, mit einer gewissen Schadenfreude, klatschte sie eine übervolle Kelle Morgensuppe in ihr Essgeschirr, als wollte sie sagen: Hier, friss!
Doch dabei zischte sie: »Die Äbtissin will dich sprechen!«
Magdalena hielt kurz inne, blickte Hildegunde ins vertrocknete Gesicht, doch die zeigte keine Regung und wandte sich der nächsten Nonne zu. Magdalena war aufgefallen, dass die Äbtissin nicht zur Morgensuppe erschienen war. Das kam selten vor, eigentlich nur dann, wenn eine schwere Krankheit sie daran hinderte und sie das Bett hüten musste. Umso rätselhafter war es, wenn die Äbtissin sie in Abwesenheit einbestellte.
Angewidert starrte Magdalena auf die gräuliche Morgensuppe in ihrer Essschale. Und je länger sie ausharrte, desto dicker wurde die glibberige Haut, welche den Brei wie ein feuchtes Spinnennetz überzog. Magdalena ekelte sich immer mehr.
Die Nonne zu ihrer Linken, welcher der Vorgang nicht verborgen geblieben war, puffte sie mit dem Ellenbogen in die Seite, und Magdalena begann hektisch in dem Brei herumzurühren. Aber so sehr sie auch rührte, ihr Widerwillen wurde nur noch größer, und der Gedanke, sich den Brei einzuverleiben, verursachte ihr Brechreiz.
Dabei war Magdalena, was das Essen anbelangte, keineswegs heikel, wie manch andere Nonne aus feinem Adel. Die übergaben sich zur Fastenzeit reihenweise, wenn gebackene Frösche und gebratene Schnecken auf dem klösterlichen Speiseplan standen. Kaltblüter und Kriechtiere galten nicht als Fleisch und fielen deshalb nicht unter das Fastengebot.
Klösterliches Gebot war es jedoch, jede verteilte Mahlzeit aufzuessen, auch wenn sich der Magen dabei umstülpte. Unter diesem Zwang stand jetzt Magdalena.
Ihr Zögern war inzwischen auch anderen Mitschwestern aufgefallen. Der Gedanke, Magdalena könnte in der Morgensuppe Gift oder etwas Ekelerregendes entdeckt haben – was bisweilen durchaus vorkam –, ließ sie innehalten und fragend in die Runde blicken. Auf einmal saßen alle regungslos vor ihren Essschalen, und lähmende Stille breitete sich aus.
Hildegunde, von bäuerischer Herkunft und rüder Sprache, warf ihre Schöpfkelle in den Suppentrog und musterte ihre Mitschwestern von unten mit zusammengekniffenen Augen. Sie war gefürchtet wegen ihrer Unberechenbarkeit. Man wusste nie, woran man mit ihr war, und bisweilen teilte sie mit knöchernem Handrücken Schläge aus.
Plötzlich gellte ihre brüchige Stimme durch das Refektorium, dass es von den kahlen Wänden hallte:
»Sündhaftes Gesindel! Schmarotzer im Weinberg des Herrn! Ihr verdient es allesamt, ausgestoßen zu werden aus der klösterlichen Gemeinschaft. Dann könnt ihr euch vom Dreck ernähren, den die Ziegen und Schafe hinterlassen!«
Kaum hatte die dicke Nonne geendet, da stürzte Clementia, eine Elevin von vierzehn Jahren, vornüber auf den Refektoriumstisch. Aus ihrem Mund schoss ein Strahl Erbrochenes, grau wie die Morgensuppe, die sie eben zu sich genommen hatte, und bildete eine nierenförmige Lache.
Eingedenk der mahnenden Worte der Äbtissin, dass nur das Böse unkontrolliert den menschlichen Körper verlasse, stießen die Nonnen gellende Schreie aus. Als sei der Teufel hinter ihnen her, drängten sie zur Türe, rannten, so weit es ihre wallenden Gewänder zuließen, über die enge Steintreppe nach unten – die einen in die Klosterkirche zum Gebet, die anderen zum Kreuzgang ins Freie, um die kalte Morgenluft in sich aufzusaugen.
Auf diese Weise war Magdalena einem ähnlichen Schicksal wie die Elevin entgangen; denn die flüchtenden Nonnen hatten in Panik ihre Essschalen zurückgelassen – für Magdalena die Gelegenheit, unbemerkt ihre ekelige Morgensuppe in zwei der zurückgelassenen Tonschalen zu verteilen.
In Gedanken versunken, warum die Äbtissin sie zu sich zitiert hatte, begab sich Magdalena ins Erdgeschoss, wo die Herrin des Klosters gegenüber der Pforte residierte. Seit ihrer Aufnahme in den Orden hatte sie den Raum, dessen Größe und Düsternis ihr in Erinnerung geblieben war, nicht mehr betreten. Dem finsteren, stechenden Blick der verhärmten Frau war sie stets ausgewichen. In Demut hatte sie den Blick gesenkt, wenn sich ihre Wege kreuzten.
Zaghaft klopfte Magdalena an die schwere Türe aus dunklem Eichenholz und trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten. Im diffusen Licht des frühen Tages, das durch die zum Kreuzgang hin gelegenen Fenster drang, war die Äbtissin kaum zu erkennen. Sie saß vornübergebeugt und starr wie eine Statue hinter einem schmalen, überbreiten, schmucklosen Tisch: die Augen zusammengekniffen, mit schmalen Lippen und die Arme mit gefalteten Händen nach vorne gestreckt.
»Ihr habt mich rufen lassen, ehrwürdige Mutter«, sagte Magdalena nach einer Weile peinlichen Schweigens.
Mit einem Kopfnicken löste sich die Äbtissin aus ihrer Starre, und mit einer kurzen Handbewegung wies sie der Nonne einen kantigen Stuhl zu. Magdalena nahm demütig Platz. Sie fühlte Beklommenheit.
Schließlich erhob sich die Äbtissin, indem sie sich auf ihre Unterarme stützte, und dabei erblickte Magdalena ihr blaues Auge. Sie erschrak. Als die Äbtissin in drohender Haltung um ihren Tisch herumging und hinter Magdalena trat, ahnte sie nichts Gutes. Umso mehr versetzte sie das Folgende in Erstaunen: Magdalena spürte zwei Hände, die ihre Brüste zu kneten begannen. In ihrer Hilflosigkeit, wie sie der Situation begegnen sollte, ließ sie es zunächst geschehen. Doch als ihr Verstand einsetzte, und als die Äbtissin wollüstig zu grunzen begann, rief sie leise:
»Es ist nicht recht vor Gott dem Herrn!«
Doch die Alte ließ nicht von ihr ab. Mit gepresster Stimme erwiderte sie:
»Gott der Herr hat auch dich erschaffen. Es kann kein Unrecht sein, das Werk des Herrn zu berühren.«
Mit einem Satz sprang Magdalena auf, dass die Äbtissin ins Taumeln geriet und beinahe zu Boden stürzte. Den kurzen Augenblick nutzte sie zur Flucht. Auf der Treppe, die zur Kleiderkammer oben unter dem Dach führte, versperrten ihr zwei Nonnen den Weg. Die eine, mit einem Hinterteil wie ein Brauereiross und Beinen wie die Säulen in der Klosterkirche, hielt ihr Essgeschirr in der Hand. Die andere, gut einen Kopf größer als Magdalena, riss ihr, noch ehe sie sich versah, die Haube vom Kopf. Mit bloßen Händen begannen die beiden auf sie einzuschlagen.
»Wir werden dich lehren, deine Morgensuppe in unsere Schalen zu kippen!«, fauchte die Riesin und entleerte ihr Essgefäß über Magdalenas kahlem Kopf.
Magdalena schrie und spuckte, und nach verzweifelter Gegenwehr entkam sie in die Kleiderkammer. Erschöpft und verzweifelt ließ sie sich auf einer Kastentruhe nieder. Weinend vergrub sie ihr Gesicht in den Händen, und in hilfloser Wut fasste sie den Entschluss, das Kloster Seligenpforten bei der nächsten Gelegenheit, die sich böte, zu verlassen. Auf jeden Fall noch vor Ablegung ihrer Profess, die in wenigen Tagen bevorstand.
Der Gedanke versetzte sie in Panik. Das Kloster zu verlassen war leichter gedacht als getan. Wohin sollte sie fliehen? Vom Vater und Bruder, die sie vor vier Jahren hier abgeliefert hatten, weil auf dem Lehenshof für sie kein Platz war, hatte sie seit dieser Zeit nichts mehr gehört. Und sowohl ihr Vater als auch der Bruder hatten bei der Verabschiedung unmissverständlich zu erkennen gegeben, dass es ein Abschied für immer sein sollte. Weibliche Nachkommen waren auf einem Lehen unerwünscht.
Magdalena war sich nicht sicher, ob ihr Vater sie womöglich mit der Peitsche vom Hof jagen würde, wenn sie das Kloster verließ. Dennoch wollte sie die Flucht wagen.
Im Kloster hatte sie viel gelernt, sich im Lesen und Schreiben geübt und sich sogar mit Latein beschäftigt. Mit Begeisterung hatte sie sich in der Bibliothek, über die eine gelehrte Zisterzienserin Aufsicht führte, weitergebildet und sich dabei ein respektables Wissen angeeignet.
Als die Aufseherin der Kleiderkammer selig im Herrn verschieden war, hatte die Äbtissin nach einer Nachfolgerin gesucht und Magdalena, ohne Rücksicht auf ihre Eignung und Neigung, für die Aufgabe bestimmt.
Die Kleiderkammer unter dem Dachgebälk des Klosters, in die Magdalena sich geflüchtet hatte, diente der Aufbewahrung der weltlichen Kleidung, welche von den Novizinnen bei ihrem Eintritt ins Kloster abgegeben und gegen die Nonnentracht vertauscht wurde. Letztere lagen zu Dutzenden und in allen Größen in klotzigen Schränken. Die weltlichen Kleider waren in Truhen und Kästen abgelegt. In ihrer Vielzahl hätten sie der Mitgift einer Königstochter zur Ehre gereicht. Schließlich stammten nicht wenige Nonnen im Kloster Seligenpforten aus adeligem Geschlecht.
Auf der Suche nach ihrem bäuerischen Gewand, das sie bei ihrem Eintritt ins Kloster getragen, aber seitdem nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte, stieß Magdalena auf kostbare Kleider aus Samt, verbrämt mit Pelzkrägen und Knöpfen aus Elfenbein, Tücher aus Seide und fein gewebte Decken, die sie in einen wahren Rausch versetzten wie der Weihrauch beim Sanctus. Dazu trug vor allem der scharfe Duft von Lavendelblüten bei, welche, büschelweise getrocknet, Motten und anderes schädliches Getier abhalten sollten.
Als schlüpfte der Teufel aus einem der vornehmen Kleider, kam Magdalena der sündhafte Gedanke, sich auf ihrer Flucht in eines der kostbaren Gewänder zu kleiden. Im Notfall trüge sie auf diese Weise einen Wert am Leibe, den sie zu Geld machen könnte. Denn Geld für die Flucht hatte sie nicht. Zwar waren unter den Nonnen Münzen in Umlauf, doch um in den Besitz von Geld zu kommen, bedurfte es ungestümer Leidenschaft zum eigenen Geschlecht oder anderer Gefälligkeiten, denen Magdalena ablehnend gegenüberstand.
In einer Reisetruhe mit eisernen Griffen und einem verblichenen Wappen an der Vorderseite entdeckte Magdalena ein Kleid aus lindgrünem Leinen und von vornehmer Machart, wie es die Tochter eines reichen Tuchmachers oder die Frau eines Stadtherrn getragen haben mochte. Dazu passend, fand sich eine bauschige Haube, welche ihren kahl geschorenen Schädel vorteilhaft verbarg. Die Haube und das auserwählte Kleidungsstück wickelte Magdalena zu einem Bündel und legte es in die Truhe zurück in der Absicht, ihren Fluchtplan noch ein paar Tage zu überdenken und abzuwarten, bis der Regen nachließ, der seit Tagen in dunklen Wolken über dem Maintal hing. Doch traf es sich anders.
Als am nächsten Morgen die alte Hildegunde beim Verteilen der Morgensuppe sie erneut aufforderte, bei der Äbtissin vorstellig zu werden, und dabei die Augen verdrehte, als nähme sie daran Anstoß, da ahnte Magdalena nichts Gutes. Ihr Verhalten der Äbtissin gegenüber, dachte sie, würde gewiss irgendwelche Strafhandlungen nach sich ziehen, wie Kloaken reinigen oder, wenn es schlimmer kommen sollte, Dunkelhaft im Kellergeschoss ohne jede Nahrung.
Von einem Augenblick auf den anderen war deshalb ihr Entschluss gefasst. Als die Nonnen nach der Morgensuppe vom Refektorium zum Schlafsaal, zwei Stockwerke höher, emporstiegen, begab sich Magdalena in die darüber liegende Kleiderkammer, holte das gerichtete Bündel aus der Truhe und warf es im Treppenhaus aus dem Fenster. Nach Tagen hatte der Regen endlich nachgelassen, und Magdalena empfand dies als einen Wink des Himmels.
Noch bevor die Nonnen ihre Arbeit im Dormitorium verrichtet hatten, begab sie sich nach unten. Die Pforte war so früh am Morgen noch nicht besetzt, und so fiel niemandem auf, wie sie durch die kleine Pforte ins Freie schlüpfte und, sich bedächtig an der Klostermauer entlangdrückend, die Stelle aufsuchte, an der sie das Bündel aus dem Fenster geworfen hatte.
Hurtig entkleidete sie sich und tauschte ihr Nonnenkleid gegen das vornehme Gewand. Die Tracht wickelte sie zu einem Bündel. Um Zeit vor möglichen Verfolgern zu gewinnen, lief sie im Morgengrauen in Richtung des Flusses. Am Mainufer angelangt, schleuderte sie ihre alte Kleidung in das träge dahinfließende Gewässer. In einem Anflug von Melancholie betrachtete sie das flussabwärts treibende Nonnenkleid, als blickte sie auf ihr ganzes bisheriges Leben zurück. Vier Jahre hatte das strenge Gewand sie eingeengt, umklammert und an ein Leben gefesselt, dem sie zunächst keineswegs abgeneigt gewesen war. Im Laufe der Jahre hatte es sich jedoch als Trugbild, ja, als Albtraum entpuppt.
Dass sie ihr Nonnenkleid in den Fluss warf, geschah nicht ohne Hintergedanken. In einer Biegung des Flusses, von denen der Main so viele in die hügelige Landschaft zeichnete wie kein anderes Gewässer, würde die Zisterzienserinnentracht wohl angeschwemmt werden. Dies ließ die Deutung zu, die Nonne sei freiwillig aus dem Leben geschieden – Grund genug, die Suche nach ihr einzustellen.
Eine Weile schwamm das Bündel nahe dem Flussufer, bis es sich aufblähte wie der Bauch einer Wasserleiche und, von einem kühlen Luftstrom erfasst, in die Mitte des Flusses getrieben wurde, wo es nach kurzer Zeit ihren Blicken entschwand.
Aus dem Gedächtnis wusste Magdalena, dass das Lehen ihres Vaters in südöstlicher Richtung lag und dass sie mit dem Pferdewagen zwei Tage gebraucht hatten, um das Kloster zu erreichen. Zu Fuß und mit der Sonne als einziger Orientierung würde sie gewiss doppelt so lang brauchen, vorausgesetzt, sie fand den unbefestigten Fahrweg, der im Wald wenige Meilen am Lehnsgut ihres Vaters vorbeiführte. Wegweiser gab es nicht, nur hin und wieder einen Zinken an einer Buche oder flüchtig auf einen Stein gezeichnet, jene rätselhaften Hinweise der Gaukler und Zigeuner, die sonst niemand verstehen konnte. Übersät von feuchtem Laub, von dem ein modriger Geruch aufstieg, war der weiche Waldboden einem schnellen Vorankommen nicht gerade förderlich. Zudem zog der Saum des langen Kleides die Feuchtigkeit an und wurde schwerer und schwerer.
Auf einem entwurzelten Baum, der quer im Wege lag, ließ sich Magdalena zu einer kurzen Rast nieder. Den Kopf in die Hände gestützt, blickte sie abwesend ins Unterholz, und plötzlich rannen ihr dicke Tränen über die Wangen. Gefragt nach der Ursache ihrer Traurigkeit, hätte sie keine rechte Antwort gewusst. Es war wohl die Angst vor dem Ungewissen, die auf ihr lastete.
Bevor sie ihren Weg fortsetzte, hob Magdalena ihre Röcke und versuchte den handbreiten feuchten Saum ihres Gewandes auszuwringen. Dabei machte sie eine seltsame Entdeckung. Im Stoff verborgen fühlte sie ein kreisrundes, gut zwei Finger breites Etwas – ein Knopf vielleicht oder eine Gemme. Neugierig drückte Magdalena das rätselhafte Gebilde mit beiden Händen bis zu einer Stelle, an der die Saumnaht nachgab, sodass sie es herauszwirbeln konnte: Es war ein blitzender Golddukat, ein kleines Vermögen.
Wann und auf welche Weise das wertvolle Stück in den Saum des fremden Kleides gelangt sein mochte – Magdalena machte sich keine großen Gedanken und steckte es in den Saum zurück. Hoffnungsvoll setzte sie ihren Weg fort.
2. KAPITEL
Nach sieben Tagen, die bei ihr den Eindruck hinterließen, als sei sie mehrmals im Kreis gelaufen, trat Magdalena aus dem triefenden Buchenwald. Vor ihr lag ein weites Tal. Tief dahinjagende, dunkle Wolken hingen über den Wiesen. Und dort, auf halber Strecke, wo das Tal wieder zu einer Höhe anstieg, lag das mächtige Anwesen, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte. Während der vier Jahre im Kloster Seligenpforten war ihr dieser Anblick stets im Gedächtnis geblieben: das stolze Herrenhaus mit den Wirtschaftsgebäuden zu beiden Seiten.
Magdalena raffte ihre vom Regen schwer gewordenen Röcke mit beiden Händen und begann bergab zu laufen, wie sie es als Kind oft getan hatte. Mit einem Sprung setzte sie über den Bach, der das Tal in zwei ungleiche Hälften teilte. Dann hielt sie keuchend inne. Wie würden ihr Vater und Bruder reagieren, wenn sie so unerwartet auftauchte?
In Gedanken versunken, erreichte Magdalena den Hof. Die Eingangstüre war verschlossen. Magdalena klopfte einmal und noch einmal. Schließlich wurde die Türe geöffnet, und ein unbekanntes Gesicht blickte misstrauisch aus dem Türspalt.
»Ich bin Magdalena. Ist mein Vater zu Hause?«
Die Frau im Türspalt gaffte sie wortlos an. Sie war etwa im selben Alter wie Magdalena.
»Deinen Vater haben sie vor zwei Jahren zu Grabe getragen«, antwortete die Unbekannte barsch.
»Tot?« Magdalena schluckte.
»Die beiden wurden von einer umstürzenden Buche erschlagen.«
»Die beiden?«
»Vater und Sohn – Gebhard, mein Mann. Ich bin Gebhards Witwe.«
»Die Frau meines Bruders Gebhard«, murmelte Magdalena tonlos vor sich hin. Zu plötzlich stürzte die Nachricht auf sie ein. Sie fand nicht einmal Gelegenheit zu trauern.
»Ich weiß«, fuhr die fremde Frau fort, und ihre Stimme klang verhärmt, »euer Verhältnis war nicht das beste. Aber schlecht geredet hat Gebhard nie über dich. Ich dachte, du bist eine Nonne geworden und verbringst deine Tage im Kloster?«
»War ich auch bis vor wenigen Tagen. Ich bin fortgelaufen …«
»Ach, und jetzt glaubst du, bei mir Unterschlupf zu finden? Oh nein.«
»Nur für ein paar Tage, bis sich das Wetter bessert und mir klar wird, wo ich eigentlich hin will. Gott soll es dir lohnen!«
»Hör auf mit dem dummen Gerede von Gott! Wo war er denn, als mein Ehemann und mein Schwiegervater ums Leben kamen? Welch unverzeihliche Sünde habe ich begangen, dass mir das widerfahren ist? – Und jetzt verschwinde!« Krachend fiel die Haustüre ins Schloss, und Magdalena vernahm, wie der Riegel vorgeschoben wurde.
Eine Weile stand sie wie gelähmt, unfähig, das Gehörte zu begreifen. Doch dann überkam sie eine ungeheuere Traurigkeit, und ihr war, als stürzte sie in einen Abgrund. Schließlich drehte sie sich um und begann zu laufen, nur fort von hier, fort von dem Ort ihrer Kindheit, die sie in so guter Erinnerung hatte.
Magdalena überquerte den Bach und hetzte bergan, als sei eine Hundemeute hinter ihr her. Erschöpft lehnte sie sich oben am Waldrand an den glatten Stamm einer Buche und ließ sich auf die feuchte Erde gleiten. Mit angezogenen Beinen vergrub sie ihr Gesicht in beiden Armen. So ließ sie ihren Tränen freien Lauf.
Sie wusste nicht, wie lange sie in dieser Haltung und in trüben Gedanken verharrt hatte. Das Knacken von Ästen holte sie in die Gegenwart zurück. Als Magdalena aufblickte, stand eine hochgewachsene Erscheinung vor ihr, ein hünenhafter Mann mit einer Holztrage auf dem Rücken, beladen mit dürren Ästen. Magdalena rappelte sich hoch und wich ängstlich zurück. Der Holzsammler schüttelte heftig den Kopf und hob beide Hände, als wollte er sagen: Ich tue dir nichts.
Magdalena zögerte, hielt inne und nahm den Unbekannten näher in Augenschein. Schließlich trat sie auf den Mann zu und fragte zögernd:
»Bist du nicht Melchior, der Knecht?«
Der Hüne nickte stürmisch, und dabei erhellte sich sein finsteres Gesicht zu einem überschwänglichen Lachen. Die Last der hoch aufgetürmten Äste brachte seine Holztrage ins Wanken und den baumlangen Mann aus dem Gleichgewicht. Er stürzte rücklings ins Gras. Und als er so dalag, hilflos wie eine Schildkröte auf dem Rücken und glucksend vor Vergnügen, da musste auch Magdalena lachen. Sie lachte laut und herzlich. Unvermittelt kam ihr der Gedanke, dass es Jahre her war, seit sie zum letzten Mal so ausgelassen gelacht hatte.
Von einem Augenblick auf den anderen hatte sie die Erinnerung an früher eingeholt, als sie mit dem taubstummen Knecht auf den Wiesen herumtollte, mit Stöcken und Netzen bewaffnet Wiesel und Kaninchen jagte und dabei meist erfolglos blieb.
»Melchior, lieber Melchior«, rief Magdalena und half dem Holzknecht auf die Beine.
Als er wieder Boden unter den Füßen hatte, faltete er theatralisch die Hände wie zum Gebet und deutete mit dem rechten Zeigefinger gen Westen.
Magdalena verstand sofort, was er sagen wollte. »Du meinst, warum ich nicht im Kloster Seligenpforten bin?«
Melchior nickte.
»Ich habe es nicht mehr ausgehalten und bin einfach fortgelaufen. Dabei hatte ich gehofft, ein paar Tage bei meinem Vater und meinem Bruder unterzukommen. Jetzt musste ich erfahren, dass beide nicht mehr am Leben sind. Und meines Bruders Witwe hat mich vom Hof gejagt.«
Magdalena unterstrich ihre Worte mit gespreizten Daumen und Zeigefingern. Ein paar wenige Begriffe der Stummensprache waren ihr im Gedächtnis geblieben.
Schließlich zupfte Melchior an Magdalenas durchnässtem Kleid, und mit wenigen Handbewegungen deutete er an, sie könne sich in dem nassen Gewand den Tod holen, sie solle ihm folgen.
»Aber die Witwe hat mich abgewiesen!«, wandte Magdalena ein.
Der Knecht machte eine wegwerfende Handbewegung, als wollte er sagen: Lass mich nur machen! Und mit einem weiteren Zeichen fügte er hinzu: Komm!
Magdalena verdrängte ihre anfänglichen Bedenken und folgte dem stummen Knecht auf die andere Seite des Baches. Es dämmerte bereits, und die Stille über dem weiten Tal veranlasste Magdalena zum Schweigen.
Vorsichtig näherten sich Melchior und Magdalena der rechter Hand vom Haupthaus gelegenen Scheune. Bevor der Knecht das hohe Holztor mit einem kräftigen Fußtritt aufstieß, gab er Magdalena ein Zeichen, sie solle draußen warten und sich ruhig verhalten. Dann verschwand er im Innern des Gebäudes.
Durch den Türspalt drang ein Schwall warmer Luft ins Freie. Er roch süßsauer wie Heu nach einem Gewitterregen. Magdalena spürte das dringende Bedürfnis, wenigstens eine Nacht im Trockenen zu verbringen. Sie fröstelte in ihrem durchnässten Gewand. Nach endlosem Warten – jedenfalls schien es ihr so – steckte Melchior den Kopf durch den Türspalt, legte den Zeigefinger auf die Lippen und gab ihr ein Zeichen, ihm zu folgen.
Der Mittelgang der Scheune, gerade so breit wie das zweiflügelige Tor, war, soweit man das in der Dunkelheit erkennen konnte, mit mehreren hochrädrigen Leiterwagen und allerlei hölzernen Gerätschaften wie Eggen und Pflügen zugestellt. Es gab kaum ein Durchkommen. Mächtige Stützbalken zu beiden Seiten trugen das Dachgebälk. Vor einem der Balken machte Melchior halt. Wie die Äste einer wohlgeratenen Tanne ragten links und rechts daumendicke Pflöcke aus dem Balken und bildeten so eine Art Sprossenleiter.
Melchior kletterte voran. Etwa in halber Höhe hielt er inne und blickte nach unten. Dabei gab er einen gurgelnden Laut von sich. Magdalena wusste sofort, was er sagen wollte: Komm! Machs mir nach!
Als Kind war ihr kein Baum zu hoch, kein Bach zu breit und kein Teich zu tief gewesen. Angst kannte sie nicht. Aber das war lange her. Jetzt saßen ihr Schrecken und Müdigkeit von sieben Tagesmärschen in den Knochen. Einen Augenblick zögerte sie, trug sich mit dem Gedanken fortzulaufen. Aber dann kam ihr die klamme Kälte in den Sinn und das feuchte Moos, das sie in der Nacht im Freien erwartete, und sie setzte den Fuß auf die erste Sprosse. Aus Kindertagen wusste sie, dass man beim Äpfelpflücken nie nach unten blicken darf, und so hangelte sie sich, bedächtig dem Holzknecht folgend, bis zum oberen Heuboden hinauf, wo Melchior ihr die Hand entgegenstreckte.
Der Platz unter dem Dachgebälk war mit Heu ausgelegt und vermittelte den Eindruck, als hätte er schon häufiger als Nachtlager gedient. Aus einer hinteren Ecke wehte bestialischer Gestank herüber. Durch die Ritzen zwischen den Dachziegeln fiel spärliches Dämmerlicht. Melchior nickte zufrieden, dann kletterte er flink wie eine Katze nach unten und verschwand wieder.
Vom Hof her hörte man das Jaulen eines Hundes, und aus dem Stallgebäude gegenüber schallte das Muhen hungriger Kühe. Magdalena schloss die Augen. Zum ersten Mal seit ihrer Flucht aus Seligenpforten fühlte sie sich in Sicherheit. Sie musste nicht auf jedes Geräusch achten. Und während sie vor sich hindöste, wurden Erinnerungen an ihre Kindheit wach, als sie mutterseelenallein die umliegenden Wälder durchstreifte und Pilze, Beeren und Kräuter sammelte, giftige wie solche von köstlichem Duft und Geschmack. Melchior war es, der damals Gutes von Schlechtem getrennt und ihr das Wissen um die Ernte vermittelt hatte, die der Wald hergab.
Eines Tages im Spätherbst hatte plötzlich ein bärtiger Mann im heruntergekommenen Ordenskleid vor ihr gestanden, mit einem rauen Sack über der Schulter, und sie freundlich angelächelt. Sie wollte fortlaufen, aber der Blick des Mannes hatte eine lähmende Wirkung. Sie stand wie versteinert, als der Mönch ihr stumm zu verstehen gab, er sei ein Wandermönch und habe sich verlaufen. Da nahm sie ihn mit. Auch ihr Vater hatte sich von der Schweigsamkeit des Fremden einnehmen lassen.
Nach einer Weile kam Melchior zurück. Er trug einen Korb bei sich und eine flackernde Laterne. Korb und Laterne hakte er an seinem Gürtel ein und erklomm so das Versteck unter dem Dach. Die Laterne stellte er auf den Boden, sodass sie lange Schatten auf das Gebälk warf. Aus dem Korb holte er einen Kanten Brot, unter einem Fell versteckt, halb verkohlt, wie er den Knechten vorgesetzt wurde, einen duftenden Fetzen Pökelfleisch, zwei Rettiche und ein bauchiges Tongefäß mit Wasser.
Von einem Augenblick auf den anderen begann Magdalenas Magen sich bemerkbar zu machen. Von der kargen Klosterkost nicht gerade verwöhnt, hatte sie sich seit sieben Tagen von dem ernährt, was der Wald hergab, und dabei kaum Hunger verspürt. Doch nun überkam sie plötzlich ein Heißhunger. Sie riss dem Knecht Brot und Fleisch aus den Händen und verschlang es gierig wie ein wildes Tier. Als sie den größten Hunger gestillt hatte, schämte sie sich. Stumm sah sie Melchior an, als wollte sie ihn um Verzeihung bitten wegen ihrer Unbeherrschtheit. Der verstand ihre Geste und machte eine abwehrende Handbewegung mit der Rechten: Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen!
Als Melchior sah, dass Magdalena fröstelte, zog er in gebückter Haltung einen Ballen Heu nach vorne und breitete ihn vor ihr aus. Dann bedeutete er ihr, sie möge ihr Kleid ausziehen, er wolle das nasse Gewand zum Trocknen auslegen, sie könne sich mit dem Fell bedecken.
Bedenkenlos kam Magdalena seiner Aufforderung nach und entledigte sich ihrer Kleider. Melchior legte ihr das Fell um die Schultern und häufte Heu um sie auf, zum Schutz vor der Abendkühle. In ihrer Kindheit hatte sie nicht selten zur Sommerzeit im Heu Schutz gesucht vor den Nachstellungen ihres rabiaten Bruders. Nicht selten hatte sie sich dabei in Melchiors Arme geflüchtet. Melchior war der Einzige gewesen, der sie jemals in ihre Arme schloss. Und daran hatte sich bis heute nichts geändert.
Während Magdalena schweigend ihren Erinnerungen nachhing, wurden ihr die Augen schwer. Schließlich formte sie mit beiden Händen einen Ballen Heu zu einem Kissen und legte sich zum Schlafen nieder. Eigentlich wollte sie Melchior mitteilen, dass sie hundemüde war und nur ein wenig ausruhen wollte; aber dazu kam es nicht. Magdalena schlief sofort ein.
Sie wusste nicht, wie lange sie schlafend unter dem Fell zugebracht hatte, als sie ein unangenehmes Stechen in der Nase verspürte und einen peinigenden Gestank. Magdalena schlug die Augen auf.
Zunächst glaubte sie, die aufgehende Sonne schiene ihr ins Gesicht. Es dauerte endlose Sekunden, bis sie begriff, was geschehen war: Das Talglicht in der hölzernen Laterne war niedergebrannt und hatte die Laterne und dann die Dielenbretter entflammt. Jeden Augenblick konnte das Heu Feuer fangen.
Vor ihr lag Melchior wie tot. Nur leichte Zuckungen in seinem Gesicht verrieten, dass er noch am Leben war.
Magdalena warf das Fell beiseite. Nackt, wie sie war, versuchte sie den schlafenden Knecht wachzurütteln. »Melchior!«, rief sie. »Melchior, wach auf, es brennt!«
Endlich öffnete der Knecht die Augen. Und als ihm, noch schlaftrunken, klar wurde, was sich da vor seinen Augen abspielte, stieß er einen furchterregenden Schrei aus. Der Anblick der züngelnden Flammen verzerrte sein Gesicht, und sein wuchtiger Leib begann zu zittern wie ein getroffener Eber, den der Jäger soeben mit dem Speer erlegt hat. Bange Augenblicke verharrte er in dieser Haltung, doch dann sprang er plötzlich auf, packte Magdalenas Kleid, das er zum Trocknen ausgelegt hatte, und warf es nach unten. Ebenso ihre Sandalen und die linnene Haube, mit der sie ihren kahlen Schädel bedeckte.
»Und jetzt komm!«, vernahm sie Melchiors Stimme. »Komm!«
Sie wusste nicht, wie ihr geschah. Magdalena glaubte, der beißende Qualm des Feuers vernebelte ihre Sinne, weil sie Melchior sprechen hörte.
»Komm endlich!«, wiederholte Melchior ungehalten und drängte Magdalena zur Balkenleiter. Der stinkende Rauch und die immer höher züngelnden Flammen ließen Magdalena kaum Gelegenheit, sich ihrer Nacktheit zu schämen. Melchior folgte ihr. Unten angelangt, warf sich Magdalena ihr Kleid über, zog Haube und Schuhe an und sah den Knecht fragend an. Der öffnete das hintere Scheunentor einen Spalt, fasste Magdalena am Unterarm und zog sie nach draußen ins Freie.
»Ich habe Angst«, stotterte Magdalena. »Die Scheune und der ganze Hof werden abbrennen!«
Melchior tat, als hörte er ihre Worte nicht, und zog Magdalena mit sich fort.
»Komm!«, hörte sie ihn stammeln. Dann begannen beide zu laufen, immer den Bach entlang in Richtung Osten, wo ein matter Lichtschein aufkam. Einmal blieben sie kurz stehen, blickten zurück und hielten mit gepressten Lungen ihren Atem zurück. Sie lauschten in Richtung des rötlichen Scheins über den Baumwipfeln. Man hörte entferntes Hundegebell, blökende Kühe und wildes Geschrei. Melchior stieß Magdalena weiter. Von panischer Angst getrieben, man könnte sie als Brandstifter verfolgen, rannten sie, bis Magdalena stolperte und kraftlos zu Boden sank.
»Ich kann nicht mehr«, keuchte sie, »lauf du allein weiter.«
Melchior zeigte keine Reaktion. Wie abwesend blickte er zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Schließlich setzte er sich neben Magdalena ins Gras. Ohne einander anzusehen, starrten beide vor sich hin.
»Ich dachte, du hättest die Sprache wiedergefunden«, sagte Magdalena. Sie kämpfte noch immer mit dem Atem und hatte keine Antwort erwartet. Doch dann vernahm sie die hilflosen Worte:
»Das Feuer – Flammen – der schwelende Boden – wie damals …«
Magdalena sah Melchior zweifelnd und ratlos an. »Mein Gott«, sagte sie leise. Und noch einmal: »Mein Gott!«
Dann fielen beide wieder in endloses Schweigen.
Obwohl ihr tausend Fragen auf der Zunge brannten, wagte Magdalena nicht, auch nur eine davon zu stellen. Und Melchior war von dem Geschehen so überwältigt, dass es ihm den Hals zuschnürte.
Der Tag graute und vertrieb die Morgendämmerung. Schließlich erhob sich Melchior und reichte Magdalena wortlos die Hand, damit sie ihm folgte. Es mochten eine Meile oder zwei gewesen sein, die sie schweigend nebeneinander hergingen, als Melchior mit gesenktem Kopf und stockend zu reden begann. Bisweilen verhaspelte er sich, rang nach den richtigen Worten oder begann einen Satz von Neuem.
Er wolle, ließ Melchior sie wissen, nicht mehr zurück auf das Hofgut der Witwe. Gewiss würde er der Brandstiftung verdächtigt, denn seit dem Tod ihres Vaters und Bruders habe er viele Feinde gehabt. Vor allem die Witwe. Sie habe ihm mehr als einmal gedroht, ihn vom Hof zu jagen. Und wenn sie, Magdalena, wolle, werde er sie auf ihrem Weg in eine neue Zukunft begleiten und beschützen.
Magdalena schüttelte den Kopf: »Melchior, wie stellst du dir das vor? Ich habe selbst keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Als ich aus dem Kloster floh, habe ich auf die Hilfe meines Vaters gesetzt. Aber jetzt, da ich weiß, dass er tot ist, bleibt mir nur noch eine Möglichkeit: Ich will zurück nach Seligenpforten und werde wohl mein Leben hinter Klostermauern verbringen müssen.«
Dann wolle er sie eben nach Seligenpforten begleiten, erwiderte Melchior. Er selbst werde später auf einem der Flusskähne anheuern, die mainabwärts bis Mainz und dann auf dem Rhein bis nach Holland führen. Magdalena stimmte schließlich zu.
Zügigen Schrittes folgten sie dem Bachlauf, meist schweigend, durchquerten mit dem Wasserlauf lichte Laubwälder, wie sie heimisch sind in der Gegend des Steigerwaldes, und stapften über großflächige Wiesen, auf denen es weit und breit keinen Weg gab, nicht einmal einen Trampelpfad.
In das ermüdende Trotten hinein fragte Magdalena: »Wohin gehen wir eigentlich? Ich kann nicht mehr.«
»Nach Ochsenfurt«, entgegnete Melchior knapp und ohne auf Magdalenas Erschöpfung Rücksicht zu nehmen.
»Und woher weißt du, dass unser Weg nach Ochsenfurt führt?«
Mit dem Zeigefinger wies Melchior auf das fließende Gewässer: »Der Bach mündet bei Ochsenfurt in den Main. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn es dunkel wird, werden die Stadttore geschlossen. Komm!«
»Ich kann wirklich nicht mehr«, jammerte Magdalena. Der Saum ihres langen Kleides hatte sich wieder einmal auf dem feuchten Waldboden vollgesogen und erschwerte jeden Schritt. Stumm wandte Melchior sich um, reichte ihr die Hand und zog sie hinter sich her wie ein störrisches Kalb.
Endlich öffnete sich der Wald, und der Bach, der sich seit Stunden träge dahingewälzt hatte, begann gurgelnd und plätschernd dahinzufließen, als fühlte er sich seinem Ziel nahe. Mit einer Kopfbewegung wies Melchior ins Tal, als wollte er sagen: Geschafft!
Magdalena holte tief Luft. Der Anblick des Städtchens, das sich mit seinen Dächern und Tortürmen hinter einer wuchtigen Mauer versteckte, verlieh ihr neue Kraft, und sie raffte ihr Kleid und begann bergab zu rennen. Nun war sie es, die Melchior aufforderte, es ihr gleichzutun und seine Schritte zu beschleunigen.
Flussabwärts, im Westen, war die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwunden. Und die Wächter am Stadttor mahnten zur Eile, als sie die Fremden in einiger Entfernung kommen sahen. Dabei schlugen sie mit dem Schaft ihrer Hellebarden gegen das schwere Eisentor, dass der Lärm weithin zu hören war. Mit Mühe und Not schafften es Magdalena und Melchior noch in die Stadt.
Der Marktplatz von Ochsenfurt, auf dem sich in breiter Reihe stolze Fachwerkhäuser drängten, war übersät von hin und her eilenden, drängenden Menschen. Ein besonderes Ereignis versetzte die Bewohner der Stadt an diesem Abend in helle Aufregung: Eine Gauklertruppe hatte hinter dem Rathaus ihre Wagen und Zugtiere abgestellt und verkündet, nebst zahlreichen anderen Attraktionen werde der Große Rudolfo bei Einbruch der Dunkelheit auf einem Hanfseil den Turm des Oberen Tores besteigen, ohne Balancierstange und mit nichts in den Händen als je einer brennenden Fackel.
»Ich fürchte«, begann Melchior ganz unerwartet zu reden, während sie sich an den dicht gedrängt stehenden Menschen vorbeizwängten, »ich fürchte, wir müssen irgendwo im Freien übernachten. Geld haben wir beide nicht, nicht einmal kleinen Besitz, den wir versetzen könnten, um ein Wirtszimmer zu bezahlen.«
Magdalena, die hinter ihm blieb, während Melchior sich mit rudernden Armen vorwärtsdrängte, antwortete nicht, und Melchior glaubte schon, sie habe im Lärm seine Worte nicht verstanden, als sie ihn bei der Schulter fasste. Melchior drehte sich um.
Mit spitzem Finger und einem verschmitzten Lächeln zeigte Magdalena auf ein aus Eisen geschmiedetes Gitterwerk über einem Hauseingang mit einem rot bemalten Ochsen in der Mitte, Zunftzeichen des Wirts zum ›Roten Ochsen‹.
»Ich sagte doch, wir haben beide keinen Kreuzer, um eine Rechnung zu begleichen!« Melchior warf Magdalena einen strafenden Blick zu.
Doch die ließ sich nicht beirren und schob Melchior in Richtung des Eingangs vom ›Roten Ochsen‹.
»Was hast du vor?«, fragte Melchior sichtlich beunruhigt, während sie gemeinsam in die Wirtsstube traten. Der Schankraum war leer bis auf einen einsamen Zecher im hinteren Halbdunkel, der abwesend in den hölzernen Humpen vor ihm auf dem blanken Tisch starrte.
Hinter der Schänke, auf der ein Fass Wein und ein Glasballon mit Branntwein standen, tauchte im Kerzenlicht das versoffene Gesicht des Wirts auf. Der Mann, von gedrungener Gestalt, trug eine bauschige, schwarze Haube auf dem Kopf und ein Wams von gleicher Farbe, das in deutlichem Kontrast zu seiner auffallend hellen Hautfarbe stand.
»He, seid Ihr der Wirt des ›Roten Ochsen‹?«, fragte Magdalena forsch.
Und der Alte gab ebenso forsch zurück: »Das will ich meinen, junge Frau!« Er schien verunsichert, weil die Frau das Wort führte, während der kräftige Mann beinahe schüchtern im Hintergrund blieb.
»Dann habt Ihr doch wohl ein Quartier für uns, sei’s für eine Nacht oder zwei?«
»Magdalena!«, mahnte Melchior im Flüsterton. »Du weißt, was ich gesagt habe.«
»Lass gut sein«, entgegnete Magdalena, während der Wirt zuerst sie, dann Melchior von oben bis unten musterte.
»Sechs Pfennige für eine Kammer pro Nacht«, meinte der Alte schließlich, und mit zusammengekniffenen Augen fügte er hinzu: »Ihr könnt doch wohl bezahlen?«
Melchior trat von hinten an Magdalena heran und versuchte sie aus der Wirtsstube zu ziehen. Aber Magdalena riss sich los, trat einen Schritt auf den Alten zu und hob den Saum ihres langen Kleides hoch. Mit schnellen Fingern nestelte sie am Kleidersaum, bis die Naht aufplatzte, und zog eine Goldmünze hervor. Die legte sie auf die Theke. Und etwas schnippisch meinte sie: »Ist Eure Frage damit beantwortet?«
Mit großen Augen beugten sich der Alte und Melchior über die blinkende Münze: ein Florentiner Goldgulden!
»Dafür könnt Ihr bleiben, solange es Euch in meinem Haus gefällt«, entgegnete der Wirt, während Melchior Magdalena fragend ansah. »Wenn es genehm ist, wird Euch mein Weib etwas zum Essen bereiten. Ihr seid sicher hungrig von der weiten Reise. Woher kommt Ihr, wenn ich fragen darf?«
»Aus dem Sächsischen«, kam Melchior Magdalena zuvor. Er hoffte, mit dieser Lüge ihre Spuren zu verwischen. Mit einem Lächeln ließ Magdalena die Goldmünze in einer Tasche ihres Kleides verschwinden.
Wenig später, als sie bei Tisch saßen und Schweinepfoten und Blutwurst, stinkendem Käse und deftigem Brot zusprachen und Frankenwein aus tönernen Bechern tranken, meinte Melchior kleinlaut: »Warum hast du nicht gesagt, dass du ein kleines Vermögen mit dir herumträgst?«
»Was hätte das geändert?« Magdalena hob die Schultern und fuhr fort: »Ich kann noch immer nicht begreifen, wie du deine Sprache wiedergefunden hast.«
Melchior schwieg betroffen. Aber Magdalena entging nicht, dass seine Hände zitterten. Während des Essens würgte es ihn. Und wie er so dasaß, wirkte der große, kräftige Kerl scheu und schüchtern wie ein jugendlicher Scholar.
»Tut mir leid«, versuchte Magdalena die Situation zu entspannen, »ich wollte dich nicht bedrängen. Lass uns zu den Gauklern gehen. Das wird uns beide auf andere Gedanken bringen!«
Als sie aus dem ›Roten Ochsen‹ auf die Straße traten, empfingen sie der Lärm und das bunte Treiben des Pöbels, dem solche Belustigungen höchst willkommen waren. Selbst ehrbare Bürger genossen den Auftritt der Trommler, Trompeter und Marktschreier. Ein Ausrufer versuchte den anderen zu übertönen, als sei seine Attraktion das größte Spektakel, seit Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen ein Mahl für fünftausend Männer gezaubert hatte, damals, vor eineinhalbtausend Jahren.
Frauen kreischten, wenn Schweine, Hunde, Katzen und kleine Jungen im Gedränge durch ihre Beine und unter die Röcke krochen, um nach Essensresten und Abfällen zu suchen. Die lagen zuhauf auf dem Platz herum. Es stank nach Pisse, weil weder Frauen noch Männer etwas dabei fanden, an Ort und Stelle ihrem Bedürfnis nachzukommen. Wein und Branntwein, der von Marketenderinnen aus Umhängefässern für einen Pfennig kredenzt wurde, taten ihr Übriges.
Geachtete Stadtbewohner in besserer Kleidung wurden von Lakaien begleitet, die ihrer Herrschaft mit Holzstangen den Weg bahnten und dabei derbe Flüche ausstießen. Zum Unwillen der einfachen Leute, die dies lautstark mit hämischen Sprüchen auf die Pfeffersäcke beantworteten.
Wenn Gaukler die Stadt bevölkerten, herrschte eine gewisse Gesetzlosigkeit. Gaukler lebten gesetzlos, sie galten als vogelfrei, und ein Verbrechen an ihnen fand keinen Richter. An einem Abend wie diesem war alles erlaubt, ohne den strengen Arm des Gesetzes fürchten zu müssen.
Ein derartiges Spektakel hatte Magdalena noch nie erlebt. Wann auch und wo? In Kindertagen hatte sie den Hof nie verlassen, und in der klösterlichen Abgeschiedenheit war jede Art von Volksbelustigung verpönt. Gaukler machten einen großen Bogen um Klöster und Konvente, weil sie damit rechnen mussten, dass man die Hunde auf sie hetzte.
Mit großen Augen verfolgte Magdalena die Kunststücke eines gelenkigen Jongleurs, der, auf einem alten Weinfass stehend, Reifen in die Luft warf, einen nach dem anderen, und, bevor sie zu Boden fielen, auffing und abermals in die Luft schleuderte. Nicht weit entfernt hatte ein Quacksalber ein Podium aufgebaut. In halber Höhe über den Gaffern pries er in einem fremden, kaum verständlichen Dialekt Wunderelexiere, seltene Kräuter mit magischen Heilkräften und schlangenförmige verdorrte Wurzeln an. Die, so behauptete er jedenfalls mit krächzender Stimme, selbst einem Hundertjährigen die Manneskraft zurückgäben. Er war ganz in Schwarz gekleidet, und unter seinem knielangen, weiten Mantel ragten dürre Beine hervor, die in einer Strumpfhose steckten. Wenn er auf seinem Podium nach links und rechts stapfte, sah es aus, als stolzierte ein Storch über eine Flussaue. Verstärkt wurde der Eindruck durch einen Rabenschnabel vor der Nase, wie ihn die Pestärzte trugen, um zu verhindern, dass man ihnen zu nahe kam. Zur Belebung seines Geschäfts warf der Quacksalber ab und an kleine Säckchen mit getrockneten Pflanzen unter das Volk: Arnika, »den guten Beistand der Frauen«, Tausendgüldenkraut »gegen Erkältungen«, Eibisch, »der die Gicht aus den Knien zieht«, und Ehrenpreis, »der die Krätze auf der Haut vertreibt wie die Märzsonne den letzten Schnee«.
Da balgten sich die Gaffer um jedes Säckchen, das geflogen kam, und Magdalena zog Melchior mit sich fort zu einer aus Holzkisten und einem Balkengerüst errichteten Bühne. Der geschlossene rote Vorhang an einem quer gespannten Seil verbarg Geheimnisvolles und Sensationelles. Mit weiß gekalktem Gesicht und einer Spitzmütze auf dem Kopf versprach ein bunt gekleideter Ausrufer gegen Entrichtung von zwei Pfennigen einen Blick auf den Riesen von Ravenna, welcher bei Regen aus der Dachrinne trinke, sowie auf menschliche Monstren mit Riesenköpfen und auf tierische Missgeburten wie eine Kuh mit einem Leib und zwei Köpfen.
Darüber hinaus machte er neugierig auf eine Zwergin – was heißt Zwergin – es sei die Königin des Zwergenvolks, eine von der Natur mit gerade vier Fuß Körpergröße und fünfundzwanzig Pfund Lebendgewicht bedachte Menschenfrau. Jedoch, was die Schöpfung ihr an Größe versagt habe, sei ihr an Lieblichkeit und Ebenmaß zuteil geworden. Wovon Besucher des Spectaculums sich überzeugen könnten, wenn Ihre Lieblichkeit, die Zwergenkönigin, hinter dem Vorhang ihre Kleider fallen lasse. Dabei rollte der Ausrufer so sehr mit den Augen, dass diese wie reife Pflaumen aus dem weißen Gesicht hervortraten.
Im Nu bildete sich vor dem roten Vorhang eine Menschentraube. Jeder wollte vor dem anderen einen Blick auf die Wunder und Kuriositäten werfen.
Magdalena war todmüde, und Melchior vermittelte auch nicht gerade den Eindruck, als ob er gewillt sei, sich weiter ins Getümmel zu stürzen. Da zeigte Magdalena mit spitzem Finger in Richtung des Oberen Torturms. Von einem schweren Gauklerwagen, dessen Eisenräder auf dem Straßenpflaster verankert waren, führte ein Seil schräg zum obersten Fenster des Turms. An dem Seil hingen in regelmäßigem Abstand flackernde Laternen, die dem ganzen Szenario ein pittoreskes Aussehen verliehen. Im aufkommenden Abendwind tanzten sie hin und her wie Glühwürmchen in einer Juninacht.
»Ich will sehen, wie der Große Rudolfo auf dem Seil tanzt!«, rief Magdalena begeistert. Ihre Müdigkeit schien auf einmal verflogen.
Melchior war weniger begeistert. Aber dann gab er ihrem Drängen nach.
Um den Gauklerwagen, an welchem das Seil verankert war, herrschte große Aufregung. Ein stattlicher Mann in weißer Kleidung war unschwer als der Große Rudolfo zu erkennen. Er trug eine Bluse mit weiten Ärmeln, eine Kniehose aus dünnem Stoff, die seine Männlichkeit aufs Vorteilhafteste betonte. Seidenstrümpfe umspannten seine kräftigen Waden, und seine Füße steckten in weichem, weißem Schuhwerk, das keine feste Sohle zu haben schien.
Der Große Rudolfo zeigte sich ungehalten, weil das Seil, auf dem er zur Turmspitze des Oberen Tors balancieren wollte, im Abendwind schwankte wie ein Baumwipfel im Herbst. Vergeblich mühten sich ein paar Männer, das Seil straffer zu ziehen, um es neu zu verankern. Mit lautem »Hau ruck!« zogen und zerrten sie, um dem Seil mehr Spannung zu verleihen, aber es wollte nicht gelingen.
Magdalena warf Melchior einen Blick zu, als wollte sie sagen: Da fehlt ein kräftiger Mann wie du! Melchior verstand sehr wohl, was sie meinte, und noch bevor Magdalena auszusprechen wagte, was sie dachte, kam er ihr zuvor, stellte sich zu den anderen in eine Reihe und hing sich mit aller Kraft in das Seil, bis es nachgab und von Rudolfo in seiner Verankerung nachgespannt werden konnte.
Die Umstehenden klatschten anerkennend in die Hände, und der Große Rudolfo trat auf Melchior zu und bedankte sich überschwänglich. Sein italienisch klingender Name vermochte nicht seine fränkische Herkunft zu verleugnen.
»Er ist wohl der Stärkste hier in der Stadt«, meinte er lachend und schlug Melchior, der Rudolfo an Körpergröße deutlich überragte, auf die Schulter.
Melchior fühlte sich geschmeichelt. Er rang nach Worten: »Heute vielleicht«, erwiderte er schließlich. »Ich bin auf der Durchreise und nächtige im ›Roten Ochsen‹.«
»Wie dem auch sei, Fremder, du hast mir sehr geholfen. Warte hier. Vielleicht können wir nach der Vorstellung noch einen Humpen leeren.«
Melchior hob die Schultern und wollte antworten. Aber noch ehe er dazu kam, war der Große Rudolfo in seinem Gauklerwagen verschwunden.
Magdalena hatte die Szene ein paar Schritte entfernt beobachtet und die Einladung vernommen. Bei der Vorstellung, aus der Menge herauszutreten und mit dem Großen Rudolfo zu zechen, fühlte sie sich unbehaglich. Deshalb zog sie Melchior am Ärmel und raunte ihm zu: »Lass uns verschwinden. Es wäre besser, wir müssten keine Erklärungen abgeben, woher wir kommen, wohin wir gehen. Gauklern kann man nie trauen!«
»Du hast recht«, antwortete Melchior, und so drängten sie sich durch das Menschengewühl zurück zum ›Roten Ochsen‹. Der Wirt war sein einziger Gast. Er habe schon bessere Tage erlebt, bemerkte er im Hinblick auf die leere Gaststube mit sarkastischem Grinsen. Dann reichte er Melchior eine Laterne und wünschte eine gute Nacht.
Die Treppe zum obersten Stockwerk unter dem Dach ächzte bei jedem Schritt wie ein ausgedienter Leiterwagen, voll beladen mit Heu. Von den Wänden blätterte der Putz, und auch das Zimmer zur Nacht hatte schon bessere Tage erlebt. Zwei Fenster mit Butzenscheiben gingen zum Hof. Darunter stand das Bett, ein quadratischer Holzkasten zu ebener Erde mit einer Felldecke und zwei Strohsäcken, aus denen abgeknickte Strohhalme hervorragten. Neben dem Lager auf beiden Seiten ein Stuhl. Mehr gab es nicht an Einrichtung.
Melchior stellte die Laterne auf den rechten Stuhl und warf Magdalena einen Blick zu, den sie nicht deuten konnte. Was die Einrichtung einer Schlafstätte betraf, waren beide nicht gerade verwöhnt. Die Fenster hatten Scheiben aus Glas, die Strohsäcke waren trocken, und Mäuse oder Ratten schien es nicht zu geben – jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Was wollten sie mehr?
Ohne groß darüber nachzudenken, begann Magdalena sich zu entkleiden. Dass Melchior dabei zusah, störte sie nicht. Die Jahre im Kloster hatten sie abgestumpft und ihr jede Sinnlichkeit gegenüber dem anderen Geschlecht genommen. Männer übten auf sie keine Anziehungskraft aus. Ja, in Gedanken fürchtete sie sich vor dem Augenblick, wenn ein Mann ihr jemals in eindeutiger Absicht gegenüberträte. Von Melchior hatte sie, dessen war sie sich gewiss, nichts zu befürchten. Als Kind hatte sie oft zur Sommerzeit nackt mit ihm im Bach gebadet. Für beide war das die natürlichste Sache der Welt. Warum sollte das jetzt anders sein?
Beim Anblick der flackernden Laterne erinnerte sie sich plötzlich wieder an die Vorkommnisse der vergangenen Nacht. Ihre Hände begannen zu zittern. Mit Daumen und Zeigefinger, die sie zuvor mit Speichel benetzt hatte, löschte sie das Licht und legte sich auf die rechte Seite des Bettes. Melchior folgte ihr schweigend, ohne sich seiner Kleider zu entledigen, als wollte er nachts jederzeit gerüstet sein, einen Feind abzuwehren.