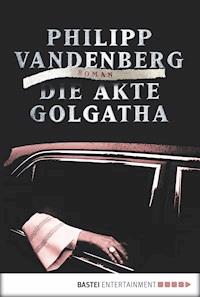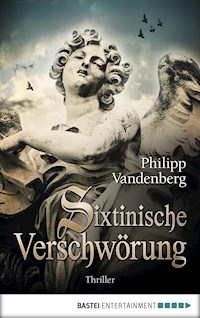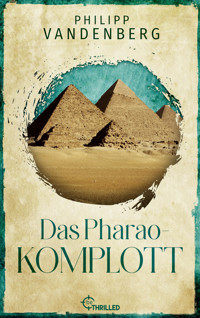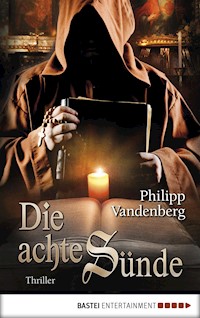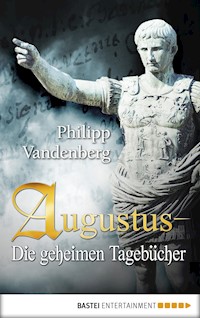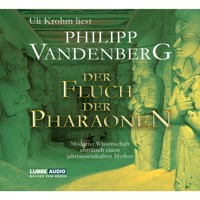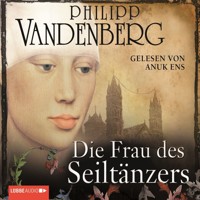4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriller von Bestseller-Autor Philipp Vandenberg
- Sprache: Deutsch
Ein Mann, besessen von einer Frau. Eine Frau, besessen von ihrer Vergangenheit. Ein Roman um das Rätsel der Wiedergeburt - vom Meister des archäologischen Thrillers.
Ägypten, 1964. Präsident Nasser lässt sein großes Prestigeobjekt, den Assuan Staudamm bauen. Parallel versuchen in Abu Simbel westliche Ingenieure und Archäologen ein wesentliches schwierigeres Unterfangen zu verwirklichen: den Tempel Ramses II. vor den Fluten des Stausees zu retten. Dazu muss das monumentale Bauwerk behutsam zerlegt und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden - eine äußerst anspruchsvolle Präzisionsarbeit voller Unwägbarkeiten. Unter den Spezialisten befindet sich auch der deutsche Ingenieur Arthur Kaminski. Während der Arbeiten entdeckt er das Grab der lange verschollenen Königin Benet-Anat. In der Hand der Mumie findet Kaminski einen grünen Skarabäus. Doch in den Skarabäus ist ein Fluch eingeritzt - und dieser Fluch reicht bis in die Gegenwart ...
»Ein archäologischer Thriller - spannend bis zur letzten Seite.« Mainpost
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Weitere Titel des Autors
Feedbackseite
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ein Mann, besessen von einer Frau. Eine Frau, besessen von ihrer Vergangenheit. Ein Roman um das Rätsel der Wiedergeburt, vom Meister des archäologischen Thrillers.
Abu Simbel – ein magisches Wort und das kühnste Unternehmen der Archäologie. Um den Tempel Ramses II. vor der Flut des Assuan-Stausees zu retten, musste er abgetragen und an anderer Stelle neu errichtet werden. Dabei stießen die Ingenieure auf ein Unheil, das seit Jahrtausenden unter der Erde schlummerte. Denn der Fluch des Pharaos, in einen grünen Skarabäus eingeritzt, wirkt bis in die heutige Zeit.
Über den Autor
Philipp Vandenberg wurde am 20. September 1941 in Breslau geboren. Er wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg bei einer Pflegemutter und im Waisenhaus auf und kam 1952 ins oberbayrische Burghausen.Er besuchte dort dasselbe Gymnasium wie Ludwig Thoma und flog, eigenem Bekunden zufolge, wie dieser von der Schule. Er kehrte »reumütig« zurück und konnte in der Folge die mangelhaften Leistungen in Griechisch sowie Mathematik durch hervorragende Leistungen in Deutsch und Kunst ausgleichen. 1963 machte er am humanistischen Gymnasium Burghausen/Salzach Abitur und studierte anschließend an der Universität München Kunstgeschichte und Germanistik (ohne Abschluss). Ein Volontariat machte Vandenberg 1965/1967 bei der Passauer Neue Presse, die ihn 1967 zum Redaktionsleiter des Burghauser Anzeigers machte.Anschließend wurde er Nachrichtenredakteur bei der Münchener Abendzeitung. 1968–1974 arbeitete er für die Illustrierte Quick. Dann war Vandenberg bis 1976 als Literaturredakteur für das Magazin Playboy beschäftigt. Seither ist er als freier Autor tätig.Vandenbergs Karriere als Sachbuchautor begann 1973, als er seinen Jahresurlaub nahm und begann, über den »Fluch des Pharao« zu recherchieren. Über den rätselhaften Tod von dreißig Archäologen veröffentlichte er das Buch »Der Fluch der Pharaonen« (1973), das ein Weltbestseller wurde. Quick hatte das Manuskript als Serie abgelehnt. Auf den Bestsellerlisten platzierten sich auch Vandenbergs weitere Publikationen wie die archäologische Biographie »Nofretete« (1975). 1977 wechselte Vandenberg seinen Verlag, blieb aber der kulturgeschichtlichen Thematik treu und war in der 80er Jahren als Autor historischer Sachbücher wie »Cäsar und Kleopatra« (1986) erfolgreich. Mitunter versuchte die Fachkritik, seine populären Sachbücher als »Archäo-Krimis« abzutun. Vandenbergs 30 Bücher, mit einer weltweiten Gesamtauflage von über 24 Millionen, erschienen bisher in 34 Sprachen übersetzt, darunter, neben allen Weltsprachen, ins Türkische, Bulgarische, Mazedonische und Rumänische.Vandenberg hat aus erster geschiedener Ehe einen Sohn Sascha (geb. 1965). Seit 1994 ist er mit Evelyn, geb. Aschenwald, verheiratet, beide leben in Baiernrain, in einem tausend Jahre alten Dorf zwischen Starnberger- und Tegernsee. Sein Hobby ist das Sammeln von Oldtimern und Phonographen.
Philipp Vandenberg
Der grüne Skarabäus
Thriller
1
Er hatte sich das alles ganz anders vorgestellt; schließlich war es nicht seine erste Auslandsbaustelle. In Indien hatte er den Oberlauf des Ganges gestaut, in Persien jene Meerwasserentsalzungsanlage errichtet, die als ein technisches Wunder galt. Kaminski hatte überhaupt nur wenige Jahre zu Hause zugebracht; er nannte das Freiheit. Wäre er in all der Zeit derselben geregelten Tätigkeit nachgegangen, jeden Tag am selben Ort, er wäre vermutlich verrückt geworden oder blöde oder alt wie ein Greis. So aber war er, trotz seiner fünfundvierzig Jahre, ein durchaus jugendlich wirkender Kerl, braun gebrannt von der Arbeit im Freien, die kurz geschnittenen Haare nach vorn gekämmt und muskulös wie ein Ringer, ein richtiger Frauentyp also, was ihm bisweilen zum Verhängnis wurde.
Nein, Abu Simbel hatte er sich ganz anders vorgestellt: Mitten in der Wüste gelegen, eine karge Oase, umgeben von Hunderten Kilometern Sand, dazwischen der Nil, träge gestaut, Holzbaracken am Ufer und unbefestigte Wege, die nach jedem Sturm von Radladern freigeräumt werden mussten, und irgendwo eine Kantine mit einem Dach aus Wellblech und roh gezimmerten Tischen und Bänken, auf denen die Männer bei Gaslicht den halben Lohn versoffen. So war es in Indien, und in Persien war es nicht anders: Auslandsbaustelle.
»Überrascht?« Lundholm, der Kaminskis staunende Blicke bemerkte, lachte. Das Casino war dicht besetzt. Es war Nacht.
Kaminski nickte: »Donnerwetter. Und das mitten in der Wüste. Donnerwetter!« wiederholte er.
Lundholm, der Schwede, hatte den Auftrag, den Neuen mit allen Einrichtungen des »Joint Venture Abu Simbel« bekannt zu machen. Er war wie Kaminski Bauingenieur, und die beiden sollten in den nächsten zweieinhalb Jahren zusammenarbeiten. Anders als Kaminski, der seine deutsche Herkunft nicht einmal während eines Sandsturmes hätte verleugnen können, sah man Lundholm den Schweden nicht an. Er war klein, eher dicklich, und sein dunkler Wuschelkopf verriet nur allzu deutlich die italienischen Vorfahren mütterlicherseits.
»Indien war schrecklich«, begann Kaminski zaghaft, »in Persien hatten wir immerhin gemauerte Unterkünfte. Dafür kämpften wir jede Nacht mit den Ratten.«
»Hier soll es Skorpione geben«, erwiderte Lundholm, und er fügte hinzu: »Aber zu Gesicht bekommen habe ich noch keinen.«
»Und Schlangen?«
Lundholm hob die Schultern. Abu Simbel war seine erste Auslandsbaustelle. Für Skanska, eine der am »Joint Venture Abu Simbel« beteiligten Firmen, hatte er bisher daheim in Schweden Brücken gebaut.
»Schlangen sind gar nicht so übel«, nahm Kaminski den Faden wieder auf, »sie halten dir das Ungeziefer vom Leibe. Alte Erfahrung.« Und als er den ungläubigen Blick des Schweden sah: »Ja, vor Schlangen kannst du dich schützen, aber gegen Ratten, Mäuse und Mungos hast du keine Chance. Die werden immer mehr.« Dann griff er nach seinem Bier, leerte das Glas bis zur Hälfte und blickte in die Runde. »Geht es hier immer so gesittet zu?«, fragte er mit einer Kopfbewegung auf die anderen Tische.
Das Lokal war voll besetzt. An den quadratischen Tischen aus Stahlrohr herrschte ein Stimmengewirr aus Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch und Arabisch. Die meisten Gäste waren Männer; aber bei näherem Hinsehen entdeckte Kaminski auch Frauen, meist nicht anders gekleidet als die Männer, in khakifarbenen Hosen und ebensolchen Hemden.
»Wart’s ab«, erwiderte Lundholm, »um neun tritt Nagla auf, dann ist hier die Hölle los.«
»Wer ist Nagla?«
»Eigentlich ist sie die Pächterin dieses Casinos. Sie kommt aus Assuan. Als bekannt wurde, dass sie in jungen Jahren als beste Bauchtänzerin Ägyptens galt, drängten sie die Männer so lange, bis sie einmal auftrat.«
»Und?«
»Nagla ist nicht mehr die Jüngste, aber ihr Nabel kann es mit jeder Zwanzigjährigen aufnehmen. Außerdem hat sie solche Dinger.« Dabei spreizte Lundholm seine Finger vor dem Oberkörper. »Seitdem tritt Nagla jede Woche einmal auf. Du wirst sie sehen.«
Das ebenerdige Casino, auch Messe oder Klub genannt, erhob sich hufeisenförmig auf einer Bergnase über dem Niltal und war nach Süden ausgerichtet. Tagsüber bot sich von hier ein atemberaubender Ausblick in Richtung Nubien. Jetzt, am Abend, blickte man wie in ein großes schwarzes Loch; es mutete eher unheimlich an.
Für gewöhnliche Arbeiter, von denen es etwa tausend gab, war das Casino tabu. Wer hier sein Bier oder seinen Whisky trank, gehörte zur europäischen Führungsmannschaft, wohnte in der nur wenige Schritte entfernten Contractor’s Colony an der Honeymoon Road oder der Souna Road und verdiente gut und gerne seine zehntausend Mark im Monat.
Zehntausend sind ein Haufen Geld, und Geld war auch der Hauptgrund, warum sich einer freiwillig meldete für so einen Job wie Abu Simbel – Geld oder irgendwelche Geschichten, die es erforderlich machten, für zwei oder drei Jahre von der Bildfläche zu verschwinden. Für Kaminski war es auch eine technische Herausforderung.
»He, Rogalla!« Lundholm winkte einem hageren, hochgewachsenen Mann zu, der in Begleitung einer jungen Frau das Casino betrat. Der Lange trug ein schlabbriges Leinensakko, das seiner Erscheinung eine gewisse Eleganz verlieh, während das Mädchen offensichtlich weniger Wert auf sein Aussehen legte. Es steckte in einem weiten, verwaschenen Overall, das lange dunkle Haar zu einem Nackenknoten gebunden; eine Hornbrille verlieh ihrem Gesicht etwas Unnahbares.
»Ich darf bekannt machen«, sagte Lundholm, nachdem die beiden an ihren Tisch getreten waren: »Arthur Kaminski von Hochtief aus Essen; er löst Mösslang ab. Und das sind Istvan Rogalla, Archäologe, und Margret Bakker, seine Assistentin.«
Kaminski schüttelte beiden die Hand, und Lundholm bemerkte sarkastisch: »Ich sag dir eins, alle Archäologen, die hier herumlaufen, sind unsere natürlichen Feinde; sie verursachen nur Ärger. Sie glauben, wir könnten unsere Arbeit verrichten, ohne die geringsten Spuren zu hinterlassen. Aber das ist nun einmal unmöglich!«
Rogalla grinste gequält, Margret Bakker verzog keine Miene.
»Wir werden uns schon vertragen«, sagte Kaminski aufmunternd.
Rogalla nickte und bestellte bei einem in ein langes, weißes Gewand gekleideten Ober Bier. »Sie auch?«, fragte er an Margret gewandt; es klang etwas gekünstelt, als ob er seine Assistentin für gewöhnlich duzte. Margret nickte.
»Ich habe ja schon vieles gemacht in meinem Leben«, begann Kaminski, um die peinliche Pause zu überbrücken, »aber das ist bestimmt die verrückteste Aufgabe: Einen Tempel in Stücke zu zerlegen und ein paar hundert Meter entfernt wieder aufzubauen!«
»Wenn es denn nur ums Zerlegen ginge«, warf Rogalla ein.
»Wie meinen Sie das?«
»Ihre Aufgabe ist deshalb so kompliziert, weil der Tempel von Abu Simbel praktisch aus einem einzigen Stück besteht. Wie Sie wissen, ist er in den Berg hineingebaut oder aus dem Berg herausgeschnitten. Und gerade das macht ihn so einmalig, und deshalb darf Abu Simbel nicht im Stausee des Nils versinken!«
»Wir gehen ein verdammt hohes Risiko ein«, bemerkte Lundholm.
»Ich weiß«, erwiderte Kaminski. »Wann ist der Flut-Termin – ich meine, wann wird der aufgestaute Nil den Damm, der um die Tempelanlage gelegt ist, überfluten?«
Lundholm machte eine abweisende Handbewegung: »Ägypter und Russen streiten noch um das Datum. Die Ägypter meinen 1967, die Russen sagen ganz konkret: am 1. September 1966. Ich vertraue den Russen mehr als den Ägyptern. Schließlich sind es die Russen, die den Staudamm bauen.«
»1. September 1966? Das sind gerade noch zwei Jahre!«
»Weniger als zwei Jahre! Und bis jetzt wurde noch kein einziger Stein abgetragen!«
Rogalla nickte.
»Und warum hat man noch nicht angefangen?«, erkundigte sich Kaminski.
»Warum, warum, warum!«, entgegnete Lundholm beinahe wütend. »Der gottverdammte Grund! Sand, Sand, Sand, und wenn wir Glück haben, eine Schicht Sandstein. Die Spundwände finden zu wenig Halt. Wir sind seit Monaten mehr damit beschäftigt, den Damm um die Tempelanlage zu verbreitern, anstatt zu erhöhen. Der Druck vom Nil her wird immer größer. Das Ding ist jetzt zwischen sechzig und hundert Meter breit.«
»Und die Höhe?«
»Oberkante Dammkrone 135 Meter SSL1. Oberkante Wasserspiegel 133 Meter SSL.«
»Das bedeutet …«
»Das bedeutet, dass gerade zwei Meter zwischen Erfolg und Misserfolg liegen, zwei lumpige Meter.«
»Und zwei Jahre.«
Lundholm nickte. Er sah nicht sehr optimistisch aus in diesem Augenblick.
Nach einer langen Pause sagte Kaminski: »Und wenn die Russen sich verrechnet haben? Ich meine, wenn der Stausee schneller ansteigt …?«
Am Nebentisch blickte Jacques Balouet, der Leiter des Informationsbüros von Abu Simbel, auf. Lundholm, Rogalla und Margret Bakker sahen sich an, als fürchteten sie, der Mann am Nebentisch könnte Kaminskis Bemerkung gehört haben, als hätte der Neue etwas Unaussprechliches von sich gegeben; denn im Camp wurde über alles geredet, nur nicht über diesen unsäglichen Termin, der wie ein Menetekel über dem »Joint Venture Abu Simbel« stand. Niemand kannte die Berechnungen, der Termin war einfach da, und sie mussten daran glauben.
»Der Teufel soll sie holen, diese Russen«, schimpfte Lundholm, »sie haben gerade drei Kosmonauten mit einem Raumschiff ins All geschossen, sie haben siebzehnmal die Erde umkreist, da werden sie sich doch nicht mit dem Nilwasser verrechnet haben!«
Rogalla hob die Hand, als wollte er etwas Wichtiges sagen: »Die Russen trifft keine Schuld, wenn hier etwas schiefläuft. Der Damm von Assuan wird seit vier Jahren gebaut. Seitdem weiß jeder, dass Abu Simbel in absehbarer Zeit im Stausee versinken wird.«
»Damals«, stimmte Lundholm dem Archäologen zu, »hatten wir hier einen Wasserstand von 120 SSL. Wir hätten uns den Schutzdamm sparen können, wenn die Ägypter eher zu einer Entscheidung gekommen wären. Als es jetzt im Frühjahr losging, da stand uns das Wasser schon bis zum Hals. Seitdem machte ich hier nichts anderes, als immer längere Spundbohlen in diesen gottverdammten Sandstein zu rammen. Angefangen habe ich mit zwölf Metern, jetzt bin ich bei vierundzwanzig – auf 370 Metern Länge – und wofür? Für nichts!«
Noch bevor der Schwede geendet hatte, schallte aus einer Lautsprecheranlage wilde arabische Musik, an der in der Hauptsache eine Flöte und dumpfes Schlagwerk beteiligt waren. Hinter der Bar, von der die Mitte des halbrunden Raumes eingenommen wurde, trat eine Frau hervor, eine Orgie von Farben. Lundholm rammte Kaminski mit dem Ellenbogen, und mit einer Wendung des Kopfes sagte er: »Nagla.«
Nagla hatte feuerrotes Haar. Kaminski, der schon vielen Frauen begegnet war, hatte noch nie so feuerrot glühendes Haar gesehen. Es bildete den rechten Kontrast zu ihrem grünen Kostüm, einem langen Rock aus glitzernder Seide, der um die Hüften gespannt und vorne offen war. Das mit Perlen und Steinen wie ein Weihnachtsbaum behängte Oberteil bändigte ihre gewaltigen Brüste nur mit Mühe.
Nagla vollführte konvulsive Bewegungen, die offenbar dem Rhythmus der Musik entsprachen; aber davon verstand Kaminski wenig. Er empfand die Musik als scheußlich, die aufreizenden Bewegungen der Tänzerin jedoch als durchaus bewundernswert. Denn Nagla verstand es, ihren Körper wie eine Schlange in Wellenbewegungen zu versetzen, an deren Ende sie jeweils den Kopf in den Nacken warf. Als sie auf die Knie sank und den Oberkörper nach hinten beugte, dass ihre roten Haare den Boden berührten, und mit weit ausgestreckten Armen in der Luft herumfuchtelte, da johlten und klatschten die Männer, und sie riefen immer wieder »Nagla – Nagla – Nagla«, als könnten sie nicht genug bekommen.
Angefeuert von den Rufen, erhob sich die Tänzerin vom Boden, ohne die Arme zu gebrauchen. Sie versetzte ihre Hüften in immer schneller werdende, zuckende Bewegungen und stampfte so, die Hände hinter dem Hals verschränkt, mit kurzen, heftigen Schritten durch die Tischreihen, unterstützt vom rhythmischen Klatschen der Gäste.
Kaminski bemerkte einige Männer, die der Tänzerin Geldscheine in die Kleidung klemmten, und bisweilen beugte sich Nagla so provozierend zu dem Spender herab, dass dieser gar nicht anders konnte und den Schein zwischen ihre Brüste steckte. Unter den Geldscheinen befanden sich kleine gefaltete Zettel, und als Lundholm Kaminskis fragenden Blick sah, flüsterte er ihm zu: »Nagla bekommt bei jedem Auftritt ein halbes Dutzend Angebote.«
»Und?«, erkundigte sich Kaminski.
Lundholm nickte, als wollte er sagen: Doch, da ist schon was zu machen.
Aufgestachelt von der schrillen Musik und den herausfordernden Bewegungen der Bauchtänzerin, begannen auch Lundholm, Rogalla und Kaminski in die Hände zu klatschen. Nur Margret saß steif da. Ohne ihr direkt einen Blick zuzuwenden, beobachtete Kaminski sie von der Seite, und er fragte sich, was wohl geschehen müsse, dass diese junge Frau sich zu einem Lächeln durchrang.
Inzwischen nahm Naglas Tanz Zeichen heftigster Erregung an. Der laszive Körper der Tänzerin zuckte immer heftiger, immer schneller. Nun näherte sie sich Kaminski. Er sah den Schweiß auf ihren Brüsten, hörte das Klirren ihrer goldenen Armbänder und ihren schweren Atem. Nagla fixierte ihn mit den Augen; wie sehr sie sich auch drehte und wand, sie ließ den Blick nicht von dem Neuen. »Hey, hey!«, riefen die Männer, die die Szene verfolgten, »hey, hey!«
Für Kaminskis Geschmack war Nagla zu füllig, ihr Körper zu provozierend. Im Übrigen hatte er, was Frauen betraf, erst einmal die Nase voll. Er hatte eigentlich erwartet, in Abu Simbel keiner einzigen Frau zu begegnen, aber er hatte sich eben alles anders vorgestellt.
Nagla schien Kaminskis Desinteresse zu bemerken, denn sie wandte sich mit einer heftigen Kopfbewegung von ihm ab und begann ihre Verführungskünste einem der Nebentische zu widmen, zum Bedauern Lundholms, der Naglas Rückzug mit gierigem Blick verfolgte.
In die aufpeitschende Musik und das heftige Klatschen mischte sich plötzlich vom Eingang her lautes Geschrei, und wie ein Lauffeuer verbreitete sich der Ruf von Tisch zu Tisch: »Wassereinbruch!«
Lundholm, dessen Blick eben noch verklärt an Nagla gehangen hatte, sprang auf. Er schob die Hände in die Hosentaschen und starrte einen Augenblick wie gelähmt vor sich hin. Dann stammelte er irgendetwas Unverständliches, blickte Kaminski ins Gesicht und zischte: »Ich habe es immer gewusst, ich hab es gewusst!« Erst jetzt schien er zu einer Handlung fähig; er zog einen Geldschein aus der Tasche, knallte ihn auf den Tisch, und während er Anstalten machte, sich umzudrehen und zu gehen, raunte er Kaminski zu: »Komm mit, du sollst sehen, wie alles absäuft!«
Im selben Augenblick ertönte draußen eine Art Nebelhorn. Die wilde Musik brach ab, und Nagla verschwand hinter der Bar. Die Männer drängten zum Ausgang. Ohne auf Kaminski zu achten, rannte Lundholm zu seinem Landrover, der an der Einfahrt zum Tennisplatz parkte. Der Neue hatte Mühe, ihm zu folgen.
Als ginge es um sein Leben, hetzte Lundholm den Geländewagen mit heulendem Motor über die Souna Road, nahm rechter Hand die Abzweigung nach Osten, eine breite, geteerte Straße, die beinahe zwei Kilometer kerzengerade auf die Landzunge von Abu Simbel zuführte. Zur Linken tauchte im Scheinwerferlicht das einsame, lang gestreckte Gebäude der Bauleitung auf. Ungeachtet der hohen Geschwindigkeit, die er dem störrischen, hart gefederten Fahrzeug abforderte, fingerte Lundholm unter dem Fahrersitz herum. Kaminskis Angebot, behilflich zu sein, ließ er unbeantwortet. Schließlich zog er eine Flasche hervor, hielt sie prüfend gegen die Windschutzscheibe und zog den Korken mit den Zähnen heraus.
»Hier!«, sagte der Schwede und reichte die Flasche seinem Beifahrer; aber noch ehe Kaminski das Angebot ablehnen konnte, trat Lundholm mit großer Heftigkeit auf die Bremse, weil von rechts ein Fahrzeug in die Kreuzung vor der Radiostation schoss. Dabei schlug die Flasche gegen den stämmigen Schalthebel auf dem Getriebetunnel und fiel auf der Beifahrerseite zu Boden, wo sich der Inhalt über den staubigen Gummiboden ergoss und teuflischen Schnapsgestank verbreitete.
»Tut mir leid«, knurrte Lundholm, als er das Fahrzeug wieder beschleunigte, »schade um das gute Zeug.«
Kaminski machte eine abwiegelnde Handbewegung, und der Schwede verlangsamte die Fahrt. Hinter der nächsten Kreuzung machte die Straße eine scharfe Kurve nach links und kletterte leicht bergan, um sich nach zwei-, dreihundert Metern in einem weiten Bogen nach Osten zu senken. Zur Linken lag im Scheinwerferlicht der kleine Lagerplatz, und von hier führte die Straße, einen großen Halbkreis beschreibend, zum Nil und zu den Tempeln hinab. Vor ihnen erkannte Kaminski in der Dunkelheit die Scheinwerfer von mindestens zehn anderen Fahrzeugen.
Auf der rechten Seite tauchte auf einmal die hell erleuchtete Baustelle auf. Riesige Scheinwerfer strahlten von der Bergkuppe in die Mulde zwischen dem aufgeschütteten Damm und der Tempelanlage. Als ginge sie das alles nichts an, blickten die zwanzig Meter hohen Ramses-Kolosse auf die Bagger, Lastwagen, Kranarme und Maschinen herab. Männer, klein wie Ameisen, rannten aufgeregt hin und her. Lundholm riss den Landrover nach rechts und kam auf einer planierten, sandigen Stelle vor dem kleinen Tempel zum Stehen.
»Komm mit!«, rief er und schlug die Tür des Fahrzeugs zu. Kaminski hastete hinterher. Es roch nach Brackwasser und geöltem Stahl. Schwere Bagger, die sich mit ihren Riesenschaufeln scheinbar planlos in den Sandboden fraßen und heftige Drehbewegungen vollführten, als tanzten sie Walzer, stießen stinkende Wolken in die Luft und ließen den Boden erzittern, als bebte die Erde.
An der tiefsten Stelle der sandigen Mulde erkannte der Neue den schwarzen Wasserspiegel eines Sees. Wie das Knochengerüst eines Riesenwals ragten in der Mitte zwei Reihen Stahlpfosten aus dem Wasser. Mannsdicke Leitungsrohre verzweigten sich wie überdimensionierte Schlagadern und führten auf verschiedenen Wegen über die Dammkrone. Dort kippte ein gewaltiger Radlader Geröll über den Erdwall. Die Steine peitschten das Wasser wie bei einer Sturmflut.
Auf der Dammkrone kam ihnen Lundholms Vorarbeiter entgegen. Er fuchtelte wild mit den Armen und zeigte auf eine bestimmte Stelle, an der er den unterirdischen Wassereinbruch vermutete. Lundholms Beherrschtheit in dieser Situation forderte Kaminski Respekt ab.
Der Schwede betrachtete beide Seiten des Dammes, stampfte mit dem Fuß auf den Sandboden, als wollte er dessen Festigkeit prüfen, und schrie gegen den Lärm der Bagger, Pumpen und Aggregate an: »Pumpen abstellen! Drittes Pumprohr legen – die Bruchstelle einschlämmen, Schotter nützt da gar nichts! Dann fluten!«
Der Vorarbeiter verstand und rief nun seinerseits irgendwelche Kommandos in sein Sprechfunkgerät, und mit einem Mal tauchten von allen Seiten Arbeiter auf, sammelten sich, nahmen ihre Aufträge entgegen und zerstreuten sich wieder. Das alles ging ohne große Aufregung vonstatten, so als könne eigentlich überhaupt nichts passieren.
Deshalb staunte Kaminski, als Lundholm, der ihn abseits stehen sah, ihm zurief: »Eine verdammt brenzlige Situation!«, und, als er seinen fragenden Blick erkannte, hinzufügte: »Wenn wir Pech haben, brauchst du gar nicht mehr in Aktion zu treten; dann ist alles vorbei – aus, Schluss!«
Kaminski trat auf Lundholm zu und fragte: »Was soll das heißen?«
Der Schwede lachte, aber in seinem Lachen lag Bitterkeit; schließlich antwortete er: »Der Wasserdruck von außen ist zu stark für den sandigen Boden. Das Wasser hat einen Weg unter der Spundwand hindurch gefunden. Alles Sandstein, verstehst du. Der wäscht sich aus wie Seife.«
»Und nun?«
Lundholm hob die Schultern. »Ich will versuchen, die Mulde zu fluten. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es ist die einzige Möglichkeit, den Druck von der unterirdischen Einbruchstelle zu nehmen. Dann dichten wir die Stelle von außen ab und pumpen den See zurück in den Nil. Wenn’s klappt!«, fügte er noch hinzu, dann sprang er auf das Trittbrett eines vorbeifahrenden Lasters, der Rohre geladen hatte, und dirigierte den Fahrer an seinen Einsatzort.
Hilflos blickte Kaminski von der Dammkrone über das eingebrochene Wasser hinüber zu den Ramses-Kolossen. Seine Aufgabe würde es sein, die Statuen, eine jede gut und gerne zwanzig Meter hoch, aus dem Fels zu schneiden, nicht im Ganzen, aber in Blöcke von zehn bis dreißig Tonnen geteilt. Und nicht nur das, es galt, den ganzen, 55 Meter tiefen Tempel aus dem Berg zu sägen und vor den steigenden Nilfluten in Sicherheit zu bringen.
Kaminski hatte alle Pläne im Gedächtnis, er kannte jede Nische und jedes Maß des Tempels; dabei hatte er ihn noch nie betreten. Abu Simbel faszinierte ihn. Aber noch bevor er seine Arbeit beginnen könnte, würde der Wasserspiegel des Stausees höher liegen als der Eingang des Tempels. Deshalb musste Lundholm mit seinen Leuten diesen gottverdammten Damm um die Tempelanlage legen. Und jetzt stellte er auf einmal alles in Frage?
In dieser Atmosphäre nervenzerreißender Spannung zerlegte Kaminski mit dem Auge des Ingenieurs die von Scheinwerfern angestrahlten Kolosse in einzelne Teile, maß die Reichweite des riesigen Derrick-Kranes, für den bis jetzt nur das Fundament planiert war, und forschte nach dem geeigneten Standplatz, auf dem die siebenachsigen Tieflader beladen werden konnten.
Der Tempel selbst war für Kaminski in erster Linie ein technisches Problem, das findige Rechner am Schreibtisch bereits gelöst hatten – vorausgesetzt, der Damm um die Baustelle würde halten.
Der Wasserspiegel im Innern stieg langsam, und Kaminski verfolgte aus der Entfernung, wie Lundholms Männer mithilfe eines Kranwagens eine Rohrleitung in das eingebrochene Wasser legten und diese mit einem fahrbaren Pumpaggregat auf der Dammkrone verbanden. Andere versuchten inzwischen, mit mehreren Trennschleifern ein Rohrloch in die Spundwand zu schneiden. Meterhohe Funken verursachten ein Feuerwerk wie zu Silvester. Zu Füßen der Kolosse nahmen zwei gewaltige Radlader Sand auf und schoben ihre Ladung mit erhobenen Schaufeln in Richtung Dammkrone, um von dort ihre Ladung ins Wasser zu kippen.
Lärmend nahm das Pumpaggregat auf dem Damm seine Arbeit auf, und wie aus einer unterirdischen Quelle brodelte braunes Nilwasser an die Oberfläche des neu gebildeten Sees. Aus der Mulde stieg fauliger Geruch und mischte sich mit den Auspuffgasen der Fahrzeuge und Maschinen.
Nilaufwärts näherte sich ein Boot, ein Lastkan mit primitivem Aufbau am Heck. Die Ladeluken in der Mitte standen offen; sie waren bis über den Rand mit Sand gefüllt. Von der Westseite wühlten sich die Raupen eines Greifbaggers über eine schräge Rampe zur Dammkrone. Der Lastkran legte an, und die Greifer des Baggers tauchten in den Laderaum, nahmen Sand auf und ließen ihn an der Einbruchstelle ins Wasser gleiten.
Im Innern des aufgeschütteten Dammes stieg der Wasserspiegel jetzt sichtbar an. Kaminski war nicht wohl bei dem Gedanken, dass Lundholm die Mulde bis dicht an die Fundamente der Tempelkolosse flutete, denn das würde die mühevoll angelegten Fahrwege und Rampen für die Tieflader zerstören. Ihre Neuanlage würde mindestens zwei Wochen in Anspruch nehmen, kostbare Zeit in Anbetracht der steigenden Flut des Stausees.
Während Kaminski seinen Gedanken nachhing, kam es in der Nähe der Pumpe zu einem lauten Wortwechsel zwischen Lundholm, Rogalla und einem langen, hageren Ägypter, den Kaminski nicht kannte. Soweit Kaminski ihre heftigen Bewegungen deuten konnte, ging es den beiden darum, den Schweden zu bewegen, das Fluten der Mulde zu beenden. Aber Lundholm beharrte darauf und ließ, kurz bevor es zu Handgreiflichkeiten kam, die beiden anderen stehen, sprang auf das Führerhaus des Baggers, drängte den Führer beiseite und schleuderte den zweien mit gekonnter Drehung eine Ladung Sand vor die Füße, dass diese fluchend davonliefen.
»Ein Verrückter!«, rief Rogalla, als er im Scheinwerferlicht Kaminski erkannte. »Der Mann ist verrückt. Sie sollten sich vor ihm in Acht nehmen.«
»Er ist aufgeregt«, versuchte Kaminski die beiden zu beschwichtigen. »Sie müssen das verstehen. Er hat die Verantwortung.«
»Verantwortung!«, polterte der Ägypter los. »Der Kerl hat vergessen, worum es hier eigentlich geht.«
Erst jetzt bemühte sich Rogalla, Kaminski mit dem Ägypter bekannt zu machen, und er erfuhr, dass der Lange Dr. Hassan Moukhtar hieß und leitender ägyptischer Archäologe war. Kaminskis erster Gedanke: Mit dem wirst du noch zu tun haben!
Moukhtar zeigte an dem Neuen wenig Interesse, so dass Kaminski sich genötigt sah, nach dem Grund ihrer Erregung zu fragen. Der Ägypter zeigte auf die Ramses-Kolosse am Tempeleingang. »Ihre Füße haben seit dreitausend Jahren kein Wasser berührt«, erklärte er. »Wir wissen nicht, wie der Sandstein reagiert, wenn das Wasser bis zum Sockel heranreicht. Kann sein, dass er trocknet wie Salz in der Sonne. Kann aber auch sein, dass das vollgesaugte Gestein eine andere Farbe annimmt. Vielleicht zerfällt es aber auch zu Sand.« Dabei klopfte er den Staub aus seiner hellen Baumwolljacke.
Rogalla nickte heftig und fügte hinzu: »Vielleicht verstehen Sie jetzt unsere Aufregung.«
»Ich verstehe«, erwiderte Kaminski; aber viel lieber hätte er geantwortet: Nein, ich verstehe Sie nicht; denn wenn die Mulde nicht geflutet wird, dann läuft sie auch voll, aber unkontrolliert. So jedenfalls besteht Hoffnung, dass der Einbruch abgedichtet ist, bevor der Wasserspiegel den Tempel erreicht hat. Doch er biss sich auf die Zunge und schwieg. Er wollte es sich nicht gleich am ersten Tag mit dem Mann verderben.
»Na dann, gute Nacht!« Moukhtar streckte Kaminski die Hand hin: »Und auf gute Zusammenarbeit!«
»Auf gute Zusammenarbeit!«, antwortete Kaminski und fügte artig hinzu: »Sir!« Er hatte gehört, dass man selbst einem gebildeten Ägypter keine größere Freude machen kann, als ihn mit »Sir« anzureden.
Auch Moukhtar zeigte sich erfreut. »Besuchen Sie mich doch morgen mal in meinem Büro«, meinte er. »Government’s Colony.« Kaminski sagte zu, er wolle kommen.
Den Blick in das große, tiefe Loch gerichtet, das sich blubbernd und brodelnd mit braunem Wasser füllte, wurde Kaminski den Eindruck nicht los, dass Abu Simbel, diese riesige Baustelle inmitten der Wüste, ihre eigenen Gesetze hatte. Gesetze, die so ganz anders waren als jene auf den Baustellen, auf denen er bisher gearbeitet hatte. Ja, es schien, als läge eine unerklärliche Spannung über dem Projekt, die sich in einer seltsamen Gereiztheit aller Beteiligten zeigte.
Schon auf dem Schiff, das ihn von Assuan nach Abu Simbel gebracht hatte, war Kaminski eine gewisse Verschlossenheit unter den Passagieren aufgefallen, wenn er die Sprache auf ihre Arbeit brachte. Gewiss, er war das eintönige Leben auf einer Auslandsbaustelle gewöhnt, und es machte ihm nichts aus, auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation zu verzichten; aber seine bisherige Erfahrung hatte Kaminski gelehrt, dass oft gerade aus dieser Situation ungewöhnliche Freundschaften erwuchsen.
Er zweifelte jedoch, ob er hier echte Freunde finden würde.
Schließlich schob er seine dumpfen Gedanken beiseite, und da er Lundholm unter den zahllosen Arbeitern nicht mehr ausmachen konnte, ging er schweigend zurück zu jener planierten Fläche, wo der Schwede seinen Landrover abgestellt hatte. Hier konnte er nichts tun. Auf Lundholm wollte er nicht warten; deshalb hielt er den nächsten Laster an, der des Weges kam, und trat so den Heimweg an.
Der Fahrer, ein junger Ägypter, der kein Wort Englisch sprach, brauchte einen halben Kilometer, um Kaminski verständlich zu machen, dass er Makar heiße, aber nur el Krim genannt werde, worauf er besonders stolz zu sein schien, denn er wiederholte den Namen immer wieder und nickte dabei dem Deutschen freundlich zu.
An der Kreuzung, wo es linker Hand zum Arbeiter-Camp ging, setzte el Krim seinen Fahrgast ab und brauste davon. Am östlichen Horizont graute der Morgen. Das Hospital zur Rechten war taghell erleuchtet, ebenso die Transformatorenstation.
Man hatte Kaminski ein Haus in der Contractor’s Colony zugewiesen, das er zusammen mit Lundholm bewohnte, ein ebenerdiges, aus Steinen gemauertes Haus mit weiß getünchtem Kuppeldach gegen die Hitze und einem Fleck grünen Rasens vor dem Eingang.
Vom Lärm der Baustelle war hier oben nichts zu hören, und selbst die Zikaden, die des Nachts ihr schrilles Gebet verrichteten, waren um diese Zeit schon verstummt. Nach hundert Metern verließ Kaminski die fest gefügte Straße und stapfte mit langen Schritten durch den Sand wie ein Mensch, der gewöhnt ist, durch Sand und Schottersteine zu stapfen, ohne müde zu werden.
Die Häuser sahen alle gleich aus, vor allem bei Nacht. Kaminski bewohnte, von der Straße gesehen, das dritte. Lundholm hatte ihn mit der Camp-Ordnung bekannt gemacht. Danach war es verpönt, die Haustüren abzuschließen. Kaminski kannte das aus Persien.
Als er die Tür öffnete, stand Balboush vor ihm; er trug eine weiße Galabija und sah aus wie ein Gespenst. Balboush war Diener, Koch und Faktotum in einem, und Kaminski und Lundholm teilten sich seine Dienste.
»Mister«, stammelte er aufgeregt, »Mister Lundholm nicht zu Hause. Mister Lundholm verschwunden.«
»Ja, ja.« Kaminski hob die Hände. »Alles in Ordnung.«
2
Der gelbe Pritschenwagen, der mit heulendem Motor über die Valley Road in Richtung Camp-Hospital jagte, zog eine lange Staubwolke hinter sich her. Ein Ägypter im blauen Overall kniete auf der Ladefläche und hielt mit beiden Händen den leblosen Körper eines Arbeiters fest. An der Trafostation, wo die Straße einen Knick machte und nach Norden geradewegs auf das Hospital zuführte, begann der Fahrer wie wild zu hupen, um auf sich aufmerksam zu machen.
Zwei weiß gekleidete Pfleger kamen ihnen mit einer Trage entgegen, als der Fahrer und sein Begleiter vor der Klinik anhielten. »Stromschlag!«, rief der Begleiter aufgeregt, und der Fahrer fügte erklärend hinzu: »Ali hat die 10000-Volt-Leitung berührt. Allah steh ihm bei!«
Zu viert verfrachteten sie den leblosen Körper auf die Trage, und im Laufschritt brachten sie ihn in das Behandlungszimmer am Ende des linken Korridors. Eine elektrische Klingel in der Mitte des Ganges, die einen Notfall verkündete, machte Höllenlärm, und im Nu waren Dr. Heckmann, der Leiter des Hospitals, und Dr. Hella Hornstein, seine Assistentin, zur Stelle.
»Strom!«, rief einer der Pfleger den Ärzten von weitem zu, »Patient ohne Bewusstsein!«
»Freimachen!«, kommandierte Heckmann. Und an seine Assistentin gewandt: »EKG anschließen!« Mit dem Stethoskop horchte er den Oberkörper des Verunglückten ab. Er schüttelte den Kopf. Schließlich zog er das Augenlid des Mannes nach oben. »Ach du lieber Gott«, sagte er leise, »Linsentrübung, Blitzstar.«
Jetzt, da der Patient unbekleidet vor ihnen lag, sah man deutlich die unregelmäßigen dunklen Streifen auf seiner Haut, die vom rechten Arm zum rechten Fuß führten.
Die Ärztin hatte inzwischen das EKG-Geräte in Betrieb gesetzt. Die Zeiger beschrieben einen unregelmäßigen Zickzackkurs ohne größere Ausschläge. Sie sah Heckmann an: »Herzkammerflimmern.«
Der Arzt warf einen Blick auf den Papierstreifen: »Sauerstoff. Künstliche Beatmung.«
Einer der Krankenpfleger reichte eine Sauerstoffmaske. Die Ärztin stülpte sie dem Patienten über Mund und Nase. Heckmann presste seine übereinandergelegten Hände ruckartig auf den Brustkorb des Patienten.
Auf einmal hielt er inne. Er blickte auf den breiten Papierstreifen, der aus dem EKG-Gerät lief. Der Ausschlag der Zeiger war kaum noch zu erkennen. Heckmann verstärkte seine Anstrengungen und stemmte sich gegen die Brust des Mannes. Die EKG-Zeiger beschrieben noch einen letzten Ausschlag; dann blieben sie stehen und zeichneten nur noch einen geraden Strich.
»Exitus«, sagte Dr. Heckmann ohne erkennbare Regung. Die Ärztin nickte stumm und begann resigniert die Elektroden von dem leblosen Körper zu entfernen. Ihr ging der Tod des ägyptischen Arbeiters sichtlich nahe.
Heckmann bemerkte ihre Niedergeschlagenheit und meinte, während sie den langen Gang entlang zu dem Zimmer gingen, das ihnen als Aufenthaltsraum diente: »Glauben Sie mir, Kollegin, es ist besser so. So schwere Stromverletzungen schädigen meist das Rückenmark und bewirken spastische Lähmungen und Atrophien. Im schlimmsten Fall kommen periphere Nervenschädigungen und Bewusstseinsstörungen hinzu. Der Mann wäre für den Rest seines Lebens ein Krüppel gewesen oder ein Idiot – oder beides. Wollen Sie mir die Freude machen und heute Abend mit mir essen?«
Hella Hornstein zuckte zusammen. Die nassforsche Art, mit der Dr. Heckmann zur Tagesordnung überging, hatte etwas Aufgesetztes.
Heckmann war kein schlechter Arzt, aber er betrachtete seine Arbeit als einen Job – oder tat zumindest so. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass sich dahinter nur persönliche Unsicherheit verbarg. Was ihn nicht hinderte, ihr bei jeder Gelegenheit nachzustellen, da er außerdem noch stolz war auf sein gutes Aussehen und sich für unwiderstehlich hielt.
»Kaffee?«, fragte die Ärztin mehr in der Hoffnung, ihn abzuwimmeln, aber er ergriff sofort die Gelegenheit: »Sehr aufmerksam, danke, gern! Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet!«
Selber schuld, dachte Hella Hornstein. Jetzt hast du ihn am Hals.
Während sie den altmodischen elektrischen Kaffeetopf in Betrieb setzte, den sie aus Deutschland mitgebracht hatte – der braune ägyptische Kaffee und seine Zubereitung waren ein Kapitel für sich –, fühlte sie, wie Heckmann, der in einem grünen Ledersessel Platz genommen hatte, sie mit den Augen verschlang. Sie tat, als bemerkte sie es nicht, aber sie war sich dessen sehr wohl bewusst.
Die junge Ärztin war weit davon entfernt, einen Mann, der sie so ansah, zu verurteilen. Sie war eine stolze junge Frau, die sich schick kleidete – soweit das in der Wüste möglich war – und die es durchaus darauf anlegte zu gefallen. Ihre kurzen schwarzen Haare und die dunkle Tönung ihrer Haut, die auffallend großen, dunklen Augen und die hervortretenden, hohen Wangenknochen verliehen ihr Rasse, die sie mit einem stets blass geschminkten Mund zu unterstreichen wusste.
Hella war klein, zierlich und schlank und trug unverschämt kurze Röcke, die kaum ihre Knie bedeckten. Vermutlich sollten sie von einem unbedeutenden körperlichen Gebrechen ablenken, das ihr bei der Geburt widerfahren war, als ihr eine Hebamme das linke Fußgelenk brach. Seither zog sie den Fuß, stets leicht nach innen gewandt, etwas nach. Und hätte ihr der angesehene Stand ihres Arztberufes nicht einen gewissen Respekt verschafft, Hella Hornstein hätte es unter den über tausend einheimischen Arbeitern in Abu Simbel gewiss ertragen müssen, dass ihr die Männer hinterherpfiffen.
Was die internationale Crew betraf, so gab sich Dr. Hornstein betont abweisend, und sie gehörte zu den Frauen, die sich das sogar leisten konnten, ohne an Attraktivität zu verlieren. Im Gegenteil, die kühle Zurückhaltung, die von ihr ausging, wirkte eher herausfordernd, und es verging kaum ein Tag, an dem sie nicht von einem der Ingenieure oder Archäologen auf der Baustelle eingeladen wurde.
Meist lehnte sie jedoch ab. Nur selten sah man sie im Casino, und es wäre unvorstellbar gewesen, dass sie etwa einen über den Durst getrunken hätte – was bei den Männern ziemlich häufig vorkam.
Die Blicke in ihrem Rücken wurden ihr, während sie den Kaffee bereitete, allmählich unerträglich, und deshalb sagte sie, ohne sich umzudrehen: »Warum starren Sie mich so an, Dr. Heckmann?«
Heckmann schrak aus seinen lüsternen Gedanken auf; er fühlte sich ertappt wie ein kleiner Schuljunge. Doch er ließ sich nichts anmerken und antwortete mit süffisanter Stimme: »Entschuldigen Sie, Frau Kollegin, Sie sind ein anatomisches Wunder, Sie können nach hinten sehen!«
»Sehen nicht, aber fühlen«, entgegnete Dr. Hornstein, ohne sich dem Gesprächspartner zuzuwenden.
Der sah keinen anderen Ausweg, als die Flucht nach vorn anzutreten, und meinte: »Also gut, ich habe Sie angestarrt, wie Sie sich auszudrücken pflegten; aber soll ich mich dafür entschuldigen? Sie sind eine äußerst attraktive Frau, Frau Kollegin; ein Mann, der es versäumte, ein Auge auf Sie zu werfen, wäre kein Mann …«
Hella fand die als Kompliment gedachte Äußerung ziemlich plump, aber sie entsprach genau seinem Niveau, das einem Mann in seiner Position in keiner Weise angemessen war. Männern wie Heckmann, diesen so genannten tollen Kerlen, begegnete Hella Hornstein eher mit Mitleid – eine Regung, die Männer am allerwenigsten ertragen.
Sie schätzte Männer, die darauf verzichteten, stark zu sein, eine ziemlich seltene Gattung. Und wenn sie ehrlich war, hatte sie bei Männern bisher immer nur an sich gedacht und ihren Egoismus ausgelebt, in mehr oder weniger abgewandelter Form. Und das war auch der Grund, warum sie trotz ihrer beinahe 27 Jahre noch keine feste Beziehung gehabt hatte.
Seit ihrem vierzehnten Lebensjahr träumte sie vom Idealbild eines Mannes, eines Mannes, den es überhaupt nicht gab, es sei denn in ihrer Fantasie. Heckmann jedenfalls war von diesem Idealbild weit entfernt; aber das wusste er nicht, und hätte er es gewusst, so hätte er es mit Sicherheit nicht geglaubt.
Natürlich hatte auch Heckmann seine Geschichte. Jeder in Abu Simbel hatte so seine Geschichte; denn freiwillig und ohne Grund verpflichtet sich kein normaler Mensch, für sechs Jahre in die Wüste zu gehen. Nein, nicht die obligatorische Weibergeschichte, die zwei Drittel aller Männer auf der Baustelle als Motiv angaben (das letzte Drittel nannte Geld als Motiv – oder beides), hatte Heckmann hierher geführt, sondern ein peinlicher Vorfall an einer westdeutschen Klinik.
Die Zeitungen hatten damals von einem ärztlichen Kunstfehler gesprochen, aber es war eher ein Versehen gewesen, und er hatte sich moralisch in keiner Weise schuldig gefühlt, und die Standesversicherung hatte der Betroffenen ein respektables Schmerzensgeld zukommen lassen, worauf die Frau ihre Anzeige zurückzog. Dennoch hatte der Fall – ein vergessener Tupfer im Bauch der Patientin – so viel Aufsehen erregt, dass es ihm ratsam erschienen war, seinen Dienst zu quittieren, um Gras über die Sache wachsen zu lassen.
Niemand in Abu Simbel wusste von dieser Geschichte, und niemand würde je davon erfahren. Befragt nach dem Grund seiner Entscheidung, das Camp-Hospital zu übernehmen, hatte Heckmann stets Abenteuerlust als Motiv genannt, und das klang durchaus glaubhaft.
Obwohl sie nur ein paar Meter entfernt von ihm herumhantierte, hatte sich zwischen George Heckmann und Hella Hornstein eine unsichtbare Kluft gebildet. Er wagte nicht, ihr seine Leidenschaft zu gestehen, und sie hielt es für angebracht, ihm deutlich zu machen, dass sie nicht füreinander geschaffen waren.
Als sie sich endlich umdrehte und zwei Tassen, die sie soeben flüchtig gesäubert hatte, neben Heckmann auf den Tisch stellte, da erschrak er beinahe über das eiskalte Funkeln in ihrem Blick.
»Wir könnten glänzend miteinander auskommen«, sagte Hella mit einem gezwungenen Lächeln, »wenn Sie mich als das akzeptierten, wofür ich hier engagiert worden bin. Beischlaf mit Vorgesetzten ist in meinem Vertrag mit keinem Wort erwähnt, und ich bin sicher, auch in Ihrem Vertrag kommt ein entsprechender Passus nicht vor.«
Die Bemerkung traf. Hellas überlegene Art, ihre Selbstbeherrschung und die Fähigkeit, jeden seiner Annäherungsversuche abzuschmettern oder ins Lächerliche zu ziehen, warf ihn, der im Umgang mit Frauen mehr als erfahren zu sein glaubte, aus der Bahn, und zum ersten Mal ertappte er sich bei dem Gedanken, dass er dieser Frau vielleicht nicht gewachsen sein könnte.
Hilflos rührte Heckmann in seiner Tasse. Er wagte nicht, Hella, die neben ihm Platz genommen hatte, ins Gesicht zu sehen. Und so schien es ihm beinahe wie eine Erlösung, als ein Pfleger an die Tür klopfte und fragte, ob Kemal, der Schmied, eintreten dürfe.
Noch ehe Heckmann etwas erwidern konnte, stand Kemal, ein Mann von dunkler Hautfarbe, glatzköpfig und von gedrungener Erscheinung, mitten im Raum. In den Armen hielt er einen aus Stroh geflochtenen Korb, den er auch nicht abstellte, als er in einer Mischung aus Arabisch und Englisch zu radebrechen begann, er habe vom Unfall des Arbeiters gehört, und er sei der Einzige zwischen Wadi Halfa und dem ersten Katarakt, der dem Bedauernswerten helfen könne.
Heckmann erhob sich und ging zwei Schritte auf Kemal zu. Er legte ihm die Hand auf den Unterarm und erklärte, der Arbeiter sei soeben an Herzstillstand gestorben; für Hilfe sei es zu spät.
Das aber wollte Kemal, der Schmied, nicht wahrhaben. Er schüttelte heftig den Kopf und vollführte mit dem Korb in der Hand tänzerische Bewegungen und rief, der Mann sei nicht tot, das elektrische Feuer habe ihn nur gelähmt, und er sei der Einzige zwischen Wadi Halfa und dem ersten Katarakt …
»Haben Sie nicht gehört, was Dr. Heckmann gesagt hat!«, unterbracht Hella Hornstein das seltsame Schauspiel. »Der Mann ist tot, und auch Sie werden ihn nicht mehr zum Leben erwecken.«
So schnell ließ Kemal sich jedoch nicht abweisen: »Nicht tot, nicht tot!«, rief er mit seiner tiefen Stimme immer wieder. »Elektrisches Feuer hat Sohn Allahs gelähmt!«
Dr. Heckmann versuchte, die Lage in den Griff zu bekommen, aber es gelang ihm nicht so recht; jedenfalls zog er sich Dr. Hornsteins Unwillen zu, als er dem Schmied die Frage stellte: »Dann erklären Sie mir doch: Wie wollen Sie den Mann aus seiner Starre erlösen?«
Der Schmied zog seine buschigen Augenbrauen hoch, dass sie einen Halbkreis beschrieben. Er war sich der Bedeutung des Augenblickes durchaus bewusst und nahm den pilzförmigen Deckel von seinem Korb.
In der Öffnung erschien der breite Kopf einer Schlange. Sie vollführte heftige, ruckartige Bewegungen und züngelte nach allen Seiten.
»Naja-naja«, sagte Kemal, und in seiner Stimme schwang ein gewisser Stolz, und während er in der Linken den Korb hielt, streckte er der Schlange die rechte Hand mit gespreizten Fingern entgegen, dass sie pendelnd in sich zusammensank und in ihrem Korb verschwand. »Naja fürchtet Kemal«, stellte er fest, »Naja macht alles, was Kemal befiehlt.«
»Und wozu haben Sie diese Naja mitgebracht?«
Kemal bekam große Augen: »Naja wird Toten zum Leben erwecken.«
»Und wie soll das geschehen?« Heckmann verschränkte die Arme vor der Brust. Die Sache begann ihn zu interessieren.
Hella bemerkte das und fauchte Heckmann an: »Sie werden sich doch nicht von so einem Scharlatan einlullen lassen!«
»Pst!« Heckmann legte seinen Zeigefinger auf die Lippen und wies mit den Augen auf den Schlangenkorb.
Aber Kemal winkte belustigt ab: »Naja taub. Alle Schlangen taub, nur gute Augen.«
»Und wie wollen Sie den Toten ins Leben zurückholen?«, wiederholte Heckmann seine Frage.
Kemal fasste in den Korb. Der Glatzkopf kannte keine Furcht. Wie ein Schlangenbeschwörer im Zirkus zog er das Reptil aus dem Korb. Er hielt das Tier unmittelbar hinter dem Kopf. Der Schlange schien das nicht zu behagen; sie hielt das Maul weit geöffnet, so dass man den tiefen rötlich weißen Schlund sehen konnte.
»Ein Biss von Naja«, sagte Kemal und drückte den Hals der Schlange mit aller Kraft zusammen, »ein Biss, und Schlangengift erweckt Tote zum Leben. Schon alte Ägypter wussten das.«
Beim Anblick der Schlange, die unter dem gnadenlosen Händedruck des Schmieds ihre Kiefer so weit aufriss, dass sie beinahe eine gerade Linie bildeten, begann Hella Hornstein hysterisch zu schreien, aber es war mehr Zorn als Angst: »Sie haben doch gehört, dass der Mann tot ist! Er ist tot, tot, verstehen Sie, da hilft auch kein Schlangengift!«
Als Kemal jedoch keine Anstalten machte zu gehen und der Ärztin die Schlange entgegenhielt, damit sie die Giftzähne betrachtete und sich von der Richtigkeit seiner Aussage überzeugte, da brüllte Hella mit einer Kraft in der Stimme, die den Arzt erschauern ließ: »Heckmann, werfen Sie den Kerl hinaus!«
Der kleine dicke Mann mit der Schlange sah Heckmann an. Sein Blick schien die Frage an ihn zu richten, ob er dem Befehl der Ärztin nachkommen müsse.
»Sie hören doch, was Dr. Hornstein gesagt hat«, wandte sich Heckmann dem Schmied zu. »Also gehen Sie. Glauben Sie mir, der Mann ist tot. Wir haben alles Menschenmögliche getan.«
Kemal warf Hella, die vor Erregung zitterte, einen bösen Blick zu. Seine dunklen Augen blitzten wie Feuer. Zornig steckte er die Schlange in den Korb zurück. Er sagte kein Wort, wandte sich um und verschwand durch die Tür, die er offen stehen ließ zum Zeichen, dass er die Ärzte verachtete.
Heckmann schloss die Tür.
»Ich glaube«, sagte er, »Sie haben seit heute in Abu Simbel einen Todfeind.«
Hella sah ihn an. »Sie glauben doch nicht etwa an solchen Humbug?«
Heckmann hob die Schultern und schob die Unterlippe nach vorn: »Die Leute erzählen sich Wunderdinge von Kemal …«
3
In Abu Simbel hatte das Fluten des Dammes zu heftigem Streit zwischen den Ingenieuren und den Archäologen geführt, die unausbleibliche Schäden an den Ramses-Kolossen befürchteten. Auf einer eilends einberufenen Katastrophensitzung, an der auch Kaminski teilnahm, gerieten sich die Kontrahenten so sehr in die Haare, dass Carl Theodor Jacobi, der leitende Baudirektor, von allen nur »Professor« genannt, den Schweden Lundholm und den Franzosen Bedeau des Raumes verwies, weil er fürchtete, die beiden würden im nächsten Augenblick gegen Dr. Moukhtar, den ägyptischen Archäologen, tätlich werden.
Lundholm und Bedeau kamen dem Befehl – denn um einen solchen handelte es sich – fluchend und wutschnaubend nach, und der Franzose, Moukhtars heftigster Kritiker, man könnte beinahe sagen, sein Todfeind, schlug die Tür hinter sich zu, dass die dünnen Wände der Bauleitung zitterten.
Als Ergebnis der mehrstündigen Diskussion kam man überein, bereits am folgenden Tag mit dem Abpumpen des gefluteten Sees zu beginnen. Der Professor, der in der Sache voll hinter Lundholm stand, wollte jedoch keine Verantwortung dafür übernehmen: denn, so argumentierte er, die Einbruchstelle bedürfe noch weiterer hundert Lastwagen-Schüttungen, erst dann könne er mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob die Abdichtung erfolgreich sei. Hundert Schüttungen seien jedoch selbst bei drei Schichten nicht an einem Tag zu bewerkstelligen. Moukhtar hingegen vertrat die altbekannte These der Archäologen, dass der Grundwasserspiegel durch das Fluten für kurze Zeit ansteige, sich kapillar einen Weg bis zu den Sockeln der Kolosse suche und dabei im Sandstein chemische Reaktionen bewirke, die zur Kristallbildung führten. Durch den Wachstumsdruck der Kristalle werde das Gestein systematisch zerstört – unwiederbringlich zerstört, wie er mit erhobenem Zeigefinger betonte.
Verwirrt von den Streitereien zwischen Technikern und Archäologen nahm Arthur Kaminski am selben Tag seine Arbeit auf, die darin bestand, die zersägten Kolosse und Tempelteile abzubauen, zu nummerieren, auf Tieflader zu verladen und vor der steigenden Nilflut in Sicherheit zu bringen, bevor dann der Wiederaufbau begann.
Das Zersägen der Tempel selbst gehörte nicht zu Kaminskis Aufgabenbereich; dafür waren spezielle Steinschneider zuständig, so genannte Marmisti, ein wilder Haufen Italiener, der sich stets laut schreiend verständigte, auch wenn dies gar nicht erforderlich war.
Das größte Problem, dem Kaminski sich gegenübersah, war die Verankerung der Träger, an denen die einzelnen Steine aufgehoben werden konnten. Die ursprüngliche Idee, die Tempelteile mit Stahlseilen hochzuhieven, trieb den Archäologen den Angstschweiß in den Nacken, weil, wie erste Versuche gezeigt hatten, Stahlseile den weichen Sandstein zerfurchten, wobei dieser bisweilen zerbarst. Nun lautete Kaminskis Auftrag, jeden einzelnen Block, noch bevor er aus dem Berg gesägt war, von oben her anzubohren und im Bohrloch unter Verwendung von Kunstharz einen Stahlhaken zu verankern, an dem der Steinklotz schließlich hochgehievt werden konnte.
Doch bevor es dazu kam, hatte Kaminski einen genauen Schnittplan zu erstellen, der auf die unterschiedlichsten Gegebenheiten Rücksicht nehmen musste. Die Archäologen bestanden auf möglichst großen Teilstücken; die Marmisti forderten möglichst kleine, weil das ihre Arbeit erleichterte. Kaminski wiederum benötigte eine Blockhöhe von mindestens anderthalb Metern, um seine Stahlträger, meist zwei im Abstand von anderthalb Metern, haltbar zu verankern. Das aber bedeutete ein hohes, oft zu hohes Gewicht.
Zwei volle Tage brauchten Kaminski sowie die Archäologen Moukhtar und Rogalla und Sergio Alinardo, der Chef der Marmisti, um allein die Schnitte an den vier Ramses-Kolossen festzulegen. Als sie am Morgen des dritten Tages wieder zusammentrafen, um ihre Arbeit fortzusetzen, kam es zum Streit zwischen Alinardo und Kaminski. Der Italiener zeigte sich auf einmal mit der Planung nicht mehr einverstanden. Die gewählten Schnitte seien zu groß. Dafür müssten aus Italien neue Sägewerkzeuge angefordert werden.
»Ja, dann fordere eben neue Werkzeuge an!«, rief Kaminski in höchster Erregung.
Alinardo hielt den Unterarm über die Augen, einerseits zum Schutz vor der Sonne, andererseits aber, um seiner Haltung etwas Drohendes zu verleihen. »Weißt du, Kerl, was das bedeutet, eh? Bis das Zeug hier ist, dauert es drei Monate!«
»Ha, drei Monate«, prustete Kaminski los, »dass ich nicht lache! In drei Monaten transportieren wir ein komplettes Kraftwerk nach China!«
»Wer wir?« schrie Alinardo zurück.
»Wir Deutschen!« gab Kaminski wütend zurück. »Da müsst ihr Italiener euch eben auf den Hosenboden setzen. Nix siesta! Laborare, laborare, verstehst du?«
Ein Hitzkopf, wie er war, wollte Sergio Alinardo das nicht auf sich sitzen lassen: »Ah, du sagst, Italiener sind faul, eh? Aber eure Dreckarbeit in Deutschland dürfen wir machen?«
Und ehe Kaminski sich versah und noch bevor Moukhtar und Rogalla eingreifen konnten, hatte Alinardo ihm einen Stoß vor die Brust versetzt, dass er zu Boden ging.
Kaminski fiel unglücklich; er schlug mit dem Hinterkopf gegen den Sockel eines Kolosses, blieb einen Augenblick reglos liegen, als habe er das Bewusstsein verloren. Aber als Rogalla ihm zu Hilfe kommen wollte, schlug er die Augen wieder auf und murmelte: »Alles in Ordnung. Geht schon.«
Alinardo drehte sich um, spuckte auf den Boden und verschwand.
Kaminski schickte ihm einen Fluch hinterher, den weder Moukhtar noch Rogalla verstanden. Als er den Hinterkopf berührte, sah er, dass seine Hand voll Blut war.
Nachdem Rogalla die Wunde in Augenschein genommen hatte, meinte er besorgt: »Sie müssen zum Arzt. Mit einer offenen Wunde ist in der Wüste nicht zu spaßen.«
Kaminski presste sein Taschentuch gegen die blutende Stelle, und Dr. Moukhtar winkte einen Lastwagen herbei und half Kaminski ins Führerhaus. Der Fahrer, ein Schwede, raste mit hoher Geschwindigkeit die staubige Schleife hinauf zum Plateau, vorbei an der Bauleitung bis zur Trafostation, wo er zum Hospital abbog.
Das Hospital, der größte Bau des ganzen Camps, ein lang gestrecktes zweistöckiges Gebäude mit zwei Quertrakten wie ein Andreaskreuz, genoss inzwischen in der ganzen Umgebung einen hervorragenden Ruf, und es kam vor, dass eine Karawane aus dem Sudan vor dem überdachten Portal haltmachte und einen todkranken Fellachen ablieferte, für dessen Genesung sie mit einem Kamel bezahlten oder bezahlen wollten; doch Heckmann weigerte sich, Naturalien als Honorar entgegenzunehmen.
Ein weiß gekleideter Sanitäter führte Kaminski in einen Verbandsraum, und kurz darauf erschien eine junge Ärztin in der Tür. Mit ihren schwarzen Haaren und der dunklen Haut hielt er sie für eine Südländerin, aber die junge Frau in weißen Hosen überraschte Kaminski mit den Worten: »Na, wo fehlt’s denn?«
Kaminski, der auf einem Drehstuhl Platz genommen hatte, blickte auf: »Sie sind Deutsche?«, erkundigte er sich und rang sich dabei ein gequältes Lächeln ab.
»Mein Name ist Hornstein, Dr. Hella Hornstein. Ich komme aus Bochum, vom dortigen Klinikum.«
Kaminski sah in die dunklen Augen der Ärztin und wollte sagen: Na ja, lange können Sie dort wohl nicht tätig gewesen sein. Für eine Ärztin war die Frau ziemlich jung; vor allem war sie eine ausnehmend schöne Erscheinung. Beinahe hätte Kaminski vergessen, warum er nach Abu Simbel gekommen war und dass er sich geschworen hatte, nie wieder eine Frau anzusehen, jedenfalls nicht in den Nächsten zwei, drei Jahren.
»Ich bin Arthur Kaminski«, meinte er etwas verlegen, »ich bin in Essen zu Hause.« Er hielt inne.
Die Worte »zu Hause«, die ihm so leicht über die Lippen gegangen waren, gab es für ihn nicht mehr. Dem Zwang gehorchend hatte er alles aufgegeben; er fühlte sich seit seinem Weggang wie ein outlaw, ein Geächteter, Gesetzloser. Das Einzige, was er noch hatte, war sein Beruf und die Aufgabe, die sich ihm hier stellte. Nein, er konnte hier nur gewinnen, verlieren konnte er nicht.
»Ich hatte einen kleinen Unfall«, versuchte er die Situation herunterzuspielen. Die Wunde schmerzte unerträglich.
Behutsam nahm die Ärztin das Taschentuch weg und betrachtete, Kaminskis Kopf haltend, die Wunde. »Haben Sie Schmerzen?«, erkundigte sich Dr. Hornstein.
»Nicht der Rede wert«, log Kaminski und verzog dabei das Gesicht. Er registrierte, dass er schon wieder den starken Mann mimte, ein Gehabe, das er vorzugsweise gegenüber Frauen an den Tag legte, die ihm gefielen. Im Augenblick genoss er die Berührung der Ärztin; er fühlte jede Einzelne ihrer Fingerkuppen auf seiner Kopfhaut.
»Die Wunde muss genäht werden«, sagte Dr. Hornstein kühl, und Kaminski schien es, als erwachte er aus einem wohligen Schlummer.
»Ach was«, protestierte er heftig, »ein bisschen Jod, und die Sache kommt wieder in Ordnung!«
Da nahm die Ärztin einen Handspiegel, gab ihm einen zweiten in die Hand und sagte, während sie ihren Spiegel an Kaminskis Hinterkopf hielt: »Hier, sehen Sie, die Wunde muss genäht werden.«
»Und wenn ich mich weigere?«, fragte Kaminski aufgebracht.
»Es ist Ihr Hinterkopf«, lachte die Ärztin, und dabei blitzten ihre Augen wie die Sonne, die sich am späten Vormittag im Nil spiegelte, »ich kann Sie nicht zwingen, aber …«
»Aber?«
»Natürlich heilt die Wunde auch so, aber Sie müssen damit rechnen, dass an der Stelle später keine Haare mehr wachsen.«
Kaminski fuhr sich mit den Fingern durch das Haar. Der in Aussicht gestellte Makel ging ihm nahe; denn auch wenn er den Frauen abgeschworen hatte, ein bisschen eitel war er doch.
»Also?«, drängte Dr. Hornstein und nahm ihm den Spiegel aus der Hand. In ihrer Stimme lag jetzt etwas Herrisches, und die Sympathie, die Kaminski ihrem Wesen soeben noch entgegengebracht hatte, schwand mit einem Mal.
»Müssen Sie mich dann hierbehalten?« erkundigte er sich zaghaft.
Die Ärztin reagierte eher belustigt: »Aber nein, was glauben Sie, wenn wir jede kleine Naht hierbehalten würden, hätten wir kein Bett mehr frei.« Sie hatte den Patienten längst durchschaut, und ohne seine Antwort abzuwarten, rief sie nach dem Pfleger und erklärte, sie werde die Wunde mit drei Stichen schließen, er möge alles vorbereiten und eine Injektion Xylocain aufziehen.
Eigensinnig weigerte sich Kaminski, auf der Liege Platz zu nehmen. Er wusste nicht warum, aber er versuchte schon wieder, Stärke zu beweisen. Dr. Hornstein schien durchaus bereit, das zu akzeptieren; sie setzte die Lokalanästhesie links hinter dem rechten Ohr, der Pfleger entfernte einen schmalen Haarsaum um die Wunde, und Kaminski döste im Sitzen vor sich hin.
Er versuchte, an andere Dinge zu denken. Die Tempelkolosse gingen ihm nicht aus dem Sinn. Sie tauchten vor seinen Augen auf wie Riesen, mit denen er einen Kampf austragen würde, unberechenbare Ungetüme, und auch wenn er es sich nicht eingestehen wollte – er hatte Angst vor seiner Aufgabe.
Schwindel erfasste ihn. Die Spritze tat ihre Wirkung. Auf seinem Rücken trat Schweiß hervor. Kaminski presste die Hände ineinander; er spannte seine Wadenmuskeln, indem er die Zehen anhob, um sich wach zu halten. Vergebens. Der geflieste Boden vor ihm begann zu wanken wie ein Schiff auf rauer See. Nur nicht schlappmachen, redete er sich ein. Er fürchtete die Blamage. Mein Gott, das wirst du doch aushalten! Aber noch während er sich auf diese Weise zuredete, sackte er, ohne es selbst zu bemerken, ganz langsam nach vorne, und er wäre zu Boden gestürzt, hätten nicht Dr. Hornstein und der Pfleger den Taumelnden im letzten Augenblick aufgefangen und zu der vorgesehenen Liege geschleppt.
Diesen kurzen Weg vom Drehstuhl zu der Liege genoss Kaminski wie in einem angenehmen Traum. Er fühlte den warmen Körper der Ärztin, die Bewegungen ihrer Arme und Schenkel; er hatte ein wohliges Gefühl. Nur aus der Ferne vernahm er die spöttischen Bemerkungen, und mit derselben Taubheit, die seinen Hinterkopf eingehüllt hatte, nahm er die Stiche in seine Haut wahr. Als er Minuten später wieder zu Bewusstsein kam, trug er einen Verband am Kopf.
4
Am selben Tag traf Carl Theodor Jacobi, der leitende Baudirektor von Abu Simbel, 280 Kilometer nilabwärts in Assuan, wohin er mit einer Boelkow 207 geflogen war, mit dem Bautenminister Ägyptens, Kamal Maher, und dem russischen Baudirektor des Staudammes, Michail Antonow, zusammen. Das Treffen fand im alten Cataract-Hotel statt, auf dem rechten felsigen Nilufer, von wo man einen atemberaubenden Blick auf die mitten im Nil gelegene Insel Elephantine hat, die den Fluss an dieser Stelle in eine schmale Rille zwingt.
Die Sitzung war seit langem anberaumt, war aber aufgrund des Wassereinbruchs in Abu Simbel von besonderer Aktualität. Jacobi sah den Flut-Termin 1. September 1966 in Gefahr. Doch bevor er seine Bedenken zum Ausdruck bringen konnte, überraschte Antonow mit der Feststellung, die Bauarbeiten am Sad el-Ali, wie die Ägypter den Staudamm nannten, gingen gut voran, und die Fertigstellung könne aufgrund technischer Einsparungen um mindestens drei Monate verkürzt werden.
»Was soll das heißen?«. rief Jacobi erregt und drückte, was ein deutliches Zeichen für diesen Zustand war, seine Brille gegen die Nasenwurzel.
Maher, ein dicklicher Mann mit Glatze, trug europäische Kleidung und versuchte, den Mangel an Haaren unter einem roten Fez zu verbergen. Er gab sich Mühe, Jacobi zu beschwichtigen; aber sein holpriges, schwer verständliches Englisch bewirkte eher das Gegenteil. »Das soll heißen«, stotterte der Ägypter, »dass der Sad el-Ali drei Monate eher ans Netz gehen kann.«
»Aber das ist ganz unmöglich!« Der sonst so gelassen wirkende Deutsche wurde laut. »Wozu schließen wir internationale Verträge, wenn Sie diese Verträge nicht einhalten? Ich werde die UNESCO einschalten! Mein Termin lautet 1. September 1966, und dabei bleibt es. Im Übrigen beobachten wir seit einigen Wochen, dass der Wasserspiegel schneller ansteigt, als Ihre Berechnungen vorhergesagt haben.«
Jetzt griff der Russe in die Diskussion ein: »Cherr Professor«, entgegnete er an Jacobi gewandt, »diese Berechnungen sind veraltet, sie basieren auf der Planung eines Flutkanals, durch den wir während der Bauzeit des Dammes täglich eine festgesetzte Menge Wasser abfluten könnten, Sie verstehen!«
»Ich verstehe überhaupt nichts!«, erwiderte Jacobi unruhig.
Maher nahm dem Russen die Antwort ab: »Antonow meint, gäbe es einen Flutkanal, dann wäre es überhaupt kein Problem, den Wasseranstieg zu steuern.«
Jacobis breites Gesicht nahm eine tiefrote Farbe an. »Wollen Sie damit etwa sagen …«
Maher nickte: »Wir haben entschieden, auf den Flutkanal zu verzichten. Inshallah.«
»Inshallah.« Der Deutsche schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dann erhob er sich umständlich und ging, die Hände auf dem Rücken verschränkt, zum Fenster und blickte durch die schräg ausgestellten Jalousien nach draußen.
In der Mittagshitze flirrten die Steine, und über allem lag das schrille Zirpen der Zikaden. Der betörende Duft exotischer Pflanzen drang sogar durch die geschlossenen Fenster. Welch ein Unterschied zu der Wüstenlandschaft von Abu Simbel, wo es nur nach Sand und Staub roch.
»Ich muss gestehen«, nahm Michail Antonow seine Rede wieder auf, »wir haben uns auch getäuscht, was den natürlichen Wasserschwund betrifft. Er ist weitaus geringer als angenommen. Alle Experten haben die Wüste für durstiger gehalten. Auch die Verdunstung erreicht nicht annähernd die Berechnungen. Deshalb wird der Stausee sein Limit mindestens drei Monate früher als vorhergesagt erreichen.«
Jacobi drehte sich um: »Dann können Sie Abu Simbel vergessen! Das ist nicht zu schaffen.«
Der Minister hob die Schultern. Die Drohung schien ihn nicht besonders zu beeindrucken: »Jeder Tag, den die Turbinen eher ans Netz gehen, bringt uns 25 Millionen Kilowatt. Wissen Sie, was das für ein armes Land wie Ägypten bedeutet, Professor? 25 Millionen Kilowatt?«
An diesem Punkt verlor Jacobi die Fassung. Er schrie den Ägypter an: »Und wissen Sie, was es für die Menschheit bedeutet, wenn Abu Simbel absäuft? Ich habe den Eindruck, Sie wollen sich einen Namen machen wie jener Herostratos, der vor 2300 Jahren den Tempel von Ephesos, eines der sieben Weltwunder, angezündet hat, nur um berühmt zu werden. Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken!«
Kamal Maher kramte mit unruhigen Fingern in einem Berg von Papier, der vor ihm auf dem Tisch lag. Man konnte die Wut förmlich sehen, die in ihm aufstieg; aber auch seine Hilflosigkeit wurde deutlich, auf die Vorwürfe des Deutschen angemessen zu reagieren.
Jacobi erkannte das und setzte nach: »Mag ja sein, dass man Sie wegen ein paar Millionen Kilowatt feiern wird, aber schon in weniger als fünfzig Jahren wird man mit Ihrem Namen nur noch die Zerstörung von Abu Simbel in Verbindung bringen.«
Antonow sah Maher fragend an, als habe er Jacobi nicht verstanden, und beinahe entschuldigend sagte er etwas wie: »Ich tue hier nur meine Pflicht …«