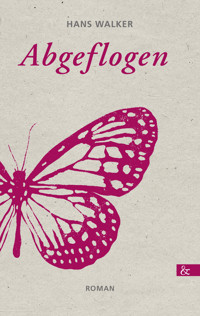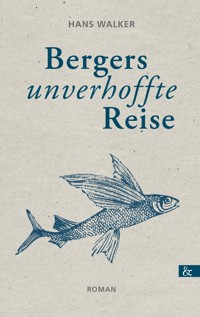Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buch&media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Max-Berger-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Mai 1989: Der Wind der Veränderung weht durch Europa – und auch das Leben von Max Berger nimmt eine unerwartete Wendung. Mittlerweile Anfang vierzig und seit Jahren Projektleiter beim WWF in Frankfurt, erhält er das ungewöhnliche Angebot, die Leitung einer entlegenen Safari-Lodge in Simbabwe zu übernehmen. Max sagt zu und kündigt seinen sicheren Job, nicht zuletzt, weil er die Integrität seines Arbeitgebers zunehmend anzweifelt: Von einem Hubschrauber, den der WWF gesponsert hat, sollen in Simbabwe Wilderer gezielt erschossen worden sein. Die Führungsriege der Organisation bestreitet, Kenntnis davon zu haben. An seinem neuen Arbeitsplatz in der mit Wildtieren reich gesegneten Buschsavanne hat Max zunächst andere Probleme: Die ungewohnten Anforderungen eines Lodge-Managers und die Gefühle für seine Assistentin Lindiwe fordern seine ganze Aufmerksamkeit. Doch als der Wildlife-Fotograf James tief im Busch Zeuge eines brutalen Verbrechens wird, holt Max die Vergangenheit mit aller Härte ein. Als dann auch noch klar wird, dass eine lange zurückliegende, schicksalhafte Begegnung von Max nicht ohne Folgen geblieben ist, wird sein Aufenthalt auf der Amkila River Lodge endgültig zur emotionalen Achterbahnfahrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe
September 2025
© 2025 Buch&media GmbH MünchenLektorat: Heidi Keller
Layout & Satz: Johanna ConradUmschlaggestaltung: Mona KönigbauerGesetzt aus der Adobe Garamond ProPrinted in Europe · ISBN 978-3-95780-318-4
Buch&media GmbH
Merianstraße 24 · 80637 MünchenFon 089 13 92 90 46 · Fax 089 13 92 90 65
Weitere Publikationen aus unserem Programm finden Sie aufwww.buchmedia-publishing.de
Kontakt und Bestellungen unter [email protected]
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Der Leopard leckt alle seine Flecken, schwarze wie weiße. Sprichwort der Ndebele
1
Amkila River Lodge, Simbabwe – September 1989
IAN SMITH WIRD heute Nacht noch rauskommen«, flüsterte Scott und starrte in die Glut. Das Feuer in der flachen Eisenschale hatte die harten Mopani-Scheite in zerklüftete, schwarze Brocken verwandelt, aus denen wie aus kleinen Vulkanen dunkelrote Eruptionen hervorschossen, sobald sich die Glut noch tiefer in den Kern des Holzes fraß.
»Was macht dich so sicher?« Die leise Stimme von Akash klang skeptisch. Er saß dicht neben Scott auf einem Baumstamm und ließ seinen Blick über die mit dichtem Gras bewachsene, sanft abfallende Uferböschung bis zum Fluss wandern. Die Oberfläche des Wassers war dunkel, fast schwarz. Und spiegelglatt.
»Ich kenne ihn.« Die Antwort Scotts kam mit minutenlanger Verspätung.
Und nach einer weiteren Pause, in der nur ein feines Rascheln aus den trockenen Kameldorn-Sträuchern zu hören war, die einige Meter von ihnen entfernt eine graue Wand bildeten, setzte er hinzu: »Ian ist ja schließlich einer von uns.«
Scott lachte leise vor sich hin und ergänzte: »Um genau zu sein, einer von meiner Sippe. Nicht von deiner.«
»Armer weißer Mann«, spottete Akash. »Du tust mir leid. Du kannst ja nichts dafür, dass du weiß bist.«
»Weiß? Kein Hautarzt würde meine sonnenverbrannte Haut als weiß bezeichnen, Akash. Bist du farbenblind?«
»Die Sonne hilft dir nicht, Scott. Du bist ein Ex-Rhodesier. Und damit bist du weiß – egal, wie viele Pigmente die Sonne in deiner Haut aktiviert hat. Es muss schrecklich sein, in einem schwarzafrikanischen Land wie ein Mehlsack herumlaufen zu müssen.«
»Danke für dein Mitgefühl, Akash. Du bist wirklich ein echter Freund. Aber darf ich dich daran erinnern, dass es vor einem Jahrzehnt noch genau anders herum war? Da bist du als Schwarzer aufgefallen! Zumindest, wenn du dich am falschen Ort bewegt hast. Stell dir vor, du wärst vor der Unabhängigkeit mit deiner Schwester zum Nachmittagstee im Royal Salisbury Golf Club aufgetaucht! Ich kann mir die Gesichter der feinen weißen Herrschaften gut vorstellen. Und der dunkelhäutige Ober mit der schwarzen Fliege und den weißen Handschuhen hätte dich entsetzt angeschaut. Auch wenn er dich insgeheim für deinen Mut bewundert hätte.«
Beide mussten sich bei diesem geflüsterten Wortwechsel ein befreites Lachen verkneifen, da sie wussten, dass Ian Smith nicht aus dem Fluss steigen und auf seinen kurzen stämmigen Beinen zum Äsen auf die Grasfläche kommen würde, wenn sie zu viele Geräusche verursachten.
Eine Weile schwiegen sie erneut. Der Sternenhimmel über ihnen wölbte sich wie eine Zirkuskuppel, die mit Millionen silberner Punkte übersät war. Mitten drin hing schief ein weißlich schimmernder Halbmond.
Scott lenkte seinen Blick von der Glut weg und zum Ufer, um seine Augen wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen.
Plötzlich spürte er die Hand von Akash auf seinem Arm, und auch er hatte im selben Moment die kreisförmigen Wellen auf der Wasseroberfläche entdeckt. Das Zentrum der Wellen bewegte sich auf das Ufer zu.
»Könnte auch ein Croc sein«, flüsterte Akash.
Die Wellen wurden stärker. Ein dunkles, unförmiges Gebilde tauchte aus dem Wasser auf, schob sich über den Uferrand, und dann konnten die beiden Männer die Umrisse des Flusspferdes klar erkennen. Seine nasse Haut glänzte im Licht der Gestirne. Es hatte den schweren Kopf tief gesenkt und führte ihn wie einen Staubsauger langsam über die Grasfläche. Offenbar hatte das Tier die Männer nicht wahrgenommen. Oder ignorierte ihre Anwesenheit. Noch lag eine sichere Distanz zwischen ihm und den Rangern und den Gebäuden der Safari-Lodge hinter ihnen.
»Bist du sicher, dass es Ian ist?«, flüsterte Scott.
»Todsicher. Es ist sein Revier. Und als alter, einzelgängerischer Bulle tauscht er unsere gepflegte Böschung auf keinen Fall mit einem seiner männlichen Konkurrenten gegen die ausgedörrten Uferstreifen links und rechts von unserer Lodge ein. Schau dir mal seinen Umfang an. Das muss er sein.«
Akash und Scott kannten sich schon seit acht Jahren. Scott arbeitete vor der Unabhängigkeit Simbabwes im Jahr 1980 als Wildhüter in dem benachbarten Chizarira-Nationalpark. Akash war ein Jahr nach der Machtübernahme durch Mugabe im Zuge der Afrikanisierung des öffentlichen Dienstes als Ranger zu Scotts Team gestoßen. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und arbeiteten eng zusammen.
Vor fünf Jahren entschieden sie sich, gemeinsam dem Angebot eines millionenschweren Ex-Rhodesiers, Godwin Brown, zu fol-gen, der sich auf seinem ausgedehnten Buschland südlich des Karibasees den Traum von einer eigenen Safari-Lodge erfüllt hatte und erfahrenes Personal suchte. Sie hatten die Entscheidung bis heute nicht bereut.
Wieder raschelte es im Unterholz des Dornengebüschs. Aus einem der Mopanebäume hinter den Wirtschaftsgebäuden kam das Krächzen eines Vogels, der aus dem Schlaf geweckt worden sein musste. Eine Fledermaus schoss taumelnd dicht über die Wasseroberfläche.
»Ian kommt näher«, flüsterte Akash. »Sollen wir?«
»Ich glaube nicht, dass er Ärger machen wird«, sagte Scott dicht an Akashs Ohr. Er spürte, wie sich seine Muskeln anspannten. Das Tier würde nur angreifen, wenn es sich bedroht fühlte. Ein absolutes Horrorszenario war, wenn man als Mensch zwischen ein Flusspferd und das Wasser geriet und das Tier das Gefühl hatte, dass ihm der Rückzug in sein Schutzgebiet abgeschnitten wurde. Die schwerfälligen Kolosse drehten dann durch. Und sie griffen mit einer Geschwindigkeit an, die ihnen niemand zugetraut hätte, der sie zuvor friedlich äsend am Ufer beobachten konnte.
Ian bewegte sich jetzt grasend mit lauten Schmatz- und Kaugeräuschen direkt auf sie zu. Ab und zu hob er kurz den Kopf, und dabei waren selbst in der Dunkelheit die Stehohren links und rechts des riesigen Schädels gut zu erkennen.
Ohne etwas zu sprechen erhoben sich die Männer und bewegten sich langsam einige Schritte rückwärts die Böschung hoch. Als das Tier nicht weiter reagierte, drehten sie sich um und liefen die letzten Schritte bis zu der hölzernen Veranda, auf der die Gäste bei gutem Wetter ihre Mahlzeiten einnahmen, wenn sie sich ihre Mahlzeiten nicht direkt in ihre Bungalows bringen ließen.
Durch die angelehnte Tür gelangten die beiden von der Veranda in den Teil der Anlage, der als Empfangsgebäude und Gästelounge diente. Scott schloss die Tür von innen und blieb dann stehen.
»Wir müssen noch mit unserem neuen Boss einen Termin für die Tour durch unser Gelände vereinbaren. Ich habe es so verstanden, dass wir damit warten, bis Godwin alles an ihn übergeben hat.«
»Korrekt«, bestätigte Akash. »Der Mann hat Glück, dass er zum Ende der Trockenzeit kommt und die Savanne noch recht übersichtlich ist. Die Chancen, dass wir ihm viele Tiere zeigen können, sind gut. Wenn mit den ersten kräftigen Regen im November die Belaubung einsetzt, wird es schwieriger, einen Überblick zu bekommen.«
»Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Raubkatzen, die ihre Beute schlechter ausmachen können«, ergänzte Scott, und es klang für Akash, als ob Scott die Tiere bedauern würde.
Die Männer verließen das flache Gebäude durch die Vordertür. Dort trennten sich ihre Wege.
Beide schalteten fast zeitgleich ihre starken Taschenlampen an und berührten sich zum Abschied kurz an den Schultern. Sie hielten sich streng an eine der Verhaltensregeln, die Godwin Brown aufgestellt hatte: sich niemals ohne Taschenlampe bei Nacht über das Gelände der Lodge zu bewegen. Das galt gleichermaßen für die Angestellten wie für die Gäste. So sollte vermieden werden, dass jemand auf eine giftige Schlange oder einen Skorpion trat. Das Licht sollte aber auch wilde Tiere, vor allem Elefanten, abschrecken, die häufig mitten in der Nacht der Lodge einen Besuch abstatteten.
Scott folgte dem schmalen, mit flachen Steinen belegten Weg entlang der vier Gästehäuser, die in größeren Abständen am Flussufer angelegt worden waren und alle über einen eigenen Garten und eine Terrasse mit einem Minipool verfügten. Über den Hauseingängen brannten runde Leuchten, die matte Lichtkegel auf die Pfade warfen, die vom Hauptweg zu den Bungalows führten.
Am Ende der Häuserreihe befand sich linker Hand der Bootsanlegesteg der Lodge. Im Licht des Mondes konnte Scott die Umrisse des kleinen Ausflugsschiffes erkennen, das ein Touristencamp am Karibasee vor Jahren ausgemustert und preiswert an Godwin verkauft hatte, als das Camp zur Sterne-Lodge mutierte und die Ausrüstung nicht mehr den Ansprüchen der Edeltouristen entsprach.
Am Steg bog Scott ab, ließ das Flussufer hinter sich und erreichte nach etwa hundert Metern das Mopanewäldchen, in dessen Mitte sich ein großes Zelt mit Außendusche versteckte. Scott hatte sich bis heute nicht damit anfreunden können, in einem massiv gebauten Haus zu wohnen.
Akash hatte zwischenzeitlich den Pfad in die entgegengesetzte Richtung genommen und das Haupthaus und einige Funktionsgebäude hinter sich gelassen. Jetzt näherte er sich dem umzäunten Werkstattgelände. Über den Wellblechdächern brannte an einem hohen Holzpfosten ein einsames, kräftiges Flutlicht, das den Drahtzaun geometrische Muster auf den Pfad werfen ließ. Wenig später erreichte er die Staff Quarters der Angestellten.
Er blieb kurz stehen und warf noch einen Blick in die Verlängerung des Pfads. An dessen Ende lag das Wohnhaus des Managers. Akash konnte hinter den schwarzen Silhouetten der Büsche nur die Umrisse des Daches gegen den Sternenhimmel erkennen. Im Moment wohnte der Neue noch als Gast bei Godwin. In wenigen Tagen würde er allein dort hausen und für die kommenden Monate die Verantwortung für Amkila übernehmen, während sich Godwin um seine kranke Frau kümmerte.
Akash schloss die kräftige, hölzerne Tür der strohgedeckten Rundhütte auf und trat ein. Mit Hilfe seiner Taschenlampe fand er die Paraffinlampe in der Wandnische, daneben die Streichhölzer. Wenig später erleuchtete mildes Licht den Raum.
Akash blickte auf seine Uhr. Mitternacht. Er war müde, und die Nacht würde kurz werden. Für sechs Uhr war er mit einem jungen Schweizer Ehepaar zu einer zweistündigen Walking Safari verabredet. Vor der Tour brauchte er einen starken Kaffee, frühstücken würde er danach auf der Terrasse. Vermutlich zusammen mit seinen Gästen, die erfahrungsgemäß die Gelegenheit nutzen würden, ihre Erlebnisse mit ihm zu verarbeiten.
Besucher, die zum ersten Mal in ihrem Leben Afrika bereisten, waren selbst Stunden nach der Safari noch ganz aufgedreht von ihren Eindrücken: auf ihrem Weg zu Fuß durch den Busch plötzlich einer schwarzen Wand von mächtigen Büffeln gegenüberzustehen; oder unerwartet in eine wandernde Herde von Elefanten zu geraten, die mit ihren weit hochgereckten Rüsseln die jungen grünen Triebe von den Bäumen rissen. Ganz zu schweigen von der Begegnung mit einem Nashorn, das sich frei zwischen dem nahegelegenen Nationalpark und dem Buschland der Lodge bewegte.
Wie lange wohl die Menschen im südlichen Afrika noch das Privileg genießen konnten, eine der bedrohten Tierarten in freier Wildbahn zu erleben?, fragte sich Akash. Im Moment wurde zwar vieles getan, um die Tiere zu schützen, aber ihre Zahl schrumpfte trotzdem ständig, da rücksichtslose Wilderer den Wildhütern immer einen Schritt voraus waren.
Generell ließ ihn das Zusammentreffen mit den Big Five – den Elefanten, Büffeln, Nashörnern, Löwen und Leoparden – selbst als erfahrenen Ranger nicht kalt, und er erwischte sich in solchen Momenten dabei, wie er den dunkel polierten Schaft seines Gewehrs fester umklammerte und die Tiere keinen Moment aus den Augen ließ.
Aber jetzt brauchte er dringend seinen Schlaf. Schnell zog er sich aus, und wusch sich an dem aus Granit gehauenen Waschtisch. Nebenher kaute er auf einem Stück Mopaneholz, um seine Zähne zu reinigen. Danach legte er sich auf die geflochtene Grasmatte auf den Boden und zog die braune Wolldecke mit dem verblichenen schwarzen Schriftzug des Chizarira-Nationalparks, in dem er früher gearbeitet hatte, über sich.
Mit dem Bild des Nilpferds, das friedlich und ungestört unter der Sternenkuppel auf dem Uferstreifen weidete, schlief Akash ein.
Was für eine verrückte Idee von seinem Freund Scott, dem Haustier der Amkila River Lodge den Namen des weißen Ex-Regierungschefs Ian Smith zu verpassen!
2
London – Februar 1989
DIE TEILNEHMER DER internationalen Jahreskonferenz des WWF drängten in den hell erleuchteten Konferenzsaal des Hotels in der Innenstadt von London. Normalerweise hielt sich das Interesse an den jährlichen Treffen der Natur- und Umweltschutzorganisation in Grenzen. Die Mitarbeiter, die nicht direkt von ihren Vorgesetzten zur Teilnahme verpflichtet wurden, überlegten es sich zweimal, ob sie sich einen ganzen Tag den langatmigen Lobgesängen der Führungsriege über die segensreichen Projekte des Funds in allen Teilen der Welt aussetzen wollten. Oder schlimmer noch: mit zusammengekniffenen Augen auf kaum lesbare Folien mit Zahlen und Kurven zu starren, die zur eintönigen Stimme eines Finanzexperten von einem leise surrenden Overheadprojektor auf die große Leinwand geworfen wurden.
Dieses Jahr war manches anders. Dass der WWF in die Schlagzeilen der Presse geriet, war nichts grundsätzlich Neues. Aber so vehement wie im vergangenen Jahr war er noch selten ins Kreuzfeuer selbst wohlmeinender Kritiker geraten. Die Vorwürfe gingen diesmal über die üblichen Kritikpunkte mangelnder Transparenz und Kungelei der Führungsriege mit der Großindustrie hinaus. Im Fokus standen Erkenntnisse undercover arbeitender Journalisten, die behaupteten, dass die Stiftung an der brutalen Vertreibung indigener Bewohner aus Naturschutzgebieten aktiv beteiligt sei und dabei mit nationalen Militär- und Polizeiapparaten oder Geheimdiensten kooperiere.
Jeder, der für den WWF arbeitete, war sich des Spagats bewusst: auf der einen Seite ein sehr hoher, oft überzogener Anspruch an das, was eine Nichtregierungsorganisation auf dem Feld des Arten- und Naturschutzes leisten konnte. Auf der anderen Seite die Auseinandersetzung in den meist armen Empfängerländern mit Bürokratie, Korruption und unkontrolliert agierenden lokalen Sicherheitskräften. Und das alles gepaart mit dem ungeklärten Verhältnis der Akteure zur Rolle des Naturschutzes in den Lebensräumen der indigenen Bevölkerung, der durch die rigide Naturschutzpolitik des Westens im schlimmsten Fall die Lebensgrundlage entzogen wurde.
Mit diesem Dilemma wurden die Mitarbeiter der Organisation meist allein gelassen. Jeder musste für sich einen eigenen Weg finden, wie er mit den Widersprüchen umging. Max Berger kannte diese nur zu gut und hatte seit der Übernahme des Postens eines Projektmanagers für Süd- und Ostafrika in der deutschen Sektion des WWF in Frankfurt vor drei Jahren zunehmend Gewissensbisse. War er hier an der richtigen Stelle? Er hatte schon als junger Mann die Arbeit des WWF bewundert und mit Spenden unterstützt. War überzeugt, dass es Organisationen wie seinen Arbeitgeber brauchte, um die bedrohte Natur zu schützen. Wenn da nicht die dunklen Seiten des WWF gewesen wären, die nicht in sein Wertesystem passten. Wie konnte er seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden?
Von der diesjährigen Konferenz erhoffte er sich Antworten. Angesichts der öffentlich gewordenen Vorwürfe konnten sich die Verantwortlichen nicht mehr hinter ihren wolkigen Erklärungen verstecken. Max hatte sich vorgenommen, sehr genau hinzuhören. Sollte sich die Organisation der Kritik nicht offen stellen und klare Vereinbarungen treffen, wie ein Fehlverhalten in Zukunft vermieden werden konnte, waren seine Tage bei der Stiftung wohl gezählt. Ähnlich hatten sich in den letzten Monaten auch schon einige seiner Kollegen in Frankfurt geäußert.
»One, one, one … one, two three …«
Der Techniker auf der Bühne testete ein letztes Mal das Mikrofon. Der Saal war bis auf wenige Plätze gefüllt. Unterhalb der Bühne standen zwei Herren in dunklen Anzügen und redeten gestenreich aufeinander ein. Dann löste sich einer der beiden und ging die Treppe zur Bühne hoch. Er stellte sich hinter das Rednerpult, klopfte kurz auf das Mikrofon, schob es einige Zentimeter nach oben und räusperte sich.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten?« Im Saal wurde es ruhig. »Danke. Für die, die mich nicht kennen sollten: Ich bin Dr. Lambert, der Chef der englischen Sektion des WWF, und Ihr Gastgeber für diese Konferenz. Ich darf Sie vorweg darüber informieren, dass wir für den Vormittag die Presse ausgeschlossen haben. Sicher haben Sie dafür angesichts der bösartigen Vorwürfe, die gegen uns erhoben wurden und die jeglicher Substanz entbehren, Verständnis. Wir möchten Ihnen in den kommenden Stunden ungestört unsere Sicht erläutern, Ihre Fragen beantworten und mit Ihnen intern, und in der gewohnt professionellen Weise, den Weg nach vorne in eine vielversprechende Zukunft für unsere Organisation und für einen besseren Schutz der natürlichen Ressourcen dieser Welt diskutieren.«
Max schüttelte den Kopf. Ausschluss der Presse! Das war das Letzte, was er erwartet hatte – und genau das, was seiner Meinung nach das Verhältnis zwischen der Öffentlichkeit und dem WWF weiter verschlechtern würde. Also kein Eingeständnis der Verantwortlichen, dass eventuell Fehler gemacht worden waren? Keine Entschuldigung für Fehlverhalten? Nur ein »Weiter so«?
In der Kaffeepause begrüßte er eine alte Bekannte, die er aus seiner Zeit in Tansania kannte, und traf danach auf zwei seiner Kollegen aus Frankfurt. Von Volker Schulz, einem immer gut aufgelegten, großgewachsenen Rheinländer, wusste er, dass dieser sich große Sorgen um die Zukunft des Funds machte und dass auch er schon mit dem Gedanken gespielt hatte, den Arbeitsplatz zu wechseln. Dem anderen, Dietmar Riethmüller, einem dick-lichen Mittfünfziger mit Glatze, traute er nicht über den Weg. Schulz und Berger wechselten einen kurzen Blick, der signalisierte, mit persönlichen Kommentaren zurückhaltend zu sein.
Stattdessen legte Riethmüller gleich los: »Gute Entscheidung, die Presse draußen zu lassen. Dieses Pack. Erfinden Lügengeschichten und versuchen, unsere Arbeit schlecht zu machen. Am besten gibt man sich gar nicht damit ab.«
Das war anscheinend auch das Motto der Führungsriege in der Konferenz, denn bis zur Kaffeepause gab es tatsächlich von Seiten des Vorstands so gut wie keine Hinweise darauf, sich ernsthaft mit den Vorwürfen der Journalisten auseinanderzusetzen. Die Kritikpunkte wurden zwar benannt, aber jedes Argument wurde entweder schlicht als sachlich nicht richtig abgetan oder als böswillige Unterstellung deklariert.
Selbst in jenen Fällen, in denen belastbare Beweise vorlagen, waren die Verantwortlichen der Stiftung nur eingeschränkt bereit, Eingeständnisse zu machen. So etwa bei dem Vorwurf der Nähe des Funds zur Großindustrie und zu Großwildjägern. Journalisten war es wohl gelungen, an einen Teil der streng anonymen Spenderliste zu gelangen. Und diese las sich wie das »Who’s who« internationaler Konzerne, die bislang eher dadurch aufgefallen waren, dass sie die Umwelt rücksichtslos ausbeuteten oder zerstörten. Garniert wurde die Liste mit den Adressen von Politikern und Vertretern europäischer Adelsgeschlechter, die sich ungeniert als Großwildjäger hinter erschossenen Wildtieren ablichten ließen, die vom Aussterben bedroht waren.
Tenor auf der Konferenz war, dass sich der WWF von der Kritik nicht beeindrucken lassen durfte. Stattdessen wurde in den Präsentationen dargelegt, welche Erfolge die Organisation beim Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten bis heute vorweisen konnte. Und kein Sprecher vergaß, darauf hinzuweisen, was die Organisation am Leben hielt: »Wir leben von Spenden! Wir müssen also alles tun, um zu verhindern, dass potenzielle Spender erschreckt werden!«
Ein Klingelzeichen erinnerte die Delegierten, an ihre Plätze zurückzukehren. Der Pressesprecher des WWF trat ans Mikrofon. Er wartete, bis es im Saal ruhig geworden war. »Bevor wir am Nachmittag die Vertreter der Presse im Raum haben, möchte ich Sie darüber informieren, dass wir in naher Zukunft mit einem kritischen Bericht des Guardian rechnen, der unser Engagement in Simbabwe zum Thema haben wird. Wie Ihnen sicher bekannt ist, unterstützen wir das Land im Kampf gegen die Wilderei. Als Teil dieser Unterstützung haben wir über die deutsche Sektion dem Wildlife Department in Simbabwe im Jahr 1987 einen Helikopter gespendet. Ziel war der Schutz des schwarzen Nashorns, dessen Bestand, wie Sie alle wissen, extrem gefährdet ist. Vor wenigen Tagen haben wir vertrauliche Informationen erhalten, dass der Guardian davon ausgeht, dass von diesem Hubschrauber aus in den vergangenen Jahren fast sechzig Wilddiebe in sogenannten ›shoot-to-kill‹-Aktionen gezielt getötet wurden. Lassen Sie es mich sehr deutlich und klar sagen: Uns ist davon nichts bekannt und wir behalten uns selbstverständlich juristische Schritte vor, sollte es zu einer Veröffentlichung kommen. Soweit wir wissen, verläuft die Operation im Norden Simbabwes höchst effektiv. Und darauf sollten wir als WWF stolz sein.«
Dass es im Raum völlig ruhig blieb, nahm Berger als Beweis dafür, dass die Erwähnung der »shoot-to-kill«-Aktionen für viele der Mitarbeiter des WWF nicht überraschend kam. Auch für ihn war die Sache keineswegs neu. Er hatte schon bald nach seinem Arbeitsbeginn im Sommer 1986 in der Geschäftsstelle in Frankfurt mitbekommen, dass es innerhalb der deutschen Sektion heftige Debatten um das geplante Geschenk an Simbabwe gab. Offensichtlich trauten einige seiner Kollegen der simbabwischen Behörde nicht zu, verantwortungsvoll mit dem Fluggerät umzugehen.
In einer Sitzung des Führungskreises der deutschen WWFSektion kurz vor dem Erwerb des Hubschraubers eskalierte die Diskussion. Max’ Kollegin Steinwald warf der Führung unverantwortliches Verhalten vor und beschuldigte sie, bewusst den Tot von Menschen in Kauf zu nehmen. Der Sitzungsleiter verwies sie daraufhin des Raumes. Steinwald reichte am Tag nach der Sitzung ihre Kündigung ein und tauchte nur noch ein einziges Mal kurz auf, um ihr Büro zu räumen. Die Frage von Max, warum sie kampflos das Handtuch warf, ließ sie unbeantwortet.
Max hatte sich während der Rede des Pressesprechers einige Notizen auf seinem Schreibblock gemacht. Jetzt schaute er noch einmal darüber und blieb an dem »shoot to kill« hängen. Der WWF würde in Erklärungsnot kommen, wenn die Behauptung des britischen Guardian stimmte. Und er selbst auch. Denn am Ende der internen Diskussionen hatte er die Entscheidung in dem festen Glauben mitgetragen, dass der Helikopter nicht zweckentfremdet eingesetzt werden würde.
3
London – Februar 1989
DIE KONFERENZ ENDETE am Abend mit einem Dinner im Hotel. Die Stimmung war nicht so unbeschwert wie ein Jahr zuvor. Vielen im Raum war klar geworden, dass ihre Organisation in schwieriges Fahrwasser geraten war. Die Politik der Führungsriege, alles unter den Tisch zu kehren, wollten zahlreiche Mitarbeiter nicht mehr mittragen.
Für Berger war es noch zu früh, eine Entscheidung zu treffen. Er fühlte sich unwohl bei dem Gedanken, Teil eines Systems zu sein, das so rücksichtslos auftrat. Auf der anderen Seite konnte und wollte er die seiner Meinung nach fantastischen Ansätze im Bereich des Tier- und Artenschutzes nicht einfach zur Seite wischen. Wie sollte er sich da positionieren? Gab es ein Richtig oder Falsch? Hinzu kam, dass er als Projektmanager eine wichtige Position in der Geschäftsstelle in Frankfurt innehatte und seine Führung Loyalität von ihm erwarten durfte.
Den Großteil des nächsten Tages verbrachte Berger in bilateralen Sitzungen mit Kollegen, die – so wie er – in afrikanischen Projekten des Funds engagiert waren. Das längste Gespräch hatte er mit der englischen Kollegin, die von London aus für Sambia zuständig war und ihm wertvolle Hinweise für seine anstehende Dienstreise geben konnte.
Am frühen Abend fuhr Max mit dem Taxi zum Flughafen Heathrow, um für den Nachtflug nach Harare einzuchecken. Von Harare wollte er am nächsten Morgen direkt nach Lusaka weiterfliegen, wo ihn Gespräche mit Vertretern einer gemeinnützigen Tierschutzorganisation erwarteten. Die Sambier hoff-ten auf Unterstützung durch die deutsche Sektion des WWF für die Erweiterung eines Tierreservats entlang des Sambesi direkt oberhalb der Victoriafälle.
Am Schalter von British Airways angekommen, war Max überrascht, ein Upgrade von der Economy auf die Business Class zu bekommen.
»Economy ist heute Nacht überbucht«, erklärte die freundliche Engländerin. »Wir haben aber noch freie Sitze in der Business, die wir nutzen wollen. Sie sind einer der Glücklichen.«
Die Zweiersitzreihe war frei. Max verstaute sein Handgepäck und ließ sich in den Sitz am Gang fallen. Wenig später tauchte ein Mann auf und bat, zum Fenster durchgelassen zu werden. Der Mann durfte Ende sechzig sein, und Max kannte diesen Typ. Weißer Farmer im südlichen Afrika, dachte er. Die Haut an den Händen und im Gesicht war verbrannt. Die braunen, teilweise schorfigen Flecken deuteten auf Schädigungen durch die intensive Sonne Afrikas hin.
Sie grüßten sich kurz und setzten sich beide wieder. Sein Nachbar hatte ein englischsprachiges Journal unter dem Arm, welchem er sich sofort widmete. Er schien kein Interesse an einem Gespräch zu haben. Das Abendessen, das zwei Stunden nach dem Start serviert wurde, nahm er konzentriert ein. Außer einem kurzen »Lassen Sie es sich schmecken« kam nichts. Berger erwiderte den Wunsch und ließ es dabei bewenden. Er war froh, sich nicht unterhalten zu müssen. Er war müde. Die Konferenz ging ihm nicht aus dem Sinn. Und der stumme Nachbar versprach ihm eine ungestörte Nachtruhe, die er sicher gut für die anstehenden Tage in Lusaka brauchen konnte.
Nachdem das Abendessen abgeräumt war und sich beide Männer denselben Scotch – Johnnie Walker Black Label – bestellt hatten, wandte sich der Mann abrupt an Max und fragte: »Was führt Sie nach Harare?«
Max war angesichts dieser schnörkellosen Anrede etwas überrascht, auf der anderen Seite wurde dadurch seine Neugierde geweckt. Wer war dieser wortkarge Passagier?
»Nach Simbabwe führt mich gar nichts«, erwiderte Max und war gespannt, wie sein Nachbar auf diese kryptische Antwort reagieren würde.
»Hmm«, hörte er. »Anschlussflug.«
Das war keine Frage, sondern eine Feststellung.
»Ja. Lusaka.«
»Und dafür gibt’s einen Grund.«
»Richtig.«
»Und der wäre?«
Max musste grinsen. Der Mann wurde ihm sympathisch. »Ich treffe Vertreter einer Nichtregierungsorganisation, die sich dem Naturschutz verschrieben hat. Genauer gesagt geht es um die geplante Erweiterung eines Reservats in Sambia.«
Sein Nachbar richtete sich in seinem Sitz auf. Max musste einen Nerv getroffen haben.
»Und für wen arbeiten Sie?«
»Für den World Wildlife Fund.«
»Damned shit!«, sagte der Mann und es klang erstaunlicherweise nicht wie ein Schimpfwort. Eher wie eine sachliche Einordnung. Max schaute den Hautgeschädigten erstaunt an.
»Sorry, mit denen habe ich ein echtes Problem«, erklärte der Mann. Er griff nach seinem Glas. »Lassen Sie uns erst mal anstoßen. Ich bin Godwin Brown. Nennen Sie mich Godwin.«
»Max. Max Berger.«
»Ihrem Akzent nach sind Sie Deutscher, oder?«
Max nickte.
»Dann erwischt es mich heute voll! Ich habe ein Riesenproblem mit Ihrem Arbeitgeber. Und ein weiteres mit den Deutschen.« Er nahm einen tiefen Schluck.
Max wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Er war nach dem Krieg geboren, verstand aber genau, dass ihm das jetzt nicht helfen würde. Er hatte schon oft, vor allem im Ausland, erkennen müssen, dass er als Deutscher eine Verantwortung trug, die aus seinem Status als Nachfahre der Mörder abzuleiten war.
»Hey, keine Sorge, junger Mann«, sagte Brown versöhnlich, »wir können uns trotzdem unterhalten. Sie scheinen ja ganz in Ordnung zu sein. Aber der Reihe nach. Erst mal zur Sache mit meinen Spezialfreunden. Erzählen Sie mir doch, was genau Sie für den WWF machen.«
Brown unterbrach nicht ein einziges Mal, während Max seine Arbeit schilderte. Erst als er über die Konferenz in London berichtete und den Helikopter erwähnte, fuhr sein Sitznachbar hoch.
»Sie haben darüber gesprochen?« Er schüttelte den Kopf. »Was für ein Zufall, dass wir beide heute Nacht nebeneinandersitzen. Ich bin mit der Diskussion um die Spende des WWF sehr vertraut.«
»Ist es diese Geschichte, die Sie so kritisch auf den WWF blicken lässt?«
»Nicht nur. Ich engagiere mich seit Jahrzehnten im Naturschutz. Das begann schon zu Zeiten von Ian Smith, lange vor der Unabhängigkeit Simbabwes. Naturschutz war damals für viele meiner Landsleute noch ein Fremdwort. Und genauso lange verfolge ich die Geschichte des WWF. Du kommst an der Organisation gar nicht vorbei, wenn du in diesem Feld engagiert bist. Aber wem sage ich das?«
Er grinste breit und nippte an seinem Glas.
»Die Idee hinter dem WWF ist gut«, sagte Brown. »Aber ich traue denen nicht. Sie wissen sicher genauso gut wie ich, dass der Verein nicht sauber ist. Angefangen mit der Dominanz der Groß-wildjäger seit der Gründung, über die Kungelei mit Umweltsündern innerhalb der Großindustrie bis zur Zusammenarbeit mit brutalen Geheimdiensten und korrupten Regierungen. Und wann immer jemand Kritik übt, tauchen die Rechtsanwälte der Organisation auf.«
Godwin klopfte nervös mit den Fingern auf den Rand seines Klapptisches.
»Was machen Sie denn beruflich?«, fragte Max schnell, um ihn etwas vom Thema abzulenken.
»Da muss ich ausholen. Meine Eltern sind vor über achtzig Jahren aus Schottland in das damalige Rhodesien eingewandert. Ich bin auf einer Tabakfarm großgeworden und sollte sie zusammen mit meinem Bruder übernehmen. Dazu hatte ich keine Lust. Ich habe in Südafrika BWL studiert und mich für das Unternehmertum entschieden. Über die Jahre habe ich eine Kaufhauskette in Simbabwe und Namibia aufgebaut. Für die Kaufhäuser habe ich heute natürlich Geschäftsführer. Aber ich schaue trotzdem noch ab und zu nach dem Rechten. Meine Frau Violette drängt mich, endlich loszulassen und meinen Lebensabend zu genießen.«
Das berühmte Loslassen. Max fühlte sich in sein Psychologiestudium zurückversetzt. Dort hatte er sich in einer Seminararbeit mit dem Thema beschäftigen müssen. Er glaubte sich zu erinnern: Loslassen hatte nicht nur mit Ablösung, sondern ganz entscheidend auch mit Aufbruch zu tun. Als Ausdruck des freien Willens. Wohin würde Godwin aufbrechen, wenn er sich nicht mehr um seine Kaufhauskette kümmern würde?
Als hätte Godwin seine Gedanken gelesen, sagte er jetzt: »Ein Stück weit habe ich ja meinen Beruf schon hinter mir gelassen. Heute widme ich mich, zusammen mit einer Gruppe engagierter Naturschützer, fast ausschließlich dem Kampf gegen die Ausrottung afrikanischer Wildtiere.«
Für einen Moment schwiegen beide.
»Und woher kommt Ihr Hass auf die Deutschen?«, fragte Max.
Brown schaute ihn überrascht an.
»Es ist kein Hass, Max. Das ist der falsche Ausdruck. Es ist … es ist das Entsetzen über die Menschenverachtung der Nazis. Ich weiß, Sie sind nicht der richtige Ansprechpartner. Aber dieses Gefühl sitzt so tief drin. Bei mir. Bei meinen Kameraden, die mit mir im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben.«
»Im Zweiten Weltkrieg? Als Rhodesier?«
»Ich bin auf Seiten der Engländer als Pilot einer Spitfire Einsätze gegen die Wehrmacht geflogen. Wie eine ganze Reihe von jungen Rhodesiern, die begeisterte Flieger waren. Dabei hatte ich mehr Glück als Ian Smith. Während ich unversehrt aus dem Krieg zurückkam, wurde er bei einem Fehlstart seiner Maschine schwer verletzt und später dann auch noch über Italien abgeschossen. Er kam mit dem Fallschirm runter, versteckte sich und schlug sich nachts bis zur französischen Grenze zu den Partisanen durch. Und setzte sich danach sofort wieder in seine Spitfire. Stellen Sie sich das vor … Ein toller Kerl!«
Ian Smith – ein toller Kerl? Alles, was Max bis heute über den früheren Regierungschef gehört und gelesen hatte, hätte ihn nicht zu dem Schluss kommen lassen, es mit einem »tollen Kerl« zu tun zu haben. Aber vermutlich war jetzt nicht der passende Moment, eine Diskussion über die Politik des Smith-Regimes anzuzetteln.
»Ich habe auch den Pilotenschein«, sagte er deshalb. »Nur saß ich noch nie am Steuerknüppel einer Spitfire. Sondern nur in einem Leichtflugzeug.«
»Wenn das kein Zufall ist. Ich bin auch heute noch häufig mit meiner unverwüstlichen alten Cessna in der Luft.«
»Sie haben ein eigenes Flugzeug?«
»Ja. Eine viersitzige Cessna 172. Ohne das Flugzeug wäre mein Herzensprojekt schwer denkbar.«
»Ein Herzensprojekt, das ein Flugzeug braucht?«
»Genau. Ich habe zugunsten meines Bruders auf meinen Anteil an der Tabakfarm verzichtet und dafür von meinem Vater eine ausgedehnte Buschsavanne im Norden Simbabwes geerbt. Sie ist weitgehend unerschlossen und die Heimat von Tausenden von Wildtieren. Und dort habe ich mir meinen Lebenstraum erfüllt. Seit sechs Jahren betreibe ich eine kleine Lodge südlich des Kariba-Stausees. Mit den Safaris bieten wir unseren Besuchern die einmalige Gelegenheit, sich von der Magie unberührter afrikanischer Wildnis verzaubern zu lassen.«
Max starrte Godwin an. In diesem Moment beneidete er den Mann.
»Mein Gott, wie schön«, sagte er leise. »Auf einer Lodge in Afrika zu arbeiten, wäre auch mein Traum.«
4
WWF-Geschäftsstelle Frankfurt – Mai 1989
IN DEN MONATEN nach der Konferenz in London war Max sehr beschäftigt. Von seiner Reise nach Sambia im Februar hatte er die konkrete Anfrage örtlicher Naturschützer für ein Engagement des WWF in einem Naturreservat im Südosten des Landes mitgebracht. Die deutsche Sektion hatte sich nach längerer Prüfung im April dafür entschieden und Max als Projektmanager mit der weiteren Planung und Umsetzung beauftragt.
Vor ihm auf seinem Schreibtisch in Frankfurt lag eine Landkarte Sambias, die geplante Fläche des Schutzgebiets war hellgrün markiert. Sie reichte von Livingstone im Westen, entlang des Sambesi bis zu dem Punkt, an dem dieser in den riesigen Kariba-Stausee mündete.
Max war immer wieder fasziniert von der Entstehungsgeschichte des Sees, durch dessen Mitte die heutige Grenze zwischen Sambia und Simbabwe verlief. Im November 1956 war in Kariba mit dem Bau einer über hundert Meter hohen Staumauer begonnen worden, die den Sambesi über drei Jahre hinweg zu einem 280 Kilometer langen See anschwellen ließ – dem größten künstlichen Stausee der Welt. Verantwortlich für das Projekt waren die damaligen Nachbarstaaten Nord- und Südrhodesien, die sich von dem Wasserkraftwerk im Damm eine verlässliche Stromversorgung sowohl für den Kupfergürtel im nördlichen Teil als auch für die Großfarmen und die Industrie im südlichen Teil versprachen.
Im Rahmen des Projekts wurden über 50.000 Menschen vom Stamm der Tonga, die seit Jahrhunderten entlang des Sambesi lebten, zur Umsiedelung gezwungen. Sie verloren dadurch nicht nur ihre traditionellen Wohngebiete, sondern auch den Zugang zum Wasser – Quelle ihrer Rituale und Sitz ihrer Götter.
Berühmt wurde das Projekt jedoch vor allem durch das, was mit den Wildtieren passierte, die im Überschwemmungsgebiet lebten. Hunderttausende flohen vor dem Ansteigen des Wassers, der Großteil in die weitgehend unberührte Buschsavanne südlich des Sees. Viele Tiere wurden allerdings vom Wasser überrascht und fanden sich plötzlich auf Inseln im Stausee wieder. Sechstausend von ihnen wurden in einer aufwendigen, international organisierten Aktion, die am Ende über fünf Jahre dauerte, auf das Festland gerettet.
Die Rettungsaktion bekam von Journalisten den Namen »Arche Noah« und erregte weltweit Aufsehen. Max erinnerte sich an Berichte, die er im Archiv gefunden hatte. Dort beschrieben Wildhüter, wie sie die panischen Tiere einzufangen versuchten. Oft gelang das erst, nachdem diese erschöpft und hungrig den Kampf aufgaben. Die besonders schweren Geschöpfe, wie Büffel, Rhinos und Elefanten, mussten eingeschläfert werden und wurden dann auf Flößen, die die Helfer aus leeren Ölfässern und Holzplanken gezimmert hatten, aufs Festland geschafft.
Max starrte auf die Landkarte vor ihm und malte sich aus, was dort vor über 30 Jahren passiert sein musste. Sechstausend Wildtiere – eines nach dem anderen – einzufangen und über Wasser an Land zu bringen! Ein Bericht ging sogar so weit, detailliert den Fang von Schlangen zu beschreiben, die in Säcken mit Booten in ihre neue Heimat transportiert wurden.
Die Landkarte auf seinem Schreibtisch endete nicht direkt an der sambischen Staatsgrenze, sondern deckte noch einen schmalen Streifen des nördlichen Simbabwe ab. Hier, unterhalb des Karibasees, musste das Gelände liegen, das Godwin Brown auf dem Flug nach Harare erwähnt hatte. Dort musste die Lodge stehen. Auffallend war, dass in dem riesigen Gebiet keine Straßen und keine menschlichen Ansiedlungen eingezeichnet waren. Was hatte Godwins Vater dazu gebracht, hier Land zu erwerben? Und seinen Sohn, dort eine Lodge aufzubauen?
Natürlich hatte Max während seiner Tätigkeit in Tansania für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und später als Projektmanager beim WWF immer wieder auf Lodges übernachtet und die Stunden inmitten der atemberaubenden Natur Afrikas genossen. Auf die Idee, selbst eine Lodge zu führen, wäre er aber bis heute nicht gekommen.
»Da ist ein Anrufer für Sie in der Leitung, Herr Berger«, rief Frau Kerner aus dem Vorzimmer durch die offenstehende Tür. »Aus Simbabwe. Ich habe ihm gesagt, dass Sie im Moment nicht gestört werden wollen, aber er lässt sich nicht abwimmeln. Er meint, es sei sehr dringend.«
»Ist okay. Stellen Sie ihn durch.«
In der Leitung zirpte es.
»Hallo Max. Godwin Brown hier.«
Max war perplex.
»Hallo, sind Sie noch dran? … Max? … Die Verbindung ist schlecht. Ich rufe aus Harare an. Sie erinnern sich? Ihr Sitznachbar auf dem Nachtflug von London nach Harare?«
Endlich fand Max die Sprache wieder. »Hallo, Godwin, sorry, ich …«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Hören Sie, ich weiß nicht, wie lange die Verbindung steht. Es ist etwas passiert. Ich muss dringend für einige Zeit nach England. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich vorstellen könnten, die Amkila River Lodge einige Monate vertretungsweise zu führen. Sie müssten dazu spätestens Ende September hier auftauchen. Ich weiß, das kommt jetzt sehr überraschend, aber es gibt gute Gründe, die ich Ihnen später erläutern kann. Ich faxe alle Details, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen können. Und wir telefonieren dann wieder.«
In der Leitung rauschte es.
»Godwin?«, rief Max. »Hallo? … Hallo!«
Er hörte ein lautes Knacken. Dann ertönte das Freizeichen. Max hielt den Hörer vor sich in die Luft und starrte darauf. Das konnte doch nicht wahr sein. Ja, sie hatten irgendwann in der Nacht nach einigen Whiskys über Träume gesprochen. Godwins Traum war die Lodge. Errichtet auf dem ausgedehnten Buschland seiner Familie. Max hatte damals nicht gefragt, wie die Browns daran gekommen waren, aber seine Kenntnisse der Kolonialgeschichte Rhodesiens ließen ihn vermuten, dass der clevere Vater von God-win das Land einem afrikanischen Chief abgeluchst haben musste.
Wie stellte sich Godwin die Sache vor? Er konnte doch nicht ernsthaft annehmen, dass ein Max Berger untätig herumsaß und nur darauf wartete, dass jemand anrief, den er kaum kannte, und er dann mir nichts, dir nichts seine Sachen packen und nach Afrika fliegen würde.
Aber warum sollte er das eigentlich nicht tun? War er nicht schon einmal in seinem Leben in einer vergleichbaren Situation gewesen und hatte genau das getan, was er jetzt weit von sich wies? Er würde diesen Moment im Frühjahr 1970 nie vergessen, hatte er doch sein Leben grundlegend verändert. Er war mitten im Psychologiestudium, als er die Einladung einer deutschen Familie erhielt, nach Indonesien zu reisen und dort für ein Jahr als Hauslehrer ihre beiden Kinder zu unterrichten. Damals hatte er keine Sekunde gezögert, das Angebot anzunehmen. Obwohl es bedeutete, sein Studium zu unterbrechen, und es um ihn herum nur Unverständnis gab.
Vermutlich würde sein Umfeld auf die Anfrage Browns auch heute wieder ähnlich reagieren. Den größten Widerstand würde es aber wohl von seinen Eltern geben, da sie überglücklich waren, dass ihr Sohn nach dem vierjährigen Aufenthalt in Tansania endlich wieder nach Deutschland zurückgekehrt war und seit mehreren Jahren eine feste Stelle in Frankfurt hatte.
Erschwerend kam hinzu, dass sein Vater schon Mitte siebzig war. Vor allem seine Mutter spielte inzwischen immer häufiger auf diese Tatsache an.
»Wir machen uns schon Gedanken, Max, wie das mit uns im Alter werden soll. Im Moment sind dein Vater und ich ja noch gut beieinander, auch wenn die Augen nachlassen und meine Hände am Klavier nicht mehr mitmachen wollen«, hatte seine Mutter bei seinem letzten Besuch in Süddeutschland gemeint, als sie zu dritt am runden Esstisch saßen und dem selbstgebackenen Träubleskuchen zusprachen.
»Wir sehen es bei unseren älteren Freunden, Max: Es ist gut, wenn die Kinder in der Nähe sind. Du erinnerst dich doch an die Webers vorne in der Straße. Da wurde der Mann plötzlich krank, und die Tochter – du weißt schon, diese verklemmte Person mit der unmöglichen Frisur –, also, die konnte ja auch nicht weit genug von den Eltern wegziehen und jetzt, wo der Vater bettlägerig ist und …«
Max hatte Mühe, seine Mutter zu unterbrechen. Die Geschichte war weder neu noch interessierte sie ihn wirklich. Seine Intervention hielt sie aber nicht davon ab, stattdessen ihr Lieblingsthema anzuschneiden: »Wir machen uns nicht nur Gedanken um uns selbst, nicht wahr, Julius?«
Sein Vater setzte sofort seine unbeteiligte Miene auf und schob sich ein großes Stück Kuchen in den Mund, das ihn für unbestimmte Zeit an einer Antwort hindern würde.
Hilde Berger schüttelte unwillig den Kopf und fuhr fort: »Was dich angeht, mein Junge, ist es überhaupt nicht gut, dass du immer noch ohne Frau lebst.«
»Es gibt Frauen in meinem Leben«, wandte Max ein.
»Das ist genau dein Problem! Immer der Schmetterling! Von einer Blüte zur anderen!«
»Stelle ich mir eigentlich auch ganz schön vor«, murmelte Max’ Vater durch den Träubleskuchen.
»Das darf doch nicht wahr sein«, fauchte seine Frau ihn an. »Statt mir in den Rücken zu fallen, solltest du auf deinen Sohn einwirken, eine Frau fürs Leben zu finden.«
Sie stand auf, warf beiden einen wütenden Blick zu und lief in die Küche. Vater und Sohn grinsten sich verständnisvoll an.
An diese Situation am Esstisch seiner Eltern musste Max denken, als er im Anschluss an das Telefonat mit Brown gedankenverloren den Hörer auf die Gabel gelegt hatte.
Er lachte dabei vor sich hin. Er liebte seine Eltern und konnte sich keine besseren vorstellen. Die verbalen Scharmützel, vor allem mit seiner Mutter, hatten einen liebevoll-spielerischen Charakter und waren nicht ernst zu nehmen. Gedanken um die Zukunft seiner Eltern machte er sich aber tatsächlich. Und immer öfter. Konnte er, längerfristig gesehen, ruhigen Gewissens im Ausland arbeiten und seine alten Eltern allein lassen? Welche Verantwortung hatte er? Inwieweit durfte er seine eigenen Bedürfnisse und Träume in den Vordergrund stellen? Wo begann der Egoismus?
»Sie denken an Ihre Sitzung, Herr Berger?«
Die Stimme von Frau Kerner riss ihn aus seinen Gedanken. Er suchte einige Papiere zusammen, verließ sein Büro und ging den Flur entlang zum Konferenzraum.
Als er nach einer Stunde zurückkam, hatte sein Fax einen kleinen Stapel Papiere ausgespuckt. Brown konnte es offensichtlich nicht schnell genug gehen.
Obwohl er sich mit einem wichtigen Strategiepapier seiner Organisation hätte befassen müssen, das er heute noch kommentiert absenden musste, griff Max aufgeregt nach den Faxseiten.
Auf den ersten Seiten fand sich eine kompakte Zusammenstellung aller Informationen zur Amkila River Lodge: eine Lagebeschreibung mit skizziertem Lageplan und die Auflistung und Kurzbeschreibung aller infrastrukturellen und baulichen Einrichtungen, einschließlich des privaten Hauses von Godwin.
Die Folgeseiten präsentierten die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen drei Jahre, inklusive Umsatz und Gewinn und die Zahlen zur Auslastung durch die Gäste. Max sah, dass die Lodge über die Jahre eine Belegung von neunzig Prozent hatte. War das ein guter Wert? Dafür, dass die Lodge nach Aussage von Godwin am Ende der Welt lag und nur sehr schwer zu erreichen war, kam ihm diese Zahl hoch vor. Trotzdem reichte die Auslastung kaum aus, um rentabel zu wirtschaften.
Aber spielte das für einen Multimillionär wie Brown überhaupt eine Rolle? Die Lodge war kein gewöhnliches Investment. Sie war sein Traum. Vermutlich durfte man bei Träumen nicht an Zahlen denken, sagte sich Max. Die Zahlen würden die Träume auffressen.
Die letzte Seite enthielt eine Stellenbeschreibung für einen Manager, die aber sehr kurz und allgemein gehalten war und dem Standard eines Unternehmens nicht gerecht geworden wäre. Offensichtlich ging Godwin davon aus, dass es so etwas nicht brauchte. Er schien sicher zu sein, dass Max der richtige Mann für den Job war, und daraus ergab sich keine Notwendigkeit für ausgefeilte Arbeitsverträge.
In einer handschriftlichen Notiz unter dem gedruckten Text ließ er Max wissen, dass er sich sehr freuen würde, wenn dieser Interesse hätte und das Angebot annähme.
Und er schrieb weiter: Bitte rufen Sie mich so bald als möglich zurück. Die private Telefonnummer steht oben auf dem Fax. PS: Es gibt einen persönlichen Grund, warum ich sehr schnell Ihre Entscheidung brauche. Es hat mit dem gesundheitlichen Zustand meiner Frau Violette zu tun.
Tatsächlich reagierte Max, wie von Godwin gewünscht, sehr schnell auf das Angebot. Sein Arbeitgeber hatte Verständnis für seinen Wunsch, möglichst bald aus seinem Vertrag auszusteigen. Max war sich nicht sicher, ob es nur mit dem wohlwollenden Verständnis der Führung zu tun hatte oder ob in der deutschen Sektion durchgesickert war, dass er frustriert war von dem, was im WWF passierte und der Organisation zunehmend kritisch gegenüberstand.
Ein Nachfolger für seine Stelle konnte problemlos innerhalb seines Teams gefunden werden. Bei seiner Verabschiedung gab es vereinzelt Tränen. Der Großteil der Kollegschaft wünschte ihm von Herzen viel Erfolg, einige wenige gönnten ihm sein Glück nicht oder konnten schlichtweg nicht nachvollziehen, warum ein Mann von heute auf morgen eine ordentlich bezahlte, sichere Stelle in Deutschland gegen eine zeitlich begrenzte Anstellung auf einer Lodge am »Arsch der Welt« – wie sich sein Kollege Riethmüller ausdrückte – eintauschte.
Selbst der Abschied von seiner Kollegin Melanie, mit der er in unregelmäßigen Abständen guten Sex gehabt hatte, verlief reibungslos. Als sie an einem seiner letzten Abende in Frankfurt verschwitzt nebeneinander auf dem Boden lagen, gestand sie ihm, dass sie seit längerem auch mit dem Kollegen Bauknecht intim verkehre und Max sich deshalb nicht wundern dürfe, dass sich ihr Abschiedsschmerz in Grenzen halte.
Max wunderte sich nicht, sondern zog sich an, küsste sie noch einmal zärtlich und verließ still die Stätte seines Wirkens.
5
Simbabwe – September 1989
FÜNF MONATE NACH dem Telefonat mit Godwin Brown landete Max Ende September an einem klaren Morgen auf dem internationalen Flughafen in Harare. Ein kräftiger schwarzer Mann in einer Khakiuniform erwartete ihn mit handgeschriebenem Namensschild Mr. Berger am Fuß der Gangway. Der Mann stellte sich als Lovemore Vudzijena vor und bedeutete Max, dass er als Angestellter im Sicherheitsbereich des Airports arbeite und in dieser Funktion unter anderem die privaten Gäste Browns durch die Kontrollen schleuse. Dann schnappte er sich Max’ Reisetasche, bat ihn um seinen Pass und lief mit großen Schritten los.
Die offiziellen Schalter der Passkontrolle, an denen sich lange Schlangen von Passagieren des vor ihnen gelandeten Flugzeugs der Kenya Airways aus Nairobi gebildet hatten, umging der Hüne, indem er mit Max durch eine seitliche Tür in ein Büro verschwand. Dort wechselte er einige Worte mit einem Beamten der Einwanderungsbehörde, der Max’ Pass kontrollierte und stempelte und ihm einen schönen Aufenthalt in Simbabwe wünschte. Wieder zurück in der freudlosen Ankunftshalle, steuerte Love-more auf einen Durchgang zu, der sich neben einer der hölzernen Kabinen befand, in denen uniformierte Beamte die wartenden Passagiere abfertigten. Max schaute unverwandt nach vorne, um sich nicht den bösen Blicken der Reisenden auszusetzen. Wenig später standen sie direkt im Bereich der Gepäckkontrolle.
Max ging davon aus, dass sie nun längere Zeit warten mussten, bis seine beiden Koffer auf dem verschlissenen Gepäckband erscheinen würden. Aber Lovemore schob ihn weiter.
»Ich kümmere mich um Ihr Gepäck. Es wird direkt zu Ihrem Flugzeug gebracht.« Dann rief er einem der Zollbeamten am Band zu: »Willst du in die Tasche unseres Gastes aus Deutschland schauen?«
Der Angesprochene winkte ab und machte ein Zeichen, dass sie durch die Zollkontrolle gehen könnten.
»Welcome to Zimbabwe!«, sagte Lovemore jetzt und zeigte zwei Reihen strahlend weißer Zähne. »Folgen Sie mir.«
Wenige Minuten später traten sie durch eine Sicherheitstür wieder auf das Flugfeld. In einiger Entfernung sah Max die Maschine der British Airways stehen, mit der er angekommen war. Im Moment wurde das Gepäck entladen.
Direkt vor ihnen parkten drei Sportflugzeuge. Eines davon eine Cessna. Max erkannte das Modell sofort. Und den Mann, der sich an der Motorhaube zu schaffen machte, kannte er auch.
Die Starterlaubnis vom Tower kam direkt, nachdem seine Koffer auf einem Gepäckwagen angekarrt und im Flugzeug verstaut worden waren. Der Controller hinter der Glasscheibe war mit bloßem Auge gut zu sehen. Er winkte ihnen nach der Startfreigabe kurz zu, Godwin hob die Hand in seine Richtung.
Als sie in der Luft waren und in etwa tausend Metern Höhe die Außenbezirke Harares in Richtung Nordwesten überflogen, erkundigte sich Max nach Violettes Befinden und Godwin erklärte, sie habe im Moment massive Beschwerden in der rechten Hüfte. Seiner Meinung nach war es allerhöchste Zeit, dass sie operiert wurde, aber davor hatte sie große Angst und hatte sich bislang geweigert. Ihrer Vertrauensärztin an der Avenues Clinic in Harare war es aber gelungen, sie von der Notwendigkeit einer künstlichen Hüfte zu überzeugen. Die Operation war für Mitte Oktober in einer renommierten Klinik im Herzen Londons geplant. Dort sollte sich auch eine mehrmonatige Rehabilitation mit Physiotherapie anschließen. Godwin wollte seine Frau keine Minute allein lassen. Er liebte sie.
Max entschloss sich, keine weiteren Fragen zu stellen. Godwin und Violette hatten ihren Entschluss gefasst und für ihn war es jetzt wichtig, möglichst schnell in seine neue Rolle als Interimsmanager der Lodge hineinzuwachsen.
So neugierig Max auch auf die Lodge war: das nächste Gesprächsthema der beiden Männer war nicht etwa Amkila, sondern Browns Privatflugzeug. Da sie beide Piloten und Flugenthusiasten waren, drehte sich alles um die Vorzüge und Schwächen der Cessna.
Die Fachsimpelei fand ihr Ende, als unter ihnen über viele Kilo-meter hinweg dunkelgrüne, einheitlich bepflanzte landwirtschaftliche Flächen auftauchten, die gut erkennbar von gigantischen Sprinkleranlagen bewässert wurden. Die Fontänen, die die Anlagen kreisförmig über das Grün schossen, glitzerten wie Diamanten in der Sonne. Was Max sah, erinnerte ihn an Luftaufnahmen der bewässerten Felder im Grain Belt im Norden der USA.
»Was wird da unten angebaut?«, fragte er.
»Tabak«, antwortete Godwin. »Die sandigen Böden sind dafür hervorragend geeignet. Ich vermute, wenige Menschen wissen, dass wir einer der größten Tabakproduzenten der Welt sind. Überwiegend Virginia. Und dass wir die beste Qualität liefern. Letzteres gilt aber nur für den kommerziell produzierten Tabak, der in den Großfarmen und fast zu hundert Prozent von weißen Farmern produziert wird. Die Schwarzen bauen auch Tabak an, aber nur für den lokalen Markt.«
»Und wo ist die Farm Ihres Bruders? Hier in der Gegend?«
»Ja. Wenn wir ein Stück weiter östlich fliegen würden, könnten wir sie sehen.«
Für eine Weile schwiegen sie und genossen den Flug. Max beobachtete, wie sich das Landschaftsbild unter ihnen veränderte. Je weiter sie kamen, desto mehr wurden die riesigen Farmen von ländlichen Kleinbetrieben abgelöst. Da sie relativ niedrig flogen, konnte Max deren Muster sehr gut ausmachen: eine strohgedeckte Rundhütte oder ein rechteckiges Holzhaus mit einem Dach aus Wellblech wurde umrahmt von mehreren kleinen bewirtschafteten Parzellen. Was genau angebaut wurde, ließ sich nicht erkennen.
»Vor allem Gemüse und lokales Getreide«, sagte Godwin auf Nachfrage und fügte unvermittelt hinzu: »Nach unserer Ankunft werde ich Sie am besten gleich meinen wichtigsten Mitarbeitern vorstellen. Und dann gehen wir zu meinem privaten Bungalow, in dem Sie die nächsten Monate wohnen werden. Violette hat in den Schränken und Kommoden schon Platz für Sie geschafft.«
Seit dem Start in Harare war etwas mehr als eine Stunde vergangen, als Godwin über das Armaturenbrett hinweg nach vorne deutete. Am Horizont tauchte eine glitzernde Wasserfläche auf.
»Der Kariba-Stausee«, erklärte Brown. »Sie werden bald Gelegenheit haben, ihn aus der Nähe zu sehen. Scott und Akash haben schon geplant, Sie dorthin mitzunehmen. Schließlich ist der See auch im Besuchsprogramm unserer Lodge und er ist eine echte Alternative zu den Safaris durch die Buschsavanne. Als Manager der Lodge müssen Sie schließlich wissen, was Sie unseren Gästen anbieten.«
Max konnte darauf nicht antworten. Als Manager der Lodge! Für ihn war in diesem Moment sein neuer Job noch vollkommen irreal. Es war alles so furchtbar schnell gegangen. Und wie erstaunlich glatt die Abschiede verlaufen waren! Sowohl von seinen Kollegen im Büro als auch von seinen Eltern und Freunden. Ließ sich das dadurch erklären, dass er seit Beginn seines Studiums viel gereist war und über Jahre hinweg im Ausland gelebt hatte? War da schon eine gewisse Routine eingekehrt? Am schwersten war ihm wieder der Abschied von den Eltern gefallen. Er ließ die beiden ungern allein, aber am Ende überwog seine Vorfreude auf das Neue.
»Sehen Sie mal nach unten!« sagte Godwin. »Wir überfliegen im Moment das Escarpment, die Abbruchkante des Hochlandes. Von hier geht es fast sechshundert Meter steil in die Tiefe. Sie werden diese Strecke in Zukunft häufiger fliegen. Ab hier ist besonders große Vorsicht geboten. Durch die Hitze, die vom Sambesi-Tal hochkommt und sich mit der kühleren Luft des Hochlands mischt, entstehen gefährliche Luftwirbel. Sie müssen beim Anflug möglichst lang Höhe halten, über die Kante hinaus. Dann ziehen Sie die Cessna in einer steilen Kurve zügig nach unten, fliegen parallel zum Hang und schwenken danach auf die Piste der Lodge ein. Ich nehme an, dass Sie Starts und Landungen auf sehr kurzen Pisten gewohnt sind?«
Max überlegte noch, was er darauf antworten sollte, da hörte er Godwin sagen: »Am besten übernehmen Sie jetzt selbst und probieren den Anflug gleich mal aus.«
Mit diesen Worten ließ er demonstrativ seinen Steuerknüppel los. Max übernahm blitzschnell. Verdammt, der Kerl diskutierte nicht lange herum. Sobald Max die Kontrolle über das Flugzeug hatte, spürte er eine routinierte Ruhe einkehren. Er war oft genug mit der Cessna geflogen, hatte vor allem in Tansania einige kritische Situationen in der Luft sowie anspruchsvolle Landungen ohne Probleme überstanden. Er spürte, wie Godwin ihn von der Seite beobachtete, aber so tat, als ob er interessiert aus dem Fenster schauen würde.
Plötzlich wurde die Maschine kräftig durchgeschüttelt.
»Wie versprochen«, kommentierte Godwin.
Das Flugzeug tanzte regelrecht durch die Luft, die Stöße kamen unberechenbar von allen Seiten.
»Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Steilkurve«, sagte God-win.
Max schob die Nase der Maschine nach unten und kippte über den linken Flügel ab.
»Da hinten sehen Sie die Lodge«, sagte Godwin nach weiteren zehn Minuten. »Erkennen Sie den dunkelbraunen Streifen der Landebahn? Parallel zum Fluss?«
Max holte tief Luft. Die Lodge. Wie an einer Schnur aufgereiht lagen die Bungalows und mehrere größere Funktionsgebäude entlang des schmalen Flusses, der trotz des Endes der Trockenzeit immer noch gut Wasser führte. Etwas entfernt vom Ufer konnte er eine Ansammlung strohgedeckter Rundhütten entdecken. Ansonsten gab es im weiten Umkreis keine menschliche Ansiedlung.
Wenig später setzte Max das Flugzeug auf der Graspiste auf. Die Cessna machte mehrere Luftsprünge. Er musste stärker als erwartet bremsen, da wenig Platz für den Auslauf blieb. Die Maschine bockte und kam dann in einer Staubwolke zum Stehen.
»Gut gemacht, Max. Wir sind da. Welcome to Amkila River Lodge!«
Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Auf der Lodge sind wir übrigens alle per Du.«
Eine Begrüßung der Mitarbeiter direkt nach ihrer Ankunft fiel ins Wasser. Wie sich herausstellte, hing Lindiwe, Godwins Assistentin, mit dem Reisebüro in Harare am Telefon. Die beiden Ranger waren mit Gästen auf Safari. Das Küchenteam bereitete das Mittagessen vor, das Hausmädchen richtete die Gästehäuser, und der Hausmeister bastelte seit Stunden am Generator. Diese Informationen erhielten sie von einem der beiden Sicherheitsleute, einem kräftig gewachsenen Schwarzen namens Kutenda, der sie an der Landepiste erwartete, Max die Tasche abnahm und ihnen über einen grasbewachsenen Pfad die wenigen hundert Meter bis zur Lodge folgte.
»Komm weiter, Max,« sagte Godwin, als sie vor einem langen, flachen Gebäude standen. Über einer offenstehenden Tür prangte ein hölzernes Schild mit der Aufschrift Reception. »Wir lassen die Angestellten erst mal in Ruhe und gehen nach hinten zu meinem Bungalow. Dort setzen wir uns auf die Terrasse und stoßen auf deine Ankunft an. Alles andere ergibt sich von selbst. Kutenda wird dein restliches Gepäck bringen.«
»Ihr habt Gäste, die mit dem eigenen Flugzeug anreisen?« Max starrte Lindiwe ungläubig an, als sie zwei Stunden später im Rah-men seiner Einführung mit ihm über die Lodge sprach. Godwin hatte ihm seine Assistentin vorgestellt und sie dann allein gelassen.
»Du hast keine Vorstellung, wie reich manche Leute sind. Ich rede hier nicht nur von Gästen aus Europa oder Amerika. Millionäre gibt es selbst hier in Simbabwe und in allen sogenannten armen afrikanischen Ländern. Es sind lokale Geschäftsleute und Politiker. Beide Gruppen profitieren auf ihre Weise vor allem von unseren Bodenschätzen. Und an die kommen sie relativ ungehindert, weil die allgegenwärtige Korruption Deals jeglicher Art möglich macht.« Lindiwe schaute ihn fragend an, als wolle sie prüfen, ob sie ihm gegenüber so offen sein durfte. Als Max zustimmend nickte, erklärte sie lächelnd: »Solange sie ein gutes Trinkgeld geben, kann es uns Mitarbeitern im Grunde egal sein, woher das Geld kommt. Wir können die Entwicklung in unseren Ländern sowieso kaum beeinflussen. Aber reich heißt leider nicht automatisch großzügig. Wir haben hier schon alles erlebt: den Gast, der nach einem Wochenende in seinem Bungalow einen Umschlag mit mehreren hundert US-Dollar hinterlässt – zusammen mit einem freundlichen Dankesschreiben. Und den Multimillionär mit Privatflugzeug, der auf den Cent abrechnet.«
Max war glücklich, eine Frau wie Lindiwe an seiner Seite zu wissen. Ihre frische und offene Art gefiel ihm. Godwin hatte schon auf der Terrasse seines Hauses bei einem eiskalten Gin Tonic von ihr geschwärmt.
»Eine Frau wie sie müsste in die Politik gehen, ein Ministeramt übernehmen und den korrupten und verkalkten Politikern um Mugabe so richtig in den Arsch treten.« Bei diesem Gedanken grinste er breit. »Dass Lindiwe bei mir eine verantwortungsvolle und gut bezahlte Stelle einnehmen kann, verdankt sie vor allem ihrem Vater, der als Pastor früh mit weißen Missionaren in Berührung kam und durch sie die Möglichkeit erhielt, in England zu studieren. Dadurch konnte er über den eigenen Teller-rand hinausschauen und seine Tochter zu einer selbstbewussten Frau erziehen. Sicher hat auch geholfen, dass sie bis heute nicht geheiratet hat und so der Kontrolle durch einen afrikanischen Mann entgangen ist.«
»Schau, Max.« Lindiwe öffnete das großformatige, in dunkles Büffelleder gebundene Buch, das auf dem Tresen im Empfangsgebäude neben dem schwarzen Telefonapparat lag. »Hier registrieren wir die Gäste, notieren die Kontaktdaten und halten die wichtigsten Informationen bezüglich ihres Aufenthaltes fest. Welches Haus sie bewohnt haben. Ob es Sonderwünsche bezüglich des Essens gab. Welche Sonderleistungen sie in Anspruch genommen haben. Dazu gehören Safaris mit den Rangern, individuell organisierte Events, wie etwa ein privates Abendessen unter einem alten Baobab am Flussufer oder ein Flug mit der Cessna zu den Victoriafällen. Diese Dinge müssen separat abgerechnet werden.«
»Wie muss ich mir die klassische Klientel der Lodge vorstellen?«, fragte Max.
»Da können wir doch einfach in unserem schlauen Buch die Belegung dieser Woche anschauen. Ich glaube, die ist recht typisch«, sagte Lindiwe und blätterte bis zur letzten beschriebenen Seite des Gästebuchs. »Von den vier Gästehäusern sind drei durchgängig bis Ende der Woche belegt. Das vierte steht seit heute Morgen leer, ist aber für das kommende Wochenende gebucht. Okay, wen haben wir da? Fangen wir vorne in der Reihe an und gehen dann den Fluss entlang: Im ersten Bungalow, den du von hier aus sehen kannst, wohnt seit gestern ein südafrikanischer Geschäftsmann mit Frau. Ob es seine eigene ist, darüber haben Scott und ich noch eine Wette laufen. Die beiden haben verschiedene Nachnamen, aber das sagt ja erst mal nichts. Ich finde, er ist viel zu aufmerksam der Frau gegenüber, als dass es seine Ehefrau sein könnte.«
Max lachte schallend los. »Lindiwe, Lindiwe! Was hast du für Vorstellungen von der Ehe?«
»Liege ich wirklich so falsch? Wir zwei haben doch schon etwas Lebenserfahrung, oder? Auch wenn wir beide nicht verheiratet sind.«
»Wie kommst du darauf, dass ich ledig bin?«
»Nun ja, Godwin hat uns einiges über dich erzählt.« Sie lächelte.
»Nur Gutes natürlich.«
Max musste gestehen, dass er Lindiwes Logik in Bezug auf das Verhalten des Paars im ersten Bungalow problemlos folgen konnte.
»Wir haben übrigens auch immer wieder Paare, die für außerehelichen Sex hier absteigen. Hier kann man sich wirklich gut verstecken. Meist sind es Geschäftsleute und Politiker aus Harare mit ihren Freundinnen. Die schwarzen Männer hier im Land haben keine Probleme mit dem Fremdgehen. Ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld. Sie sind stolz auf ihre Potenz. Und noch stolzer darauf, dass sie es ohne Kondom machen. Obwohl inzwischen alle wissen, welche Gefahr von AIDS ausgeht. Für die konservativen Weißen ist es dagegen schon eher ein gesellschaftliches Risiko, beim Fremdgehen erwischt zu werden.«
Max wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Er war es gewohnt, sehr offen über Sex zu reden, aber diese erstaunliche Frau brachte ihn tatsächlich etwas aus der Fassung.
»Und wer bewohnt Haus 2?«, fragte er schnell.
Lindiwe schaute ihn kurz belustigt an, beugte sich dann über das Buch und fuhr mit ihrem dunkelrot lackierten Nagel die Zeile entlang.
»Professor Emerson, begleitet von Mrs. Emerson, beide USA-merikaner, auf Rundreise durch das südliche Afrika. Fünf Tage bei uns gebucht. Ein sehr ruhiges, angenehmes Paar.«
Sie bewegte ihren Finger in die nächste Zeile. Max starrte auf ihre Hand. Die samtige, schwarze Haut. Die langen, wohlgeformten Finger. Sie passten zu ihrer Besitzerin. Lindiwe war schlank und feingliedrig. Leicht gelockte, schwarze Haare umrahmten ihr oval geschnittenes Gesicht mit den großen dunklen Augen. In der kurzärmeligen weißen Bluse und den knielangen Khakishorts wirkte sie sportlich und dynamisch. Wie eine Leichtathletin.
»Ist was, Max?«
»Nein, nein … Und wer wohnt in den Häusern 3 und 4?«
»Zwei Einzelreisende aus Italien und Österreich. Sie reisen in wenigen Tagen ab. Zusammen mit den Amerikanern.«
»Wie ist denn die Auslastung der Lodge?«, fragte Max, der sich an die Zahlen in den Unterlagen, die ihm Godwin zur Verfügung gestellt hatte, erinnerte, aber gerne eine Bestätigung gehabt hätte.
»Sie ist fast das ganze Jahr überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu anderen Unterkünften im Land.«
»Heißt konkret was?«
»Etwa 90 Prozent.«
»Und das bei der Lage – oder gerade wegen der Lage?«