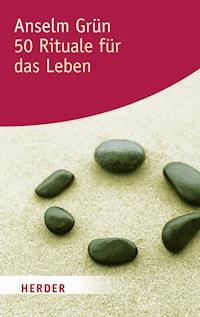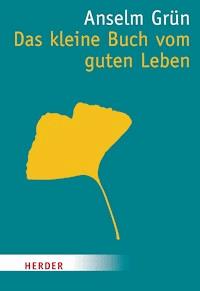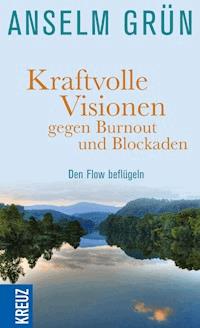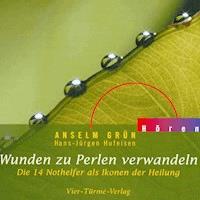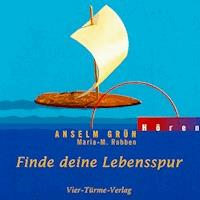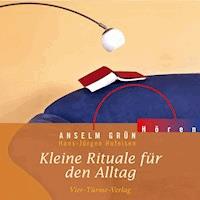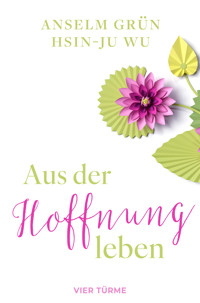
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hoffnung ist ein zentrales Thema für unsere Zeit. Angesichts der Entwicklungen in unserer Gesellschaft , aber auch der Nachrichten aus der ganzen Welt kann sie ein wichtiges Gegengewicht zu den Gefühlen von Ohnmacht und manchmal auch Verzweiflung sein, die uns zu überfluten drohen. In diesem Buch betrachten Anselm Grün und Hsin-Ju Wu die Hoffnung aus philosophischer, psychologischer und spiritueller Sicht. Zudem finden sie tragfähige Antworten auf wichtige Fragen zum Thema wie: Was unterscheidet Hoffnung von Erwartung? Wie können selbst Pessimisten Hoffnung einüben? Wie können wir trotz Krieg auf Frieden hoff en? In einem zweiten Teil zeigen sie praktische Wege auf, wie wir selbst die Hoffnung täglich nähren und wirksam machen, wie wir aus der Hoffnung leben können. So wird sie zu einer Kraft , um gemeinsam mit anderen, an einer menschlicheren Welt zu arbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie. Detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Printausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2025
ISBN 978-3-7365-0680-0
E-Book-Ausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2025
ISBN 978-3-7365-0702-9
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Erstellung: Sarah Östreicher
Lektorat: Antonie Hertlein
Covergestaltung: Finken und Bumiller, Stuttgart
Covermotiv: wacomka / shutterstock.com
www.vier-tuerme-verlag.de
Anselm Grün Hsin-Ju Wu
Aus der Hoffnung leben
Vier-Türme-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Vorwort »Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte«
Kapitel 1 Biblische Aussagen zur Hoffnung
1. Petrusbrief – Gebt Rechenschaft über die Hoffnung
Paulusbriefe – Die Liebe hofft alles
Hebräerbrief – Hoffnung als Anker der Seele
Pastoralbriefe – Ethische Werte für ein gutes Leben
Lukas – Hoffnung und Heilung für Ausgegrenzte
Kapitel 2 Philosophie der Hoffnung
Thomas von Aquin – Hoffnung als gottgeschenkte Lebenskraft
Henri Bergson – Hoffnung als »Élan vital«
Hildegard von Bingen – Grünkraft als heilende Lebensenergie
Gabriel Marcel – Konkrete in absolute Hoffnung verwandeln
Ernst Bloch – Hoffnung als Motor für die Verwandlung der Welt
Corine Pelluchon – Hoffnung entsteht aus der Tiefe unserer Ohnmacht
Byung-Chul Han – Das Trotzdem der Hoffnung gegen alle Verzweiflung
Psychologische Aussagen – Die Hoffnung ist dem Menschen immanent
Kapitel 3 Aus der Hoffnung leben
Hoffnung, nicht Erwartung weckt die Kraft in jungen Menschen
Enttäuschte Hoffnung entlarvt die Täuschung
Die Liebe hofft alles
Die Hoffnung gibt niemanden auf
Hoffnung stiftet Sinn
Trotz Krieg auf Frieden hoffen
Spiritualität der Hoffnung
Das Sein als Grundlage
Das Tun strömt aus dem Sein
Nehmen und Empfangen als Kraftquelle
Hoffnung als innere Kraft prägt unser Sein
Glaube und Liebe nähren die Hoffnung
Hoffnung auf die Auferstehung – Im Tod Vollendung finden
Das Kreuz als radikalstes Zeichen der Hoffnung
Hoffnung als Kraftquelle – fest verankert in unserer Seele
Hoffen und Handeln – Einsatz für eine menschlichere Welt
Kapitel 4 Die Hoffnung einüben
In Berührung kommen mit der Hoffnung, die schon in uns ist
Wie Pessimisten Hoffnung einüben können
Sehnsucht führt uns zur Hoffnung
Gute Erinnerungen schenken Hoffnung und Zuversicht
In schwerer Zeit die Hoffnung vorausträumen
Die heilende Kraft der Hoffnung
Eltern legen Hoffnung in ihre Kinder
Falsche Hoffnungen blenden die Realität aus
Segensrituale zum Einüben von Hoffnung
Hoffnungsworte der Bibel als stärkende Begleiter
Gottesdienste als Ort der Hoffnung
Immer wieder aufblühen – Die Natur als Quelle der Hoffnung
Abschluss Als Pilger der Hoffnung an einer menschlicheren Welt arbeiten
Literaturangaben
Orientierungsmarken
Cover
Impressum
Buchtitel
VORWORT»Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte«
Das Symposium zur Feier des 80. Geburtstages von P. Anselm im Januar 2025 stand unter dem Motto »Was uns Hoffnung gibt«. Unter den Teilnehmern war deutlich zu spüren, wie wichtig dieses Thema gerade für unsere Zeit ist. In vier Gesprächen näherten wir uns jeweils von einem anderen Gesichtspunkt aus dem Thema Hoffnung. Mit dem Religionsphilosophen und Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi sprachen wir über die Hoffnung, dass sich die Religionen gegenseitig befruchten und sich gemeinsam für den Frieden in dieser Welt einsetzen, anstatt – wie es heute leider oft der Fall ist – sich gegenseitig zu bekämpfen. Hsin-Ju Wu, die Mitautorin dieses Buches und Mutter von zwei studierenden Kindern, sprach vor allem über junge Menschen, die Hoffnung oft mit Erwartung verwechseln und dann enttäuscht sind, wenn sich ihre Erwartungen nicht erfüllen. Bernd Deininger, Psychoanalytiker und ehemaliger Chefarzt einer psychosomatischen Klinik, bezog sich auf die Säuglingsforschung, die zeigt, dass die Hoffnung dem Menschen gleichsam eingeschrieben ist. Sie ist eine wichtige Antriebskraft des Menschen. Ohne Hoffnung könnte ein Kind gar nicht leben. Bodo Janssen erzählte von seinen Erfahrungen als Inhaber des Hotelunternehmens Upstalsboom. Ein Koch, der ihm lange Zeit ein hoffnungsloser Fall zu sein schien, weil er trotz aller Gespräche und Bemühungen seine Lehrlinge sehr hart behandelte, wurde von einem zehnjährigen Mädchen verwandelt. Bei einem Aktionstag im Hotel hatten Kinder Kochmützen bemalt. Das Mädchen, in schwierigsten Verhältnissen aufgewachsen, überreichte dem Koch am Ende des Tages eine Mütze, ganz ohne Bild, aber mit dem Satz: »Das war der schönste Tag in meinem Leben.« Das Mädchen hat in diesem Mann eine Hoffnung erweckt, die ihn berührte und verwandelte. Ab diesem Zeitpunkt waren die Lehrlinge gerne in seiner Küche und schlossen bei der Prüfung als die besten ab. »Wir sollen niemals die Hoffnung aufgeben«, so lautete Bodo Janssens Fazit.
Die Gäste, die zu diesem Symposium geladen waren, gingen mit neuer Hoffnung nach Hause. Und sie freuten sich auf das Buch über die Hoffnung, das wir ihnen angekündigt haben. So hoffen wir beide – Dr. Hsin-Ju Wu, die mit 55 Jahren in Heidelberg in Diakoniewissenschaft promoviert hat, und Pater Anselm Grün, der seit über 60 Jahren im Kloster lebt –, dass auch unsere Leserinnen und Leser hoffnungsvoll auf ihr Leben schauen können und mit der Hoffnung in Berührung kommen, die von Geburt an in ihnen ist, aber oft genug durch die Enttäuschungen in ihrem Leben verdunkelt wurde.
Dass das Thema Hoffnung für die Menschen von heute lebensnotwendig ist, hat auch Papst Franziskus erkannt, der das Heilige Jahr 2025 unter das Motto »Pilger der Hoffnung« gestellt hat. Er zitiert in seinem Schreiben über das Heilige Jahr das Wort aus dem Römerbrief: »Spes non confundit – Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen; sie geht nicht unter, sie löst sich nicht auf« (vgl. Römer 5,5). Dass wir heute Hoffnung bitter nötig haben, zeigen auch zwei philosophische Bücher, die 2024 erschienen sind: »Die Durchquerung des Unmöglichen. Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe« von der französischen Philosophin Corine Pelluchon und »Der Geist der Hoffnung. Wider die Gesellschaft der Angst« des koreanisch-deutschen Philosophen Byung-Chul Han.
Viele Philosophen und Dichter haben sich über die Hoffnung Gedanken gemacht. Ihre Aussagen mögen weltfremd erscheinen, zumal für Menschen, die die heutige Welt mit ihren Kriegen, mit dem Klimawandel, der Polarisierung der Gesellschaft und den Hassbotschaften, die uns in den neuen Medien entgegengeschleudert werden, eher als hoffnungslos erleben. Doch vielleicht kann uns gerade Walter Benjamin, der deutsche Kulturphilosoph, der auf der Flucht vor der Gestapo selbst die Hoffnung verloren und Suizid begangen hat, auffordern, der Hoffnung in uns zu trauen. Er schreibt: »Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben.« Dieses Wort fordert uns heraus, Hoffnung zu leben in Solidarität mit allen Hoffnungslosen dieser Welt. Wir gehen gemeinsam mit ihnen den Weg durch diese Zeit und hoffen, dass wir sie mit unserer Hoffnung anstecken und aus ihrer Hoffnungslosigkeit befreien können.
In vielen Völkern gibt es Sprichwörter über die Hoffnung. Sie beschreiben die Hoffnung als eine Kraft, die uns hilft zu leben. Aus China stammt das Sprichwort »Hoffnung ist wie der Zucker im Tee. Auch wenn sie klein ist, versüßt sie das Leben«. Die Hoffnung hat also eine Auswirkung, sie verwandelt unser Leben. Das weiß auch das russische Sprichwort »Im Reich der Hoffnung wird es nie Winter«. Die Hoffnung vermag die Kälte zu überwinden, die uns oft von unserer Umwelt entgegenkommt, sodass das eigene Herz zu erkalten droht. In Polen kennt man das Sprichwort »Wer die Hoffnung vor seinen Wagen spannt, fährt doppelt so schnell«. All diese Sprichwörter beziehen sich auf die Hoffnung als eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Es ist nicht immer die religiöse Hoffnung gemeint, sondern die Hoffnung als eine Lebenskraft.
Der römische Dichter Ovid sagt in seinen Metamorphosen: »Die Hoffnung ist es, die die Liebe nährt.« Hölderlin bezieht die Hoffnung auf das Leben: »Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte.« Ähnlich sieht es Goethe, wenn er sagt: »Die Hoffnung hilft uns leben.« Dass diese Worte nicht einfach schön sind, sondern durchaus helfen, schwierige Situationen durchzustehen, zeigt ein Tagebucheintrag von Anne Frank, die wusste, dass sie von den Nazis ermordet werden würde: »Es ist ein Wunder, dass ich all meine Hoffnungen noch nicht aufgegeben habe, denn sie erscheinen absurd und unerfüllbar. Doch ich halte daran fest, trotz allem, weil ich noch stets an das Gute im Menschen glaube.« Die Hoffnung von Anne Frank zerbricht nicht, auch wenn das Erhoffte nicht eintritt, denn sie gründet auf ihrem Glauben an das Gute im Menschen. Es ist ein religiöser Glaube, der ihre Hoffnung nährt.
Auch viele Philosophen und Psychologen haben sich mit dem Phänomen der Hoffnung auseinandergesetzt. Sie bedenken die rein natürliche Dimension der Hoffnung als eine Lebenskraft, die in uns wirkt. Aber sie sind auch offen für die spirituelle Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Ein Konsens besteht zwischen den verschiedenen Philosophen darin, dass die Hoffnung einen Bezug zur Zukunft hat, dass sie immer etwas Gutes erhofft und dass es immer einen Unsicherheitsfaktor gibt. Die Hoffnung bezieht sich daher »auf ein zukünftiges, nicht völlig verfügbares und deshalb ungewisses Gut« (Edmaier 35). Wenn wir über Hoffnung nachdenken, ist es gut, Hoffnung genau von Erwartung zu unterscheiden. Die Erwartung richtet sich normalerweise auf andere Menschen und auf ein bestimmtes Ergebnis. Ich erwarte von meinem Sohn ein bestimmtes Verhalten. Ich erwarte von einem Angestellten Leistung. Die Erwartung kann daher immer enttäuscht werden. Bei der Hoffnung ist zu unterscheiden zwischen der Hoffnung auf konkrete Dinge und einer transzendenten Hoffnung. Ich hoffe, dass ich eine Prüfung schaffe, dass ich wieder gesund werde. Auch diese konkreten Hoffnungen können enttäuscht werden. Aber die Hoffnung beschränkt sich nicht auf die konkreten Dinge. Sie geht weiter. Die Hoffnung schaut nicht auf das Ergebnis, sondern auf den Prozess, und der ist immer offen. Über die konkrete Hoffnung hinaus gibt es die transzendente Hoffnung, die sich auf etwas richtet, was das rein Materielle und Irdische übersteigt. Es ist die Hoffnung auf Werte, wir hoffen auf Liebe und Frieden. Und wir hoffen auf ein Leben, das auch den Tod übersteigt, auf das ewige Leben, auf den Übergang in eine neue Welt. Diese Hoffnung macht sich keine konkreten Vorstellungen. Daher kann sie auch nicht enttäuscht werden.
Das Buch, das sowohl Juden als auch Christen seit über dreitausend Jahren trotz aller Rückschläge und Enttäuschungen Hoffnung vermittelt, ist die Bibel. Manchen mögen die biblischen Aussagen über die Hoffnung zu spirituell klingen und nicht ihrer Erfahrung entsprechen. Doch die Worte der Bibel haben den Menschen seit drei Jahrtausenden die Hoffnung geschenkt als eine Kraft, die sie befähigt hat, Krankheit und Unglück zu überstehen, nach verlorenen Kriegen nicht aufzugeben, in der Verbannung weiterzuhoffen, auch wenn realistisch gesehen kaum Hoffnung auf Befreiung bestand. Die Christen schöpften aus den Zusagen der Bibel eine Hoffnung, die sie trotz der Anfeindungen und Verfolgungen, die sie immer wieder erlebt haben, mit Zuversicht leben ließ und ihnen eine Freude schenkte, die ihnen die Verfolger und Folterer nicht zu rauben vermochten.
So geht es auch uns darum, die biblischen Aussagen auf unser Leben hin auszulegen. Wir wollen betrachten, wie unser konkretes Leben durch die Hoffnung verwandelt wird. Und wir wollen die Hoffnung, von der die Bibel spricht, auch verstehen. Der Grundsatz des Anselm von Canterbury »fides quaerens intellectum – der Glaube sucht nach Einsicht« gilt auch für die Hoffnung. Ernst Bloch spricht von der »docta spes«, von der gelehrten Hoffnung, die wir auch mit unserem Verstand durchleuchten und verstehen, und von der Hoffnung, die wir lernen können. Es gilt, die Hoffnung als eine Kraft zu erfahren, die in uns ist. Wir möchten nicht nur daran glauben, sondern sie in uns spüren.
Kapitel 1Biblische Aussagen zur Hoffnung
Sowohl das Alte wie das Neue Testament sind voller Hoffnungsworte. Im Alten Testament beziehen sich die Hoffnungen zunächst auf irdische Dinge: auf reiche Nachkommenschaft, auf die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft, auf Wohlergehen. Der Theologe Gerd Theißen stellt fest: »Die Bibel entwickelt zunächst Hoffnung für diese Welt. Sie will die Geschichte vollenden. Aber immer deutlicher zielt in der Bibel diese Hoffnung auf Überwindung des Todes« (Theißen 2).
Man hofft auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf das himmlische Jerusalem. Ganz gleich, wie gut oder schlecht es den Israeliten ging, ob sie unter König David Frieden und Erfolge erlebt haben oder ob sie im Exil waren, immer setzen sie ihre Hoffnung auf Gott. Die Hoffnung auf Gott ist die Grundhoffnung Israels. Der Altphilologe Jonas Grethlein folgert daraus: »Hoffnung wird zum Teil der Beziehung des Menschen zu Gott« (Grethlein 69).
Das Neue Testament beschreibt vor allem die Hoffnung auf eine neue Schöpfung, die Hoffnung auf die Auferstehung, die Hoffnung auf den Gott, der die Toten auferweckt und »das, was nicht ist, ins Dasein ruft« (Römer 4,17). Das Neue Testament spricht also vorrangig von der transzendierenden, von der absoluten Hoffnung, die durch keine Enttäuschung zerstört werden kann. Doch die Frage ist, wie sie konkret unser Leben prägt. Es kommt darauf an, dass wir diese spirituelle Hoffnung in Verbindung bringen mit der natürlichen Hoffnung, die uns von Geburt an gegeben ist. Wenn wir nur theologisch über die Hoffnung sprechen, dann bleiben unsere Aussagen in der Luft hängen und sie berühren die Menschen nicht. Daher wollen wir nach den biblischen Aussagen die Einsichten der Philosophie und Psychologie betrachten. Sie sollen uns helfen, das biblische Verständnis der Hoffnung in unser konkretes Leben hinein zu übersetzen.
1. Petrusbrief – Gebt Rechenschaft über die Hoffnung
Der 1. Petrusbrief beginnt mit der Zusage: »Er (Gott) hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten« (1 Petrus 1,3). Es ist also eine lebendige Hoffnung, die die Christen prägt, eine Hoffnung, die sie hier und jetzt lebendig macht. Es ist aber zugleich die Hoffnung auf die Auferstehung, eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Diese Hoffnung soll die Christen bestärken, die Feindseligkeiten und Ablehnung durch die damalige Gesellschaft zu ertragen, ja sie sogar mit innerer Freude und Zuversicht zu ertragen. Dieses andere Verhalten angesichts der Bedrängnisse, in die sie gerade als Christen geraten, hat die Menschen in ihrer Umgebung neugierig gemacht. Daher heißt es: »Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt« (1 Petrus 3,15). Die Menschen, die mit den Christen zusammenlebten, haben sich gewundert, dass sie so gelassen und freundlich reagiert haben auf die Aggressionen ihrer Umgebung. Sie wollten wissen, was ihnen dazu die Kraft gab. Und sie spürten, dass die Christen offensichtlich von einer Hoffnung geprägt waren, die ihnen selbst fremd war. Der 1. Petrusbrief wurde zu einer Zeit der Dekadenz geschrieben. Sie gleicht unserer Zeit, in der wir ja auch beklagen, dass die Werte, die uns bisher heilig und teuer waren, nicht mehr zählen.
Die Hoffnung der Christen hatte ihren Grund in der Auferstehung Jesu, aber sie drückte sich auch in ihrem alltäglichen Leben aus in den Haltungen, die sie anderen Menschen gegenüber zeigten. Die spirituelle Hoffnung hat auch ihre Ausstrahlung geprägt. Offensichtlich kamen sie durch die Hoffnung auf die Herrlichkeit in Berührung mit der natürlichen Hoffnungskraft, die in ihnen war. Ihre Hoffnung hat sich leibhaft ausgedrückt in der Ausstrahlung, die von ihnen ausging und die in ihrem Antlitz und in ihrem Leib für die Menschen erfahrbar wurde.
Paulusbriefe – Die Liebe hofft alles
Vor allem der Apostel Paulus hat in seinen Briefen immer wieder von der Hoffnung geschrieben. Abraham ist für ihn das Urbild der Hoffnung. »Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde« (Römer 4,18). Hier unterscheidet Paulus die natürliche Hoffnung auf Nachkommen von der übernatürlichen, dass Gott ihm, auch wenn diese natürliche Hoffnung nicht erfüllt wird, etwas geben wird, was alle Erwartungen übertrifft. Die Hoffnung Abrahams gründete in dem Glauben an den Gott, »der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft« (Römer 4,17). Der Theologe Jürgen Moltmann sieht darin das Wesen der christlichen Hoffnung und stellt sie der Hoffnung gegenüber, die Ernst Bloch in seinem Buch »Prinzip Hoffnung« beschreibt. Doch für mich ist das kein Gegensatz. Der Glaube an den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft, weckt die im Menschen verankerte natürliche Hoffnung, sodass diese spirituelle Hoffnung die natürliche Hoffnung durchdringt und stärkt. Die Hoffnung, die Paulus uns verkündet, hat eine tiefere Dimension. Aber sie knüpft an die Hoffnung an, die uns als Menschen gegeben ist. Wenn Abraham gegen alle Hoffnung voller Hoffnung glaubt, dann meint das: Gegen alle rationale Einschätzung, dass er kinderlos bleiben wird, hat Gott ihm eine neue Hoffnung geschenkt, eine Hoffnung auf etwas, was Abraham nicht sehen und womit er rein rational nicht rechnen konnte. Dieser Unterscheidung zwischen der Hoffnung auf das, was wir sehen, und der Hoffnung auf das Unsichtbare begegnen wir auch im Römerbrief. Die Hoffnung, die nur auf das Irdische zielt, ist für Paulus keine wahre Hoffnung (Römer 8,24f). Die absolute Hoffnung besteht weiter, auch wenn die natürliche Hoffnung nicht erfüllt wird.