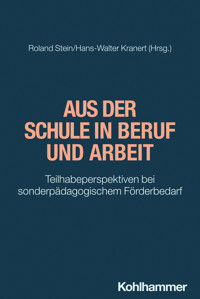
Aus der Schule in Beruf und Arbeit E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Frage nach Teilhabeperspektiven an beruflicher Bildung sowie am Erwerbsleben stellt sich für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zum Ende ihrer Schulzeit, aber auch über ihre weitere Biografie hinweg. Im Rahmen der Diskussion um eine stärker inklusive Gesellschaft erhält dies eine zusätzliche Dynamik. Traditionelle Formate der Unterstützung und Begleitung werden hinterfragt und - auch sozialrechtlich - neu gestaltet. Ziel dieses Bandes ist es, differenziert nach sonderpädagogischen Förderbedarfen am Ende der Schulzeit zu fragen, Teilhabeperspektiven zu skizzieren und Gemeinsamkeiten wie auch Differenzen herauszustellen. Diese Analyse wird zugleich durch einen interdisziplinär ausgerichteten Theoriediskurs um zentrale Fragen der beruflichen Teilhabe gerahmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Aus der Schule in Beruf und Arbeit – zur Einführung
Überblick über den Band
Literatur
Teilhabe als Weg und Ziel
1 Annäherungen an den Teilhabebegriff
2 Teilhabebarrieren und Teilhabepotenziale im Arbeitsleben
3 Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Teilhabe
4 Fazit
Teil 1: Theorie der Teilhabe an Beruf und Arbeit – Aspekte und Hintergründe
1 Ethische Perspektiven
1.1 Einleitung
1.2 Teilhabe als Menschenrecht
1.3 Teilhabe und gesellschaftliche Anerkennungsverhältnisse
1.4 Perspektivwechsel
2 Soziologische Perspektiven
2.1 Teilhabe als allgemein angestrebtes Lebensziel
2.2 Beeinträchtigung – Teilhabe – Behinderung
2.3 Fazit und Zusammenfassung
3 Psychologische Perspektiven
3.1 Übergangswege
3.2 Psychologische Herausforderungen
3.3 Diagnostische Prozesse
3.4 Fazit
4 Berufs- und wirtschaftspädagogische Perspektiven
4.1 Der Objektbereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als erziehungswissenschaftliche Teildisziplin und das zu bearbeitende Problem
4.2 Pädagogisches Professionsfeld Personal- und Organisationsentwicklung in der Dialektik von gesellschaftlicher Teilnahme und Exklusion
4.3 Conclusio?
5 Sozialpädagogische Perspektiven
5.1 Capabilities Approach als sozialpädagogische Perspektive auf Teilhabe
5.2 Freiheit zur Entscheidung für ein gutes Leben
5.3 Möglichkeitsräume
5.4 Nachdenklicher Abschluss
6 Heil- und sonderpädagogische Perspektiven
6.1 Verständnis der Teilhabe aus Sicht der Heil-/Sonderpädagogik
6.2 Jugendliche mit Beeinträchtigungen im Übergang Schule – Beruf
6.3 Unterstützungsansätze – Chancen auf berufliche Inklusion
6.4 Aufgabenfelder der Heil-/Sonderpädagogik
7 Sozialrechtliche Perspektiven
7.1 Einleitung
7.2 Ersteingliederung durch Berufliche Bildung
7.3 Fazit
8 Sozialpolitische Perspektiven
8.1 Die Würde des Menschen ist unantastbar – gesellschaftliche Basis für alle?
8.2 Kompensation von Benachteiligung. Sozialpolitischer Auftrag zur Befähigung
8.3 Feststellung von Leistungsberechtigung als sozialpolitisch notwendige Legitimation?
8.4 Orientierung am Konzept Lebenslagen
8.5 Berufliche Qualifizierung – individualisiert und differenziert
8.6 Sozialpolitischer Ausblick: Arbeitsmarkt und berufsbildungspolitische Flexibilisierung
9 Theorie der Teilhabe an Beruf und Arbeit – eine interdisziplinäre Perspektive
Teil 2: Praxis der Teilhabe an Beruf und Arbeit – Aspekte und Optionen bei Unterstützungsbedarfen
10 Personen mit Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten
10.1 Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten
10.2 Gelingen des Übergangs Schule – Beruf
10.3 Teilhabe an Beruflicher Bildung
10.4 Teilhabe am Erwerbsleben
10.5 Fazit
11 Personen mit Lernbeeinträchtigungen
11.1 Unterstützung während der Schulzeit
11.2 Unterstützung im Zuge von Berufsvorbereitung
11.3 Unterstützung im Rahmen einer Berufsausbildung
11.4 Unterstützung zur Teilhabe am Arbeitsleben
11.5 Ausblick
12 Personen mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen
12.1 Teilhabe von Menschen mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen
12.2 Besondere Versorgungssituation
12.3 Selbsteinschätzung der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten
12.4 Sprachlich-kommunikative Herausforderungen im beruflichen Kontext
12.5 Fazit
13 Personen mit geistiger Behinderung
13.1 Schulische Situation
13.2 Teilhabeperspektiven für die berufliche Bildung und das Arbeitsleben
13.3 Die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
13.4 Ausgelagerte Arbeitsplätze der WfbM (Außenarbeitsplatz)
13.5 Inklusionsbetriebe
13.6 Unterstützte Beschäftigung
13.7 Das Budget für Arbeit und Ausbildung
13.8 Kritische Diskussion
14 Personen mit Körperbehinderung
14.1 Transition von der Schule ins Erwerbsleben
14.2 Adaption von Arbeitsplätzen und der Einsatz von Assistiven Technologien
14.3 Akademisierung von Menschen mit Körperbehinderung als Chance auf berufliche Teilhabe
14.4 Aktuelle Perspektiven und Ausblick
15 Personen mit Hörbeeinträchtigungen
15.1 Hörbeeinträchtigungen, Grad der Behinderung und soziale Dimension von (Hör-)Behinderung
15.2 Schulische und berufliche Bildung als Voraussetzung für berufliche Teilhabe
15.3 Diskussion der aktuellen Sicht auf berufliche Teilhabe – Ergebnisse einer Literaturanalyse
15.4 Maßnahmen für die Teilhabe am Berufs- und Arbeitsleben
15.5 Abschließende Bemerkungen
16 Personen mit Sehbeeinträchtigungen
16.1 Leistungseinschränkungen und Inkompetenzerwartungen
16.2 Blindenwerkstätten und die Berufskreation
16.3 Die Individualisierung hinter den Barrieren
16.4 Ausblick
17 Personen im Autismus-Spektrum
17.1 Der Übergang in das Arbeits- und Berufsleben bei Personen im Autismus-Spektrum
17.2 Möglichkeiten der beruflichen Bildung für Personen im Autismus-Spektrum
17.3 Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe für Personen im Autismus-Spektrum
17.4 Prekäre Beschäftigungssituation autistischer Personen
18 Praxis der Teilhabe an Beruf und Arbeit – bestehende Chancen und weitere Bedarfe
Perspektiven für einen chancengerechten Arbeitsmarkt – ein Fazit
Verzeichnisse
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Roland Stein, Hans-Walter Kranert (Hrsg.)
Aus der Schule in Beruf und Arbeit
Teilhabeperspektiven bei sonderpädagogischem Förderbedarf
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-042374-9
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-042375-6epub: ISBN 978-3-17-042376-3
Aus der Schule in Beruf und Arbeit – zur Einführung
Roland Stein & Hans‐Walter Kranert
Das Tätig-Sein, ein aktives Leben ist Kennzeichen jeglichen menschlichen Daseins. Während in der Urzeit angesichts von Jagen und Sammeln noch kein genuines Verständnis von Arbeit vorhanden war, entwickelte sich mit der Antike eine dichotome Auffassung von geistiger versus körperlicher Arbeit, bei Geringschätzung der Letzteren. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wandelte sich »die produktive ...und auf Erwerb gerichtete Arbeit ... zu einer gesellschaftlich positiv bewerteten Aktivität« (Jochum 2018, 117). Zugleich ist damit eine gesellschaftliche Idealvorstellung entstanden, in der die »marktvermittelte, berufliche Erwerbsarbeit ... zur normativ ausgezeichneten Normallage« wurde (Kocka & Offe 2000, 11). Dies führt zu einer gesellschaftlichen Ungleichverteilung der Chancen auf Teilhabe an eben diesem bedeutsamen Lebensbereich. Dabei werden auch weitere Formen von Arbeit (vgl. Standing 2014; Fayard 2021) wie etwa bürgerschaftliches Engagement oder Haushaltsarbeit nicht als eben solche bewertet, obwohl auch sie wichtige psychosoziale Funktionen von Erwerbsarbeit erfüllen können (vgl. Jahoda 1983; Bähr, Batinic & Collischon 2022) sowie zugleich gesellschaftlich sehr bedeutsam sind. Stattdessen werden diese Beschäftigungsformen analog einer Arbeitslosigkeit als Nichterreichen einer gesellschaftlichen Normalvorstellung und damit als individueller Makel attribuiert. Zudem ist der Zugang zu Erwerbsarbeit nach wie vor überwiegend berufsförmig gesteuert (Sailmann 2018), d. h. die erfolgreiche Bewältigung einer beruflichen Bildungsphase mit anerkanntem Abschlusszertifikat ist Ausdruck erreichter Beruflichkeit (Seifried et al. 2019). Sind die Zugänge zu diesem Bildungssegment individuell erschwert oder gar verstellt, so gefährdet dies konsekutiv die Teilhabe am Erwerbsleben und damit am sozialen Miteinander (Weber & Weber 2013).
Konsequent ist daher die systematische Einbettung beruflicher Orientierung in allgemeinbildende Prozesse jeglicher Schulstufen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität und Quantität (Barlovic, Ullrich & Wieland 2024). Der gelingende Übergang in eine Phase beruflicher Bildung nimmt bildungs- wie auch sozialpolitisch einen hohen Stellenwert ein, insbesondere auch für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Um Anschlüsse zu ermöglichen, ist mit den Systemen der Beruflichen Rehabilitation (Biermann 2008; 2015), insbesondere den Institutionen Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, sowie der Benachteiligtenförderung (Bojanowski et al. 2013; Niedermair 2017) und auch der Jugendberufshilfe (Enggruber & Fehlau 2018) in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten eine sich zunehmend ausdifferenzierende Förderstruktur entstanden, die sich unter anderem auch der hier fokussierten Zielgruppe zuwendet. Über individualisierte, prolongierte, adaptive und/oder kompensatorische Lernprozesse werden Wege der beruflichen Befähigung gebahnt und unterstützt. Diese sind in der Regel zielgruppenorientiert ausgerichtet und umfassen zumindest teilweise separierende Lösungen, wenn auch meist nur auf Zeit (vgl. Rauch & Tophoven 2020). Ist eine Beruflichkeit im geforderten Maße nicht erreichbar und/oder ist der Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt anderweitig verwehrt, ist zumindest für einen Teil der jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein Sonderarbeitsmarkt in Form der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen etabliert worden (Kranert, Hascher & Stein 2024). In der Diskussion um die Umsetzung der UN‐Behindertenrechtskonvention und damit verbunden einer stärker inklusiv ausgerichteten Gesellschaft werden jedoch diese »traditionellen« Formate der Unterstützung und Begleitung hinterfragt. Alternative Formate wie Unterstützte Beschäftigung, Budget für Ausbildung und Budget für Arbeit treten stattdessen auf den Plan.
Dabei erhalten Fragen des gelingenden Übergangs zwischen Schule einerseits und dem Eintritt in berufliche Bildung und Arbeit andererseits einen besonderen Stellenwert (Engels, Deremetz, Schütz & Eibelshäuser 2023; Stein, Kranert & Hascher 2020): Welche Perspektiven beruflicher Teilhabe ergeben sich aktuell für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach Abschluss ihrer allgemeinbildenden Schulzeit? Was sind ihre biografischen Wege, vor allem hinsichtlich einer Beteiligung an Erwerbsarbeit? Welche Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen ergeben sich bei einer zielgrupppenorientierten Betrachtung dieser Aspekte? Wie können gelingende Übergänge schulisch, aber auch durch außerschulische Maßnahmen vorbereitet und begleitet werden? Diesen und weiteren damit verbundenen Fragestellungen wendet sich der vorliegende Band zu. Er versucht dabei mitzuwirken, eine Lücke im sonderpädagogischen Diskurs ein Stück zu schließen: Sonderpädagogik als Wissenschaft wie auch als Bildungspraxis wendet sich – in nahezu allen Förderschwerpunkten – weitgehend singulär Fragen schulischer Bildung zu; die nachschulische Lebensphase hingegen wird kaum in den Blick genommen, obwohl hier Unterstützungsbedarfe persistieren, entstehen oder wieder verstärkt zu identifizieren sind – und obwohl diese Phase in der Regel biographisch deutlich umfassender sein wird als die vorangegangene Schulzeit. Zur Unterstützung des hiermit verbundenen und in diesem Buch beschriebenen und diskutierten, recht komplexen Teilhabeprozesses könnte die Sonderpädagogik durchaus einen konstruktiven Beitrag leisten und wird auch immer wieder hierzu aufgefordert (vgl. Bylinski 2021). Auch in historischer Perspektive finden sich zahlreiche Anknüpfungspunkte zum sonderpädagogischen Handeln im Hinblick auf Berufsbildung und Erwerbsarbeit (vgl. Kranert & Stein 2024). Aktuell zeichnen sich hier allerdings (noch) keine größeren »Horizonterweiterungen« ab.
Überblick über den Band
Unter dem Titel »Teilhabe als Weg und Ziel« unternimmt Christian Walter-Klose in einem einführenden Beitrag eine erste Annäherung an den für den Band zentralen Begriff der Teilhabe. Dieser vereint für ihn drei Aspekte: das Einbezogensein, die Selbst- und Mitbestimmung und damit schließlich das selbstbestimmte Einbezogensein. Hinsichtlich der Entwicklung derartiger Teilhabeoptionen im Lebensbereich Beruf und Arbeit entwirft er im Folgenden ein »Passungsmodell zur Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben«, welches das ›Was‹ und das ›Wie‹ der Teilhabe systematisiert in den Blick nimmt.
Den interdisziplinären Diskurs zur Theorie der Teilhabe eröffnet Michelle Becka mit einem Blick auf ethische Perspektiven. Diese sehen in Fragen der Teilhabe vor allem eine Gerechtigkeitsforderung, die aus menschenrechtlichen Bezügen klar moralisch begründbar ist, vor allem aber politisch realisiert und rechtlich umgesetzt werden muss. Dies drückt sich in einer gegenseitigen Anerkennung der Menschen aus, und zwar auf intersubjektiver, rechtlicher wie auch auf fähigkeitsbasierter Ebene. Gerade letzterer Aspekt kann vor allem auch über eine Teilhabe an Beruf und Arbeit erreicht – oder eben auch vorenthalten werden.
In soziologischer Hinsicht skizziert Mario Schreiner Teilhabe als ein von der Mehrheit der Bevölkerung angestrebtes Lebensziel, da es eine grundlegende gesellschaftliche Zugehörigkeit zum Ausdruck bringt. Dabei wird Teilhabe als dynamischer Prozess wie auch Zustand interpretiert, der sich zwischen den Extrema eines ›Drinnen‹ und ›Draußen‹ in unterschiedlichen Konstellationen manifestieren kann. Dem Lebensbereich Erwerbsarbeit wird hierfür eine besonders hohe Bedeutung zugewiesen; Arbeit wird gar als »Schlüssel zur Inklusion« identifiziert.
Matthias Morfeld blickt im Anschluss vornehmlich aus psychologischer Perspektive auf Fragen der Teilhabe. Hierfür wird der Übergang Schule – Beruf in den Mittelpunkt des Diskurses gestellt, der gerade von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf als besonders herausfordernd und zugleich als besonders belastend erlebt werden kann. Damit ist dies – im Einzelfall – ein spezifischer Wendepunkt der Lebensgeschichte dieser jungen Menschen. In einem solchen Zusammenhang ergeben sich in der Folge relevante Wechselwirkungen zwischen Schule, Berufsbildung und psychischer Gesundheit, welche spezifische diagnostische und therapeutische Prozesse induzieren können.
Die Reihe der pädagogischen Betrachtungen auf das Themenfeld eröffnet Ulrike Buchmann aus berufs- und wirtschaftspädagogischer Perspektive. Ausgehend von einer notwendigen Klärung des Kategorie Inklusion in der Fachdisziplin wird postuliert, eine neue Sichtweise auf junge Menschen, auf Bildungsgänge und -institutionen wie auch auf die zugrunde liegenden Wissensstrukturen einzunehmen, auch in transdisziplinärer Ausrichtung. Dies erfordert neben einer Organisations- und Personalentwicklung wie auch einer Netzwerkstruktur vor allem »überfälliges« professionelles Lehrkräftehandeln. Der sich darin abbildende »common ground« der Fachdisziplin ermöglicht erst die erforderliche Neuorientierung – im Sinne von Inklusion.
Wie sozialpädagogisches Handeln in Angeboten der Berufsbildung zu einem Mehr an Teilhabe führen kann, skizziert Ruth Enggruber mit ihrem Beitrag. Hierzu wird der capabilities-Ansatz als normative Grundlage sozialpädagogischer Arbeit herangezogen. Daraus ableitbar ist die Handlungsmaxime, dass junge Menschen das von ihnen gewünschte Leben selbstbestimmt und angemessen für sich realisieren sollen. Hierzu benötigen sie persönliche wie auch gesellschaftliche Möglichkeitsräume, hier etwa in der beruflichen Bildung, welche durch sozialpädagogisches Handeln eröffnet werden können – auf individueller wie auch auf struktureller Ebene.
Als Vertreterin einer »besonderen Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit besonderen Problemen« blickt Claudia Schellenberg aus heil- und sonderpädagogischer Perspektive auf das Themenfeld. Auf Basis eines bereits realisierten, allgemeinbildenden Anspruchs werden auch entsprechend Zugänge und Unterstützungsmöglichkeiten im beruflichen Kontext für diese Zielgruppe postuliert. Welchen konkreten Beitrag diese pädagogische Teildisziplin zur Teilhabe an Beruf und Arbeit leisten könnte, wird mit Hilfe von vier Thesen skizziert. Für deren Umsetzung wäre allerdings eine stärkere Einbindung heil- und sonderpädagogischen Wissens in diesen Lebensbereich vonnöten, von dem zumal alle junge Menschen in diesem Bildungssegment profitieren dürften.
Den rechtlichen Rahmen zu Fragen der Teilhabe spannen Katja Nebe und Belinda Weiland in ihrem Beitrag auf. Dabei wird deutlich, dass der Einzelne mit dem Familienrecht, dem Sozialrecht, dem Ausbildungs- und Arbeitsrecht, dem Schulrecht wie auch dem Antidiskriminierungs- und Teilhaberecht in differenten rechtlichen Beziehungen steht, die jedoch eng miteinander verwoben sind. Aufgrund der unterschiedlichsten Rechtsträger erfordert dies eine koordinative Leistung, um alle Beteiligten in die selbstbestimmte Inanspruchnahme einzubinden. Hier ergeben sich trotz eines bestehenden Bundesteilhabegesetzes noch zahlreiche Barrieren.
Teilhabe als sozialpolitische Aufgabe umschreibt Harald Ebert mit dem Auftrag zur Befähigung und zur Suche nach Verwirklichungschancen für alle jungen Menschen. Bezogen auf den Lebensbereich Beruf und Arbeit wird hierfür berufliche Bildung als zentrales »Ticket« gesehen. Angesichts aktueller Entwicklungen wird allerdings die Frage aufgeworfen, ob trotz eines Bekenntnisses zur Menschenwürde und eines Rechts auf Teilhabe wirklich alle Menschen miteinbezogen – geschweige denn wirklich »gebraucht« – werden. Dem gilt es, über berufliche Bildungsangebote für alle, zugleich individualisiert und differenziert, entgegenzutreten – ein kompensatorischer Auftrag nicht nur für die Heil- und Sonderpädagogik.
Roland Stein fasst abschließend den interdisziplinären Diskurs um Teilhabe zusammen und zieht hieraus resümierende Konsequenzen für sonderpädagogische Theorieentwicklung wie auch Teilhabeforschung.
Einen Perspektivenwechsel auf die Praxis der Teilhabe mit dem Blick auf den Einstig in Berufsbildung und Erwerbsarbeit von jungen Menschen mit unterschiedlichen sonderpädagogischen Förderbedarfen eröffnen Hans-Walter Kranert und Roland Stein, indem sie Teilhabeoptionen von Menschen mit Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben in den Blick nehmen. Hierzu werden vor allem Transitionsphasen – in Berufsbildung, aber auch in den Arbeitsmarkt – als individuell stark verunsichernde Momente charakterisiert. Anhand der wenigen existierenden Forschungsbefunde wird aufgezeigt, dass es biografisch zu mehrfachen und konsekutiven Selektionsprozessen bei dieser Personengruppe kommt, die zwar einerseits den Zugang zu Unterstützungsstrukturen eröffnen, aber andererseits nur in Teilen den Bedarfen gerecht werden. Ein langfristiger Dropout der Zielgruppe aus dem Teilhabefeld ist daher für eine nicht unerhebliche Teilgruppe zu befürchten.
Der in Bildungskontexten größten Gruppe der als behindert klassifizierten Personen – Menschen mit Lernbeeinträchtigungen – widmet sich der Beitrag von Marc Thielen. Ausgehend von einer Charakterisierung von Lernschwierigkeiten wird deutlich, dass Diskontinuität und Belastungen für die individuellen Biografien durchaus propädeutisch sind. So mündet etwa die überwiegende Zahl der Schulabgänger*innen zunächst ins Übergangssystem; aber auch der nachfolgende Zugang zu Ausbildung – auch in spezifischen Berufsbildern für Menschen mit Behinderungen – gelingt nicht der Gesamtkohorte. Im Kontext von Erwerbsarbeit existieren mittlerweile Lernformate, etwa für gering literalisierte Beschäftigte; der Zugang zu derartigen Angeboten ist aber noch nicht gelöst. Somit wären lebensbegleitende Unterstützungsangebote bedeutsam, um einerseits vorhandene Potenziale zu identifizieren und andererseits einer drohenden Verarmung entgegenzuwirken.
Für Menschen mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen hingegen existieren im Anschluss an die allgemeinbildende Schule nur wenige institutionalisierte Bildungsangebote, wie Stephan Sallat und Anja Theisel konstatieren. Dabei stellen jedoch Beeinträchtigungen in diesem Bereich erhebliche Risiken für Berufliche Bildungsprozesse wie auch für die Teilhabe an anderen Lebensbereichen wie etwa dem Arbeitsleben dar. Die unzureichende Unterstützung im nachschulischen Kontext ist einerseits auf die geringe Verbreitung von schulischen Angeboten in der Sekundarstufe I zurückzuführen, andererseits aber auch auf den geringen Wissensstand in der Berufsbildung, etwa zum Zusammenhang von Beeinträchtigungen in der Sprache und in Lernprozessen. So sind Sprachverarbeitungsproblematiken deutlich mit spezifischen Anforderungen in der Ausbildung wie Gesprächsführung, Lesen oder Schreiben verbunden. Hier bedarf es einer stärkeren Beachtung dieses Zusammenhangs, insbesondere auch vor dem Hintergrund einer wachsenden Gruppe von jungen Menschen, die Deutsch nicht als Erstsprache verwenden. Dies würde die Teilhabeoptionen in Beruf und Arbeit insgesamt erweitern.
Kristina Schmidt hält in ihrem Beitrag über die Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung fest, dass zwar in allen Schulformen eine Vorbereitung auf das Berufsleben erfolgt, strukturell bedingte Benachteiligungen aber den Einstieg erheblich erschweren. Somit ist bundesweit nach wie vor ein »Automatismus« für den Übergang in Werkstätten für behinderte Menschen festzustellen, obwohl etwa mit dem Budget für Ausbildung bzw. Arbeit oder aber auch der Unterstützten Beschäftigung durchaus alternative Bildung- und Arbeitswege beschritten werden könnten. Zur Veränderung der gegenwärtigen Teilhabesituation bedarf es neben eines umfassenderen Aufklärungsprozesses der Zielgruppe auch einer individualisierten und partizipativeren Berufswegeplanung, wie diese etwa im Teilhabeplanverfahren bereits strukturell vorgesehen ist.
Für Fragen der Teilhabe von Menschen mit Körperbehinderungen ist die große Varianz in der Leistungsfähigkeit und in den beruflichen Eignungen innerhalb dieser Gruppe zur berücksichtigen, so Jessica Lilli Köpcke in ihrem Beitrag. Dabei gelten berufliche Bildung wie auch das Arbeitsleben als »Brennpunkte« der Rehabilitation dieser Personen. Auch hier spielen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen eine bedeutsame Rolle, welche allerdings zugleich von den Einzelnen zum Teil als Barriere wahrgenommen werden, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu werden. Gerade aber assistive Technologien bieten für die Teilhabe am Erwerbsleben vielfältige Chancen; zugleich ist die Verwehrung von erforderlichen Arbeitsplatzanpassungen nach wie vor die häufigste Form der Diskriminierung in diesem Lebensbereich. Dass dies auch unabhängig vom erreichten Berufsabschluss ist, belegt die Situation von Akademiker*innen mit Behinderung am Arbeitsmarkt. Als zentrale Lösungsansätze werden auch hier eine Intensivierung von Beratungsangeboten für alle Beteiligten eingefordert und zugleich ein breites Verständnis von Arbeit – jenseits der Lohnarbeit – zugrunde gelegt, um eine Teilhabe aller tatsächlich realisieren zu können.
Wird demgegenüber die Personengruppe mit Hörbeeinträchtigungen in den Blick genommen, ist grundlegend von einer »besonders guten beruflichen Ausgangsqualifikation« auszugehen, die zudem häufiger in allgemeinen beruflichen Bildungskontexten erworben wird. Dennoch identifiziert Annette Leonhardt in ihrem Beitrag Barrieren bei der Teilhabe am Arbeitsleben für diese Personengruppe. Dies betrifft insbesondere die Gestaltung und Beteiligung an Kommunikationsprozessen, aber auch die eventuell daraus resultierende fachliche Unterforderung seitens der Vorgesetzten. Die »Unsichtbarkeit« einer Hörbeeinträchtigung kann diese Herausforderungen nochmals verstärken. Für Menschen, die erst im Erwachsenenalter eine Hörbeeinträchtigung erworben haben, ist vor allem das psychosoziale Belastungserleben zentral. Neben einer intensivierten Aufklärung über Formen der Hörbeeinträchtigung und dem Gewähren von unterstützenden Hilfen sind zukünftig vor allem zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen, um auch berufliche Aufstiege zu ermöglichen.
Über eine historische Retrospektive in die Anfänge von Blindenanstalten zeigen Dino Capovilla und Andrea Sijp auf, dass mit Blindenwerkstätten und behinderungsspezifischen Berufskreationen den Bedarfen von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zu entsprechen versucht wurde. Als Konsequenz entwickelte sich hieraus ein lebensumspannendes Fürsorgesystem für die Personengruppe. Aktuell existieren nach wie vor Spezialeinrichtungen, die Menschen mit Sehbeeinträchtigungen über ein angepasstes Ausbildungsangebot zur Erwerbsarbeit hinführen, aber auch stärker inklusiv ausgerichtete Systeme. Dem Mentoringprozess über peer-counseling wird hierfür eine besondere Bedeutung beigemessen. Auch mittels Inanspruchnahme von Arbeitsassistenz eröffnen sich Wege der Teilhabe am Arbeitsleben. Ein stärker inklusiv ausgerichteter Weg in die Arbeitswelt – etwa über innerbetriebliche Unterstützte Beschäftigung – wäre jedoch für mehr individuelle Teilhabeoptionen förderlich. Die mit dieser Beeinträchtigungsform verbundenen Inkompetenzerwartungen seitens Dritter könnten somit auch abgebaut bzw. ihnen präventiv begegnet werden.
Abweichend von der bisherigen Gliederungssystematik des Bandes – sonderpädagogischer Förderbedarf – greifen Christian Lindmeier und Carina Schipp zur Vervollständigung des thematischen Reigens in ihrem Beitrag die Situation von Menschen im Autismus-Spektrum auf. Für entsprechende Unterstützungsleistungen ist zwar eine psychiatrische Diagnose erforderlich, jedoch werden in dem Beitrag die »autistischen Besonderheiten« als Ausdruck von Neurodiversität verstanden und entsprechend skizziert. Der Übergang aus der Schule in den Beruf ist für diese Personengruppe nicht selten durch »Umwege« gekennzeichnet; die sich anschließenden beruflichen Bildungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Hochschulstudium über Berufsausbildung bis hin zu Bildungsangeboten in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen – zum Teil über autismusspezifische Unterstützungsleistungen. Dabei ist hier oft nicht die fachliche Aneignung von beruflichen Inhalten das erschwerende Moment, sondern vor allem das Verstehen und Gestalten von sozialen Prozessen. Trotz zahlreicher und vielfältiger Unterstützungsangebote ist die Beschäftigungssituation schlussendlich oft als prekär zu charakterisieren – trotz formaler Qualifikation. Über Formen der Teilhabeberatung wie auch die Ausbringung von Teilhabeleistungen als persönliches Budget könnten jedoch auch hier Veränderungen induziert werden.
Das entstandene Bild der Praxis der Teilhabe bei verschiedenen Unterstützungsbedarfen wird schließlich von Hans-Walter Kranert im Überblick reflektiert; Schlussfolgerungen für das sonderpädagogisches Handeln im Lebensbereich Beruf und Arbeit werden gezogen.
Welche Perspektiven sich aus den einzelnen Beiträgen für einen chancengerechten Erwerbsarbeitsmarkt ergeben könnten, diskutieren abschließend Roland Stein und Hans-Walter Kranert. Dabei werden insbesondere eine berufliche Bildung für alle, ein erweitertes Arbeitsverständnis (work & labour) sowie auch eine breite Anerkennung individueller Leistungen jenseits einer Verwertungslogik eingefordert.
Literatur
Bähr, S., Batinic, B. & Collischon M. (2022): Heterogeneities in the latent functions of employment: New findings from a large-scale German survey. Front. Psychol. 13:909558. doi: 10.3389/fpsyg.2022.909558
Barlovic, I., Ullrich, D. & Wieland, C. (2024): Ausbildungsperspektiven 2024. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
Biermann, H. (2008): Pädagogik der beruflichen Rehabilitation. Stuttgart: Kohlhammer.
Biermann, H. (2015) (Hrsg.): Inklusion im Beruf. Stuttgart: Kohlhammer.
Bojanowski, A. et al. (2013) (Hrsg.): Einführung in die Berufliche Förderpädagogik. Münster: Waxmann.
Bylinski, U. (2021): Berufliche Bildung für Menschen mit Beeinträchtigungen im Spannungsfeld von Ausgrenzung und Teilhabe. In: L. Bellmann et al. (Hrsg.), Schlüsselthemen der beruflichen Bildung in Deutschland (S. 93 – 110). Leverkusen: Barbara Budrich.
Engels, D., Deremetz, A., Schütz, H. & Eibelshäuser, S. (2023): Studie zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Abschlussbericht. Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Im Internet unter: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/f626-entgeltsystem-wfbm.pdf?__blob=publicationFile&v=3. Abruf vom 18. 06. 2024.
Enggruber, R. & Fehlau, M. (Hrsg.) (2018): Jugendberufshilfe. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.
Fayard, A. L. (2021): Notes on the meaning of work: Labor, work, and action in the 21st century. Journal of Management Inquiry, 30(2), 207 – 220.
Jahoda, M. (1983): Wieviel Arbeit braucht der Mensch? Weinheim: Beltz.
Jochum, G. (2018): Zur historischen Entwicklung des Verständnisses von Arbeit. In: F. Böhle, G. Voß & G. Wachtler (Hrsg.), Handbuch Arbeitssoziologie. Band 1: Arbeit, Strukturen und Prozesse (S. 85 – 142). Wiesbaden: Springer.
Kocka, J. & Offe, C. (2000): Einleitung. In J. Kocka & C. Offe (Hrsg.), Geschichte und Zukunft der Arbeit (S. 19 – 22). Frankfurt/M.: Campus.
Kranert, H.-W. & Stein, R. (2024): Berufsbildungswerke als Orte der beruflichen Rehabilitation – historische Einordnung und aktuelle Konstitution. In: M. Weiser & M. Holler (Hrsg.), Berufsbildungswerke (S. 20 – 45). Weinheim: Beltz Juventa.
Kranert, H.-W., Hascher, P. & Stein, R. (2024). PlaUsiBel lehren und lernen. Ein didaktischer Ansatz zur beruflichen Teilhabe. Bielefeld: wbv.
Niedermair, G. (Hrsg.) (2017): Berufliche Benachteiligtenförderung: theoretische Einsichten, empirische Befunde und aktuelle Maßnahmen. Linz: Trauner.
Rauch & S. Tophoven (Hrsg.) (2020): Integration in den Arbeitsmarkt: Teilhabe von Menschen mit Förder- und Unterstützungsbedarf. Stuttgart: Kohlhammer.
Sailmann, G. (2018): Der Beruf. Eine Begriffsgeschichte. Bielefeld: transcript.
Seifried, J., Beck, K., Ertelt, B.-J. & Frey, A. (Hrsg.) (2019): Beruf, Beruflichkeit, Employability. Bielefeld: wbv.
Standing, G. (2014): Understanding the precariat through labour and work. Development and change, 45(5), 963 – 980.
Stein, R., Kranert, H.-W. & Hascher, P. (2020): Gelingende Übergänge in den Beruf. Bielefeld: wbv.
Weber, B., & Weber, E. (2013): Bildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit (IAB-Kurzbericht Nr. 4/2013). Nürnberg: IAB.
Teilhabe als Weg und Ziel
Christian Walter-Klose
Zugegeben – der Begriff der Teilhabe klingt im ersten Moment für Menschen, die sich neu im Kontext Behinderung bewegen, fremd, ungewöhnlich und ein wenig altertümlich. Und doch beschreibt er in einfacher Weise das Paradigma, das in den letzten Jahrzehnten der Weg und das Ziel des Engagements für Menschen mit Beeinträchtigungen geworden ist: Menschen mit Behinderung sollen gleichwertig wie ihre Mitmenschen am Leben in der Gesellschaft teilhaben. Teilhabe bedeutet dabei mehr als nur dabei zu sein. Sie beinhaltet die Möglichkeiten, mitzubestimmen und Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Lebenssituation zu haben (z. B. DHG 2021, 16 ff.).
Teilhabe hat in diesem Verständnis mit sozialer Gerechtigkeit und gleichwertigen Lebensbedingungen für alle Menschen zu tun – ein Bemühen, das sich auch in den Diskursen um Empowerment, Selbstbestimmung und Inklusion abbildet (z. B. Lindmeier & Meyer 2020). Es geht um die Beziehung von Individuum und Umwelt, die Stärkung des Einzelnen mit Blick auf Selbstbestimmung und persönlicher Entscheidungskompetenz sowie den Abbau von Teilhabebarrieren. Bartelheimer (2007, 4) stellt in diesem Zusammenhang heraus, dass der Teilhabebegriff »in den letzten Jahren zu einem Leitkonzept der wissenschaftlichen und politischen Verständigung über die Zukunft des deutschen Sozialmodells aufzusteigen [beginnt]. Er markiert die Schwelle, deren Unterschreiten öffentliches Handeln und soziale Sicherungsleistungen auslösen soll«.
Trotz dieser Bedeutung ist festzustellen, dass mit dem Teilhabebegriff im fachlichen Diskurs Unklarheiten verbunden sind, so dass es schwer ist, Aussagen, ob und in welchem Ausmaß Teilhabe vorliegt, zu treffen. Diese Herausforderungen sollen im Folgenden skizziert und Lösungsmöglichkeiten im Kontext Arbeit aufgezeigt werden.
1 Annäherungen an den Teilhabebegriff
Die Beschäftigung mit der Teilhabe von Menschen berührt vielfältige Handlungsfelder aus den Bereichen der Selbsthilfe, des Sozial- und Menschenrechts, der Rehabilitation und Gesundheitswissenschaft sowie der Pädagogik und Psychologie. Diese einerseits positive Tatsache – zeigt sie doch die Relevanz des Themas – bedingt andererseits Differenzen und Unschärfen in der Begriffsverwendung. So kommen Bartelheimer und Kolleg*innen (2020) nach der Analyse des Teilhabeverständnisses in den Handlungsfeldern der Rehabilitation und Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe und Sozialhilfe zu dem Schluss:
»Die gemeinsame Bezugnahme auf Teilhabeziele schlägt bisher noch keine Brücke zwischen den Handlungsfeldern. Wo ein ›Mindestmaß‹ an Teilhabe beginnt und wo ›volle‹ Teilhabe erreicht ist, wird entweder unterschiedlich bestimmt oder ein konkreter Maßstab fehlt noch ganz« (Bartelheimer et al. 2020, 15 f.).
Versucht man sich in einem ersten Schritt dem Begriff Teilhabe zu nähern, lohnt ein Bezug zur Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (DIMDI 2005) – ein Klassifikationssystem, für das ein biopsychosoziales Modell zur Beschreibung von Krankheitsfolgen oder Folgen von Gesundheitsprobleme entwickelt wurde (▸ Abb. 1). Dieses Modell dient dem Ziel, Auswirkungen eines Gesundheitsproblems, einer Entwicklungsstörung oder einer Krankheit auf die Funktionsfähigkeit eines Menschen zu beschreiben und in der Folge rehabilitative Maßnahmen auszurichten. Einschränkungen der Funktionsfähigkeit des Menschen lassen sich mit der ICF im Bereich körperlicher und psychischer Funktionen sowie Schädigungen abbilden, die bei einem Menschen vor dem Hintergrund seines Lebenskontextes zu Beeinträchtigungen im Bereich Aktivität und Partizipation führen können. Partizipation – sie wurde im Rahmen der Übersetzung mit dem deutschen Begriff Teilhabe gleichgesetzt – kann in diesem Modell in neun verschiedenen Lebensbereichen unterschieden werden. Sie differenziert in die Kategorien Lernen und Wissensanwendung, allgemeine Aufgaben und Anforderungen, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, häusliches Leben, interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, bedeutende Lebensbereiche sowie Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.
Abb. 1:Das biopsychosoziale Modell der ICF (DIMDI 2005, 23)
Im Rahmen der ICF wird Teilhabe mit dem »Einbezogensein in eine Lebenssituation« (DIMDI 2005, 19) beschrieben, wobei das Ausmaß des Einbezogenseins in Bezug zur Norm gleichalter Personen eingeschätzt werden kann und stets Aspekte von Mitwirkung und Mitbestimmung umfasst (vgl. Schuntermann 2022). Pretis geht hier einen Schritt weiter, indem er den Altersnormbezug erweitert und personbezogene Perspektiven stärkt. Für ihn zielt »Teilhabe auf all das [ab] [...], was eine Referenzgruppe oder Altersgruppe in der aktiven Auseinandersetzung mit sozialen Anforderungen tun kann oder tun sollte, um sich als mitgestaltendes Mitglied dieser Gruppe oder Gesellschaft zu erleben« (Pretis 2022, 8). Teilhabe umfasst nach Pretis Aspekte des sich zugehörig Fühlens, des gemeinsamen Erlebens, der Beteiligung am Diskurs und des aktiven Beitragens, wobei das Ausmaß neben gesellschaftlichen Normen oder alterstypischen Verhaltensweisen auch durch personale Faktoren wie z. B. Alter, Interessen und Kompetenzen beeinflusst wird.
Es wird deutlich: Der anfangs relativ klar erscheinende Begriff der Teilhabe beinhaltet in dieser Logik die Herausforderung der Referenzierung, wobei personbezogene, altersbezogene, regionale und gesellschaftliche Normen und Vorstellungen, welches Maß an Teilhabe angemessen sei, divergieren können (vgl. Bartelheimer 2007, 8). Es stellt sich die Frage, wie individuumsbezogene Perspektiven und Wünsche gegenüber gesellschaftlichen und (sozial-)politischen Normen gewichtet werden. Dieses Spannungsfeld löst die ICF nicht – bildet es aber ab, indem neben dem Einbezogensein der Aspekt der Selbst- und Mitbestimmung herausgestellt wird und personbezogene Wünsche und Perspektiven in die Bewertung der Funktionsfähigkeit mit einbezogen werden.
Ein weiterer bedeutsamer Einfluss auf das Verständnis von Teilhabe ergibt sich aus den Bemühungen um Selbst- und Mitbestimmung im Rahmen der Heil- und Sonderpädagogik (vgl. Dederich 2016), der Gesundheitswissenschaften (z. B. Hartung 2012) sowie aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe seit den 1990er Jahren (Hart 1992; Gernert 1993). In diesen Ansätzen wird Partizipation eng im Zusammenhang mit Mitwirkungsrechten als »Entscheidungsteilhabe« (ebd., 58) verstanden. Mit Blick auf das Ausmaß an Selbst- und Mitbestimmung formulierten Wright, Unger und Block (2010) in diesem Zusammenhang ein Stufenmodell der Partizipation (▸ Abb. 2). Für sie liegt Partizipation dann vor, wenn Menschen das Recht und die Möglichkeit haben, über Inhalte und Gestaltung des Lebensbereiches und der dort durchzuführenden Aktivitäten mitzubestimmen (Stufe 6) oder teilweise (Stufe 7) bzw. vollständig (Stufe 8) selbst zu bestimmen. Eine reine Einbeziehung in einen Lebensbereich (ohne damit verbundenes Selbst- und Mitbestimmungsrecht) wäre in diesem Sinne eine Vorstufe der Partizipation (Stufe 5) ebenso wie Anhörungen oder eine zielgruppenangepasste Kommunikation. Das Instrumentalisieren von Menschen und ihnen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben, erreicht weder den Status der Einbeziehung noch der Partizipation.
Abb. 2:Stufen der Partizipation von Wright, Unger und Block (2010) (eigene Darstellung)
Im Rahmen dieser Logik betont der Partizipationsbegriff die Mitbestimmungsmöglichkeiten, die über eine reine Einbeziehung hinausgehen, so dass diese Schwerpunktsetzung eine andere Konnotation bekommt als die mit dem Teilhabebegriff verbundenen, nicht hierarchisierten Komponenten Einbeziehung und Selbstbestimmung. Bei einer Gleichsetzung von Partizipation und Teilhabe geht diese Trennschärfe verloren.
Zusammengenommen lässt sich an feststellen, dass der Teilhabebegriff drei Dimensionen vereint: Neben dem Fokus auf das »Einbezogensein in einen Lebensbereich«, welches normativ mit Blick auf eine Referenzgruppe oder subjektiv mit Blick auf eigene Vorstellungen oder Bedarfe bewertet werden kann, ist Teilhabe durch die Möglichkeit der Selbst- und Mitbestimmung gekennzeichnet. Eine dritte Dimension des Teilhabekonzepts kann durch die Konsequenz des selbstbestimmten Einbezogenseins beschrieben werden: Ein »ungehindertes Handeln und aktiv sein können« ist im Rahmen normativer Vorstellungen und individueller Bedarfe möglich.
2 Teilhabebarrieren und Teilhabepotenziale im Arbeitsleben
Die Teilhabe ist für den Menschen in allen Lebensbereichen von großer Bedeutung. Sie ist Quelle von Gesundheit und Wohlbefinden (z. B. Tielking 2019) und Grundlage für persönliches Wachstum. Dies gilt insbesondere im Arbeitsleben: Neben Einkommen und sozialer Absicherung trägt die Teilhabe am Arbeitsleben zu sozialen Kontakten bei, sorgt für Strukturierung des Tages und ermöglicht persönliche Entwicklung über Erfahrungen sozialer Zugehörigkeit und Anerkennung (vgl. Wansing 2012, 385).
Gleichzeitig zeigen Inklusionsquoten in der Praxis, dass weder im Bereich der beruflichen Bildung (Euler & Severing 2014; Zoyke & Vollmer 2016) noch im Bereich der Arbeit (BMAS 2021) Bedingungen bestehen, in denen eine uneingeschränkte Teilhabe im Sinne von altersgemäßem Einbezogensein und Selbstbestimmung möglich ist. Euler und Severing (2014) fordern vor diesem Hintergrund, Separationen und Sondersysteme der beruflichen Bildung zu reduzieren und mehr inklusive Bildungssysteme zu schaffen.
Ähnlich stellt sich die Situation im Arbeitsleben dar. Im dritten Teilhabebericht der Bundesregierung (BMAS 2021) wird – analog zum vorhergehenden Bericht (BMAS 2017) – dokumentiert, dass der allgemeine Arbeitsmarkt noch immer für Menschen mit Schwerbehinderung schwer zugänglich ist, die Erwerbsbeteiligung verglichen mit der Bevölkerung ohne Beeinträchtigung reduziert und die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Schwerbehinderung erhöht ist – und das, obwohl vielfältige finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen ihre Teilhabe am Arbeitsleben fördern (BfA 2022). Hierfür werden neben strukturellen Merkmalen des Arbeitsmarktes betriebsbezogene Unternehmensstrukturen und sozialpsychologische Determinanten wie Vorurteile verantwortlich gemacht (z. B. Kardorff & Ohlbrecht 2013).
Besonders Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) als »Sonderarbeitswelten« stehen in den letzten Jahren in der Kritik, wobei Fragen der Entlohnung und der mangelnden Vermittlungsleistung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt besonders in den Vordergrund rücken (Schreiner 2019). Spricht man mit den Beschäftigten in der Werkstatt, wie Schreiner (2017) darstellt, zeigt sich, dass die Arbeit seitens der Beschäftigten in positiver Hinsicht als wertvoll, sinn- und strukturgebend erlebt wird. Negativ dagegen wird das Gefühl der Nichtzugehörigkeit zu der Gruppe der »Erwerbstätigen« gesehen, so dass subjektiv ein Mangel an Anerkennung und Wertschätzung außerhalb der Werkstatt erlebt wird. Auch kritisieren Beschäftigte der WfbM, keine Wahl und Alternative zur WfbM gehabt zu haben, so dass im oben skizzierten Verständnis für diese Personen nicht von Teilhabe gesprochen werden kann. Dies bedeutet nicht, dass eine WfbM nicht auch zur Teilhabe am Arbeitsleben beitragen kann (Trenk-Hinterberger 2015), jedoch erscheint eine Stärkung von Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung – auch durch die Schaffung von inklusiven Angeboten – ebenso notwendig wie die (schulische) Förderung von Selbstbestimmungskompetenzen.
3 Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Teilhabe
Ein zentrales Modell zum Verständnis des Zusammenspiels individueller und umweltbezogener Bedingungen zur Ermöglichung von Teilhabe entwickelten Bartelheimer (2007) und Kolleg*innen (Bartelheimer et al. 2020) in den letzten Jahren. Das Modell orientiert sich am Capability Approach von Sen (2000). Es soll dazu beitragen, das »›Was‹ und das ›Wie‹ der Teilhabe« näher zu bestimmen (Bartelheimer et al. 2020, 19 f). In diesem Modell ist das Vorhandensein von materiellen Ressourcen, die Personen für persönliche Ziele in einem Lebensbereich einsetzen können, eine Voraussetzung für Teilhabe. Dabei ergibt sich das Ausmaß an erforderlichen Ressourcen aus der Interaktion von personbezogenen Voraussetzungen (z. B. körperliche Funktionen, Kompetenzen, Präferenzen, Werten, Bildungsstand) mit gesellschaftlichen Bedingungen wie sozialrechtlichen Regelungen, zur Verfügung stehenden Infrastrukturen oder baulich-räumlichen Bedingungen. So besteht laut Bartelheimer et al. (2020, 32) häufig die Notwendigkeit, dass eine »Person mit gesundheitlichen Einschränkungen in einer durch Barrieren geprägten Umgebung für vergleichbare Teilhabeoptionen mehr Ressourcen einsetzen [...] [muss] als eine Person ohne Funktionsbeeinträchtigung«.
Für Bartelheimer ergibt sich aus der Passung von individuellen mit den gesellschaftlichen Bedingungen ein Handlungs- und Entscheidungsspielraum unterschiedlicher Größe, in dem eine Person die Möglichkeit zu Selbstbestimmung hat (▸ Abb. 3). Nach diesem Modell beeinflusst die Gesellschaft die Teilhabe: über Gesetze, Normen und Regelungen, die Gestaltung der physikalischen und sozialen Umwelt sowie über Bildungsmöglichkeiten und Bildungsziele, während das Individuum, je nach eigenen Zielen, Bedürfnissen, Kompetenzen sowie erlebten gesellschaftlichen Erwartungen, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten nutzt.
Abb. 3:Das Grundmodell der Entstehung von Teilhabe von Bartelheimer et al. (2020, 32)
Neben der Gestaltung und Reflexion gesellschaftlicher und umweltbezogener Rahmenbedingungen können in diesem Modell auch Ansätze des Empowerments (z. B. Theunissen 2022) sowie die Bedeutung schulischer Bildung bei der Entwicklung erforderlicher personaler Handlungs- und Entscheidungskompetenzen eingeordnet werden.
Ein weiterer Ansatz, der umweltbezogene Determinanten von Teilhabe einbezieht, ist im Inklusionskonzept zu sehen – wobei Inklusion neben Teilhabe auch auf Anerkennung, Antidiskriminierung und Bildungsgerechtigkeit zielt, wie Moser (2017) für den schulischen Kontext benennt. Boger (2019) stellt vor allem die Dimensionen Normalisierung, Empowerment sowie die Dekonstruktion ungleichheitsreproduzierender Machtstrukturen heraus, die in Theorien zur Inklusion angesprochen werden. Teilhabe verbindet für Boger das Bemühen um Normalisierung und Empowerment.
Der Inklusionsbegriff wird ähnlich wie der Teilhabegriff höchst heterogen verwendet. So werden mit ihm einerseits soziale Situationen, die Menschen »inkludieren«, »einbeziehen« oder »exkludieren« (z. B. Felder 2017), bezeichnet oder andererseits Prozesse der Adaption verstanden, die oben genannte Ziele von Inklusion möglich machen (vgl. Biewer 2017, 128 ff.). Wansing definiert Inklusion in diesem Sinne als »ein universell gültiges Prinzip mit dem Ziel, allen Menschen auf der Basis gleicher Rechte ein selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen« (Wansing 2015, 53). Ähnlich definiert Walter-Klose (2022) Inklusion als einen menschenrechtlich begründeten »Prozess der Anpassung und Ausrichtung eines Angebots, einer Institution oder eines Lebensbereiches im Hinblick auf ein visionäres Ziel, nach dem alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit jederzeit vollkommen gleichberechtigt und gleichwertig behandelt werden, so dass sie ihr Leben weitestgehend selbstbestimmt in der Gesellschaft leben können« (Walter-Klose 2022, 309). Diese Definition stellt die Grundlage für das Passungsmodell zu Inklusion dar (vgl. Walter-Klose 2020). In diesem Modell wird die Anpassungsbeziehung von Mensch und Umwelt in den Fokus gerückt und mit Bezug zum ökosystemischen Modell von Bronfenbrenner sowie der ICF hierarchisch organisiert und strukturiert. Neben dem Lebensbereich Schule (Walter-Klose 2021) lässt es sich gut auf den Arbeitsbereich beziehen (▸ Abb. 4).
Abb. 4:Passungsmodell zur Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben (entwickelt in Anlehnung an: Walter-Klose 2020, 250; Walter-Klose 2021, 20)
Im Mittelpunkt des Modells steht die arbeitnehmende Person in einer spezifischen Beschäftigungssituation, die in einer Organisation bzw. Arbeitsstätte tätig ist. In optimaler Weise sind Prozesse und Strukturen im Bereich der Arbeitssituation und der Arbeitsstätte derart auf die Menschen ausgerichtet, dass sie ihre Kompetenzen bestmöglich einsetzen können, so eine optimale Arbeitsleistung erzielen und Zufriedenheit sowie Teilhabe erleben. Dies beeinflusst auf Ebene der Organisation ebenso betriebswirtschaftliche Faktoren wie Produktivität sowie die Zufriedenheit der Beschäftigten.
Im Kontext von Behinderung können weitere Adaptionen erforderlich werden, indem beeinträchtigungsbedingte Bedarfe bei der Gestaltung der Arbeitssituation oder auf Ebene der Organisation berücksichtigt werden. Padkapayeva et al. (2017) zeigten in ihrem Review beispielsweise vielfältige Anpassungserfordernisse für Beschäftigte mit Körperbehinderung, die neben physischen und technologischen Adaptionen im Bereich der Arbeitssituation (z. B. Nutzung assistiver Technologien, Anpassungen der Arbeitsabläufe) auch Anpassungen der räumlichen Situation der Arbeitsstätte betrafen sowie Adaptionen der Arbeitsorganisation durch Möglichkeiten der Flexibilisierung der Arbeitszeiten oder Regelungen zu Homeoffice oder Dienstreisen. Dwertmann, Baumgärter und Böhm (2017) skizzieren ähnliche inklusionsfördernde Adaptionen mit Blick auf das Human-Ressourcen-Management und ergänzen Adaptionen im Bereich Rekrutierungsstrategien und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie des Karrieremanagements.
Neben diesen organisationsbezogenen Adaptionen werden im Passungsmodell auch die Unterstützung durch betriebsinterne Unterstützungsstrukturen (z. B. Beratung durch die Schwerbehindertenvertretung und durch Diversitätsbeauftragte) einbezogen sowie externe Rahmenbedingungen und Ressourcen, so dass fördernde und beeinträchtigende Einflüsse in Form von persönlichen unterstützenden Ressourcen (z. B. private Hilfsmittel, Freunde oder Angehörige) ebenso berücksichtigt werden können wie professionelle Unterstützungssysteme und Strukturen.
Das Modell ist somit mit den Überlegungen von Bartelheimer et al. (2020) oder der ICF kompatibel, indem gesellschaftliche und sozialräumliche Rahmenbedingungen erfasst werden, die Teilhabe und Inklusion beeinflussen. Es ist ein Modell, das für die Betrachtung von Passungssituationen bei Einzelperson (z. B. im Rahmen eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements) ebenso geeignet ist wie für die Reflexion der Adaption an Bedarfe spezifischer Gruppen (z. B. Beschäftigte mit Körperbehinderung) oder der Vielfalt unterschiedlicher Arbeitnehmenden.
Mit Blick auf den Übergang von der Schule in den Arbeitsbereich kann das schulische Handeln und dessen Auswirkungen auf die Teilhabe am Arbeitsleben in diesem Modell an verschiedenen Stellen sichtbar werden. Es kann unmittelbar die Passung beeinflussen, indem relevante Inhalte, Haltungen, Motivationen sowie Fach-, Methoden- und Selbstkompetenzen für die Arbeitsstätte in der Schule vermittelt werden. Die Schule kann auch als außerbetriebliche Unterstützungsstruktur der Arbeitsstätte und der beschäftigten Person während der Transition ins Arbeitsleben beratend zur Seite stehen und somit einen positiven Einfluss auf die Passung zwischen arbeitnehmender Person und Arbeitsstätte ausüben. Nicht zuletzt lässt sich ein Einfluss der Schule auf Einstellungen und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung in der Arbeitssituation, der Arbeitsstätte und der Gesellschaft darstellen.
4 Fazit
In den letzten Jahren hat sich der Teilhabebegriff als relevanter Begriff für die Ausrichtung der Behindertenhilfe und sozialer Leistungen etabliert, sicherlich auch, da er gesellschaftliche Anschlussfähigkeit verspricht und die menschenrechtliche Perspektive der UN-Behindertenrechtskonvention aufgreift. Gleichzeitig zeigt sich, dass im Teilhabebegriff gesellschaftliche Perspektiven mit individuumsbezogenen Perspektiven derart verbunden sind, dass eine Aussage zur erreichten Teilhabe nur vom Individuum subjektiv getätigt werden kann. Die Frage, ob eine Person z. B. im Bereich Arbeit ungehindert aktiv sein kann, wie sie es will und wie es für Menschen (gleichen Alters, Personen ohne Behinderung) möglich ist, ob sie Selbstbestimmung und Einbezogensein erlebt, kann nur eine Person für sich beschreiben. Für gesellschaftliches Handeln ist es demnach – im Sinne von Inklusion – notwendig, Bedingungen zu schaffen, die Teilhabe befördern. Dies impliziert eine Haltung, die die Vielfalt der Menschen wertschätzt. Dazu gehört die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Lebensrealitäten, die Anerkennung individueller Fähigkeiten und die kontinuierliche Reflexion von Vorurteilen. Auch müssen barrierearme Strukturen sowie Reflexionsprozesse etabliert werden, um individuelle Perspektiven zu erfassen und Rückmeldung über die Qualität der Passung von Person und Angebot zu erhalten. Ein letzter zentraler Grundbaustein ist die Vernetzung mit Expert*innen und Unterstützungsstrukturen, um Fachwissen und Begleitung bei der Gestaltung von inklusiven Teilhabesituationen und personenbezogenen Adaptionen sicherzustellen.
Literatur
Bartelheimer, P. (2007): Politik der Teilhabe. Ein soziologischer Beipackzettel (Fachforum, Bd. 1). Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Bartelheimer, P., Behrisch, B., Daßler, H., Dobslaw, G., Henke, J. & Schäfers, M. (2020): Teilhabe – eine Begriffsbestimmung. Wiesbaden: Springer.
Biewer, G. (2017): Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven Pädagogik. Wien: UTB facultas.wuv.
Boger, M.-A. (2019): Theorien der Inklusion. Dissertation. Universität Bielefeld: edition assemblage.





























