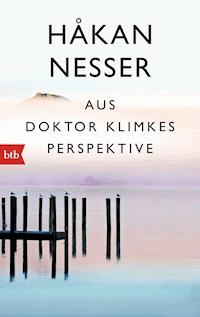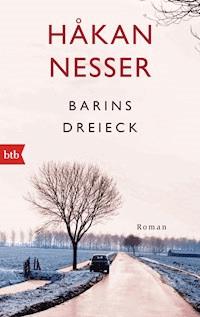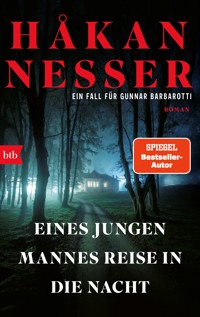Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Lob
Eine ganz andere Geschichte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Erledigung einer Sache
Die Wildorchidee aus Samaria
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Sämtliche Informationen in der Sache
Das unerträgliche Weiß zu Weihnachten
Bachmanns Dilemma
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Nachwort
Copyright
Buch
Henry Maartens, ein Mann in den besten Jahren, ist an einem Wendepunkt in seinem Leben angelangt. Seine Ehe ist gescheitert, er selbst fühlt sich seltsam orientierungslos, der Lehrerberuf füllt ihn nicht wirklich aus. Da kommt ihm der Anruf eines alten Schulfreundes, Urban Kleerwot, gerade recht. Der bittet ihn um Hilfe bei einem Romanprojekt und lädt ihn dazu in sein Sommerhaus in K. ein, eine Stadt, in der die beiden Freunde damals Abitur gemacht haben. Doch was eine Reise werden sollte, die Abwechslung und Ablenkung verspricht, verwandelt sich bald in einen Alptraum und führt mitten hinein in eine schuldbeladene, mörderische Vergangenheit – was ist mit Henrys Jugendliebe Vera Kall, dem schönsten Mädchen der Stadt, nach der Abiturfeier wirklich passiert? Spurlos verschwunden ist sie in dieser Nacht. Wurde sie ermordet? Henry Maartens muss feststellen, dass er nach all den Jahren noch immer unter Generalverdacht steht und dass er damals womöglich die falsche Entscheidung getroffen hat …
»Derart eigenwillig und eigenständig erzählt kaum jemand Krimigeschichten.« WDR
Autor
Håkan Nesser, geboren 1950, ist einer der interessantesten und aufregendsten Krimiautoren Schwedens. Für seine Kriminalromane um Kommissar Van Veeteren erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, sie sind in mehrere Sprachen übersetzt und wurden erfolgreich verfilmt. Daneben schreibt er Psychothriller, die in ihrer Intensität und atmosphärischen Dichte an die besten Bücher von Georges Simenon und Patricia Highsmith erinnern. »Kim Novak badete nie im See von Genezareth« oder »Und Piccadilly Circus liegt nicht in Kumla« gelten inzwischen als Klassiker in Schweden, werden als Schullektüre eingesetzt, und haben seinen Ruf als großartiger Stilist nachhaltig begründet.
»Es ist ganz gleich, fasste Ingenieur B. zusammen, es spielt wirklich keine Rolle. Ich habe schon seit langem, vielleicht schon mein ganzes Leben lang, das Gefühl gehabt, ich wäre nur eine Fiktion.«
M. Barin, Die Reise zum Ausgangspunkt und andereErzählungenKRANTZES VERLAG 1972
Eine ganz andere Geschichte
1
Ich fuhr nach Venedig, weil ich eine Novelle schreiben musste.
Ich hatte während des letzten Jahres drei Romananfänge hinter mich gebracht, mit denen ich Schiffbruch erlitten hatte, und in der Stadt des Todes und der Seufzer kann ja wohl ein jeder zumindest eine Novelle zustande bringen.
Oder zumindest eine Novelletta, wie mein Verleger vorgeschlagen hatte, eine fünfzig- bis hundertseitige Erzählung, das war ein zu Unrecht ins Vergessen geratenes Format. Wir fuhren an einem Samstag im März ab, meine Ehefrau hatte sich eine Woche von der Zeitung freigenommen und fuhr mit, um zu fotografieren und darauf zu achten, dass ich nicht den Mut verlor.
Wir kamen am späten Nachmittag an, nahmen das Boot vom Flughafen, und als wir den Markusplatz überquerten, empfing uns ein schneidender, düsterer Wind. Regen und Dämmerung hingen in der Luft, die Touristenscharen hatten die Tauben ihrem Schicksal überlassen und befanden sich in den Bars oder in Paris. Was weiß denn ich. Das Klaviertrio vor dem Florian spielte für leere Stühle. Corelli, wenn ich mich nicht irre.
Wir fanden das Hotel Bonvecchiati, in dem wir schon einmal gewohnt hatten, und bekamen das Zimmer nach unserem Wunsch – Nummer 322 – mit Blick über die beiden Kanäle Fuseri und Orseolo und die Brücke mit den unermüdlichen afrikanischen Taschenverkäufern. Der Gondelverkehr war für diesen Tag beendet, wir duschten und tranken jeder ein Glas Amaro auf dem Zimmer, bevor wir in einer der Gassen in der Nähe nach einem kleinen Lokal suchten.
»Nun«, sagte meine Ehefrau, als wir bei Panna Cotta und Portwein angelangt waren. »Hast du schon irgendwelche Ideen?«
Ich musste zugeben, dass ich keine hatte. Schließlich war es gerade mal der Abend des ersten Tages, erinnerte ich sie. Da gab es noch viel Zeit, und um eine Novelle zu schreiben, musste man nur Augen und Ohren offen halten.
»Ich bin nur froh, dass nicht ich der Schriftsteller in dieser Ehe bin«, erwiderte meine Ehefrau und streichelte ihre Minolta, die auf dem Tisch zwischen uns lag und die sie bereits zwanzig, dreißig Mal abgefeuert hatte, seitdem wir gelandet waren. »Vielleicht sitzt sie ja bereits hier?«
»Wer?«, fragte ich.
»Die Novelle«, antwortete meine Ehefrau. »Vielleicht ist es der Mann, der da hinten in der Ecke sitzt. Nein, guck jetzt nicht so auffällig hin.«
Ich nutzte die Gelegenheit, ihn zu betrachten, als wir bezahlt hatten und das Lokal verließen. Es war ein dürrer Herr in braunem Tweedanzug mit sorgenvollem Pferdegesicht. Er saß über ein Pastagericht und ein Buch gebeugt, und er sah aus, als beherbergte er ungefähr genauso viele Geheimnisse wie ein Glas Wasser.
Obwohl er schon ein wenig an H.C. Andersen erinnerte, das musste ich zugeben.
»Ich glaube nicht«, erklärte ich, als wir wieder draußen auf der Gasse standen. »Und außerdem habe ich beschlossen, dass die Erzählung nicht vor morgen beginnen wird.«
»Kein Problem«, sagte meine Ehefrau und packte meinen Arm, »du hast ja die ganze Woche Zeit dafür.«
Wir nahmen ein zeitiges Frühstück in dem großen marmorverkleideten Speisesaal zu uns – mit grotesken Dekorationen wohl aus der Muraner Glasbläserhütte und ein paar freifliegenden Spatzen, die von den schmutzigen Fensterscheiben wieder und wieder in ihrem vergeblichen Fluchtversuch gebremst wurden.
»Warum lassen sie die nicht raus?«, wollte meine Ehefrau wissen. »Ich weiß ja, dass sie es lieben, Vögel in Käfige zu sperren, aber Spatzen in einem Speisesaal, das ist doch absurd.«
»Wahrscheinlich haben sie sie nicht absichtlich hereingelassen«, schlug ich vor. »Bestimmt sind die von allein reingekommen, und jetzt finden sie nicht mehr hinaus.«
»Sag das nicht«, widersprach meine Ehefrau. »Man kann nie wissen, auf welche Perversionen sie in dieser Stadt so alles kommen.«
Es war erst Viertel nach sieben, meine Ehefrau wollte hinaus, um zu fotografieren, bevor die Touristenscharen sich durch die Gassen und über die Brücken schoben, und wir waren fast allein im Restaurant. Nur an einem Tisch zum Kanal hin saß ein anderes Paar, das jedoch schnell meine Aufmerksamkeit fesselte, weil etwas Besonderes sie umgab.
Aber schließlich bin ich morgens auch ungewöhnlich aufmerksam, eine Eigenschaft, die sich im Laufe der Jahre noch verstärkt hat – und die in meinem Beruf ab und zu von großem Nutzen ist.
Es waren also ein Mann und eine Frau. Der Mann irgendwo zwischen fünfundvierzig und fünfzig, soweit ich das beurteilen konnte, die Frau bedeutend jünger. Irgendetwas über zwanzig wahrscheinlich. Beide hatten dunkle Haare, er kurzgeschnitten mit grauen Einsprengseln, dazu ein ausdrucksvolles Gesicht, in gewisser Weise wie gemeißelt, mit tief liegenden Augen und einer Nase, die man fast als klassisch griechisch bezeichnen konnte. Heller Anzug, Krawatte und dunkelrote Weste. Die Frau trug ein schlichtes rotes Kleid mit schwarzen Punkten und ein Haarband im gleichen Muster, nur umgekehrt. Rote Punkte auf schwarzem Grund. Sie war sehr schön, reine, klare Züge, das Haar im Pagenschnitt, und auch sie konnte als griechisch durchgehen, dachte ich – doch als sie über ihre Kaffeetassen hinweg miteinander sprachen, geschah das in einem Englisch, das alle Zweifel zerstreute.
Sie waren Amerikaner. Es sah so aus, als hätten sie sich bereits für irgendeine Art von Ereignis angezogen, trotz der frühen Stunde. Was jedoch dazu führte, dass ich meinen Blick nicht von ihnen wenden konnte, war die Art und Weise, wie sie sich zueinander verhielten. Darin lag eine Art behutsamer Respekt, eine Zärtlichkeit, die in allen ihren Bewegungen zu spüren war, in ihrer Haltung und wie sie einander gegenübersaßen – wie sie einander betrachteten; die Choreographie der Blicke, eine Art verschleierte Konzentration und eine Nähe, in der jedes Wort und jeder Blick eine äußerst starke Bedeutung zu haben schienen, die nicht versäumt werden durfte.
Sie sprachen leise miteinander, nicht so lautstark, wie es amerikanische Touristen gern tun, ich konnte nur das eine oder andere zufällige Wort aufschnappen, obwohl doch nicht mehr als drei, vier Meter zwischen unseren Tischen lagen.
»Woran denkst du?«, fragte mich meine Frau.
Ich machte ein vorsichtiges Zeichen über ihre Schulter.
»Dieses Paar dort«, flüsterte ich. »Sie sehen aus wie Südeuropäer oder Levantiner, aber wahrscheinlich ist es nur ein amerikanischer Geschäftsmann mit seiner Tochter.«
Meine Gattin stand auf und holte sich frischen Kaffee, um den Kopf nicht verdrehen zu müssen. Als sie zurückkam, hatte sie so eine Miene aufgesetzt, die besagte, dass alle Männer doch irgendwie gleich sind und wahrlich nicht zwischen Huhn und Ei unterscheiden können.
»Wenn das Vater und Tochter sind, dann bin ich die Königin von Saba«, erklärte sie.
Fast genau im gleichen Moment legte der Mann auf dem weißen Tischtuch seine Hand auf die der Frau in einer so deutlich entlarvenden Art, dass meine Frau einfach Recht haben musste.
Eine Stunde später hatte meine Frau sich auf ihre Fotoexpedition begeben. Ich hatte mich an einem der Fenster in unserem Zimmer niedergelassen, mit einem Blick auf den Kanal und die Brücke, auf der bisher nur vereinzelte Fußgänger im Nieselregen vorbeieilten. Echte Venezianer, die unterwegs waren, um Brot fürs Frühstück zu kaufen oder den Hund auszuführen. Die Fahnen über der grünen Markise des geschlossenen Straßencafés – die europäische, italienische und venezianische – hingen reglos und traurig vor der ockerfarbenen, leicht gerissenen Fassade. Mit dem anderen Auge starrte ich ebenso trübsinnig auf die leicht gelbliche erste Seite meines Schreibblocks, der vor mir auf dem kleinen Schreibtisch lag – und auf meine reglose Hand, die schlaff einen schwarzen Stift der Marke Pilot 0,7 mm umklammerte, genau die Art von Schreibwerkzeug, die ich immer benutze, seit ich vor achtundzwanzig Jahren als Schriftsteller debütierte.
Ich dachte an Fellini. Ich dachte an Thomas Mann. Ich dachte an Goethe und Byron.
Nach zehn Minuten gab ich auf. Klemmte zwei Stifte auf den Block und begab mich hinaus, um lieber ein geeignetes Café zu suchen.
Unten an der Rezeption blieb ich stehen. Ich musste mir einen Regenschirm leihen, und da entdeckte ich das amerikanische Paar erneut. Der Mann war mit dem Portier beschäftigt, sie studierten einen Stadtplan, der zwischen ihnen auf dem dunklen Marmortresen ausgebreitet lag. Das Mädchen – als ich sie jetzt direkt vor mir sah, fiel es mir schwer, sie als »Frau« zu bezeichnen – hatte sich auf einem der großen Sofas in der Eingangshalle niedergelassen. Nein, sie sah wirklich nicht aus, als ob sie älter als zwanzig, einundzwanzig wäre, auch ihre Körperhaltung und der schüchterne Gesichtsausdruck zeugten von noch fehlender Erfahrung, von einer Art Unschuld. Sie hielt die Hände sittsam im Schoß gefaltet, der Blick war gesenkt, ich registrierte außerdem, dass sie unter dem linken Auge ein kleines Muttermal hatte, einen lila Fleck, ungefähr von der Größe einer Ein-Euro-Münze, auf der Gesichtshälfte, die sie am Frühstückstisch von mir abgewandt gehalten hatte. Doch das war nichts, was ihre Schönheit schmälerte, es verstärkte sie noch, gab ihr eine Art von Einzigartigkeit – von diesem Mädchen hier gab es nur ein einziges Exemplar auf der Welt, und genau das saß vor mir auf dem gelben Sofa und wartete, während ihr... ja, was?, fragte ich mich... Vater? Ehemann? Liebhaber?… dabei war, irgendetwas mit dem Empfangsportier zu regeln.
All diese Eindrücke und Gedanken schossen mir innerhalb einer einzigen Sekunde durch den Kopf. Dann traf eines dieser Ereignisse ein, das man im Nachhinein nur schwer glauben mag, das in Novellen und Romane gehört, in abgelehnte Filmmanuskripte, aber doch nicht ins lebendige Leben. Auf einem schmalen Marmorabsatz oberhalb des Sofas, auf dem das amerikanische Mädchen saß, stand eine dickbauchige Murano-Glasvase mit blassen Lilien, und aus irgendeinem unerklärlichen Grund kippte dieses schwere Stück nach vorn – genau in dem Moment, als ich dastand und das Mädchen verstohlen betrachtete -, fiel aufs Sofa und landete direkt neben ihr. Mit Lilien, Wasser und allem.
Sie stieß einen Schrei aus, hob die Hand vor den Mund und sprang auf. Ich ging drei Schritte auf sie zu und packte sie bei den Oberarmen, es war eine spontane Geste, ganz ohne Hintergedanken, und ich ließ sie auch sofort wieder los. Ihr Mann (Geliebter? Vater?) war in der nächsten Sekunde bei ihr, und der Portier im schwarzen Anzug eilte hinter dem Tresen hervor, Entschuldigungen und diverse italienische Kraftausdrücke von sich gebend.
Aber wir konnten schnell feststellen, dass kein größerer Schaden entstanden war. Die Vase hatte den Kopf des Mädchens um einen halben Meter verfehlt, diese war rechtzeitig aufgesprungen, so dass auch ihr Kleid kein Wasser abbekommen hatte, ja, sogar die Vase war unbeschadet, war sie doch auf dem weichen Sofa gelandet und dort liegen geblieben. Selbst die Blumen sahen genauso frisch aus wie vorher, als ein Piccolo geflissentlich den Strauß hinaustrug, nur der löwengelbe Sofabezug hatte einen etwas dunkleren Fleck davongetragen, aber wahrscheinlich würde sich das wieder geben, wenn das Wasser getrocknet war. Vielleicht konnte man ja auch ein Kissen darauf legen.
»Da hatten Sie aber Glück, Signorina«, erdreistete ich mich sie anzusprechen, als sich die ganze Aufregung gelegt hatte. »Sie waren nur einen halben Meter vom Tode entfernt.«
Der Mann war wieder zum Empfangstresen und Stadtplan zurückgekehrt, das Mädchen und ich waren ein Stück davon entfernt stehen geblieben. Sie sah mich mit einem sanften Lächeln an und schien eine Sekunde zu zögern, bevor sie antwortete.
»Ich stehe dem Tod näher, als Sie ahnen können, Sir.«
Sie sagte das mit so leiser Stimme, dass nur ich es hören konnte, und anschließend kam ihr Mann (Vater? Liebhaber?) und ergriff ihren Arm. Sie verabschiedeten sich mit einem Nicken und verschwanden durch die Drehtür.
2
Danach sah ich sie anderthalb Tage nicht mehr. Meine Ehefrau und ich nutzten den Sonntag wie auch den Montag dazu, in der Stadt herumzuschlendern, in erster Linie in San Marco, kamen aber bis Polo und Canareggio, wo meine Frau eine ganze Serie von Fotos der verschiedensten Hausportale und Fenster in unterschiedlicher Beleuchtung schoss. Es war ein Auftragsjob für eine dieser trendigen Monatszeitschriften, für die sie manchmal arbeitet. Ab und zu gingen wir für ein paar Stunden getrennte Wege, trafen uns wieder in den Cafés, in denen ich saß und von meiner Espressotasse und dem Amaroglas nippte, das muntere Treiben beobachtete und eine Novelle nach der anderen begann.
»Auf der siebten Stufe der Treppe der Riesen vor dem Dogenpalast angelangt, spürte Signora L. einen plötzlichen Stich im Herzen, und darauf fasste sie einen Entschluss«, begann eine.
»Als der Kunstkritiker Claus Lewertin an einem Donnerstagabend Anfang Dezember im Danieli abstieg, hatte er noch genau 120 000 Lire in der Tasche und noch genau 120 Minuten zu leben«, begann eine andere.
Ich tauschte die 120 000 Lire und 120 Minuten gegen 60 Euro und 60 Minuten aus. Dann versuchte ich es mit einer Million Dollar und zehn Minuten. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welche Alternative die schlagkräftigste war, und verschob das Projekt in die Zukunft.
Am Dienstagmorgen hörte es auf zu regnen, und gegen Mittag brach die Sonne durch die Wolkendecke, und es öffnete sich der Himmel. Ich ließ mich an einem Tisch beim al Tadora an der Piazzetta vor dem Dogenpalast nieder, meine Ehefrau verließ mich nach einer Viertelstunde auf der Jagd nach einer Schulterriementasche oder vielleicht einem Paar Schuhe, während ich selbst sitzen blieb mit einer Erzählung einer ganz anderen Potenz.
»Der Körper der toten Amerikanerin kam langsam den Rio Fuseri auf seinem Weg zum Canale Grande hin angetrieben, und die Uhren am Campanile hatten gerade siebenmal geschlagen, als der Schriftsteller Andrea Zorza ihn von seinem Fenster im Hotel Bonvecchiati entdeckte«, begann sie. Ich zögerte einen Moment wegen der unklaren Rückverweisung des Pronomens. Natürlich war es der Körper, den er entdeckte, nicht der Campanile oder der Morgen oder sonst etwas – man soll den Leser nicht unterschätzen, und als etablierter Schriftsteller braucht man auch nicht ständig und stets vor irgendwelcher alberner Grammatik zu Kreuze zu kriechen.
»Sie war nackt, sie trieb auf dem Rücken. Das dunkle Haar umrahmte ihr bleiches Gesicht wie ein Zisterzienserschleier, und er erkannte sie augenblicklich wieder. Ihre Nacktheit – die dunklen Brustwarzen, das noch dunklere Dreieck der Schambehaarung zwischen ihren Beinen, der sanfte Schwung ihrer Hüften -, all das war zwar neu für ihn, aber ihr fein ziseliertes Gesicht ließ keinen Zweifel aufkommen.
Patricia Hemmelwaite. Als ihr Körper hinter dem Restaurantbaldachin außer Sichtweite geraten war, schaute Zorza auf seine Armbanduhr. Vor nicht einmal acht Sunden hatte er sie zusammen mit ihrem Ehegatten beobachtet, dieser zur Feier des Abends in einen gelblichweißen Leinenanzug und kunterbunten Schlips gekleidet. Sie hatte ein schmales Glas vor sich stehen, höchstwahrscheinlich ein Gin Tonic. Er hatte ihre Schönheit als fast klassisch empfunden.
Übrigens – wirklich Ehemann?, dachte er. Sie wohnten seit einer Woche im Hotel, auf diese vulgäre amerikanische Art und Weise hatte er sich als Robert vorgestellt, aber man dürfe ihn gern Bob nennen. Er schien mindestens fünfundzwanzig Jahre älter als Patricia zu sein, hatte einen Ansatz zur Glatze und einen noch deutlicheren Ansatz zum Bauch, den er mit nur geringem Erfolg mit den verschiedensten bunten Westen zu kaschieren versuchte. Jeden Tag eine neue Farbe. Zorza hatte keine Amerikaner in seinem Bekanntenkreis, dennoch hatte er eine vorläufige Einschätzung gewagt, nach der es sich um einen steinreichen Geschäftsmann handelte, möglicherweise hatte er sich zurückgezogen, um seinen wohlverdienten Ruhestand und sein Vermögen unbeschwert genießen zu können – und der jetzt dabei war, gemeinsam mit seiner neuen Teenagerehefrau die obligatorische »tour d’Europe« abzureisen. Paris. London. Wien. Florenz und Venedig. Über seiner breiten Stirn und seinen dick gewölbten Augenbrauen hing ein Zug verdeckter Brutalität, und Zorza zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass er auf seinem Weg zum Erfolg und zur gesellschaftlichen Machtposition mit so einigen ethischen Regeln gebrochen hatte. Vorsichtig ausgedrückt.
Außerdem hatte er Mundgeruch. Während ihres einzigen, äußerst kurzen Gesprächs am vergangenen Abend in der Bar – nachdem sich seine Ehefrau (Geliebte? Tochter?) bereits unter dem Vorwand fiktiver Kopfschmerzen zurückgezogen hatte – hatte er ohne Erfolg versucht, diese Tatsache mit Hilfe von Whisky, Oliven und einer Zigarette zu verbergen, doch der unverkennbare Geruch nach Tod und inneren Organen, die sich im Stadium der Verwesung befanden, war Zorza in die Nasenflügel gestochen, so dass er sich zum Schluss gezwungen sah, sich eine seiner eigenen Monte-Canario-Zigarillos anzuzünden, obwohl er doch sein Tagesquantum von sieben Stück bereits erfüllt hatte.
Nach diesen Reflexionen und nachdem er sich seine Krawatte gebunden hatte, nahm Andrea Zorza den Telefonhörer auf und rief die Rezeption an.«
Hier wurde mein Schreiben von meiner Frau unterbrochen, die mit einer nierenförmigen Handtasche in glänzend gelbem Kalbsleder zurückkam. »Wie findest du sie?«, wollte sie wissen.
»Hübsch«, sagte ich. »Dann kannst du ja deine alte wegwerfen.«
Sie bestätigte, dies bereits getan zu haben, und dann fragte sie mich, wie es laufe. Ich musste zugeben, dass ich glaubte, einen Anfang gefunden zu haben, und sie war klug genug, nicht weiter in mich zu dringen.
»Ich habe darüber nachgedacht, was du von der Blumenvase erzählt hast«, sagte sie stattdessen. »Ich glaube, es ist gar nicht so merkwürdig, wie es aussieht, wenn man es genau betrachtet.«
»Nein?«, bemerkte ich und klappte meinen Block zu. »Wieso nicht?«
»Die Wachstumskraft der Blumen ist ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach zu stark geworden«, erklärte meine Frau mit diesem sanften und gleichzeitig listigen Lächeln, das sie mit ihren drei Schwestern gemeinsam hat. »Die Blumen, die nach hinten zeigen, haben sich sozusagen von der Wand abgestoßen, und wenn dann die Vase etwas zu weit am Rand hingestellt wird, dann muss sie früher oder später umfallen.«
Ich dachte darüber nach. Das klang eigentlich ganz plausibel, aber ich war mir dennoch nicht sicher, ob das ein Aspekt war, der in einer fiktiven Erzählung einen Platz haben könnte. Das Leben und die Dichtung sind zwei Dinge, die sich nicht immer vereinen lassen, das habe ich im Laufe der Zeit gelernt.
»Wollen wir einen Spaziergang zur Lagune machen?«, schlug ich stattdessen vor. »Nach Castello, Arsenale und so? Das Wetter ist doch gar nicht so schlecht.«
Was wir dann auch taten. Die neue Handtasche meiner Ehefrau glänzte im Sonnenschein.
Abends besuchten wir ein Konzert in der San-Vidal-Kirche in der Nähe der Ponte dell’Accademia. Ein Kammerorchester kämpfte sich in energischem Tempo durch kürzere Stücke von Vivaldi, Albinoni und Bach. Wir waren ein paar hundert Zuhörer, die in dem schönen Kirchenraum saßen (angenehmerweise befreit von Goldornamentik und fleischigen Cheruben) und hörten zu, aber bald war es nicht mehr die Musik, die meine Konzentration in Anspruch nahm.
Zwei Reihen schräg vor uns saß das amerikanische Paar. Ich hatte keinerlei Mühe, es zu betrachten, da die wenigen leergebliebenen Stühle im Raum sich genau zwischen ihnen und mir befanden. Es sah fast aus, als wäre es so arrangiert worden, damit ich die Möglichkeit hatte, sie zu betrachten. Ich weiß, dass mir genau dieser abwegige Gedanke durch den Kopf schoss, aber meine Filter für derartige Reflexionen sind im Laufe der Jahre auch immer durchlässiger geworden. Ich denke, das liegt an meinem Beruf.
Nach meiner geringen Erfahrung gibt es – was die Art zuzuhören betrifft – zwei Sorten von Konzertbesuchern. Entweder sitzt man kerzengerade da und betrachtet die Musiker, das ist das Modell, das meine Frau bevorzugt -, oder aber man versinkt in sich selbst. Man beugt den Kopf vor und hält den Blick gesenkt, vielleicht faltet man die Hände und schließt die Augen, das ist die Methode, die ich meinerseits immer anwende. Man lässt den Gedanken freien Lauf, so dass in einem inneren Raum eine Art Korrespondenz zwischen Musik und Bewusstsein entsteht, und genau dieser Raum bietet meiner Meinung nach den Platz für ein schönes Musikerlebnis.
Das amerikanische Paar hatte einen dritten Weg gefunden.
Während das erste Stück, Vivaldis Concerto in sol minore archi e cembalo, gespielt wurde, saßen sie noch Schulter an Schulter, den Blick gehoben, wahrscheinlich hielten sie einander bei der Hand, seine Rechte, ihre Linke, doch das war nur eine Vermutung, nichts, was ich von meiner Position aus sehen konnte. Doch ab dem nächsten Stück, dem sauber gespielten Estro Armonico, gingen sie dazu über, einander intensiv zu betrachten.
Das sah sonderbar aus. Da sie ja so dicht beieinander saßen, betrug der Abstand zwischen ihren Gesichtern höchstens fünfundzwanzig Zentimeter. Zuerst drehte sie ihren Kopf und betrachtete sein Profil eine halbe Minute lang, dann sah er sie in gleicher Weise an, schließlich starrten sie einander ungefähr genauso lange gegenseitig in die Augen.
Dann begannen sie wieder von vorn. Sie, er, beide. Und es ruhte dabei ein Ernst über ihnen, als hätte ihre letzte Stunde geschlagen. Mir fielen unweigerlich die Worte des Mädchens aus der Hotellobby ein: Ich stehe dem Tod näher, als Sie ahnen können, Sir.
Während der sehr kurzen Pause machte ich meine Frau auf meine Beobachtungen aufmerksam, und sie nickte. Sie hatte auch gesehen, was ich gesehen hatte, auch wenn ihr Blickfeld eingeschränkter war als meines. Es wurde zum größten Teil begrenzt von einer rotbraunen, wogenden Lockenpracht, die übrigens bedeutend besser auf einen Teenagerkopf gepasst hätte als auf das Haupt einer siebzigjährigen Matrone, wo sie sich tatsächlich befand.
»Mit den beiden stimmt etwas nicht«, flüsterte ich, gerade als die Musiker auf die Bühne zurückkamen, um mit Johann Sebastian Bachs Concerto per violini, archi e cembalo zu beginnen. »Absolut nicht.«
Ich kann nicht beschwören, dass meine Frau daran schuld war, dass wir mit ihnen ins Gespräch kamen, aber ich glaube es. Ich habe sie nie danach gefragt, doch ich weiß, dass sie sehr geschickt ist, was diese Art von verzwickten Manövern betrifft.
Auf jeden Fall stellten wir uns einander vor, als wir auf der Treppe vor der Kirche standen. Der Mann hieß Robert L. Hemmelwaite, das Mädchen hieß Patricia, ihr Nachname blieb auf eine irgendwie merkwürdige Art und Weise in der Luft hängen. Wir stellten fest, dass wir im gleichen Hotel wohnten, der gestrige Vorfall mit der Blumenvase war natürlich nicht vergessen, und nichts schien natürlicher zu sein, als dass wir uns zusammentaten. Und uns gemeinsam unsere klugen Köpfe zerbrachen, um einen einigermaßen direkten Kurs durch das Wirrwarr von Gassen zum Markusplatz hin zu finden.
Natürlich verirrten wir uns, und als wir uns plötzlich auf einem kleinen Platz befanden, den niemand von uns erkannte – der dafür aber mit zwei kleinen, einladenden Restaurants bestückt war, die immer noch geöffnet hatten -, schlug Robert L. Hemmelwaite vor, dort einzukehren und eine Flasche Wein zu trinken.
Meine Frau nahm den Vorschlag ohne jedes Zögern an, und wir zwängten uns in eines der Lokale – mit dem unheilvoll klingenden Namen »De Moraturi«. Schnell bekamen wir einen Tisch in einer Ecke und einen Barolowein, den Mr. Hemmelwaite mit großer Sorgfalt aus der zwölfseitigen Weinkarte ausgewählt hatte.
Wir prosteten uns zu, es entstanden einige Sekunden des Schweigens, während derer – davon bin ich fest überzeugt – jeder Einzelne von uns, also alle vier, bereuten, uns in diese Situation begeben zu haben. Dass wir uns alle insgeheim wünschten, wir hätten uns stattdessen auf direktem Weg nach Hause in das jeweilige Hotelzimmer im Bonvecchiati begeben. Der Wein jedoch war außerordentlich, ich machte Mr. Hemmelwaite meine Komplimente deswegen, und dann erzählte meine Frau, dass ich Schriftsteller sei.
Das tut sie immer früher oder später, aber jetzt war mir klar, dass es einer gewissen Nervosität entsprang, die es ihr nicht ermöglichte, diese Information noch länger für sich zu behalten. Normalerweise dauert es immer erst ein paar Minuten. Sie weiß, dass ich das nicht mag, anschließend bittet sie mich immer um Entschuldigung, aber das sei wie eine Art Tic, behauptet sie. Es lässt sich einfach nicht zurückhalten … wie eine sanfte Form des Touretteschen Syndroms, wie sie einmal vorschlug... statt unanständiger Worte kommt »Mein Mann ist Schriftsteller« aus ihrem Mund gerutscht.
Und das öffnet jedes zähe Gespräch, das will ich gar nicht leugnen. Es ist fast so, als wärst du ein Mönch oder ein Mörder, pflegt meine Frau zu sagen. Die Leute sind einfach interessiert.
»Schriftsteller?«, wiederholte Robert L. Hemmelwaite mit verwundertem Tonfall, während er gleichzeitig die Hand des Mädchens ergriff. »Ja, wenn das so ist, dann wage ich zu behaupten, dass wir eine Geschichte zu erzählen haben.«
3
Wir haben einen Liebespakt, Patricia und ich«, begann er und machte gleich eine Pause, damit meine Frau und ich diese schwerwiegende Feststellung erst einmal sacken lassen konnten.
»Wie schön«, sagte meine Frau und zeigte eines ihrer vorsichtigen Lächeln.
»Einen Liebes- und Selbstmordpakt«, fuhr Robert L. Hemmelwaite fort.
»Selbstmord?«, wiederholte ich. »Was zum Teufel meinen Sie damit?«
»Ich nehme an, dass Sie in der europäischen Literatur bewandert sind?«, fuhr Mr. Hemmelwaite fort, als hätte er meinen plumpen Einwurf gar nicht gehört, und wie auf ein Zeichen zog das Mädchen zwei Bücher aus ihrer Handtasche. Meine Ehefrau und ich rutschten auf unseren Plätzen ein wenig hin und her und nickten verhalten. Hemmelwaite nahm eines der Bücher und wog es in der Hand. »Die Leiden des jungen Werther«, sagte er. »Goethe. Wir sind große Bewunderer der europäischen Kultur, Patricia und ich. Sie erscheint unserer so überlegen zu sein. So...« Er befeuchtete die Lippen mit der Zungenspitze und suchte nach dem richtigen Wort. »...so erhaben.«
Meine Frau nickte erneut. Ich zuckte mit den Achseln. Das Mädchen hielt das andere Buch hoch. »Heinrich von Kleist«, sagte sie. »Wir schätzen das Großartige in seinem Schicksal... das Unwiderrufliche. Ja, es stimmt, was Robert sagt. Wir sind nach Venedig gekommen, um hier dem Tod zu begegnen. In unserem Fall zweifellos der richtige Ort.«
Ihre Stimme war unerwartet dunkel und wohl moduliert, wenn man ihren zarten Körperbau bedachte, das war mir bereits am ersten Morgen am Frühstückstisch aufgefallen. Eine alte Seele in einem jungen Körper, wie Klimke schreibt. Ich nahm einen großen Schluck Wein und holte meine Pfeife heraus. Meine Frau tauschte einen Blick mit mir und fragte: »Und was hat Sie dazu gebracht, so einen drastischen Entschluss zu fassen?«
Auch das amerikanische Paar warf sich einen Blick zu. Dann verschränkten sie zwei ihrer Hände vor sich auf dem Tisch und begannen, ihre Geschichte zu erzählen.
Robert L. Hemmelwaite stammte aus einer äußerst vermögenden Ölfamilie in Texas. Eigentlich hieß er Robert L. Hemmelwaite jr. und war einziges Kind von Robert L. Hemmelwaite sen. und dessen Ehefrau Tess, die aus einer berühmten Bankiersfamilie aus Boston stammte. Robert Jr. war 48 Jahre alt und verheiratet mit einer gewissen Laura aus der bekannten Konservendynastie Bettinghurst in San Francisco. War der Name vielleicht bekannt? Nein, nun gut.
Zusammen hatten Robert und Laura drei Kinder: Liza, Belinda und Jeffrey, 24, 21 beziehungsweise 17 Jahre alt zum jetzigen Zeitpunkt, und Robert liebte seine Ehefrau wie auch seine Kinder in der Art und Weise, wie es sich für einen guten, respektierten Familienvater und Mitglied der Gesellschaft gehörte. Daran gab es keinen Zweifel. Als Robert seinen 47. Geburtstag feierte, eine Tatsache, die mit einer einfachen Einladung für vierundsechzig Personen auf dem Familiensitz außerhalb von Austin begangen wurde, war er jedoch, plötzlich und ohne jede Vorwarnung, von einer unerklärlichen inneren Leere ergriffen worden. Des Nachts, als die letzten Gäste sich verabschiedet hatten und nach Hause gefahren waren, konnte er einfach nicht zur Ruhe kommen, und schließlich war er im frühen Morgengrauen hinausgegangen, war über die weitgestreckten Ländereien gewandert und hatte gespürt, wie sich sein Herz in der Brust zusammenschnürte. Was war der Sinn all seines Strebens? Er war erfolgreich, hatte mehr Geld, als er ausgeben konnte – zumindest, wenn er weiterhin so bescheiden lebte wie bisher -, er hatte eine Ehefrau, die ihm jeden Tag versicherte, dass sie ihn liebte.
Und drei wohlgeratene Kinder, von denen keines homosexuell war oder Kommunist oder Drogen nahm – zumindest nicht, soweit er wusste. Bei seinem letzten Besuch beim Familienarzt, Doktor Carl W. Innings, hatte dieser ihm versichert, er sei gesund wie eine Eiche und habe noch viele schöne Jahre vor sich.
Schöne?, dachte Robert jetzt. Viele Jahre? Wozu nur?
Wozu sollte das gut sein und wem sollte es nützen? Gefühle der Leere und Schwermut hatten ihn wie ein feuchtes Tuch eingehüllt, erklärte Robert L. Hemmelwaite, als er so weit in seinem Bericht gekommen war. Konnten wir als Europäer uns so ein Gefühl vorstellen und es verstehen?
»Angst?«, fragte meine Frau, »oh ja, das gehört zu unserem Erbteil. Aber erzählen Sie doch weiter.«
Anfangs, fuhr Robert L. Hemmelwaite fort, nachdem wir aus unseren Gläsern einen Schluck getrunken hatten, wir alle vier, anfangs hatte er gedacht, es wäre etwas Vorübergehendes. Dass der Trübsinn und die Schwermut ihn nach ein paar Tagen oder einigen Wochen wieder verlassen würden. Doch dem war nicht so. Als er beim nächsten Treffen mit seinem Therapeuten – ein Ereignis von vierzig oder fünfundvierzig Minuten Dauer, das regelmäßig vormittags am ersten und dritten Dienstag im Monat stattfand – ausführlich und ehrlich von seinen andauernden Problemen berichtete, hörte der Therapeut, ein gewisser PhD Wilfred T. Cummings, wohlwollend und interessiert zu, nahm anschließend Kontakt zu einem renommierten Psychiater auf, und nach einer Weile lief es darauf hinaus, dass Robert für sechs Monate krankgeschrieben wurde und fast ein Dutzend verschiedener Medikamente verschrieben bekam.
Robert erwähnte seiner Frau und seinen Kindern gegenüber nichts vom Stand der Dinge, erklärte stattdessen, dass er beschlossen habe, sich sechs Monate Auszeit zu gönnen, und legte das Steuer der Firma – oder des Konzerns, besser gesagt – in die Hände seines Stellvertreters. Er kippte alle Tabletten in die Toilette und begann die große europäische Literatur zu lesen, ein alter Traum, den er, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein, bereits seit vielen Jahren gehegt hatte. Seit dem Tag, als er das College als souveräner Kursbester verlassen hatte, genau genommen.
Baudelaire. Proust. Nabokov.
Stendhal.
Goethe und Kleist, wie gesagt.
Bereits nach einigen Tagen spürte er, dass es ihm besser ging. Eine neue Flamme hatte sich in seiner Brust entfacht. Zwar war sie noch klein und zart, eher wie eine Ahnung, die aber dennoch etwas Großes prophezeite. Etwas Starkes und Unmäßiges, und bald schon begriff er, worum es sich handelte.
Leidenschaft. Die Idee von der kompromisslosen, der alles verzehrenden Liebe.
Könnten wir uns als Europäer ein derartiges Gefühl vorstellen?
Ja, das konnten wir natürlich, beantwortete er schnell selbst seine Frage, bevor meine Frau zum Zuge kommen konnte, das hatten wir ja mit der Muttermilch eingesogen, wir, die wir auf der richtigen Seite des Atlantiks geboren waren.
Robert L. Hemmelwaite machte eine Pause. Wir tranken ein wenig Wein. Ein Kellner kam mit einem Schälchen Erdnüssen und einem kleinen Teller mit Oliven an unserem Tisch vorbei. Ich bemerkte, dass das Mädchen feuchte Augen bekommen hatte und dass sich auf der Stirn meiner Ehefrau eine Falte bildete. Ich zündete meine Pfeife an, und Mr. Hemmelwaite fuhr fort.
Vor ungefähr einem Jahr, es war Mitte April, sollte die Trauung seiner ältesten Tochter Liza stattfinden. Das war ein Ereignis, bei dem die gesamte Familie zusammenkam – beide Familien natürlich – und die zweihundertachtundzwanzig nächsten Verwandten und Freunde, und wie durch einen ironischen Wink des Schicksals ergab es sich, dass ausgerechnet in Zusammenhang mit diesem Hochzeitsfest der Wind der Liebe in Robert L. Hemmelwaites Herz geblasen wurde. Mit aller Kraft und der charakteristischen Schonungslosigkeit, die für echte Leidenschaft so charakteristisch ist. So war das.
Während des Festes wurde gegessen, getrunken und getanzt bis zum Morgengrauen. Braut und Bräutigam wurden nach allen Regeln der Kunst und der guten Sitten gebührend gefeiert, es wurden Reden gehalten, es wurde angestoßen, sie wurden umjubelt, und das rosarote Glück des jungen Paares und ihre prächtigen Zukunftschancen wurden in keiner Weise in Zweifel gezogen. Es wurde Konfetti geworfen, und es wurden Torten angeschnitten, ein Feuerwerk wurde abgefeuert, und von einem stattlichen Mezzo-Cousin wurden zwei italienische Arien gesungen. Es war ein munteres Treiben.
Und nicht weiter überraschend war es auch, dass der Vater der Braut kurz vor Mitternacht die zwei Jahre jüngere Schwester des Bräutigams zum Tanz aufforderte. Beide Familien warfen ja mit dieser Hochzeit ihre wohlgefüllten Beutel zusammen, es war der richtige Zeitpunkt, um zu konsolidieren, Bänder zu knüpfen und Brücken zu bauen. Doch als es auf den Morgen zuging, hatten sie nicht weniger als acht Tänze miteinander getanzt, Robert und Patricia, und zwei Tage später liebten sie sich zum ersten Mal in einem Motelzimmer in einem Außenbezirk von San Antonio.
Patricia war noch unschuldig und hatte gerade eine langwierige Therapie ihrer Panikattacken erfolgreich abgeschlossen, die dritte in ebenso vielen Jahren, und sie versanken in der gegenseitigen Liebe wie Verdurstende in der Wüste, ebenso widerstandslos, als ob... als ob man von einer Qualle umschlossen wird, präzisierte Robert. Er war 47 Jahre alt, Patricia sollte bald 22 werden.
Plötzlich war das Vakuum gefüllt. Das Vakuum beider Beteiligten, denn im Kernpunkt von Patricias Gefühl des Zukurzkommens während der letzten Jahre hatte sich genau die gleiche hohl klingende Zimbel befunden wie bei Robert. Doch jetzt wurden sie zusammengefügt, in Einklang gebracht, ihre gebrochenen Tonhöhen kletterten aneinander hoch und vermischten sich zu einer ungewöhnlichen Harmonie. Ein vollkommen neuer Raum öffnete sich in ihnen. Der Raum der Liebe, der unendliche rote Raum der Leidenschaft …
»Entschuldigen Sie mich, ich muss kurz auf die Toilette«, unterbrach meine Frau und verließ den Tisch. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Weinflasche bereits ausgetrunken, und während wir darauf warteten, dass sie zurückkam, fragte Robert L. Hemmelwaite, ob wir nicht Lust hätten, noch eine zu teilen.
Ich erwiderte, dass ich nicht davon ausging. Dass wir wohl genug getrunken hatten, meine Frau und ich.
Die schwedische Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Från doktor Klimkes horisont« bei Albert Bonniers, Stockholm.
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Genehmigte Taschenbuchausgabe November 2008
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Håkan Nesser
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, MünchenUmschlagmotiv: © plainpicture / Robert Harding
SL · Herstellung: BB
eISBN : 978-3-894-80592-0
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de