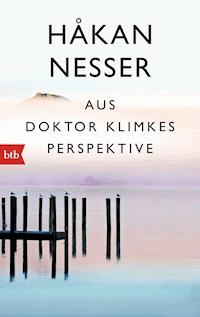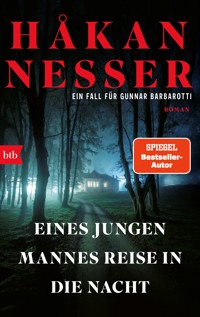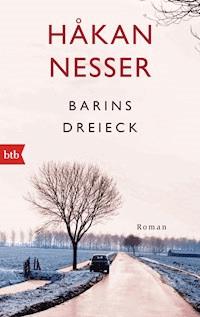
5,99 €
Mehr erfahren.
Drei Männer, drei Morde, drei tödliche Verbindungen ...
Drei Männer werden plötzlich und unerwartet mit drei Morden konfrontiert: ein verwitweter Übersetzer, ein verunsicherter Psychotherapeut und ein Lehrer kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Was verbindet die drei? Bilden sie sich die Morde etwa nur ein? "Barins Dreieck" ist ein Buch, das einem den Schauer über den Rücken jagt. Ein ungewöhnlicher Kriminalroman, der Nervenkitzel und Spannung bietet bis zum Schluss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Drei Männer, drei Todesfälle, drei rätselhafte Geschichten: Da ist zu einen David Moerk, der Übersetzer. Er ist auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau und übersetzt gleichzeitig ein Buch, das ihn in immer größere Verwirrungen stürzt: Hat der Autor seinen eigenen Tod vorhergesehen? Dann gibt es da Leon, den Psychotherapeuten, der von einer eleganten, reichen Frau konsultiert wird, die angeblich fürchtet, sie könne einen Mord begehen. Meint sie es ernst? Und dann ist da noch Studienrat Marr, Lehrer für Geschichte und Philosophie, der sich unversehens damit konfrontiert sieht, unter Mordverdacht zu stehen, obwohl er sich nicht daran erinnern kann, etwas Unrechtes getan zu haben.
»Barins Dreieck« ist ein Buch, das einem Schauer über den Rücken jagt, spannend geschrieben und mit einer gehörigen Portion Unwirklichkeit versehen – wie die Van-Veeteren-Krimis in einem fiktiven Romanland angesiedelt. Ein intensiver Psychothriller, der Nervenkitzel und Spannung bietet bis zum Schluss.
Inhaltsverzeichnis
Autor
Håkan Nesser, geboren 1950, ist einer der interessantesten und aufregendsten Krimiautoren Schwedens. Für seine Kriminalromane um Kommissar Van Veeteren und seine literarisch anspruchsvollen Psychothriller erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, sie sind in mehrere Sprachen übersetzt und wurden erfolgreich verfilmt. »Barins Dreieck« hält er selbst für eines seiner wichtigsten Bücher.
FÜR NATALIA
Zur gleichen Zeit, irgendwo andershebt immer die junge Mutter– zum ersten Mal –ihr verkrüppeltes Kind der Sonne entgegen
Zur gleichen Zeit, irgendwo anderserwacht immer der Greis in der Nachtund weißdass er den Morgen nicht erreichen wird
Zur gleichen Zeit, irgendwo andersstehen immer die gleichen Pferde– oder andere –träumend unter dem BaumMihail Barin
At such times, I conclude, the soulcan only hang in the dark, like a whitebat, and let darkness have the day.Martin Amis
Es werde Licht!Erstes Buch Mose 1.3
Rein
I
Ich hatte zwei Gründe, nach A. zu reisen, vielleicht sogar drei, und weil es mein Ziel ist, über alles so genau wie möglich Rechenschaft abzulegen, wähle ich sie als Ausgangspunkt. Meine Reise nach A.
Wie ich es jetzt in dem noch nicht Geschriebenen sehe, besteht natürlich das Risiko, dass Sachen und Dinge verwischen, unklar werden. Dass es mir vielleicht nicht gänzlich gelingt, alle Ereignisse und Zusammenhänge auseinander zu halten. Und dann ist es natürlich eine gute Regel, wenn man sich an die Chronologie hält, die sich sowieso anbietet. Auch wenn ich – das ist zumindest meine Hoffnung – nicht der Versuchung verfallen bin, mich, so weit es geht, in das Urgestein der Zeit zurückzuverirren.
Wer kann sagen, wann etwas eigentlich anfängt?
Wer?
Der erste Anlass war also dieses Rundfunkkonzert. Beethovens Violinkonzert, das bekanntermaßen in D-Dur gespielt wird, es soll angeblich im Jahr 1806 in erster Linie für den Geiger Franz Clement geschrieben worden sein, und es heißt, dass Beethoven selbst es als so ein Meisterwerk ansah, dass er nie wieder versuchte, in diesem Genre etwas zu schreiben. Unübertrefflich, mit anderen Worten.
Wie üblich hatte ich es mir mit einer Decke über den Beinen auf meinem Barnedale-Sofa bequem gemacht. Ein Glas Portwein stand in Reichweite auf dem Tisch, dazu eine Schale mit Nüssen und eine einsame Kerze. Ich erinnere mich noch, wie mir der Gedanke kam, dass der leicht flackernde Lichtkegel in gewisser Weise den Abstand zwischen mir und der Musik zu gestalten schien, dieses undurchdringliche Land, die schwammige, aber definitive Grenze zwischen dem Ich und dem Es. Draußen peitschte ein hartnäckiger Regen gegen das Fenster, wir hatten schon Mitte November, und das Wetter war, wie es zu dieser Jahreszeit zu sein pflegt. Dunkel, nass und schwermütig. Böige Winde jagten durch die Straßen und Gassen, und die Temperatur war in den letzten Wochen zwischen Null und einigen Graden darüber hin und her gependelt. Nie höher.
Die Sendung begann wenige Minuten nach zwanzig Uhr, und ich befand mich bald in diesem Zustand, der sowohl starke Konzentration als auch Entspannung beinhaltet und der so charakteristisch, vielleicht auch einzigartig für ein gutes Musikerlebnis ist. Vielleicht bin ich auch für ein paar Minuten eingenickt, aber ich bin mir sicher, dass ich trotzdem nicht einen Ton von Corrado Blanchettis souveränem Spiel verpasst habe.
Das Husten kam ganz zum Schluss, gerade während der leisesten Partie vom Rondo, und es versetzte mir einen Schlag. Ich habe immer wieder sowohl über das Geräusch als auch über meine Reaktion darauf nachgedacht, und ich weiß, dass es eigentlich keinerlei Zweifel in irgendeiner Richtung daran gibt. Es war ein elektrischer Stoß, ganz einfach. Elektrisch. Emotional. Ich verfiel in einen Schockzustand, und er dauerte eine ganze Weile: Während ich abgestumpft dem Schlussakkord des Konzerts lauschte, während des folgenden Applauses und bis der Rundfunksprecher erklärte, dass wir gerade Beethovens Violinkonzert in einer Einspielung der Rundfunksymphoniker in A. genossen hätten. Der Solist sei Corrado Blanchetti gewesen, das Datum des Konzertes der 4. Mai dieses Jahres.
Ich will nicht leugnen, dass es trotzdem bereits vom ersten Augenblick an einen gewissen intellektuellen Zweifel gab. Auf eine bestimmte Art war mir der Gedanke, ich könnte mich verhört haben, fremd. Dass ich mich geirrt haben könnte. Ich überlegte, verwarf und analysierte diese nur Sekunden währende Hörerinnerung wirklich kritisch. Ich bin weiß Gott kein Mensch schneller Entschlüsse, aber in meinem tiefsten Inneren – im geschützten Raum der Gefühle – wusste ich natürlich, dass ich mich in keiner Weise selbst belogen hatte.
Das war sie gewesen. Das war Ewas Husten. Meine verschwundene Ehefrau hatte während dieser gut ein halbes Jahr alten Aufnahme irgendwo im Publikum gesessen, und auf Grund eines leichten Kratzens im Hals, das zu unterdrücken ihr nicht gelungen war, erhielt ich das erste Lebenszeichen von ihr seit mehr als drei Jahren.
Ein Husten aus A. Eineinhalb Minuten vor Ende von Beethovens Violinkonzert in D-Dur. Natürlich mag es sonderbar und unglaublich klingen, aber im Lichte von vielem anderen betrachtet, was mir früher und auch später noch zustieß, erscheint es wiederum gar nicht mehr so aufregend.
Es kostete mich eine gute Woche – neun Tage, um genau zu sein –, um an die Aufnahme des Rundfunksenders zu kommen (mein Tonbandgerät war während der Sendung leider ausgeschaltet gewesen, da ich vergessen hatte, neue Bänder zu kaufen), aber so sehr es den Zweifeln auch gelungen war, während dieser Wartezeit ihre Klauen in mich zu schlagen, so lockerte sich der Griff doch unmittelbar, als ich mich hinsetzen und das Konzert noch einmal hören konnte. Vier, fünf Mal spulte ich vor und zurück bei der betreffenden Stelle, und jedes Mal versuchte ich, mir wieder ganz unvoreingenommen und gleichzeitig besonders aufmerksam das Geräusch anzuhören.
Ich kann es natürlich nicht beschreiben. Gibt es überhaupt Worte für so etwas wie ein Husten? Mir kommt der Gedanke, wie wenig von unserer Wirklichkeit und unseren Vorstellungen von ihr eigentlich in den Bereich der Sprache fällt. Während es also kein Problem für mich darstellt, mit Hilfe eines ganz kurzen Höreindrucks das Charakteristische an dem spezifischen Husten eines Menschen herauszufiltern – unter dem von Millionen –, besitze ich kaum ein adäquates Wort oder einen Ausdruck, um dieses Geräusch zu beschreiben. Ich nehme an, dass eine genaue Unterscheidung mit Hilfe komparativer Luftfrequenzkurven und ähnlicher Techniken zu Stande kommen könnte, aber was mich betrifft, war dieser Aspekt von Anfang an überflüssig und uninteressant.
Es war Ewa, die da hustete. Am 4. Mai hatte sie in A. gesessen und Beethovens Violinkonzert gehört. Ich hatte es sofort gewusst, als ich es hörte, und ich wusste es immer noch genau, nachdem ich es mir wieder und wieder angehört hatte.
Sie lebte. Sie lebte, und es gab sie. Zumindest vor sechs Monaten.
Und das versetzte mir einen Schlag, wie schon gesagt.
Der zweite Grund, nach A. zu fahren, trat zwei Wochen nach dem Rundfunkkonzert ein. Frühmorgens rief mich der Verleger Arnold Kerr an und teilte mir mit, dass Rein tot sei und dass er soeben dessen neues Manuskript erhalten habe.
Das klang natürlich gleichzeitig verwirrend und ein wenig widersprüchlich, und noch am gleichen Tag verabredeten wir uns im Klosterkeller zur Mittagszeit, um die Geschichte zu erörtern.
Das heißt, das Wenige zu erörtern, das es zu diesem Zeitpunkt zu erörtern gab. Rein sei tot, stellte Kerr fest und stocherte ein wenig lustlos mit der Gabel in seinen Fettucini herum. Die genauen Umstände waren noch unbekannt, aber er war während der letzten Jahre nie so richtig gesund gewesen, also war es so gesehen keine große Überraschung. Ich versuchte natürlich, Details zu erfahren, aber die meiste Zeit saß Kerr nur da und zuckte abwehrend mit den Schultern, und bald war klar, dass er nicht besonders viel darüber wusste, was eigentlich passiert war. Er hatte die Nachricht per Telefon erhalten. Zimmermann hatte am vergangenen Abend aus A. angerufen und die Tatsache mitgeteilt, und Kerr nahm an, dass alle näheren Umstände in dem Pressecommuniqué stehen würden, das zwar zugegebenermaßen ungewöhnlich lange auf sich warten ließ, aber mit Sicherheit bis zum Abend auftauchen würde. Rein war schließlich ein bekannter Mann gewesen, sowohl in seinem Heimatland als auch in einigen anderen Teilen der zivilisierten Welt.
Wählerisch und möglicherweise ein wenig schwierig, aber viel gelesen und geschätzt, oh doch. Und in gut zehn Sprachen übersetzt. Und hier kam ich ins Bild – oder war besser gesagt hereingekommen. Reins frühe Werke – die Tschandala-Suite und seine Essays – hatte noch Henry Darke in unsere Sprache übersetzt und interpretiert, aber seit Kroulls Schweigen hatte ich es übernommen. Darkes Krankheit hatte allen Übersetzeraufträgen einen Riegel vorgeschoben, und in vielen Gesprächen war mir außerdem klar geworden, dass er nie mit seinem letztendlichen Text oder mit seiner Beziehung zu Rein selbst zufrieden gewesen war. Bei einer unserer letzten Zusammenkünfte – nur wenige Monate vor Darkes Dahinscheiden – drückte er es sogar mit den Worten aus, dass Rein ihm Unlust bereite. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich Rein noch nicht persönlich und fand natürlich, dass das ein bisschen merkwürdig klang, aber mit den Jahren hatte ich seine Äußerung immer besser verstehen können und mich Darkes Standpunkt angenähert, das will ich gar nicht leugnen. Ich war Rein zwar nur bei vier, fünf Gelegenheiten begegnet, aber unweigerlich war mir etwas schwer zu Akzeptierendes in seiner Person aufgefallen. Ich habe nie wirklich sagen können, worauf es eigentlich beruhte, aber nichtsdestotrotz war dieses Gefühl vorhanden.
Ja, auf jeden Fall bis zu dem Tag, an dem Kerr und ich im Klosterkeller saßen und darüber grübelten, warum immer noch nichts von seinem Dahinscheiden bekannt geworden war, weder in den Zeitungen noch im Rundfunk oder Fernsehen. Obwohl doch seitdem mindestens vierundzwanzig Stunden vergangen sein mussten, jedenfalls so ungefähr.
»Und was war das mit dem Manuskript?«, fragte ich. Kerr bückte sich und wühlte in seiner Aktentasche, die an einem Tischbein lehnte. Zog einen gelben Ordner heraus, kreuz und quer mit einem Gummiband umwickelt.
»Das ist ja das verdammt Merkwürdige daran«, sagte er und wischte sich etwas nervös die Mundwinkel mit der Serviette ab.
Er schob die Gummibänder herunter und öffnete den Ordner, zog einen Papierbogen heraus, den obersten des Stapels, und reichte ihn mir. Er war handgeschrieben, schwarze Tinte, ziemlich ausladende Piktur. Ich erkannte sie wieder.
A., den 17. XI. 199-Ich schicke Ihnen mein letztes Manuskript zur Übersetzung und Veröffentlichung. Verboten ist jeglicher Kontakt mit meinen Verlegern und anderen. Das Buch darf unter keinen Umständen in meiner Muttersprache herauskommen. Höchste Diskretion ist notwendig. Hochachtungsvoll
Germund Rein
P.S. Das ist die einzige Kopie. Ich gehe davon aus, dass ich mich auf Sie verlassen kann. D.S.
Ich sah Kerr an.
»Was zum Teufel bedeutet das?«
Er breitete die Arme aus.
»Keine Ahnung.«
Er erklärte, dass das Paket am Tag zuvor angekommen sei, mit der Nachmittagspost, und dass er mehrere Male versucht habe, mit Rein telefonisch Kontakt aufzunehmen. Seine Versuche hätten, wie er sich ausdrückte, ein natürliches Ende gefunden, als Zimmermann ihn anrief und berichtete, dass Rein tot war.
Nach dieser Erläuterung saßen wir schweigend da und widmeten uns einige Minuten lang nur unserem Essen, und ich erinnere mich daran, dass es mir schwer fiel, den Blick von der gelben Mappe fern zu halten, die Kerr rechts von sich auf dem Tisch liegen hatte. Natürlich verspürte ich eine große Neugier, aber auch eine gewisse Verachtung. Mein letztes Treffen mit Rein hatte vor gut einem halben Jahr stattgefunden. Anlass war die Veröffentlichung seines letzten Buches in meiner Übersetzung gewesen. Die roten Schwestern hieß es. Wir hatten uns nur ganz kurz im Verlag gesehen, und wie üblich war er sehr wortkarg gewesen, fast schon autistisch, obwohl wir seine Anweisungen für die Pressekonferenz auf Punkt und Komma befolgt hatten. Wir hatten mit Champagner und Sherry angestoßen, Amundsen hatte seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das Buch ein Erfolg werden möge, und Rein hatte in seinem verschlissenen alten Kordanzug dagesessen und ausgesehen, als sei Verachtung das einzige Gefühl, zu dem er sich eventuell noch aufraffen könnte. Eine graue, gleichgültige und desinteressierte Verachtung, die zu verbergen er überhaupt keinen Versuch machte.
Nein, es wäre gelogen, wollte ich behaupten, ich hegte irgendwelche wärmeren Gefühle für Germund Rein.
»Und?«, fragte ich schließlich.
Kerr kaute zu Ende und schluckte umständlich hinunter, bevor er den Blick hob und mich aus seinen bleichen Verlegeraugen ansah. Gleichzeitig legte er sein Besteck weg und begann, mit den Fingern auf die gelbe Mappe zu trommeln.
»Ich habe mit Amundsen geredet.«
Ich nickte. Natürlich. Amundsen war der Verlagsleiter und derjenige, der die letztendliche Verantwortung trug.
»Wir sind ganz einer Meinung.«
Ich wartete. Er hörte auf zu trommeln. Faltete stattdessen die Hände und schaute aus dem Fenster auf den Karlsplatz, die Straßenbahnen und Horden von Tauben. Mir war klar, dass er durch diese einfache Gebärde dem Augenblick das Gewicht verleihen wollte, das ihm zustand. Kerr war nicht gerade dafür bekannt, einen Effekt zu versäumen.
»Du kannst es nehmen. Wir wollen, dass du es sofort übersetzt.«
Ich gab keine Antwort.
»Wenn es genauso viele Anspielungen enthält wie das vorherige, dann ist es sicher am besten, wenn du nach A. fährst. Soweit mir bekannt ist, gibt es doch nichts, was dich hier bindet, oder?«
Das war eine vollkommen richtige Vermutung, wohl wahr. Seit drei Jahren hatte ich außer meiner zweifelhaften Arbeit und meiner eigenen Trägheit nichts, was mich an dem Ort hielt, und das wusste Kerr verdammt genau. Dennoch konnte ich mich natürlich nicht einfach so auf der Stelle entscheiden, vielleicht hatte ich auch das Gefühl, ich müsste die Verlagsleute ein paar Stunden auf die Folter spannen, deshalb bat ich um Bedenkzeit. Zumindest für ein paar Tage – oder bis die Details um Reins Tod richtig bekannt geworden waren. Kerr ging auf meinen Wunsch ein, aber als wir uns vor dem Restaurant trennten, konnte ich deutlich erkennen, wie es in ihm gärte.
Das war natürlich alles andere als verwunderlich. Während ich durch den rauen Wind nach Hause ging, dachte ich über die Sache nach und versuchte mir die Lage etwas klarer zu machen. Wenn es stimmte, was Rein da in seinem Brief geschrieben hatte, dann handelte es sich hier um ein gewissermaßen jungfräuliches Manuskript. Ungelesen und unbekannt. Es war kein Problem, sich vorzustellen, für welche Sensation das in Verlagskreisen und bei der Bücher lesenden Allgemeinheit sorgen konnte, wenn es erschien. Germund Reins letztes Werk. Erste Veröffentlichung in Übersetzung! Warum nicht am Jahrestag des Dahinscheidens des Autors?
Ohne den Inhalt in Betracht zu ziehen, würde das Buch bestimmt im Handumdrehen an die Spitze der Bestsellerliste klettern und weiß Gott benötigtes Geld für den Verlag einbringen, der – und das war wohl kaum ein Geheimnis – es in den letzten Jahren ein wenig schwer gehabt hatte.
Voraussetzung dafür war natürlich, dass die Schweigepflicht eingehalten wurde und man die Sache mit der gebotenen Diskretion behandelte. Wie es um diese Besonderheit genau bestellt war, war natürlich in einem so frühen Stadium nur schwer zu sagen, aber wenn es so war, wie Kerr hoffte, dann gab es möglicherweise nur vier Menschen auf der ganzen Welt, die von der Existenz dieses Manuskripts wussten. Kerr und Amundsen. Ich selbst und Rein.
Und Rein war ganz offensichtlich tot.
Während wir im Klosterkeller gesessen hatten, hatte ich kein einziges Mal darum gebeten, mir die Mappe näher anschauen zu dürfen, und Kerr hatte es mir auch nicht angeboten. Und bis ich einen positiven Bescheid ablieferte, würde ich natürlich weiterhin in Unwissenheit über den Inhalt bleiben. Mit einer fast rituellen Gewissenhaftigkeit hatte Kerr die Gummibänder wieder an ihren Platz geschoben und das Manuskript in die Aktentasche. Nachdem wir in der Garderobe unsere Mäntel angezogen hatten, sicherte er außerdem noch den Taschengriff mit einer Kette an seinem Handgelenk. Es war nicht zu übersehen, dass er alles in allem wirklich die größte Sorgfalt aufwandte. Außerdem kam ich zu dem Schluss, dass sowohl er als auch Amundsen vermutlich Reins Ermahnung ad notam genommen und keine weitere Kopie gezogen hatten.
Was ich bisher berichtet habe, spielte sich am Donnerstag in der Woche vor dem ersten Advent ab, und auch wenn ich mich noch nicht entschieden hatte, so klärten sich die Dinge am nächsten Tag, als ich zu meinem Arbeitsplatz im Institut kam.
Schinkler und Vejmanen empfingen mich mit finsteren Mienen, und ich begriff sofort, was geschehen war. Wir hatten auf unser Ersuchen nach zusätzlichen Projektmitteln eine Absage erhalten. Ich fragte nach und bekam die Bestätigung mittels eines langen Fluchs von Vejmanen. Schinkler wedelte mit einem Brief vom Bildungsministerium herum, der vor einer halben Stunde eingetroffen war, und sah dabei sehr resigniert aus.
Uns dreien war die Lage nur allzu klar. Auch wenn wir nicht viel Zeit darauf verwendeten, die Sache zu diskutieren, so wussten wir doch, was das bedeutete.
Wir mussten runterschrauben. Wir waren drei Personen, und wir hatten nur Projektmittel für zwei.
Einmal Vollzeit und zweimal Teilzeit. Oder zweimal Vollzeit und einmal feuern.
Schinkler war der Älteste von uns. Vejmanen hatte Frau und Kinder. Wenn ich heute zurückblicke, bin ich immer noch davon überzeugt, dass ich keine große Wahl hatte.
»Ich glaube, ich kann ein Übersetzerstipendium kriegen«, sagte ich.
Vejmanen blickte zu Boden und kratzte sich nervös an der Handwurzel.
»Für wie lange?«, fragte Schinkler.
Ich zuckte mit den Schultern.
»Ein halbes Jahr, nehme ich mal an.«
»Dann ist es abgemacht«, sagte Schinkler. »Bis zum nächsten Herbst werden wir verdammt noch mal ja wohl wieder etwas Geld auftreiben können.«
Und damit war die Sache entschieden. Ich verbrachte den Vormittag damit, meinen Schreibtisch aufzuräumen und meinen bescheidenen Teil der Whiskyflasche zu leeren, die Vejmanen unten im Laden auf der anderen Straßenseite gekauft hatte, und als ich nach Hause kam, rief ich Kerr an und fragte ihn, ob er mehr über Reins Tod erfahren habe.
Das hatte er nicht. Ich erklärte ihm, dass ich beschlossen hatte, den Auftrag so oder so zu anzunehmen.
»Ausgezeichnet«, sagte Kerr. »Das ehrt dich.«
»Unter der Voraussetzung, dass ihr mir ein halbes Jahr in A. finanziert«, fügte ich hinzu.
»Das wollten wir dir sowieso vorschlagen«, stellte Kerr fest. »Ich nehme an, dass du im Translators’ House wohnen kannst, oder?«
»Vermutlich«, erwiderte ich, und da der Whisky deutlich in den Schläfen zu spüren war, beendete ich das Gespräch. Ich beschloss, stattdessen einen Nachmittagsschlaf einzulegen. Das war am 23. November, und bevor ich einschlief, lag ich eine Weile da und dachte darüber nach, wie schnell es doch gehen kann, dass das Leben einfach auf ein ganz neues Gleis wechselt.
Das war kein fremder Gedanke, aber er hatte einige Jahre lang brach gelegen. Ob er mir anschließend noch in die Scheinwelt der Träume folgte, davon habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich keine Erinnerung daran. Überhaupt ist es selten, dass es mir gelingt, mir meine Träume ins Bewusstsein zu rufen, und die wenigen Male, dass sich das zutrug, dienten sie fast immer nur der Rechtfertigung meines Gemütszustands.
Natürlich ist das Vergessen ein sehr viel verlässlicherer Bundesgenosse als die Erinnerung, das habe ich immer wieder feststellen müssen.
Der 3. Januar war ein schrecklich kalter Tag. Die Temperatur fiel bis auf 15 Grad minus, und draußen auf dem Flugplatz wehte ein kräftiger, launischer Nordwind, der die meisten Abflüge um mehrere Stunden verspätete. Ich selbst war gezwungen, den ganzen Nachmittag in Erwartung meines Flugs in der Cafeteria zu verbringen, und hatte reichlich Zeit, darüber nachzudenken, worauf ich mich eigentlich einließ.
Vielleicht war es nur natürlich, dass dieses alte Gefühl der Austauschbarkeit sich über mich stülpte. Die Empfindung, dass alle diese Menschen, die um mich herum saßen und hingen oder ungeduldig zwischen den verschiedenen Taxfree-Läden herumirrten – alle aus ihren normalen Zusammenhängen herausgerissen –, eigentlich problemlos Platz und Identität hätten miteinander tauschen können. Dass es nur nötig wäre, unsere Pässe und Reisedokumente in einen großen Haufen auf den Boden zu legen und den Zufall – in Person irgendwelcher gelangweilter, anonymer Sicherheitspolizisten – uns ein neues Leben bescheren zu lassen. Willkürlich und gerecht, ohne jede Bevorzugung oder jedes Engagement.
Außerdem versuchte ich zu lesen. Nicht in Reins Manuskript, das Amundsen und Kerr am vergangenen Abend feierlich in einer kleinen Zeremonie bei mir abgeliefert hatten – ich hatte beschlossen, auf einen besseren Moment zu warten, mich ihm zu widmen –, nein, ich blätterte in ein paar dubiosen Kriminalromanen, die ich zwischen den Tagen gekauft hatte, und versuchte mich auf sie zu konzentrieren, aber keiner von ihnen vermochte mein Interesse so weit zu fesseln, dass ich dem Plot hinreichend folgen konnte.
Stattdessen dachte ich wie gesagt in erster Linie über die Situation nach. Über Ewa natürlich und darüber, wie ich die Suche nach ihr in A. gestalten sollte: inwieweit ich versuchen sollte, sie auf eigene Faust zu betreiben, oder ob es schlauer wäre, Kontakt mit einer Art Privatdetektiv aufzunehmen. Im Augenblick neigte ich dazu, erst einmal auf eigene Faust Ermittlungen anzustellen, um später vielleicht Hilfe zu suchen, wenn sie notwendig erschien.
Dass sie vielleicht überhaupt nicht notwendig sein könnte, ich glaube, darüber machte ich mir keine besonders großen Illusionen.
Aber in erster Linie dachte ich natürlich über Rein nach. Es war schwer, die Gedanken von ihm fern zu halten, auch wenn ich ehrlich gesagt keine große Lust hatte, seinen verfluchten Tod Tag und Nacht in meinem Kopf herumzuwälzen. Ich hatte das eine Zeit lang gemacht, es gab da nämlich einige Ungereimtheiten, und die würde es sicher so lange geben, bis man zumindest seine Leiche gefunden hätte.
Falls die jemals auftauchen würde. Die Neuigkeit von Reins Fortgang hatte sich seit dem Zeitpunkt, als Kerr den Telefonanruf von Zimmermann bekommen hatte, um fast vier Tage hingezogen. Soweit wir verstanden, beruhte das darauf, dass die Witwe des Schriftstellers sich geweigert hatte, den Abschiedsbrief als echt anzusehen, und jede Menge Analysen und Untersuchungen verlangt hatte, bevor sie die Tatsache akzeptierte und man mit der Meldung an die Presse gehen konnte. Und das auch erst, als das verlassene Motorboot gefunden worden war und gleichzeitig alle anderen Indizien in die gleiche unzweifelhafte Richtung deuteten, erst dann lenkte sie ein, und die Botschaft wurde über die Welt verbreitet.
Der Ort, den er sich ausgesucht hatte – oder besser: der wahrscheinliche Ort –, hatte hinsichtlich der Suche den Vorteil, zu dieser Jahreszeit weder Winde noch Unterwasserströmungen aufzuweisen, und vieles deutete darauf hin, dass der Körper ins Meer hinausgetragen worden war. Wenn es außerdem noch zutraf, dass er ein gewisses Gewicht am Leibe trug, so sprach sehr viel dafür, dass die Überreste des großen Neomystikers Germund Rein sich nunmehr irgendwo zwischen drei- und fünfhundert Metern Tiefe befanden. Zwanzig bis dreißig Kilometer aufs Meer hinaus, wenn man der vorsichtigen Einschätzung von C.G. Gautienne und Harald Weissvogel in der »Poost« folgte, jener Zeitung, die am weitesten bei dem Versuch ging, eine mögliche Lageposition zu bestimmen.
Irgendwie war das alles typisch für Germund Rein, und ich hatte keine Probleme, mir vorzustellen, wie er da unten in der Tiefe mit seinem verächtlichen Grinsen auf den Lippen lag, während die Fische an seinem schlaffen Altmännerfleisch knabberten.
Viel zu sublim, um sich von gewöhnlichen Sterblichen nach der üblichen Art und Weise in der Erde vergraben zu lassen. Unberührbar bis zum Letzten.
Natürlich war mir schon klar, dass derartige Gedanken wohl kaum eine besonders gute Grundlage für die Arbeit darstellten, die ich in A. auszuführen hatte. Wenn es etwas gibt, was alle Voraussetzungen dafür bietet, eine Übersetzungsarbeit zu stören, dann ist es das Gefühl von Feindseligkeit und Animosität gegenüber dem Urheber des Textes.
Aber ich hatte wie gesagt ja noch gar nicht angefangen, und vielleicht war es gar nicht so schlecht, die Aggressionen los zu werden, bevor es soweit war.
Ich glaube, das versuchte ich mir wenigstens einzureden.
Mein Flugzeug startete um 22 Uhr, genau sechs Stunden zu spät, und als wir nach einer ziemlich unruhigen Reise auf dem Flugplatz außerhalb von A. landeten, war es bereits nach Mitternacht. Die Fluggesellschaft bot allen Passagieren an, im Flughafenhotel zu übernachten, was ich – wie die meisten – annahm, und so konnte ich erst am Vormittag des 4. Januar am Hauptbahnhof von A. aus dem Zug steigen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich diese nebensächlichen Zeitangaben so genau vermerke, vielleicht ist das in erster Linie eine Frage der Kontrolle. Des Gefühls von Kontrolle, besser gesagt: das, was Rimley als die notwendige Zeit- und Raumbelastung der Bewegung bezeichnet, aber nachdem ich eine Zeit in A. verbracht hatte – in diesem stillstehenden Raum –, merkte ich schnell, wie unwichtig es für mich war, solche Begriffe wie Datum und Uhrzeit parat zu haben. Als ich in der Bibliothek arbeitete, kam es häufiger vor, dass man mich höflich hinauskomplimentierte, wenn es an der Zeit war, abends zu schließen, und ich erinnere mich, wie ich einmal – höchstwahrscheinlich im März oder April – verständnislos an der Tür eines kleinen Ladens rüttelte, weit nach Geschäftsschluss oder sonntags zu einer sehr frühen Stunde.
Aber wie gesagt, am 4. Januar traf ich ein. Am Vormittag. Und auch hier lag nicht gerade Frühling in der Luft.
Mit zwei schweren Reisetaschen und meiner abgewetzten Aktentasche (in der der gelbe Ordner lag, ein paar Lexika sowie ein großer Umschlag mit unzähligen Fotos von Ewa) nahm ich ein Taxi zum Translators’ House. Von den sechs Gästezimmern waren vier belegt. Zwei Afrikaner, ein typischer Finne sowie ein rotwangiger Ire, dem ich auf der Treppe begegnete – er roch nach billigem Whisky und sprach mich in einer Art Deutsch an. Ich lehnte seine Einladung auf einen Drink in der Bar gegenüber ab, nahm mein Zimmer in Beschlag und beschloss, mir so bald wie möglich etwas Besseres zu suchen. Ich hatte die Wohnungsfrage mit Kerr und Amundsen diskutiert, und es herrschte eine gewisse Einigkeit darüber, dass das Translators’ House vielleicht nicht die beste Lösung war, wenn man es recht bedachte. Vermutlich würde mein Aufenthalt an so einem Ort früher oder später Reins Verlegern zu Ohren kommen, und wir hatten uns ja dazu entschieden, uns strikt an den Letzten Willen des Verschiedenen zu halten. Diskretion Ehrensache. Meine Arbeit in A. sollte vonstatten gehen, ohne dass jemand darauf aufmerksam wurde. Die Aufregung und die Artikel nach Reins Tod hatten den ganzen Dezember über angehalten, und es gab natürlich mit der Neuauflage des einen oder anderen Buches großes Geld zu verdienen. Ganz zu schweigen davon, welches Echo sein letztes, hinterlassenes Buch verursachen würde. Eine posthum erscheinende Erstausgabe in Übersetzung. Absurder ging es nicht mehr, kein Zweifel.
Es lag immer noch da zwischen den gelben Pappdeckeln. Ich hatte Amundsen und Kerr gegenüber schwören müssen, mit meiner Tugend und meinem Leben darüber zu wachen. Dennoch hatten sie eine Kopie gezogen und sie tief in dem allerheiligsten Bankfach des Verlags deponiert – es gab trotz allem Grenzen, welches Risiko man eingehen musste, hatte Amundsen verlauten lassen. Meine Standhaftigkeit, die Lektüre des Manuskripts nicht bereits auf dem Hinflug anzufangen, mag möglicherweise etwas übertrieben erscheinen, aber sie hängt mit der Methode zusammen, nach der ich beim Übersetzen vorgehe. Wie vieles andere habe ich sie von Henry Darke geerbt, und mir ist klar geworden, dass sie in meiner Zunft nicht unbedingt üblich ist. Der Hauptgedanke dabei ist, dass die Interpretation, die Übersetzung, unmittelbar ansetzen muss, bereits beim ersten Kontakt mit dem Text, und hierzu bemühe ich mich, so wenig wie möglich mit meiner Lektüre im Vorsprung zu sein. Möglichst nur einen Absatz oder eine Zeile, allerhöchstens eine halbe Seite. Ich weiß, dass andere Übersetzer genau gegenteilig arbeiten. Sie ziehen es vor, das ganze Werk zwei- oder dreimal durchzuarbeiten, bevor sie sich an die Arbeit machen, aber wie gesagt hatte Henry Darke mir dieses Modell empfohlen, und mir wurde schnell klar, dass es mir mehr zusagte. Besonders bei einem Autor wie Germund Rein, bei dem man oft den Eindruck gewinnen konnte, dass er während des Schreibens oft selbst nicht genau wusste, wie es zwei Seiten später weitergehen sollte.
Im Translators’ House gibt es neben den Gästezimmern eine gemeinsame Küche mit Herd, Kühlschrank und Gefriertruhe sowie eine ziemlich gut bestückte Bibliothek (besonders was Lexika betrifft natürlich) mit einer Reihe gut abgeschirmter und eigentlich ansprechender Arbeitsplätze. Aber an meinem ersten Tag erschien mir alles ziemlich heruntergekommen. Im Kühlschrank fand ich ein paar Dosen Bier, ein halbes Paket Butter und einen Käserest, der hier bestimmt schon seit lange vor Weihnachten sein trauriges Dasein fristete. Die Bibliothek sah staubig und wenig einladend aus, an drei der Arbeitsplätze waren die Lampen kaputt, und mir wurde schnell klar, dass es vollkommen ausgeschlossen war, mich mit Reins Manuskript in diesem Milieu niederzulassen. Der Kaffeeautomat im Eingang war außer Funktion, und Fräulein Franck, die vier Stunden am Tag in der so genannten Rezeption saß, erzählte, dass man bereits im Oktober einen neuen bestellt hatte, die Lieferung sich aber offensichtlich verzögerte. Sie ging dann auch die Putz- und Reinigungsgebräuche mit mir durch, wobei ich sie mit dem Hinweis darauf unterbrach, dass ich schon einmal hier gewohnt hatte und mich damit auskannte und dass ich außerdem vermutlich nur eine Woche bleiben würde.
Offensichtlich gelang es mir, sie mit diesen einfachen Informationen zu verletzen, denn sie putzte sich ostentativ die Nase und widmete sich wieder ihrer Stickerei, ohne noch ein Wort zu verlieren.
Ich überließ sie ihrem Schicksal und begab mich stattdessen in die Stadt. Es war wie gesagt ein ganz gewöhnlicher Dienstag, trotzdem waren ziemlich viele Menschen unterwegs, wie ich feststellen konnte, zumindest im Zentrum und in den Touristenbereichen. Die Kälte war beträchtlich, mehrere Kanäle waren zugefroren, und ein beißender Wind zog vom Meer heran. Ich schlüpfte in einige Buchläden und Musikgeschäfte, in erster Linie, um mich ein wenig aufzuwärmen. Saß dann in ein paar Cafés mit Bier und Zigaretten und starrte die Menschen an, und bald stellte ich fest, dass ich nach Ewa suchte. Alle Frauen mit dunklem, glattem Haar zogen sofort meinen Blick auf sich, und der Gedanke, dass ich ihr tatsächlich Aug in Aug gegenüberstehen könnte, war stimulierend und ein wenig beunruhigend zugleich.
Ich dachte an unseren letzten gemeinsamen Morgen in diesem kleinen Gebirgsort, bevor sie sich zu ihrer letzten Fahrt aufgemacht hatte, und daran, welch unendliche Zärtlichkeit ich für sie empfunden hatte, als sie ins Auto stieg und davonfuhr, um sich mit ihrem Geliebten zu treffen. Ich erinnere mich, wie ich auf dem Balkon stand und den Impuls, hinter ihr herzurufen, nur schwer unterdrücken konnte, während sie über den Hof fuhr und mir durch das heruntergekurbelte Seitenfenster zuwinkte. Wie ich sie warnen wollte. Sie dazu bringen wollte, hier zu bleiben, statt sich auf diese fatale Fahrt zu begeben. Als sie hinter der Steinmauer verschwunden war, konnte ich einen Schrei nicht mehr zurückhalten, aber der richtete natürlich nichts aus. Er war nur ein nutzloser Ausdruck der doppelbödigen Spannung, die in mir pochte. Nicht einmal der alte Hausmeister, der herumging und das Laub aus den Beeten unten herauskratzte, schien ihn gehört zu haben, und nachdem ich gesehen hatte, wie sie auf die kurvige Straße eingebogen war, die den Berg hinaufführte, drehte ich mich um, ging zurück ins Zimmer und nahm eine lange, erfrischende Dusche.
Nein, zuerst kroch ich ins Bett und versuchte zu lesen, so war das ... natürlich ein vollkommen hoffnungsloses Unterfangen.
Auf diese Art – indem ich einige Geschäfte aufsuchte und indem ich in Cafés saß und an Ewa dachte – zog ich langsam durch die zentralen Teile von A., hinunter zum Vondelpark und der Gemeindebibliothek in der Van Baerlestraat. Von meinem letzten Besuch wusste ich, dass sie die Tore dort immer erst nachmittags öffneten, sie dafür aber bis spät abends offen ließen, was mir für meine Zwecke außerordentlich dienlich erschien. Ein Morgenmensch war ich noch nie gewesen. Wichtige Dinge vor zwölf Uhr ausführen zu müssen, das war seit meiner Teenagerzeit meine Achillesferse gewesen. Die Abende und die frühen Nachtstunden, das ist mein Elixier, dann bin ich in Topform, sowohl mental als auch körperlich, und wenn man in einer Situation ist, in der man sich seinen Tagesrhythmus selbst einrichten kann, so gibt es natürlich keinen Grund, sich diese Morgen- und Vormittagsstunden im Bett zu verbieten.
Es stimmte. Montag bis Freitag: 14–20 Uhr, stand auf einem Anschlag an der Tür. Samstags: 12–16 Uhr. Also ganz ausgezeichnet. Ich ging an diesem ersten Tag nicht hinein, nahm mir aber einen Besuch am kommenden vor. Da ich keine übertrieben große Sehnsucht nach dem Translators’ House verspürte, beschloss ich, den Rest des Nachmittags in der Stadt zu verbringen. Nachdem ich mehr oder weniger planlos ein paar Stunden herumgewandert war, fand ich an der Ecke Falckstraat/Reguliergracht eine kleine Zimmervermittlung. Ich ging hinein und erklärte meine Wünsche: ein einigermaßen zentrales Zimmer, gern in der Nähe des Vondelparks. Dusch- und Kochgelegenheit. Sechs Monate ungefähr. Nicht zu teuer. Die farbige junge Frau blätterte in einigen Ordnern und führte zwei Telefongespräche. Eventuell ließ sich etwas Passendes finden, erklärte sie, wenn ich die Möglichkeit hätte, in ein paar Tagen wieder hereinzuschauen.
Ich bedankte mich und versprach, spätestens am Freitag wiederzukommen.
An diesem ersten Abend kehrte ich erst sehr spät zum Translators’ House zurück. Beschloss, dass ich mich ebenso gut ein wenig amüsieren konnte, bevor der Ernst begann. Also gönnte ich mir ein gutes Essen im Planner’s und ein paar Stunden in den Bars um den Nieuwe Markt. Doch eigentlich war ich die meiste Zeit damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie ich die Suche nach Ewa gestalten sollte, aber ich glaube nicht, dass mir ein besonders tragkräftiger Aktionsplan eingefallen ist. Zumindest nichts, an das ich mich später erinnern konnte, und als ich schließlich gegen Mitternacht ins Bett fiel, konnte ich feststellen, dass ich immer noch nicht angefangen hatte, auch nur einen Zipfel des Schleiers über den beiden unheilvollen Affären zu lüften, derentwegen ich nach A. gekommen war.
Aber ich war an Ort und Stelle. Der Acker war bestellt, und auf der anderen Seite der Nacht würde es natürlich höchste Zeit sein, loszuschlagen. Ich erinnere mich auch noch, dass mir die Vorstellung von dieser unberührten Zukunft gefiel. Eine Tabula rasa, ein schneeweißes Feld, das ich noch nicht betreten hatte und auf dem noch alles Mögliche Seite an Seite ruhte.
Mit diesen Gedanken schlief ich ein.
Ich weiß, dass ich dir wehtue, aber ich bin gezwungen, meinen eigenen Weg zu gehen.«
Genau diese Worte hatte sie gewählt, sie hätten aus dem erstbesten modernen Melodram stammen können, und ich strich ihr vorsichtig eine Haarlocke von der Wange. Es war das erste Mal, und es war nicht das erste Mal. Wir lagen auf der Seite, sahen uns an in unserem bequemen Doppelbett, und ich erinnere mich, dass ich dachte, wie dubios Augen doch sein können. Dass sie plötzlich, wenn man ihnen zu nahe kommt, vollkommen leer werden. Der Ausdruck, der vielberufene Seelenspiegel, verschwindet bei einem Abstand zwischen zehn und fünfzehn Zentimetern wie durch einen Zauberspruch. Innerhalb dieser Grenze gibt es nichts. Keinen Weg und kein Versprechen. Nicht einmal die ruhige Feindseligkeit von Katzenaugen.
Wenn wir einem anderen Menschen allzu nah kommen, bleibt nur noch diese Zellenanhäufung, diese stechende Angelegenheit. Diese Erfahrung zu machen ist natürlich bitter, und es ist nicht immer leicht, wieder den rechten Abstand zu finden. Vielleicht ist es das, was man im Laufe der Jahre lernt. Ich nehme an, Sie wissen, wovon ich rede.
In unserem Fall war mir klar, dass sie nicht lange auf eigene Faust zurecht kommen würde, aber der Gedanke, sie einfach einmal laufen zu lassen, war schon verlockend, das muss ich zugeben.
Es war an einem Tag im August. An einem Vormittag, warm und verheißungsvoll wie eine sonnengereifte Pflaume. Wir hatten drei Wochen Urlaub vor uns, und im nächsten Augenblick erklärte sie mir, dass sie einen Liebhaber hatte. Ich unterdrückte den Wunsch, laut loszulachen, ich erinnere mich noch daran, als wenn es gestern gewesen wäre, und ich glaube nicht, dass sie mich dabei ansah. Den ganzen Sommer über war sie in Therapie gewesen, es war noch nicht einmal ein halbes Jahr her, seit sie entlassen worden war, und es war noch viel zu früh, die Zukunft zu planen.
Viel zu früh.
»Soll ich das Frühstück machen?«, fragte ich.
Sie zögerte kurz.
»Ja, gern«, sagte sie dann, und wir sahen uns verständnisvoll an.
»Fahren wir morgen?«
Sie gab keine Antwort. Zeigte keine Miene, die irgendwie zu interpretieren war, und ich stand auf, ging in die Küche und bereitete das Tablett vor.
In der ersten Nacht in A. träumte ich von Ewa, offensichtlich einen ziemlich erotischen Traum, denn ich wachte mit einer starken Erektion auf. Aber die legte sich bald und wurde von Kopfschmerzen und Übelkeit ersetzt. Während ich mit dem Kopf in den Händen auf der Toilette saß, versuchte ich zusammenzukriegen, wie viel Alkohol ich am vergangenen Abend in mich hineingeschüttet hatte, aber es gab da so einige Unschärfen, die nicht deutlicher werden wollten. Ich duschte lange unter dem erbärmlichen Rinnsal, den das Translators’ House anbot, und machte mich so gegen Mittag auf den Weg hinaus in die Kälte. Die Aktentasche unter den Arm geklemmt, gelang es mir, eine Straßenbahn zu erklimmen, von der ich hoffte, dass sie ungefähr in die richtige Richtung fahren würde. Das tat sie auch, wie sich herausstellte, und auf Höhe Ceintuurbaan sprang ich ab. Schlüpfte in eine Bar und erwachte bei ein paar Scheiben Brot und einer Tasse schwarzen Kaffees wieder zum Leben. Dann ging ich das noch verbleibende Stück zur Bibliothek. Der Wind, der durch die Straßen und über die offenen Kanäle fegte, war mörderisch kalt, und mir war klar, dass ich mir zumindest einen vernünftigen Schal kaufen musste, wenn ich in dieser von Kälte geschüttelten Metropole gesund bleiben wollte.
Hinter dem Tresen befand sich im Augenblick nur eine dünne Frau in den Sechzigern, und ich wartete, bis sie einen dunkelhäutigen Herrn in Ulster und Turban bedient hatte. Nachdem seine Bücher gestempelt waren, trat ich näher und stellte mich vor. Erklärte, dass ich mit einer Übersetzungsarbeit beschäftigt sei und dass ich einen Platz bräuchte, an dem ich täglich ein paar Stunden in Ruhe und Frieden sitzen könnte.
Sie lächelte mich entgegenkommend und etwas schüchtern an, machte sich sofort die Mühe, um den Tresen herumzukommen, und begleitete mich zu den Arbeitstischen, die jeweils zu viert in sechs Reihen hinten in der Lexikaabteilung standen. Sie fragte, ob ich gern einen Tisch für mich reserviert haben wollte – es gäbe zwar immer genügend Platz, wie sie meinte, aber wenn ich Bücher und Arbeitsmaterial deponieren oder auch nur Papiere liegen lassen wollte, dann wäre das natürlich die eleganteste Lösung.
Ich bedankte mich und suchte mir einen Platz ganz links aus, nur wenige Meter von dem hohen, bleieingefassten Fenster entfernt, durch das man auf die Moerkerstraat und auf einen der Eingänge zum Vondelpark sehen konnte. Im Augenblick gab es, außer der Frau und mir, nur noch zwei andere Menschen im Raum, und ich ging davon aus, dass es wohl meistens so aussah. Sie nickte, wünschte mir viel Erfolg und schritt zurück zum Ausgabetresen. Ich ließ mich nieder und legte den gelben Ordner links von mir auf den Tisch. Rechts deponierte ich einen Collegeblock und vier neu gekaufte Stifte. Dann zog ich die Gummibänder ab und bereitete mich darauf vor, Germund Reins letztes Buch in Angriff zu nehmen.
Als ich die Bibliothek verließ, war es dunkel. Ich musste mehrere Stunden dort gesessen und gearbeitet haben, und trotzdem war ich nicht weiter als drei Seiten im Manuskript gekommen. Es war ein schwerer, rätselhafter Text, mit nichts zu vergleichen, was Rein früher geschrieben hatte, das konnte ich jetzt schon sehen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er dahinter steckte, hätte ich es vermutlich niemals erraten. Noch war es zu früh, Milieu oder Handlung erkennen zu können, das einzig Sichere schien zu sein, dass ein Mann mit der Bezeichnung R vorkam, in dessen Gedanken sich diese ersten Seiten abspielten, gestaltet in einer Art innerem Monolog, in dem außerdem eine Frau, M, und ein anderer Mann, G, eine gewisse Rolle zu spielen schienen. Möglicherweise ließ sich erahnen, dass sich das Ganze zu einer Art Dreiecksdrama entwickeln sollte, es gab Zeichen, die darauf hindeuteten, aber es konnte auch noch eine ganz andere Wendung nehmen, und als ich für diesen Tag einen Punkt machte, musste ich mir eingestehen, dass ich das Ganze noch nicht so recht im Griff hatte.
Allein für den ersten Absatz hatte ich bestimmt fast eine Stunde gebraucht, und als ich ihn später noch einmal durchlas (während ich im ‘de Knijp saß und aufs Essen wartete), schien es mir trotzdem, als hätte ich den Kern von Reins Text nicht getroffen. Oder den Ton, besser gesagt: Es ist natürlich der Akkord, der wichtig ist, auf dieser Grundlage können dann die einzelnen Worte und Ausdrücke mit einer gewissen Freiheit gesetzt werden, das ist eine Sache, die ich im Laufe der Zeit gelernt habe.
Die Totalität (so fing es an) von Rs Zeit auf der Welt wächst nicht mehr, es gibt sie noch, aber nur, ja, nur verschwindend dünn, ein Gaffen, ein Schrei nach Halt und Lob, immer dieses Lob, wie Tau, vergänglich wie Tau, inbrünstig und flackernd, und M. Wo ist M in diesen Tagen zu finden? Ihr Profil bleibt immer noch eine Weile stehen, nachdem sie den Kopf gedreht und das Zimmer verlassen hat, eine verwirrende Frau. Bleibt auch in R zurück, Bild legt sich auf Bild, Kante an Kante, alle diese Zeiten sind stets parallel zugegen, sogar das Jetzt. Er hat sie geschlagen, sicher, er hat seine Hand erhoben, aber wie ein Baum von Regen und Sturm lebt, so ist auch sie seins, der Schmerz und die Wut und das Feuer, die reinigen und heilen und zusammenfügen, und er selbst war es, R persönlich, der sie einander vorstellte, M und G, vor vielen Jahren, auch das Kante an Kante, nebeneinander, und wie der Tropfen letztendlich den Stein aushöhlt, ist es jetzt auch soweit gekommen, um das wird sich alles drehen. Als R am Morgen aufwacht, ist er verwirrt. Seit einiger Zeit scheint alles verändert zu sein.
Mein Essen wurde gebracht, und ich klappte den Spiralblock zu. Während ich aß, fühlte ich diese Leere in mir, die sich immer einstellt nach Stunden konzentrierter Arbeit. Als würden die Welt und die Umgebung nicht mehr an mich herankommen können; die Menschen, das Gemurmel und die ruhigen Bewegungen in dem gut besuchten Lokal hätten sich ebenso gut irgendwo anders befinden und abspielen können – in einem anderen Medium, zu einer anderen Zeit. Ich saß in einem taubstummen Aquarium und schaute auf eine unbegreifliche Welt hinaus.
Zwei, drei Gläser halfen da meist, und dem war auch jetzt so. Als ich erneut auf die Straße trat, war ich wieder der Alte, und ich überlegte, ob ich nicht ebenso gut ins Kino gehen könnte, statt nach Hause zum Translators’ House. Ich hatte keine große Lust, mehr als die Stunden, die ich zum Schlafen brauchte, in meinem düsteren Zimmer zu verbringen, und beschloss, die Frau in der Zimmervermittlung bereits morgen aufzusuchen, um zu hören, ob sie mir etwas anzubieten hatte.
Aber einen besonders verlockenden Film konnte ich nicht auftreiben, es war auch schon ziemlich spät, also verbrachte ich den Rest des Abends stattdessen in einem Café mit Indianermusik, während ich darüber grübelte, wie ich eigentlich das Problem Ewa in Angriff nehmen sollte.
Einfach in der Stadt herumzulaufen und zu hoffen, sie irgendwo in dem Gewühle zu entdecken, das erschien mir alles in allem ziemlich vergeblich, aber welche Handlungsmöglichkeiten mir eigentlich offen standen, das war nur schwer auszumachen. Zumindest fiel es mir schwer, sie zu entdecken. Letztendlich gab es wohl nur eine Örtlichkeit hier in der Stadt, in der sie früher oder später auftauchen würde.
Konzerte. Klassische Musik. Meines Wissens gab es zwei Konzertsäle in A. mit durchgehend klassischem Repertoire. Concertgebouw und Nieuwe Halle. Ich hatte keine von beiden jemals aufgesucht, aber während ich hier bei meinem Bier saß und den dumpfen Flöten aus den Anden lauschte, beschloss ich, dass es an der Zeit wäre, mit ihrem Programm Bekanntschaft zu schließen.
Irgendwelche weitergehenden Ideen tauchten an diesem Abend nicht in meinem Kopf auf. Wahrscheinlich hatte Reins Text mich ziemlich erschöpft, und vielleicht hatte ich ja auch ein oder zwei Glas zu viel getrunken. Ich verließ die Bar gegen Mitternacht, fühlte mich aber nicht so betrunken, dass ich nicht den ganzen Weg bis zum Translators’ House zu Fuß zurückgelegt hätte. Der Finne – ein imposanter Kerl, der mit seinem großen, buschigen Bart und seiner Stimme, die wie eine Posaune klang, nicht wenig Ähnlichkeit mit einem vorchristlichen Donnergott hatte – saß zusammen mit dem Iren in der Küche. Sie unterhielten einander mit Trinkliedern und schlüpfrigen Geschichten, und noch durch die Decke konnte ich ihre Lachsalven und verblüffenden Flüche eine ganze Zeit lang hören.
Wind vom Meer her. Temperatur um null Grad. Ab und zu spärlicher Schneefall oder unterkühlter Regen. Der Januar machte weiter, wie er begonnen hatte. Bereits am Samstag der ersten Woche wechselte ich meinen Wohnort, durch die Zimmervermittlung bekam ich eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Ferdinand Bolstraat, nur zehn Minuten Fußweg von der Bibliothek entfernt. Der Besitzer war ein junger Fotograf, der soeben von National Geographic ein Halbjahresstipendium in Südamerika erhalten hatte, und unsere Abmachung umfasste auch die Pflege seiner Grünpflanzen und der Katze.
Letztere war eine träge, sterilisierte Sie mit Namen Beatrice, die abgesehen von einer halbstündlichen täglichen Visite über den Balkon zum Hof hinaus (wo sie passiv und ohne wirkliches Interesse saß und die Tauben beobachtete) sowie einigen Spaziergängen zum Futternapf und zum Katzenklo in der Küche kaum etwas anderes unternahm, als vor dem Gaskamin zu liegen und zu schlafen.
Das kleinere Zimmer war als Dunkelkammer eingerichtet, ich benutzte es nie, auf Grund der schlechten Isolierung verbrachte ich so gut wie die gesamte Zeit entweder im Bett oder auf dem Sessel vor der gleichen Wärmequelle wie Beatrice. Die einzige in der Wohnung, aber ich möchte betonen, dass ich dennoch vollkommen zufrieden mit der Situation war.
Vielleicht in erster Linie mit der Umgebung. Unten auf der Straße gab es alle möglichen Geschäfte, einen Albert Hijn, ein paar Bars und sogar eine Reinigung. Ich fand bald heraus, dass ich es nicht besser hätte treffen können, der Verkehr und das menschliche Treiben dort draußen waren während der meisten Stunden des Tages rege und abwechslungsreich, und wenn ich mich nur warm genug anzog, konnte ich am Fenster stehen und von meinem geradezu idealen Aussichtspunkt im zweiten Stock das Leben beobachten. Zweifellos gab mir das die Illusion von Kontrolle: dort zu stehen, zwar abgetrennt, aber dennoch nicht ohne Kontakt mit den Bewegungen in Zeit und Raum.
Was die Miete betrifft, so war sie erschwinglich, gewisse Korrekturen waren wegen der Blumen und Beatrice gemacht worden, und als ich mit Kerr telefonierte, stellte sich heraus, dass der Verlag nichts gegen die kleine Zusatzausgabe hatte, um die es verglichen mit dem Translators’ House ging.
Durch den Umzug bekamen auch meine Tage eine einheitlichere und routinemäßigere Prägung. Ich schlief oft lange, meist bis elf oder halb zwölf vormittags. Duschte, zog mich an, ging hinunter und kaufte eine Zeitung und frisches Brot. Nahm im Sessel sitzend, Beatrice auf den Füßen, ein ausgiebiges Frühstück zu mir, wobei ich die Nachrichten über die Lage der Welt las sowie die Übersetzung vom vergangenen Tag. Machte eventuell ein paar Korrekturen, und so gegen Viertel vor zwei verließ ich die Wohnung. Zuerst spazierte ich durch ein paar windgeschützte Gassen, trat dann hinaus in den Wind über der Ruysdalegracht, ging die Kuyperlaan und die Van Baerlestraat entlang, um an der Bibliothek anzukommen, ein paar Minuten nachdem sich ihre Tore geöffnet hatten.
Meistens saß Frau Moewenroedhe da – die Frau, die sich am ersten Tag um mich gekümmert hatte –, aber manchmal auch eine von zwei jüngeren Frauen, die eine dunkel, eine leicht verlockende, scheue Schönheit, die andere rötlich und ein wenig übergewichtig. Keine von ihnen sprach mich an, sie nickten mir nur in einer Art ungeschriebenem Einverständnis zu, und auch mit Frau Moewenroedhe wechselte ich nur wenige Worte, aber ab dem dritten Tag bekam ich gegen halb fünf immer eine Tasse Tee und ein paar Kekse. Offensichtlich war das der Zeitpunkt, an dem sie sich selbst auch eine kleine Pause gönnten.
Besonders während dieser ersten Wochen hatte ich immerhin eine gewisse Kontrolle über die Stunden des Tages, das wird mir klar, wenn ich zurückschaue. Und das war ja irgendwie auch notwendig. Als ich das Programm der beiden Konzertsäle durchgegangen war, hatte ich mir ein Schema aufgestellt, nach dem ich vier bis fünf Veranstaltungen in der Woche besuchen wollte, was wiederum bedeutete, dass ich rechtzeitig in der Bibliothek aufbrechen musste, um noch essen zu können, bevor es Zeit für das Concertgebouw oder die Nieuwe Halle war.
Bald wurde mir klar, dass mein Konto es kaum zulassen würde, dass ich mehrmals in der Woche zu teuren Konzerten hastete, und so ging ich stattdessen dazu über, mich im Foyer aufzuhalten und zu verfolgen, wie die Zuschauer eintrafen. Manchmal überwachte ich stattdessen den Strom hinaus, aber welche Methode ich auch anwandte, ich sah während dieser kalten Januarabende nicht den Schimmer von Ewa, und auch wenn ich nicht direkt verzweifelte, so war ich mir doch bewusst, dass ich mir etwas Besseres einfallen lassen musste.
Ansonsten verbrachte ich die Abendstunden gern in den Cafés, besonders in einigen ziemlich schillernden, die auf meinem üblichen Heimweg lagen – Mart’s beziehungsweise Dusart. Dort saß ich in einer Ecke und kam ab und zu ins Gespräch mit Menschen, vor allem mit älteren, etwas heruntergekommenen Herren, die den größten Teil ihres Lebens hinter sich gebracht und einen Grad an Illusionslosigkeit erreicht hatten, den ich befreiend fand und gern geteilt hätte. Auch auf Frauen stieß ich an diesen Abenden, aber auch wenn es sicher die eine oder andere unter ihnen gab, die nichts dagegen gehabt hätte, mit mir die Nacht zu verbringen, so kam es doch nie dazu, dass ich die Initiative in dieser Richtung ergriff. Wie dem auch sei, nur im Ausnahmefall kam ich vor ein Uhr ins Bett.
Auch wenn meine Gedanken in diesem ersten Monat natürlich häufig um Ewa kreisten und darum, was es wohl bedeuten könnte, dass sie während dieser Beethovenaufnahme hier in A. vor einem halben Jahr im Publikum gesessen hatte (ich hatte nachgeprüft, dass es wirklich im Concertgebouw stattgefunden hatte), so war es doch die Arbeit an Reins Text, die meine Konzentration immer mehr in Anspruch nahm.
Er war schwer und zäh, die ersten Seiten waren keine Ausnahme gewesen, aber dennoch gab es da etwas, was bald eine Art Verlockung auf mich ausübte. Etwas Verborgenes fast. Als enthielte das Manuskript eine Botschaft oder einen Subtext, den zu verstecken er sich alle Mühe der Welt gegeben hatte. Ich wusste nicht so recht, was, ahnte aber früh, dass es da etwas geben musste. Der Text war dicht und voller Gestrüpp, manchmal geradezu unbegreiflich, aber das Gefühl, dass unter dem Ganzen etwas lag, was einfach, rein und klar war, wurde immer unbestreitbarer, je weiter ich kam.
Es war auch nicht besonders umfangreich, das Manuskript. Nur gut hundertsechzig Seiten, und wenn es mir gelingen sollte, den Rhythmus von fünfzehn Seiten die Woche beizubehalten, so würde ich mit anderen Worten irgendwann um den Monatswechsel März – April damit durch sein. Mit einem ersten Entwurf jedenfalls. Dann brauchte es natürlich noch seine Zeit für die Feinarbeit und die Korrekturen, doch es war sicher, dass ich wie abgemacht im Juni fertig sein würde.
Aber dieser Subtext nahm mich anfangs gefangen. Verwirrte mich und ärgerte mich. Keines von Reins früheren Werken hatte diesen Grad der Komplikation erreicht, und gleichzeitig waren da natürlich noch die sonderbaren Umstände und Restriktionen betreffs der Herausgabe selbst. Einen Grund musste es schließlich dafür geben, dass er unbedingt wollte, dass das Buch in der Übersetzung statt in seiner eigenen Muttersprache herauskam; Kerr und Amundsen hatten in den Archiven geforscht, aber nichts Vergleichbares gefunden – natürlich einige hinausgeschmuggelte Texte aus diversen Diktaturen, Solschenizyn und andere, aber nichts in dieser Art. Ich weiß noch genau, dass ich versuchte, nicht groß darüber nachzudenken und Spekulationen aufzustellen, aber je mehr Zeit verging, je weiter ich ins Buch eindrang, umso überzeugter wurde ich, dass genau hier, im Text selbst, die Hintergründe zu Tage treten würden. Die Antwort auf die Frage, warum Germund Reins Buch in einer Übersetzung herauskommen sollte, fand sich im Buch selbst und sonst nirgends.
Trotz dieser wachsenden Einsicht verbot ich mir selbst, im Vorwege zu lesen. Standhaft und unerschütterlich meiner Methode treu, ging ich Zeile für Zeile vor, Absatz für Absatz, Seite für Seite. Die Verlockung war da, aber ich überwand sie ohne größere Anstrengungen.
Es ist nicht einfach, Reins Text zu beschreiben. Das hervorstechendste Stilmittel war zweifellos der innere Monolog, der zwischen der Hauptperson R und dem Verfasser selbst hin und her zu wandern schien, manchmal auch hin zu der Frau, zu M. Die einzige andere Person in dem Buch, zumindest anfangs, war ein gewisser Herr G, und in dichten, mehr oder weniger traumartigen Sequenzen schilderte Rein eine Art Beziehung zwischen diesen drei Figuren. Wie ich bereits erwähnt habe, konnte ich schon frühzeitig eine Dreiecksgeschichte zwischen den beiden Männern und der Frau erkennen – es tauchte hier und da auf, in ganz unterschiedlicher Tonlage und Wortwahl, und die Beziehung zwischen R und G war nicht die beste, und dass R dem Erzähler-Ich äußerst nahe zu stehen schien, das konnte meiner Aufmerksamkeit kaum entgehen.
Aber solange der Januar noch währte, war das eigentlich auch schon alles, was mir klar wurde. Es ist natürlich möglich, dass ich die wahren Verhältnisse bereits sehr viel früher hätte erahnen können, wenn ich nicht außerdem auch noch an Ewa zu denken gehabt hätte und meine Kräfte darauf hätte verwenden müssen, aber das ist trotzdem nur Spekulation. Vielleicht war das eine Engagement auch notwendig zur Entlastung des anderen. Wenn ich zurückdenke, dann überrascht mich, wie oft ich mich damals voll und ganz entweder dem einen oder dem anderen gewidmet haben muss. Entweder ich befand mich tief in Germund Reins Text, oder aber ich suchte mit Feuereifer nach meiner verschwundenen Ehefrau. Doch ich vermischte beides nie. Ich hielt meine Aufträge wie Öl und Wasser getrennt, und ich glaube auch, dass das genau die richtige Methode war.
In den allerletzten Tagen des Januars war es mir gelungen, meiner eintönigen und nichts bringenden Konzertüberwachungen von Herzen leid zu werden, und ich beschloss, neue Wege einzuschlagen. Unter der Rubrik »Privatdetektive« fand ich im Telefonbuch nicht weniger als sechzehn verschiedene Namen und Adressen, und nach meiner Arbeit in der Bibliothek verabredete ich eines Abends, mich mit einem gewissen Edgar L. Maertens in seinem Büro in der Prohaskaplein zu treffen.
»Können Sie mir Ihr Problem schildern?«, begann er, nachdem die Eingangsfloskeln überstanden waren und wir uns beide mit einem Bier und einer Zigarette gesetzt hatten. Er war älter, als ich gedacht hatte, an die Sechzig, mit kurzgeschorenem, grauem Haar und sanften blauen Augen, die ein gewisses Vertrauen erweckten.
»Arbeiten Sie schon lange in dieser Branche?«, fragte ich.
Er lachte kurz auf.
»Seit dreißig Jahren.«
»So lange?«
»Das ist Weltrekord. Sie können sich mir beruhigt anvertrauen. Also?«
Ich zog die Fotos aus der Innentasche und legte sie auf den Tisch. Er betrachtete sie kurz.
»Eine Frau.«
Das war keine Frage, nur eine müde Feststellung. Er zog an seiner Zigarette und schaute mich an. Ich zog es vor zu schweigen.
»Lassen Sie mich erst fragen, ob Sie auch sicher sind, dass Sie das hier wirklich durchführen wollen.«
Der Ton von Resignation in seiner Stimme war klar und eindeutig. Ich nickte.
»Überwachung oder verschwunden?«
»Verschwunden«, sagte ich.
»Gut«, sagte er. »Ich ziehe die Suche nach Verschwundenen vor.«
»Warum?«
Er gab keine Antwort.
»Wann ist sie verschwunden?«
»Vor drei Jahren. Vor gut drei Jahren.«
Er machte sich Notizen.
»Name?«
Ich gab ihn an und fügte hinzu, dass sie ihn sicher nicht mehr benutzte.
»Haben Sie das überprüft?«
»Ja. Es gibt niemanden mit diesem Namen in A.«
»Und Sie haben Grund zu der Annahme, dass sie sich hier aufhält?«
Ich nickte.
»Dann seien Sie doch so gut und erzählen die ganze Sache in kurzen Zügen.«
Das tat ich. Ließ natürlich einige entscheidende Punkte aus, aber bemühte mich dennoch, alles anzugeben, was von Bedeutung sein könnte. Als ich fertig war, reagierte er nicht sofort. Stattdessen beugte er sich über den Tisch und studierte Ewas Fotos etwas genauer.
»All right«, sagte er dann. »Ich übernehme die Sache.«
Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass er hätte ablehnen können, erst jetzt erkannte ich, dass es wohl kaum ein Traumjob war, um den ich ihn hier bat.
»Ich kann natürlich keinen Erfolg garantieren«, erklärte er. »Ich schlage vor, dass wir einen Monat abmachen. Wenn wir sie bis dahin nicht aufgespürt haben, dann fürchte ich, dass wir die Sache wohl abschreiben müssen. Ich nehme an, Sie wünschen Diskretion.«
»Vollste Diskretion«, bestätigte ich.
Er nickte.
»Was das Honorar betrifft«, begann er das Gespräch abzuschließen, »so nehme ich nur die Hälfte, wenn ich keinen Erfolg vorzuweisen habe.«
Er schrieb zwei Summen auf den Block vor sich und drehte ihn herum, damit ich sie lesen konnte. Ich begriff, dass es gar keinen Zweck hatte, seine Dienste nach dem vereinbarten Monat noch weiter in Anspruch zu nehmen.
»Wie sehen Sie die Chancen?«, fragte ich.
Er zuckte mit den Schultern.
»Wenn sie wirklich hier in der Stadt ist, dann werden wir sie wohl aufspüren. Ich habe einen kleinen Mitarbeiterstab.«
»Wie Sherlock Holmes?«
»So ungefähr. Hat sie einen Grund, unterzutauchen? Noch einen anderen, als was sich aus der Geschichte schließen lässt, meine ich.«
Ich überlegte.
»Nein ...«
»Sie zögern.«
»Jedenfalls keinen, den ich kenne.«
»Und Sie haben sie seit drei Jahren nicht gesehen?«
»Bald dreieinhalb.«
Er drückte die Zigarette aus und stand auf.
»Sind Sie wirklich sicher, dass Sie sie auch finden wollen?«
Seine Hartnäckigkeit in diesem Punkt begann mich so langsam ein wenig zu ärgern.
»Warum fragen Sie das?«
»Weil die meisten nach drei Jahren über eine Frau hinweggekommen sind. Sie aber demnach nicht?«
Ich stand auch auf.
»Nein, ich nicht.«
Er zuckte wieder mit den Schultern.
»Sie können mir gleich ein paar Hunderter geben. Ich nehme an, dass Sie ab und zu vorbeischauen wollen, um zu hören, wie es läuft?«
Ich nickte.
»Dann würde ich montags und donnerstags vorschlagen. Wenn etwas Akutes passiert, dann lassen wir natürlich von uns hören.«